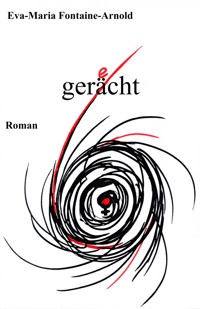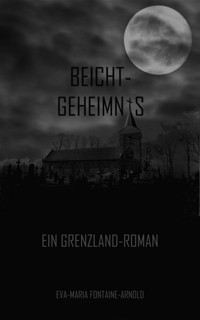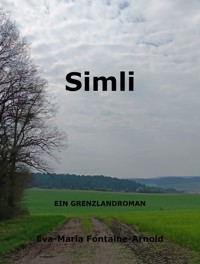
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wer die Landschaft des Saar-Gaus kennt, findet sich wieder im klaren Licht über den sanften Hügeln, auf den Streuobstwiesen, in den verschlafenen Dörfchen. Im Sommer des Jahres 2010 geschehen hier seltsame Dinge, harmlos zunächst, und dann entsetzlich sich steigernd. Früchte werden gestohlen, kleine Tiere. Dann verschwinden kurz hintereinander zwei Babys und der fünfjährige Frederick Massonne. Die Spurenlage ist äußerst dürftig, es gibt keine Zeugen, und die Polizei scheint hilflos. Marie Rosselle, fünfundfünfzig Jahre alt, klug und sensibel, ahnt, dass all die rätselhaften Dinge zusammenhängen, und sie spürt intuitiv, dass die Landschaft dabei eine entscheidende Rolle spielt. Als ein Liebespaar nachts auf einer Streuobstwiese kleine zerlumpte Gestalten beim Äpfelklau beobachtet, scheint es so, als seien Kinder in die rätselhaften Vorgänge verwickelt.Dann findet Maries kleine Enkelin auf einem Spaziergang den Schädel eines Babys. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist so grauenhaft, dass es nicht veröffentlicht wird. Der Winter kommt, und es kehrt Ruhe in den kleinen Dörfern ein. Aber sie ist trügerisch. Im April verschwindet wieder ein Baby, unter genauso mysteriösen Umständen wie die anderen Kinder. Angst und Misstrauen beherrschen die Menschen. Im August sind zwei Jäger in der Nacht auf der Pirsch, als ihnen ein Kind entgegenkommt. Es ist Frederick, der vor einem Jahr verschwunden ist. Er ist furchtbar verwahrlost, schwer traumatisiert, stumm. Er kann nichts beitragen zur Aufklärung der schrecklichen Ereignisse. Marie Rosselle liest ihm Märchen vor, und so kann sie seine Blockade aufbrechen. Er spricht sein erstes Wort, und Marie erkennt, wo er das letzte Jahr verbracht hat. Fast zeitgleich findet auch die Polizei diesen Ort. Was die Polizisten aber dort entdecken, ist verstörend, kaum vorstellbar und anders als alles, was sie bisher gesehen haben. Sie müssen erkennen, dass polizeiliche Mittel nicht geeignet sind, um diesen Fall aufzuklären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FÜR MEINE KINDER
Einstimmung
Das milde Licht der Abendsonne liegt über der sanft gewellten Landschaft.
Die Hügelzüge tragen dunkle Waldstücke, das ebene Land dazwischen zeigt die helleren Grüntöne junger Saaten oder das satte Grün der Wiesen, auf denen Kühe und Schafe weiden. Bächlein schlängeln sich durch die Wiesen, so wie sie es wollen. Sie dürfen ihren Lauf selbst bestimmen. Oft begleiten alte Weiden ihre Ufer.
Die braunen Rechtecke frisch gepflügter Äcker sind gesprenkelt mit Brocken des hellgrauen Kalksteins, der ihren Untergrund bildet.
Hecken begleiten die Wege, und auch inmitten der Flur gibt es sie. Sie sind Heimstätte der kleinen Säugetiere, der Vögel und Insekten.
In die Mulden schmiegen sich Dörfchen, aus der Ferne oft nur verraten von ihrem Kirchturm.
Stille und Frieden sind hier. Spätes Vogelgezwitscher, das ferne Bellen eines Hundes, sonst gibt es keine Geräusche.
Und würde jemand genau hinsehen, so würde er am Abend das Reh erblicken, das ohne Furcht dort steht, wo ein kleines Waldstück an eine Wiese grenzt.
Aber es ist niemand da. Die Menschen sind heimgekehrt in ihre Häuser, zu ihren Familien.
Die Natur genügt sich selbst, jetzt, in den goldenen Schein der Abenddämmerung getaucht.
Und nichts in dieser Landschaft, nichts in dieser Idylle lässt auch nur einen Hauch von dem Grauen ahnen, das unter der Oberfläche verborgen ist.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
KAPITEL 70
KAPITEL 71
KAPITEL 72
KAPITEL 74
KAPITEL 75
KAPITEL 76
KAPITEL 77
KAPITEL 78
KAPITEL 79
KAPITEL 80
KAPITEL 81
KAPITEL 82
KAPITEL 83
KAPITEL 84
KAPITEL 1
Das Dörfchen lag still, wie verlassen in der Sonntagnachmittagssonne.
Vor zwanzig Minuten ist das letzte Auto durchgefahren.
Sein Fahrer hätte schon nach ihm suchen müssen, wollte er den weißgrauen Hund sehen, der an einer Scheunenwand lag und döste. Wahrscheinlich hätte er auch die drei Jungen auf dem kleinen Platz nicht wahrgenommen, obwohl dieser direkt an der Straße lag, an der Hauptstraße des Dorfs, der Rue Principale.
Auch sie waren still. Sie taten nichts, waren einfach nur da mit ihren Fahrrädern. Sie lehnten am Rand des Brunnentrogs, in den sich aus einer alten eisernen Pumpe ein dünner Wasserstrahl ergoss.
Nichts übertönte dessen leises Plätschern.
Manchmal drehte einer der drei eine lautlose Runde auf dem kleinen Platz, manchmal balancierten zwei im Stand auf ihren Rädern, bemüht, so lange wie möglich einen Bodenkontakt ihrer Füße zu vermeiden. Danach standen sie wieder neben ihren Rädern, schauten auf die Erde zu ihren Füßen oder die Straße hinunter, so, als warteten sie auf das nächste Auto, das ja irgendwann kommen musste.
„An den See!“ Wer das Kommando gegeben hatte, war nicht auszumachen, möglicherweise war es Jean-Luc, mit dreizehn der älteste der drei. Er war schlank, dunkelbraune Locken fielen ihm in die Stirn. Als hätten sie nur auf den Entschluss gewartet, bestiegen sie ihre Räder und fuhren los, die Hauptstraße hinunter und hinter den letzten Häusern über die kleine Brücke mit dem leuchtend blauen Geländer. Für die überbordende Fülle der Blumenpracht, die in allen Farben aus den Kästen an diesem Geländer quoll, hatten sie keine Augen.
Sie waren noch zu jung.
Hinter der Brücke bogen sie nach links ab auf einen Weg, der parallel zu dem Flüsschen verlief, das hier eine weite Talmulde geschaffen hatte.
Der Weg war unbefestigt. Wenn es geregnet hatte, war er kaum zu begehen oder zu befahren. Der schwere Keuper-Lehm, der seine Oberfläche bildete, klebte sofort in dicken Klumpen an Schuhen und Reifen. Nur dort, wo das Kalkgestein des Untergrunds zutage trat, war der Weg dann noch fest.
Aber es hatte lange nicht geregnet, und die Sonne, die seit fast zwei Wochen aus einem wolkenlosen Himmel strahlte, hatte den Lehm ausgetrocknet und steinhart gebacken.
Die drei kamen flott voran.
Sie waren nun nicht mehr leise. Rufe, Gesprächsfetzen flogen hin und her, und wenn einer auf einer allzu glatten Kalkplatte ins Rutschen kam und beinahe oder tatsächlich stürzte, wollten die zwei andern sich kaputtlachen, so dass sie kaum noch geradeaus fahren konnten, auf ihren Rädern bedenklich schwankten und manchmal einander so ins Gehege kamen, dass ein Massensturz drohte.
Einmal hielten sie unvermittelt an, als hätte einer auch dazu das Kommando gegeben, versammelten sich auf dem Weg, besprachen sich ernsthaft über einen wichtigen Gegenstand, dann fuhren sie ebenso unvermittelt weiter. Für die Schönheit der Landschaft hatten sie keinen Blick.
Sie waren noch zu jung.
Der kleine Fluss floss in sanften Windungen. Buschwerk und Weiden säumten seine Ufer, manchmal so dicht, dass vom Wasser nichts zu sehen war, auch wenn der Weg dicht daneben verlief.
Dann verriet er sich nur durch sein Plätschern und Rauschen, dort, wo die Steine des Untergrunds ihm im Weg lagen, die Steine, die er selbst freigespült hatte. Aber jetzt war das Wasser nicht zu hören. Die Jungen übertönten sein Plätschern.
Sie hatten nun ihr Ziel bald erreicht. Noch ein Stück Weg, das gerade verlief, so dass sie kräftig in die Pedale treten konnten, und das, was sie ihren See nannten, lag vor ihnen.
Während der Weg weiter geradeaus führte, in die Talaue hinein, machte das Flüsschen hier eine Biegung nach rechts. Heftige Seitenerosion hatte einen Steilhang geschaffen, auf dessen Rand sie jetzt standen.
Auf einmal hatten sie wieder viel Zeit. Sie standen da, die Räder zwischen den Beinen, und blickten auf die Wasserfläche hinunter, die, einen guten Meter unter ihnen, das Innere der Flussbiegung ausfüllte.
Unter ihnen rauschte und gurgelte das Wasser, dort, wo es ans Ufer prallte, sich hineinbiss, hineinfraß und Erde herausriss und mit sich führte, so, als bedürfte es der Wegzehrung.
Am andern Ufer schien das flache Wasser stillzustehen. Es gab dort sogar einen kleinen Strand. Da wollten sie hin.
Und so, wie sie alles Wichtige gemeinsam taten, legten sie nun ihre Fahrräder ab, neben dem Weg, um eventuelle Spaziergänger nicht zu behindern. Sie waren gut erzogen.
Jean-Luc, der älteste, wandte sich einer Weide zu, deren Stamm fast waagerecht über den Fluss wuchs. Mit ein paar geschickten Bewegungen stand er auf dem Weidenstamm. Die ersten Schritte waren einfach, es gab einen Ast zum Festhalten. Dann galt es zu balancieren und mit einem kühnen Sprung das jenseitige Ufer zu erreichen. Sie hatten es schon oft getan, auch die jüngeren, die Brüder Pierre und Paul, acht und zehn Jahre alt.
Sie ließen sich auf ihrem Strand nieder. Dass er steinig war, störte sie nicht. Sie taten nichts. Eine Zeitlang genügte es ihnen, ihr Ziel erreicht zu haben und hier zu sitzen. Sie schauten aufs Wasser, folgten seinem Lauf mit den Blicken. Manchmal fuhr einer mit der Hand über den Boden, durch die Steinchen, die ihn bedeckten, und suchte eines heraus, das besonders rund oder besonders flach oder besonders gelb war. Dann warf er es ins Wasser.
Als sie endlich die kleinen Fischchen sahen, die eigentlich immer hier waren, standen sie auf und machten sich an die Arbeit.
Mit bloßen Händen gruben sie eine Mulde, ein kleines Stück oberhalb der Wasserlinie. Dann machten sie einen Graben, auf dass das Wasser in die Mulde floss. Als sie voll war, bauten sie einen Damm. Sie waren sehr zufrieden. Sie hatten einen See geschaffen.
Nun brauchten sie die kleinen Fischchen. Trotz der Übung, die sie bereits hatten, dauerte es lange, bis es einem von ihnen, Pierre, gelang, gleich zwei auf einmal in den hohlen Händen zu fangen. Stolz setzte er sie in den See.
Erst als jeder ein Fischchen gefangen und in dem winzigen See freigelassen hatte, hockten sie sich wieder hin und betrachteten ihr Werk. Sie waren sehr zufrieden.
Dann zog Jean-Luc ein kleines Notizbuch aus der Tasche. Es war schon arg mitgenommen. Er riss ein paar Blätter heraus und begann, Schiffchen zu falten. Er war der Einzige, der das konnte. Er musste doch wettmachen, dass der jüngste ihn beim Fischefangen übertroffen hatte.
Aber er war großzügig und gab jedem ein Schiffchen. Sie setzten sie ins flache Wasser, wo sie sich kaum bewegten. Sie lagen vor Anker. Als sie dort lange genug gelegen hatten, nahm jeder sein Schiff und bugsierte es in Richtung Flussmitte, ins Fahrwasser, wo es von der Strömung aufgenommen und mitgerissen wurde.
Sie blickten der kleinen Flotte nach, bis sie nicht mehr zu sehen war.
Nun brauchten sie neue Betätigung. Die Quelle? In der Wiese, in die ihr flacher Strand allmählich überging, entsprang eine Quelle. Sie war in ein Steinbecken gefasst, an dem die braunen Kühe ihren Durst stillten, die den ganzen Sommer über hier weideten und die auch jetzt da waren. Sie lagen dicht beisammen ein Stück flussaufwärts im Schatten einer Baumgruppe.
Die drei brachen auf zur Exkursion. Sie marschierten zur Quelle. Der Steintrog war noch gefüllt, aber aus dem rostigen Rohr floss das Wasser dünn und kraftlos, und entsprechend wenig ergoss sich aus der Rinne im Rand des Trogs in den kleinen Bachlauf, der durch die Wiese dem Flüsschen zustrebte. Es war nur noch ein Rinnsal. Aber es war fließendes Wasser, und damit konnte man etwas anfangen.
Sie folgten dem Rinnsal bis zu der Stelle, wo die Wiese in den steinigen Strand überging. Das spärliche Wasser erreichte den kleinen Fluss nicht. Es versickerte im Sand. Die drei blieben stehen. Hier musste etwas getan werden. Sie beratschlagten, erwogen, verwarfen. Sie zeigten mit ausgestrecktem Arm, schüttelten die Köpfe, nickten schließlich. Sie hatten jetzt aufgehört, Kinder zu sein. Sie waren Männer, die planten und ihren Plan in die Tat umsetzten. Sie arbeiteten.
Sie bauten einen Staudamm. Aus Erde errichteten sie einen halbkreisförmigen Wall, mit Steinen stabilisierten sie ihn. Sie schufen ein Becken, in dem sich das Wasser des Rinnsals sammelte. Und als das Becken voll war, machten sie einen Überlauf und gruben ein Flussbett, durch das das Wasser nun den Strand überwinden und in den Fluss münden konnte.
Sie standen auf und betrachteten ihr Werk. Sie hatten einen neuen Flusslauf geschaffen. Sie waren sehr zufrieden.
Und verwandelten sich wieder in Kinder, die es auf einmal eilig hatten, nach Hause zu kommen. Sie wandten sich ihrem ersten Werk zu, dem winzigen See, dessen Wasserspiegel schon bedenklich gesunken war, und setzten die kleinen Fischchen wieder in den Fluss. Sie hatten Achtung vor dem Leben. Sie waren gut erzogen.
Nur Jean-Luc, der älteste, schaffte es auf dem gleichen Weg zurück. Er trat auf einen großen Stein, der im flachen Wasser lag, und konnte dann den Stamm der Weide erreichen. Er war schon stark genug, um sich daran hochzuziehen, er konnte sich auch aufrichten und die Balance halten, bis er den Ast ergreifen konnte, der ihm sicheren Halt gab. Erst einmal war er bei diesem Manöver ins Wasser gefallen, so dass er mit nassen Kleidern nach Hause gekommen war. Nur dieses Ereignis hielt bis jetzt die zwei jüngeren davon ab, es Jean-Luc nachzumachen.
Sie liefen zu der seichten Stelle, knapp zweihundert Meter flussaufwärts, die die Kühe als Furt benutzten. Große flache Kalksteine, die hier aus dem Wasser ragten, ermöglichten es den beiden, das Flüsschen trockenen Fußes zu überqueren.
Sie rannten zurück zu ihren Fahrrädern, wo Jean-Luc auf sie wartete.
Im Sommer des Jahres 2010 waren diese Kinder in Mitteleuropa fast so etwas wie ein Anachronismus. Drei Jungen, die spielten, die ohne ein elektronisches Medium spielten,
einfach nur miteinander. Die zu Hause selbstverständlich einen Fernseher hatten, auch Playstation, natürlich. Jean-Luc hatte sogar schon einen eigenen Computer. Aber heute hatten sie den Spielplatz Natur den Bildschirmen und Joysticks vorgezogen. Es war nicht das erste Mal. Schon öfters hatten sie einen Nachmittag im Freien verbracht anstatt in ihren Zimmern und an Computer und Fernseher. Dann waren Wasser, Erde und Steine ihre Spielsachen. Heute hatten sie sogar ein wenig mit den kleinen Fischchen gespielt. Aber sie hatten ihnen nicht wehgetan.
Nun kehrten sie heim. Sie radelten auf dem Weg am Fluss entlang, über die Brücke mit dem leuchtend blauen Geländer und den bunten Blumen zurück in die Geborgenheit ihres Dorfes und ihrer Familien. Doppelte Sicherheit.
Aber sie waren gar nicht in Gefahr gewesen. Sie waren schon zu groß.
KAPITEL 2
Sie war alt genug, um den Anachronismus zu erkennen.
Marie Rosselle war fünfundfünfzig und arbeitete mit voller Stelle als Lehrerin.
Sie hatte nie zu denen gehört, die die Jahre zählten: noch sechs, noch vier Jahre, und dann endlich . . . Ja, was denn dann? Sie arbeitete gern, und wenn sie gefragt wurde: „Wie lange musst du denn noch?“, dann wusste sie, dass das Modalverb falsch war. Sie wollte, konnte arbeiten, und sie war dankbar dafür. Dankbar für ihre Gesundheit und dankbar für ihren Job, den sie, gegen den Mainstream, mit zunehmendem Alter immer lieber ausübte.
Die Unsicherheit der frühen Jahre, der Stress der mittleren, als sie bei voller Stelle zwei Kinder bekommen und liebevoll versorgt und erzogen hatte, all das lag hinter ihr.
Die Arbeit machte ihr Spaß, besonders die Arbeit mit den „Großen“, den Schülern der Oberstufe. Das waren kritische junge Menschen, die ihre Lehrer nur dann respektierten, wenn sie sie als kompetent und fair erlebten, junge Erwachsene, die nicht mehr alles glaubten, sondern überzeugt werden wollten durch Argumente, die sie einsehen konnten oder auch nicht. Dann blieben sie bei ihrer Meinung. Schülerinnen und Schüler, die widersprachen. Die waren ihr die liebsten. Mit einigen konnte sie durchaus auf Augenhöhe diskutieren.
Das waren Sternstunden.
Marie Rosselle wusste auch, dass fast alle ihre Schüler ihr auf einem Gebiet haushoch überlegen waren: im Umgang mit dem Computer nämlich, von dem sie ganze vier Funktionen – nicht beherrschte, aber nutzen konnte. Sie konnte schreiben, speichern, ausdrucken und recherchieren. Sie fand auch gespeicherte Texte wieder.
All das verdankte sie der Hilfe ihres Sohnes Laurent, der kein geduldiger Lehrer war und die Begriffsstutzigkeit und Vergesslichkeit seiner Mutter nicht begreifen konnte. Für ihn, für seine Generation war der Computer fester Bestandteil des Lebens, im Beruf ebenso wie in der Freizeit. Er hätte auf vieles andere eher verzichtet als auf seinen Computer.
Aus diesem Grund fielen ihr die drei Jungen auf, die einen Sonntagnachmittag ganz anders verbrachten, als es heutzutage wohl üblich war. Sie hatte sie schon ein paarmal gesehen.
Von ihrem Wohnzimmer aus konnte sie die Talaue mit dem Flüsschen überblicken, und jedes Mal, wenn sie die drei sah, empfand sie ein bisschen Wehmut. So hatte sie als Kind mit ihren Freundinnen gespielt, und so hatten auch ihre Kinder gespielt.
Dass es auch heute noch möglich war, mischte bisweilen ein wenig Trost in ihre Wehmut.
KAPITEL 3
Wehmut. Das Gefühl, das sie so gut kannte, das zu ihr gehörte, solange sie zurückdenken konnte, oder jedenfalls seit der Zeit, da sie begonnen hatte, sich selbst bewusst wahrzunehmen.
Sie war noch ein Kind, da hatte sie schon gewusst, dass ihr Gesicht anders war. Nicht richtig anders. Es war alles da, und doch sah sie anders aus als die anderen Mädchen. Ihr Gesicht war zu lang. Die Stirn zu hoch. Die Augen zu klein und zu eng beieinander. Und da die Augenwinkel nach unten wiesen, sah es immer so aus, als seien die Augen halb geschlossen. Nie würde Maria jemanden mit großen strahlenden Augen ansehen. Aber das konnte das kleine Mädchen noch nicht wissen, das Mädchen, dessen Mund meist offenstand, weil die obere Zahnreihe etwas vorstand.
Die kleine Maria hatte ein unschönes Gesicht. Und so wie das Kind kein hübsches Kindergesicht hatte, so würde der Teenager kein schönes Jungmädchengesicht haben und die Erwachsene nicht das Gesicht einer attraktiven Frau. Sie würde nie einem Mann ein betörendes Lächeln schenken. Auch das konnte das kleine Mädchen noch nicht wissen. Es lebte sein kindliches Leben, hatte Freundinnen, ging zur Schule.
Das Fest der ersten Heiligen Kommunion war es, das Maria zum ersten Mal den Unterschied zwischen ihr und den anderen Mädchen so deutlich machte, dass es wehtat.
Bei aller Frömmigkeit, die da zur Schau gestellt wurde, ging es bei den kleinen Mädchen doch vor allem auch darum, schön auszusehen. Und die Mütter taten das ihre dazu. Kaum eine, die ihre Tochter nicht zum Friseur schleppte oder ihn gar ins Haus kommen ließ am großen Tag.
Zumindest aber wurden Locken gedreht und gebrannt, und eine ihrer Freundinnen hatte sich empört darüber beklagt, dass die Friseurin ihr die Augenbrauen gezupft hatte.
Maria aber wusste: Sie könnte das schönste Kleid von allen tragen, sie, Maria Wörne, würde trotzdem kein schönes Mädchen sein. Dass ein besonders schönes Kleid ein allzu starker Kontrast zu ihrem Gesicht bedeuten würde, war der Neunjährigen nicht so klar bewusst. Sie spürte aber, dass ein auffallend schönes Kleid nicht passen würde.
In stummem Einvernehmen wählte sie mit ihrer Mutter ein einfaches, glattes Kleid, das nur am Saum und in der Taille mit einer schmalen Stickerei verziert war. Sie war froh darüber, dass sie es nur einen Tag tragen musste. Das „Kleid des zweiten Tags“ dagegen, dunkelblau, gerade geschnitten und mit einem schmalen Gürtel versehen, bereitete ihr keine Schwierigkeiten. Sie fühlte sich wohl darin.
Maria schätzte das Praktische, das Solide. Sie war ein vernünftiges Mädchen. Meist war sie ernst und still, und wenn die Mutter ihre Tochter anschaute, kamen ihr manchmal seltsame Gedanken. Als Maria klein war, hatte sie ihr Märchen vorgelesen. Und sie dachte bisweilen, dass auch am Bettchen ihres Kindes weise Frauen gestanden hatten. Die erste war böse gewesen und hatte dem Kind die Schönheit verweigert. Die andern aber waren gute Feen gewesen. Sie konnten zwar den Spruch der ersten nicht aufheben, aber sie beschenkten das Kind zum Ausgleich reich mit anderen Gaben. Sie schenkten ihm Intelligenz und Humor, Fleiß und Geschicklichkeit, Gesundheit und ein liebenswertes Wesen.
All diese Eigenschaften aber sah man nicht, und die Mutter zweifelte sehr, ob sie ausreichen würden, den einen großen Mangel auszugleichen, wenn es eines Tages um das Lebensglück ihrer Tochter gehen würde. Und sie brachte Maria zu einem Kieferchirurgen.
Maria lebte vorläufig ihr Kinderleben. Sie ging aufs Lyzeum, wie die Höhere Schule für Mädchen damals hieß. Sie lernte Latein, und was ihre Mitschülerinnen zur Verzweiflung brachte, war für sie immer wieder eine Quelle der Belustigung. Wenn die anderen mit endlosen Konjugationsreihen kämpften, lachte sie über Formen wie bibi oder amabam. Sie hatte das System rasch durchschaut, nach dem Zeiten, Modi und Genera der Verben gebildet wurden. Bald setzte sie die Formen wie Puzzleteile zusammen, einfach nur so, zum Spaß. Besonders freute sie sich, als ihr sepelibimini gelang. Sie trug das Wort ihren Freundinnen vor, und sie probierten alle möglichen Betonungen an ihm aus, und dann kringelten sie sich vor Lachen bei der Vorstellung, dass Menschen sich ernsthaft in dieser Sprache unterhalten hatten.
Fast bedauerte Maria, dass Latein nicht mehr gesprochen wurde.
Auch was sie nebenbei über die antike Mythologie erfuhr, gefiel ihr. Sie fand es praktisch, für jedes Problem einen zuständigen Gott zu haben oder sogar eine Göttin.
Manchmal äußerte sie solche Gedanken im Unterricht, und mehr als einmal brachte sie ihre Lehrer in Verlegenheit.
Nicht alle reagierten so souverän wie der Religionslehrer im fünften Schuljahr, bei dem sie sich weigerte, dem Auftrag nachzukommen, den lieben Gott zu malen. Vor ihrem leeren Blatt zur Rede gestellt, antwortete sie, sie könne sich den lieben Gott nicht vorstellen, und deswegen könne sie ihn auch nicht malen.
Anstatt ihr einen Eintrag wegen Leistungsverweigerung zu verpassen, nahm er die rebellische Äußerung zum Anlass, über die verschiedenen Gottesbilder der Religionen der Welt zu sprechen. Er fand auch die passenden Worte, um den Zehnjährigen den Pantheismus nahe zu bringen. Den Begriff vermied er und sprach von der Existenz eines höchsten Wesens, das sich in seiner Schöpfung offenbarte, in den Sternen am Nachthimmel, in jeder schönen Blume, die sich aus ihrer Knospe entfaltet, in jedem zwitschernden Vogel im Garten, und auch in dem Kätzchen, das zufrieden in seinem Körbchen schnurrt.
Maria dankte dem Lehrer im Stillen für seine Erklärung und verzichtete darauf, die Frage zu stellen, die ihr durch den Kopf ging: Wo war dieser Gott, wenn das Kätzchen den Vogel jagte und tötete und ihn fraß?
Sie war zufrieden. Sie hatte etwas Neues gelernt. Sie hatte schon begonnen, den Wert einer Unterrichtsstunde nach diesem Kriterium zu bemessen. Wenn es nur eine Sache war, die sie am Ende einer Stunde mehr wusste als zuvor, so war es eine gute Stunde. Lernte sie in einer Stunde nichts Neues, so verbuchte sie diese als verlorene Zeit.
Mit ihrem wachen Verstand, ihrer Neugier und Furchtlosigkeit war Maria ein belebendes Element im Unterricht, aber nicht bei allen Lehrern beliebt. Die alten, allzu konservativen und die jungen, die noch unsicher waren, mochten sie nicht, weil sie kritisch und deswegen manchmal unbequem war. Ihre Mitschülerinnen aber liebten sie.
Daran änderte sich auch nichts, als die Pubertät ausbrach. Man nahm sie gern mit, ins Schwimmbad, in die Eisdiele, und später auch in die Disco. Sie war witzig und schlagfertig und mit ihrem trockenen Humor brachte sie die andern oft zum Lachen. Und sie war keine Konkurrenz, wenn es um die ersten Kontakte zu den Jungs ging, die man dort traf, und nur dort, da das Jungengymnasium am andern Ende des Städtchens lag.
Koedukation war in den 1960er Jahren noch ein suspektes Unterfangen.
So waren Schwimmbad und Eisdiele wichtige Begegnungsstätten. Letzterer haftete sogar ein klein wenig Verruchtheit an, war das Licht dort doch schon am Nachmittag durch dicke Vorhänge gedämpft. Es brannten sogar rote Lämpchen.
Es war noch nicht die Zeit, da ein Mädchen allein ausging, und so profitierten alle Beteiligten: Maria, weil sie mitgenommen wurde, und alle anderen, weil sie sich so vorteilhaft abhoben. Die Hübschen wurden neben Maria zu Schönheiten, und die anderen, die Mittelmäßigen und sogar die Unscheinbaren waren auf einmal ansehnlich und angenehm anzuschauen. Neben Maria gab es keine Mauerblümchen.
Maria wusste, dass sie kaum eine Chance hatte, einen Freund zu finden. Noch litt sie nicht wirklich unter dieser Vorstellung, aber der Gedanke, dass in ihrem Leben vielleicht etwas Wichtiges fehlen könnte, ließ sich nicht immer verdrängen, und wenn sie diesen Gedanken zuließ, spürte sie eine Wehmut, hervorgerufen jetzt nicht mehr allein durch den Mangel an Schönheit. Um diesen wusste sie, dieses Wissen begleitete sie, und es gab Zeiten, da gelang es ihr, sich damit abzufinden. Dann konnte sie sich sagen, dass andere Schlimmeres zu tragen hatten: unheilbare Krankheit, den Tod der Mutter – wie hoch sie griff, um ihr Leid zu toppen, war ihr dabei gar nicht bewusst.
Dann kam die Zeit, in der sie litt. Schlimmer als die Neunjährige litt die Fünfzehnjährige, die mit ihrer Klasse den Tanzkurs besuchen sollte. Sie spürte, dass es nicht nur darum ging, tanzen zu lernen. Es ging auch um Selbstdarstellung, um Präsentation. Für die jungen Mädchen ging es darum, gut auszusehen, schön, wenigstens hübsch zu sein. Es ging um die Präsentation auf dem Markt der Eitelkeiten, der – auch das wusste die Fünfzehnjährige – schon die Vorstufe zum Heiratsmarkt war. Sie wollte nicht. Sie wollte nicht mitmachen mit ihrem Gesicht, das, obwohl der Kieferchirurg gute Arbeit geleistet hatte, immer noch kein Jungmädchengesicht war, sondern das Gesicht einer traurigen älteren Frau.
Ihre Eltern aber übten sanften Druck aus. Es gehöre zur umfassenden Bildung und Erziehung eines jungen Menschen, sich auch auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen zu können, und dazu gehöre es eben auch, tanzen zu können.
Da ihre Freundinnen ebenfalls drängten, ließ Maria sich schließlich zur Teilnahme am Tanzkurs überreden. Sie bereute es schon nach den ersten Übungsstunden. Es waren mehr Mädchen als Jungen im Kurs. Es ging nicht auf. Wenn der Tanzlehrer nicht die fehlenden Tänzer organisieren konnte, blieben stets ein paar Mädchen übrig. Maria blieb immer übrig.
Während die hübschen Mädchen oft die Wahl hatten zwischen zwei oder drei Herren – so hießen die sechzehnjährigen Bubis hier –, die sich gleichzeitig vor ihnen verbeugten, schien sie nicht dazuzugehören.
Dennoch tanzte sie, kaum weniger als die anderen Mädchen. Der Tanzlehrer forderte sie regelmäßig auf. Er war in den Fünfzigern und in den Augen der Fünfzehnjährigen ein alter Mann. Dass der Altersunterschied kaum auffiel, dass sie als Paar zusammenpassten, erfüllte Maria mit Bitterkeit. Dass sie bald besser tanzte als die anderen Mädchen, war kein Trost.
Sie wollte aufhören. Nur der geduldige Zuspruch ihrer Eltern machte, dass sie durchhielt.
Es sei für junge Menschen wichtig, so viel wie möglich zu lernen, und es sei wichtig, Begonnenes zu Ende zu führen.
Und noch etwas wussten die Eltern: Ihre Tochter brauchte einen soliden Beruf, der ihr eine eigenständige Existenz sicherte. Der Lebensentwurf, der noch für ihre Generation gegolten
hatte, passte nicht mehr. Die Ehefrau-Hausfrau-Mutter, die in wirtschaftlicher Abhängigkeit von ihrem Mann lebte, war ein Auslaufmodell. Wodurch es ersetzt werden sollte, war noch nicht klar. Junge Mädchen strebten zwar den eigenen Beruf und die Unabhängigkeit an, aber heiraten wollten sie immer noch, und die meisten würden nach der Geburt eines Kindes zumindest eine Zeitlang zuhause bleiben und die traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter übernehmen.
Aber gerade in dieser Rolle sahen Marias Eltern ihre Tochter nicht.
Das Gesicht eines Menschen ist seine Visitenkarte. Es ist das Identifikationsmerkmal, auf das der erste Blick fällt und liefert den Eindruck, der haften bleibt. Den schönen Menschen hilft diese Tatsache. Man behält sie in Erinnerung, sucht ihre Nähe, ist gern in ihrer Gesellschaft.
Die vielen Durchschnittstypen vergisst man einfach.
Maria vergaß man nicht. Ihr Gesicht blieb in Erinnerung, weil es unschön war.
Maria Wörne brauchte also einen Beruf. Sie wurde Lehrerin.
Und nun blickte sie schon auf fast dreißig Jahre Berufsleben zurück. Mit einem tiefen Seufzer tauchte Marie aus ihren Erinnerungen auf. Wie anders war ihr Leben doch verlaufen, als ihre Eltern und auch sie selbst es vorausgedacht hatten.
Sie stand immer noch am Fenster. Leise, fast ein wenig benommen, schüttelte sie den Kopf. Eine so tiefe Rückkehr in die Vergangenheit gestattete sie sich selten.
Sie zwang sich in die Gegenwart zurück.
Ihr Blick ging wieder über die weite Talmulde, die nun in abendlichem Frieden lag. Das Bild erfüllte sie mit einer großen Ruhe, jetzt, im Sommer. Wenn es hell war.
In der Dunkelheit war das anders. Sie wusste nicht, woher das tiefe Unbehagen kam, das sie fast immer fühlte, wenn sie im Dunkeln hinaussah, wenn sie in die schwarze Finsternis blickte, die das Tal in mondlosen Nächten ausfüllte wie eine dichte Masse, die sie nicht durchdringen konnte, und die sie in ihrem warmen Zimmer frösteln ließ, so dass sie die Arme um den Oberkörper schlang, wie um sich zu wärmen oder zu schützen.
KAPITEL 4
„Omarie!“ Es klang immer ein wenig empört, wenn Maries kleine Enkeltochter nach ihr rief.
Um ihre beiden Großmütter zu unterscheiden, hatte man ihr vorgeschlagen, die Vornamen dazu zu nehmen. Während Oma Claire anstandslos angenommen wurde, wurde Oma Marie sofort von der überflüssigen Silbe befreit und zu Omarie verkürzt. Es hatte ein paar Versuche gegeben, dem Kind die korrekte Form nahezubringen, aber die waren ohne Erfolg geblieben, und bald hatten die Erwachsenen nachgegeben, wohl auch deshalb, weil sie selbst fanden, dass die Ellipse besser klang.
„So besser!“, hatte die kleine Lena zufrieden gesagt, als man ihr erlaubte, die Kurzform zu benutzen.
„Omarie!“ Jetzt kam sie durch den Garten auf Marie zugelaufen, und diesmal lagen echte Empörung und Aufregung in ihrer Stimme. Sie blieb vor Marie stehen und schaute zu ihr hoch.
„Filou ist weg. Ist gar nicht mehr da!“, sagte sie anklagend. Marie ging vor ihrer Enkelin in die Hocke. „Lena-Schatz, das ist nicht schlimm“, sagte sie. „Er macht bestimmt einen Morgenspaziergang.“ Lena schüttelte heftig den Kopf, so dass die braunen Locken hin und her flogen.
„Filou ist nicht heimgekommen. Hat gar nicht im Körbchen geschlafen. Wo ist Filou?“
Die Mischung aus Unsicherheit, Hilflosigkeit und Angst im Gesicht ihrer kleinen Enkelin rührte Marie.
Viel mehr aber rührte sie dessen kindliche Schönheit, das Ebenmaß, die großen Augen, die jetzt zu ihr aufsahen. Zum zweiten Mal hatten sich ihre Befürchtungen nicht bewahrheitet.
Wenn sie selbst auch schon lange mit ihrem Gesicht ausgesöhnt war, so hatte sie doch mit beinahe unerträglicher Spannung dem Augenblick entgegengesehen, in dem man ihr ihre neugeborene Tochter zeigte, und hatte dann geweint vor Erleichterung. Sie hatte ihr Gesicht nicht weitervererbt. Auch nicht an ihre Enkelin. Lena war ein hübsches Kind, und zu ihrem ebenmäßigen Gesicht hatte sie eine gute Portion Selbstsicherheit und kindlichen Charme mit auf die Welt gebracht.
Jetzt aber war von Selbstsicherheit nichts mehr zu bemerken. „Wo ist Filou?“, fragte sie mit großen Augen, aus denen wohl bald Tränen kullern würden, wenn Marie nicht überzeugend trösten konnte. Die dachte an das Naheliegende und sagte: „Bestimmt hat er eine Freundin gefunden und will ein bisschen bei ihr bleiben.“ Es war das Falsche. Lenas Unterlippe begann zu beben. „Lena ist doch seine Freundin.“
Die Lehrerin in Marie schwankte einen Augenblick, ob sie eine frühe Aufklärungsstunde halten sollte, entschied sich aber dagegen.
„Schau mal. Du spielst doch gern mit anderen Mädchen, mit deinen Freundinnen, oder mit Frederick.“
Große Augen, bestätigendes Nicken. „Siehst du. Und manchmal wollen Katzen eben mit anderen Katzen spielen.“ Die Unterlippe kam zur Ruhe.
„Aber wenn er sich verlauft?“
„Filou verläuft sich nicht. Er hat in seinem Kopf sowas Ähnliches wie dein Papa in seinem Auto.“
„Ein Navi? In seinem Kopf?“ Ein paar Sekunden fesselte die Vorstellung das Kind, dann kehrte die Besorgnis zurück. „Aber wenn er Hunger hat?“
„Dann fängt er sich eine Maus. Du weißt doch, dass Filou Mäuschen fangen kann.“
„Und wenn er kalt hat?“
„Es ist doch warm draußen. Sogar nachts. Und außerdem – “ Marie verkniff sich ein Grinsen, „er hat ja einen Pelzmantel an.“
Lena schaute angestrengt. Marie konnte sehen, wie es im Kopf des Kindes arbeitete. Die Argumente überzeugten sie. „Filou kommt wieder. Heute?“, fragte sie.
„Ja, mein Schatz, ganz bestimmt kommt er heute zurück“, antwortete Marie. „Spätestens morgen“, fügte sie hinzu, da sie die Eskapaden ausgewachsener Kater kannte und das Kind darauf vorbereiten wollte, dass es vielleicht einen Tag länger würde warten müssen.
Sie war überzeugt, dass sie die Wahrheit sagte.
„Komm, wir füttern die Kaninchen!“, schlug sie vor, um Lena abzulenken. Sie bückte sich, um zwei Möhren aus der Erde zu ziehen, während Lena schon zu dem großen Kaninchenstall am Ende des Gartens lief. Die beiden Zwergkaninchen hatten Namen. Sie hießen Timmy und Tommy und verbrachten ihre Tage in dem großen Freigehege, das Lenas Vater ihnen gebaut hatte. Es war nicht vorgesehen, sie zu schlachten.
„Omarie!“ Jetzt waren Schrecken, Entsetzen in der hellen Stimme.
Marie eilte ans Ende des Gartens. Sie sah es sofort. Gehege und Stall waren leer. Die Gittertür des Stalls stand ein Stück offen. Gestern Abend war sie verschlossen gewesen. Sie hatte es selbst überprüft bei ihrem späten Rundgang.
Wieder ging sie vor Lena in die Hocke. Sie schaute in ein verzweifeltes Kindergesicht, dessen Augen in Tränen schwammen. Und auf einmal war sie nicht mehr überzeugt davon, dass sie vorhin die Wahrheit gesagt hatte.
Sie schloss ihre kleine Enkelin in die Arme. Die schmiegte sich ein paar Sekunden an ihre Großmutter, dann machte sie sich frei.
„Haben sie auch ein Navi?“, fragte sie, die großen Augen voller Hoffnung.
Einen Wimpernschlag lang war die Versuchung da, dem Kind diese Hoffnung zu lassen. Dann entschied sich Marie für die Wahrheit. Eine mögliche Lüge oder auch nur Unwahrheit genügte für heute.
„Nein, Lena-Schatz“, sagte sie ernst. „Das haben nur Katzen und Hunde, und manche Vögel.“
Sie hatte noch nicht ausgesprochen, da kullerten schon dicke Tränen Lenas Wangen herunter, und bald schüttelte ein verzweifeltes Kinderweinen den kleinen Körper.
Wieder schloss Marie sie in die Arme, hielt sie fest, wiegte sie sanft hin und her, bis nur noch einzelne Schluchzer kamen.
In den nächsten Tagen war Marie ähnlich angespannt wie das kleine Mädchen. Beide warteten. Aber während Lena immer wieder zum Kaninchenstall lief und auch die Gartenbeete absuchte in der Hoffnung, Timmy und Tommy hätten sich zwischen den Salatköpfen und Radieschen versteckt, um in Ruhe fressen zu können, wusste Marie, dass die beiden Kaninchen verloren waren. Der Stall war verschlossen gewesen. Jemand musste ihn geöffnet und die Tiere freigelassen oder mitgenommen haben.
Sie hoffte nur noch, dass Filou wiederkommen würde. Es konnte schon vorkommen, dass ein Kater ein paar Tage wegblieb, und wenn er dann wiederkam, war er meistens arg ramponiert und abgemagert, und es fehlte ihm schon mal ein halbes Ohr, aber er war wieder da.
Filou jedoch kam nicht zurück.
„Omarie!“ Jetzt war keine Empörung mehr in Lenas Stimme, nur Traurigkeit. „Wann kommt Filou? Du hast gesagt, Filou kommt wieder heim.“
Nach einer Woche bereitete Marie ihre Enkelin darauf vor, dass auch Filou nicht wiederkommen würde.
„Aber du hast gesagt!“ Trotz regte sich.
„Ja, ich weiß, mein Schatz. Aber auch die Erwachsenen können sich irren. Sie wissen nicht alles. Und ich glaub jetzt, dass ich mich geirrt hab. Es kann sein, dass Filou was passiert ist. Dass er vielleicht überfahren worden ist.“
Trauer und Enttäuschung in den Augen des Kindes schmerzten Marie beinahe körperlich.
Lena war traurig wegen Filou und sie war enttäuscht über ihre Großmutter. Sie hatte ihr geglaubt und war enttäuscht worden. Ihre heile Welt hatte den ersten kleinen Riss bekommen.
Marie litt mit dem kleinen Mädchen. Das Kind traurig zu sehen, tat ihr weh. Sie selbst empfand keine Trauer. Wer um Menschen geweint hat, deren Verlust kaum auszuhalten gewesen und bis heute nicht ganz verwunden war, weinte nicht um Katzen und Kaninchen.
Sie spürte aber etwas anderes. Da war auf einmal ein Unbehagen, noch kaum greifbar und kaum begreiflich. Tiere verschwanden immer mal, das wusste sie natürlich.
Es war die Koinzidenz, dass drei Tiere in einer Nacht verschwunden waren, die sie seltsam anmutete und die ihr jetzt auch am hellen Tag das Unbehagen verursachte, das sie sonst nur beim Blick über das nachtschwarze Tal empfand.
KAPITEL 5
Es blieb nicht bei den Tieren von Lenas Familie.
Marie hörte es in der kleinen Boulangerie im Nachbardorf, wo sie jeden Sonntagmorgen Croissants für ihre Familie kaufte. Hier stand die alte Clarisse hinter der Theke.
Clarisse war einsfünfzig groß und wirklich alt, in den Achtzigern. Und sie war bucklig.
Wer sie von der Seite sah, hatte den Eindruck, ihr Rumpf ende mit dem Buckel, und ihr Kopf schwebe irgendwie vor dem, was ihr Hals sein musste. Graue Haare standen wirr um ihren Kopf, und sie hätte das perfekte Bild einer Hexe abgegeben, wären da nicht die ruhige Heiterkeit und das verschmitzte Lächeln, mit dem sie ihre Mitmenschen gern bedachte.
Clarisse war so etwas wie das kollektive Gedächtnis der ganzen Gegend. Geboren im Jahr 1926, blickte sie auf mehr als acht Jahrzehnte einer bewegten Geschichte zurück, einer Geschichte, die hier im Grenzland mehr Unruhen und Veränderungen gebracht hatte als anderswo. Sie hatte nichts vergessen, und sie vergaß auch heute noch nichts. Ihr Geist war wach wie der eines jungen Menschen. Sie verfolgte die Ereignisse in der Welt, und sie nahm teil am Ortsgeschehen.
Die alte Frau konnte auch als die Verkörperung des Grenzlandbewohners schlechthin gelten.
In einem Satz konnte sie mehrmals die Sprache wechseln. Sie war in einem solchen Maß bilingual, dass ihr Idiom, die Mischung aus Französisch und Deutsch, schon fast wieder als einsprachig erschien. Die Deutschen, die am Sonntagmorgen zahlreich über die Grenze kamen, um Baguettes und Croissants zu kaufen, verstanden sie genauso wie die Franzosen.
Die Boulangerie bildete das Zentrum ihres Lebens.
Ähnlich nachlässig gepflegt wie die Inhaberin, war der kleine Laden Treffpunkt und Kommunikationsplatz für die Bewohner der umliegenden Dörfer beiderseits der Grenze.
Der Verkaufsraum war winzig, bei mehr als drei Kunden wurde es eng. Am Sonntagmorgen standen die Käufer vor dem Haus Schlange.
Die Einrichtung des Lädchens war ein halbes Jahrhundert alt. Hinter der kurzen Theke boten Holzregale mit schrägen Böden die französischen Köstlichkeiten dar, derentwegen die Deutschen sonntags in Scharen hier einfielen. In zwei großen Weidenkörben standen warmduftende Flûtes und Baguettes. Das einzige Zugeständnis an die Moderne war ein Glasschrank mit Kühlvorrichtung für die Obst- und Crèmetorten.
Meist war die Tür des Lädchens offen, und die Kunden standen draußen geduldig Schlange.
Sobald einer herauskam, rückten sie um eine Position vor.
Marie stieg aus ihrem Auto und stellte sich ans Ende der Schlange.
„Jetzt schon drei Tage“, sagte die Frau vor ihr zu ihrem Vordermann. „Das hat sie noch nie gemacht.“
„. . . wird schon wiederkommen“, beruhigte der Mann.
„Aber sie ist noch klein, fast ein Welpe. Christine hat sie zum Geburtstag bekommen. Sie ist ganz unglücklich.“
Marie hörte zu.
Eine Frau, die weiter vorn in der Reihe stand, drehte sich um. „Wir hatten neulich nachts ein Mordsspektakel im Hühnerstall. Zum Glück hat mein Sohn es gehört und ist raus. Er hat den Fuchs wohl vertrieben.“
Und es ging weiter. Im Lauf der nächsten Woche verschwand der gesamte, mehrfach prämiierte Kaninchenbestand eines Züchters. Ein Meerschweinchen, das die warme Nacht in seinem Käfig auf der Terrasse verbringen durfte, war am nächsten Morgen nicht mehr da.
Leute, die am Rand des Dorfes Gärten bepflanzten, klagten darüber, dass ihre Erdbeeren zertrampelt und geplündert und ganze Reihen von Radieschen gestohlen wurden.
Die Ereignisse wurden zum wichtigsten Gesprächsthema in den kleinen Dörfern. Es hatte sogar schon eine Mitteilung in der regionalen Presse gegeben, und es war um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter gebeten worden.
Marie bezweifelte, dass sie Erfolg haben würden.
Wie einfach wäre es, wenn die bohémiens, die gitans da wären, oder korrekt ausgedrückt die Sinti und Roma, das fahrende Volk, das manchmal im nahen Städtchen Station machte und dann für ein paar Wochen den großen freien Platz am Rand des Ortszentrums bevölkerte. Und wenn auch nie etwas vorgefallen war, wenn sie jetzt da wären, wären sie für manche doch ein willkommener Sündenbock.
Aber der Platz war seit Monaten leer bis auf die Glas- und Papiercontainer und die Marktstände am Freitag, an denen die Bauern der Umgebung ihre Waren anboten.
Also war man ratlos. Und die Spekulationen waren abenteuerlich.
Als Marie am nächsten Sonntag an Clarisses Boulangerie ankam, war es anders als sonst.
Sie sah es schon, als sie nach einem Parkplatz Ausschau hielt. Die Menschen drängten in den kleinen Laden, und die, die draußen bleiben mussten, standen in Grüppchen zusammen. Die Stimmen waren laut. Die Ordnung war gestört.
„. . . mein kleines Spargelfeld zertrampelt und geplündert!“
„. . . bald keine Katze mehr im Dorf.“
„Die Mäuse werden überhandnehmen.“
„Sophie ist mit nichts zu beruhigen, seit Mimi verschwunden ist. Mimi ist ihr Kätzchen.“
„Wer macht bloß sowas?“
Niemand war wirklich beunruhigt. Aber man war verärgert, aufgebracht. Und natürlich suchte man nach Erklärungen.
„Tierfänger!“, vermutete eine junge Frau, die von Figur und Frisur her auch als Junge durchgehen könnte. „Die fangen Tiere für kosmetische Versuche und quälen sie, nur damit eine teure und wirkungslose Hautcrème mehr auf den Markt kommt für all die Möchtegern-Models.“
„Oder für medizinische Zwecke, für neue Medikamente.“ Ein älterer Herr versuchte sich in Rechtfertigung.
„Als ob das Tier den Unterschied merkt, wofür es gequält wird.“
„Vielleicht einfach ein Tierfeind? Einer, der Tiere hasst?“
„Ja, wenn es nur Katzen wären. Aber wer hasst denn Kaninchen?“
Die Disputanten waren an der Tür angelangt. Da keiner abgehängt werden wollte, drängten alle gleichzeitig in den kleinen Verkaufsraum, ohne ihre Diskussion zu unterbrechen.
„Und was ist mit meinen Salatköpfen? Incroyable!“, schimpfte ein Bauer.
„C´est comme en guerre, wie im Krieg, et après, da hatten alle grand faim“, sagte Clarisse, die die Notzeit erlebt hatte.
„Es wird sich schon aufklären“, brummte der alte Jacques. „Wenn sie nur die Finger von meinem Pastis lassen.“
Jacques war ein Original, Pastisliebhaber, Boulespieler und Hobbyjäger. Letztere Leidenschaft betrieb er nur noch passiv, indem er gelegentlich mit einem Jäger mitging oder auch schon mal alleine auf einen Hochsitz kletterte, um dort ein paar Nachtstunden im Wald und in Erinnerungen an frühere Zeiten zu verbringen. Er schoss nicht mehr.
Ähnlich verhielt es sich mit seiner frühen Leidenschaft für Clarisse. Als Fünfzehnjähriger war er heftig in die elf Jahre ältere Clarisse verliebt gewesen, ohne Hoffnung, und ohne den Mut, ihr seine Gefühle zu gestehen. Sie hatte nie davon erfahren, und so konnte sie nicht wissen, warum der alte Jacques in seinem klapprigen Renault jeden zweiten Tag an den Bäckereien dreier Dörfer vorbeifuhr, um seine Baguettes bei ihr zu kaufen.
„Deine Sorgen möchte ich haben!“, grummelte der Bauer.
Marie sagte nichts zu alldem. Sie kaufte vier Croissants und zwei Baguettes und verließ den kleinen Laden, setzte sich ins Auto. Aber sie fuhr nicht los. Sie blieb sitzen und überdachte, was sie gehört hatte. Sie glaubte nicht an Tierfänger im Auftrag von Pharma-Unternehmen.
Dazu passten die gestohlenen Pflanzen nicht. Es fiel ihr aber auch schwer, sich so etwas wie Mundraub vorzustellen. Dafür waren die Mengen fast zu groß, und vor allem: Wer aß Katzen und Meerschweinchen? Auch die Kaninchen halfen kaum weiter. Wer stahl denn ein Kaninchen, das er töten, häuten und ausnehmen musste, bevor er es braten konnte?
Wer wusste überhaupt noch, wie das ging? An den Hinterbeinen aufhängen, das Fell an den Hinterpfoten einschneiden und dann von dem blutigen Kadaver abziehen, bis die Augen aus dem nackten Schädel herausschauten? Den Bauch aufschneiden, so dass das warme, dampfende Gedärm herausquoll? Wer tat sich das an, wo in jedem Supermarkt die bratfertigen Kaninchenteile für wenige Euro bereitlagen? Nein. Das passte nicht zusammen.
Allerdings ließen gestohlene Salatköpfe und Erdbeeren kaum einen anderen Schluss zu als den, dass die Diebstähle der Nahrungsgewinnung dienten.
Marie seufzte. Sie fand keine Erklärung für die seltsamen Vorgänge. Sie startete den Motor und fuhr nach Hause, zu ihrer Familie.
KAPITEL 6
Ja, Marie hatte eine Familie. Was ihre Eltern und sie selbst für ziemlich unwahrscheinlich gehalten hatten, war ihr zuteilgeworden, in so vollkommener Art und Weise, wie es nur wenigen Frauen vergönnt ist.
In ihrer Studienzeit war sie lange einsam gewesen. Die Freundinnen ihrer Schulzeit waren weit verstreut, ihre Kommilitonen hatten vielfach ihren eigenen Freundeskreis und meist auch feste Partner. Zu ihren abendlichen Ausgängen wurde Maria nicht eingeladen.
Ihr Privatleben spielte sich in ihrem Elternhaus ab. Gelegentlich ging sie in ihre alte Disco.
Da sie gut tanzte, wurde sie oft aufgefordert. Aber nie bat ein Tänzer sie um ein Wiedersehen.
Ihr Selbstwertgefühl bezog sie aus der Leichtigkeit, mit der sie ihr Studium meisterte und aus der Tatsache, dass sie den meisten Menschen ihrer Umgebung an Intelligenz und Schlagfertigkeit überlegen war.
Letzteres aber streute Bitterkeit in ihre Seele. Was nützten ihr die Geistesgaben, wenn Freundschaft, Liebe, Glück fehlten? Allzu oft hatte sie schon gesehen, dass ein schönes Gesicht den sogenannten inneren Werten vorgezogen wurde.
An Sonntagen unternahm sie oft Tagestouren mit ihren Eltern. Als die Burgen an Saar und Mosel abgefahren waren, hielt sie jenseits der Grenze nach neuen Zielen Ausschau.
Nach Lothringen zu fahren, das bedeutete damals tatsächlich noch einen Grenzübertritt mit Grenzstation, Zöllnern und Ausweiskontrolle, alles in zweifacher Ausführung, deutsch und französisch.
Maria fuhr also nach Lothringen – und verfiel dieser Landschaft vom ersten Augenblick an. Die Weite, die sanften Hügel, die Kirchtürme, die aus den Mulden spitzten, die verträumten Dörfchen mit ihren Waschhäusern und Wehrkirchen, all das waren neue Eindrücke, die sie nicht mehr losließen. Sie sah Schlösser, wunderschöne und so zahlreich, wie sie es nie für möglich gehalten hatte.
Sie fand das Kleinod Gombervaux, in dessen Anblick sie stumm versank, minutenlang.
Sie entdeckte das Juwel Montbras und die majestätische Schlossanlage von Hombourg-Budange, vor deren Terrasse ein riesiger Teich im Sonnenlicht glitzerte.
Beim Anblick des Wasserschlosses Haroué und in Fléville-devant-Nancy musste sie sich in Erinnerung rufen, dass sie in Lothringen war und nicht an der Loire, deren Schlösser sie von einer Klassenfahrt kannte.
Und sie bemerkte den Unterschied. Hier gab es keine Touristenscharen. Die Schlösser Lothringens genügten sich selbst. Ihre Besitzer wussten nichts von Marketing-Strategien und Gewinnmaximierung oder wollten nichts davon wissen. Sie bewohnten ihre schönen Häuser, und die Räume, die sie nicht benötigten, ließen sie ungenutzt.
Maria lernte viel auf ihren Fahrten. Und je tiefer sie eintauchte in die Landschaft und ihre Geschichte, desto weniger verstand sie, dass die Generation ihrer Eltern das Nachbarland und seine Bewohner noch als den Erbfeind angesehen hatte.
Dass die Vergangenheit noch nicht vergessen war, erfuhr sie schmerzlich, als ihr Vater entgegenkommende Spaziergänger mit „Guten Tag“ grüßte und „Heil Hitler“ zur Antwort bekam.
Wochen später parkte sie ihr Auto im Zentrum eines kleinen Provinzstädtchens. Als sie mit ihren Eltern ausstieg, scholl es mehrstimmig aus einer Gruppe Jugendlicher: „Salut les
boches!“ Es klang nicht wirklich aggressiv, aber die beiden Erlebnisse hatten zur Folge, dass Maria sich viele Jahre lang scheute, sich im Ausland als Deutsche zu outen.
Ein anderes Erlebnis sollte sich als weit folgenreicher erweisen. Die Ausgangssituation war ähnlich. Ein Parkplatz in dem Städtchen Commercy, die Parklücke so eng, dass sie ihre Eltern aussteigen ließ, bevor sie in einer einzigen zügigen Bewegung rückwärts einscherte.
Sie wand sich aus dem Auto.
„Pas mal pour une femme!“ Sie sah sich um. Da stand ein junger Mann, die Hände in den Hosentaschen, und grinste. Maria sah ihm in die Augen. „Il me faut mains, pieds et tête pour conduire, et vous?” Es kam spontan, es war bestimmt kein korrektes Französisch, aber er verstand, und Maria ward die Genugtuung, den jungen Mann unsicher werden zu sehen.
Sie glaubte sogar, eine leichte Röte in seinem Gesicht zu bemerken. Trotzdem hielt er ihrem Blick stand. „Touché!“, sagte er, wobei ein verlegenes Lächeln über sein Gesicht huschte, und dann, leiser: „Pardonnez-moi!“ Dann wandte er sich ab und ging.
„Was hat er gesagt?“, fragte ihre Mutter. „Er hat gemeint, ich könnte gut einparken.“
„Warum hat er sich denn dann entschuldigt?“ Das hatte sie verstanden. Maria hatte keine Lust, ihre Antwort zu übersetzen. „Oh, Mama, es war nicht wichtig.“
Dieses war der Irrtum ihres Lebens.
Die Semesterferien waren zu Ende. Maria fuhr wieder zur Uni. Sie hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Es war Freitagabend. Neben der üblichen Ledermappe trug sie eine große Stofftasche mit Büchern, die sie aus der Bibliothek ausgeliehen hatte. Sie wollte am Wochenende anfangen, ihre Examensarbeit vorzubereiten.
Dass ein junger Mann in der Nähe ihres Autos stand, wunderte sie nicht. Es kam häufig vor, dass Kommilitonen aufeinander warteten. Auf sie wartete nie jemand. Sie brachte den jungen Mann nicht mit sich in Verbindung. Aber er kam langsam auf sie zu, und dann erkannte sie die gleiche Verlegenheit in seinem Gesicht wie in Commercy.
„Bonjour, Mademoiselle“, sagte er. Es klang ein wenig unsicher. Und dann: „Sprechen Sie mit mir?“
„Wie kommen Sie hierher?“
„Zu Fuß.“
„Was machen Sie hier?“
„Ich versuche, mit Ihnen zu sprechen.“
Touchée.
Sie musste aufpassen, sonst gewann dieser Schnösel die Oberhand.
Aber der junge Mann blickte ernst. Er zeigte auf den Aufkleber an ihrer Heckscheibe.
„Die Eule. Universitas Saraviensis. Und eine saarländische Autonummer. Das waren genug Indizien, um mein Glück hier zu versuchen.“
Auf einmal fühlte Maria sich unsicher. Wie genau hatte er ihr Auto angeschaut? Hatte er sich ihre Nummer gemerkt? Was wollte er von ihr? Dass ein junger Mann um ihrer selbst willen ihre Nähe suchte, dachte sie nicht. Das war noch nie vorgekommen. Und ein leichtes, oberflächliches Gespräch mit einem Mann, den sie nicht kannte, ohne konkreten Anlass oder Zweck, war unbekanntes Terrain für sie. Aber vielleicht hatte er ja einen Grund. Sie konnte ihn zumindest anhören.
„Und worüber sollten wir sprechen?“
„Über gedankenlose, arrogante Männer.“
„Das lohnt sich nicht.“ Es kam schärfer als beabsichtigt, und Maria hätte es gern zurückgenommen.
„Ich stimme Sie zu.“
Nicht die Tatsache, dass er ihr beipflichtete, sondern der kleine Grammatikfehler war es, der Maria milde stimmte. Abwartend sah sie ihn an.
„Ich habe mich arrogant benommen und gedankenlos. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich bin nämlich nicht so, normalerweise.“
„Sie haben sich ja schon entschuldigt.“
„Aber nicht genug. Ich will meinen Fauxpas wieder gutmachen. Nehmen Sie einen Kaffee mit mir?“
Was passierte hier? Ein Fremder sprach sie an? So fremd ist er ja eigentlich nicht. Er lud sie ein? Nur ein Kaffee. Du kannst doch wohl mit einem Kommilit – „Studieren Sie hier?“
„Ja. Entschuldigen Sie. Ich habe mich noch nicht vorgestellt.“
„Ich hab Ihnen ja auch keine Gelegenheit dazu gegeben.“ Zum ersten Mal während dieses Gesprächs, das so ungewohnt war für Maria, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Sofort war das jungenhafte Grinsen wieder da, das sie aus Commercy kannte.
„Dafür müssen Sie mit mir einen Kaffee nehmen. Ich heiße Pierre Rosselle und studiere Jura im sechsten Semester. Am Montag warte ich im Juristencafé auf Sie, ab sechzehn Uhr. Bitte.“
Maria besann sich auf die Regeln der Höflichkeit. „Maria Wörne.“ Dass sie dabei nickte, war ihr nicht bewusst. Er nahm es als Zustimmung.
„Alors, bis Montag.“
Er trat zwei Schritte zurück und blieb dann stehen. Als sie davonfuhr, hob er die Hand und winkte kurz.
Und Maria hatte mit dreiundzwanzig Jahren ihr erstes Rendez-vous.
An diesem Wochenende gelang es ihr nicht wie sonst, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.
Es dauerte bis zum Sonntagvormittag, bis sie sich eingestand, dass ein junger Mann aus Commercy die Ursache dafür war.
Am Sonntagabend schob sie die Kleiderbügel in ihrem Schrank hin und her. Nicht dass sie eine große Auswahl gehabt hätte an hübschen Sachen. Was da hing und lag, war praktisch. Jeans, Pullis, T-Shirts. Gedeckte Farben, unauffällig, weil sie selbst nicht auffallen wollte. Und nun?
Da war es wieder, das altbekannte Gefühl der Wehmut, nur stärker jetzt, gesteigert zu einer Traurigkeit, die neu war. Warum? Warum nur war sie geschlagen mit dem, was einer Frau am wenigsten verziehen wurde? Maria wünschte sich keine Schönheit. Schönheit gehörte in eine andere Welt, an der sie keinen Anteil hatte. Aber hübsch, nur ein wenig hübsch zu sein, das wünschte sie sich an diesem Abend so schmerzlich wie noch nie in ihrem Leben. Oder wenigstens Durchschnitt. Ein durchschnittliches Gesicht könnte sie mit dem richtigen Make-up in ein hübsches verwandeln. Das hatte sie schon bei vielen Frauen gesehen. Aber sie? Was blieb ihr?
Sie legte Daumen und Zeigefinger an ihre Mund- und Augenwinkel und schob sie nach oben, wie sie es schon tausendmal vor dem Spiegel getan hatte. Sie dachte an Lenz, den armen geisteskranken Dichter, der sich gewünscht hatte, auf dem Kopf gehen zu können. Manchmal wünschte sie sich dasselbe. Vielleicht würde die Schwerkraft dann ja zu ihrer Verbündeten
werden. Maria war die einzige im Büchner-Seminar gewesen, die ein gewisses Verständnis für Lenz aufgebracht hatte.
Aber das half nun auch nicht weiter. Wieder glitten ihre Finger über die Bügel. Der Jeansrock.
Eng und kurz genug, um den Blick temporär auf ihre Beine zu lenken. Gut. Sie hatte nämlich schlanke, wohlgeformte Beine. Und dazu das rostrote T-Shirt, zu dem sie den passenden Lippenstift und Nagellack hatte, natürlich um zwei Tonstufen blasser. Noch ein dezenter grauer Lidstrich, richtig ausgeführt, so wie sie es geübt hatte, das musste genügen. Nur nicht zu viel tun. Nichts hervorheben in diesem Gesicht. Ausgleichen, abmildern hieß das Gebot.
Ihre Gedanken machten sich selbstständig.
Es ist nur ein Kaffee. Ich hab schon öfters mit Kommilitonen Kaffee getrunken.
Aber nicht mit einem allein. – Dann wird’s Zeit.
Er wird enttäuscht sein. – Na und? Das ist sein Problem.
Es ist auch meins . . . Er hat mich gesehen. Schon zweimal. Er weiß, wie ich ausseh.
Was kann er von mir wollen? – Find’s raus!
Mir ist mulmig. – Häng’s nicht so hoch, Mädchen. Es ist nur ein Kaffee.
Der letzte Satz wurde zum Mantra des Montags. Er überlagerte die Ausführungen des Professors zum bürgerlichen Trauerspiel und übertönte sogar die grelle Lyrik des Expressionismus.
Das Lyrikseminar war um viertel vor vier zu Ende. Gut. So brauchte sie keine Zeit totzuschlagen und lief auch nicht Gefahr, zu früh am Treffpunkt zu erscheinen. Viel Verspätung konnte sie sich aber nicht leisten. Höchstens fünf Minuten. Die Toleranz des Mannes gegenüber der Verspätung einer Frau ist proportional zur Attraktivität der Erwarteten.
Um vier Uhr trug sie etwas Rouge auf die Unterlippe auf, presste dann die Lippen zusammen, um Farbe an die Oberlippe abzugeben. So wirkte die Farbe dezenter. Auch die Augen bekamen eine Auffrischung. Trotzdem sehen sie nicht frisch aus. Sie können gar nicht frisch aussehen. – Maria, es ist nur ein Kaffee.
Das Juristencafé war an diesem Montag nur schwach besucht. Maria sah ihn sofort. Er saß an einem Tisch am Fenster und stand auf, als er sie erblickte. Er kam ihr entgegen, geleitete sie zum Tisch zurück und schob ihr den Stuhl zurecht. Erst als sie saß, nahm auch er wieder Platz.
„Danke“, sagte sie steif und fragte sich, ob dieses Zeremoniell einer Tasse Kaffee angemessen war.
„Kaffee?“ Sie nickte, und er holte ihr einen Kaffee, eine Premiere für Maria.
„Wollen wir uns duzen, wie es unter Kommilitonen üblich ist?“, fragte er. Wieder nickte sie stumm.
„Erzähl über dich.“ – „Warum?“
„Du interessierst mich.“ – „Warum?“
Oh Gott, was soll das werden? War sie jetzt nicht mal mehr imstande, eine einfache Unterhaltung zu führen? Gleich würde er aufstehen und gehen.
„Eine Frau, die mir in der fremden Sprache so gut – wie sagt man? – Widerspruch gibt, das hat mir gefallen. Ich schätze Frauen mit Esprit – mit Geist, mit Witz. Mit denen ist es nie langweilig. Du hast Esprit.“
Das Kompliment, unerwartet und völlig ungewohnt, zauberte ein kleines Lächeln in Marias Gesicht, das ihre Züge augenblicklich entspannte.
„War ich zu frech?“
„Du warst frech, aber nicht frecher als ich.“ Jetzt lächelte auch er.
„Du sprichst gut Deutsch.“
„Meine Mutter ist Deutsche. Sie hat mir ihre Sprache beigebracht und die Liebe zu ihrem Land, als sie noch bei uns war. Ich habe sie sehr vermisst, als sie uns verlassen hat.“
Es war eine Feststellung und ein recht offenes Eingeständnis von Gefühlen. Maria entspannte sich weiter.
„Hast du Verwandte in Commercy?“
„Nein. Aber ich liebe Frankreich. Seit ich zum ersten Mal durch Lothringen gefahren bin, an einem Sonntag, ohne Zeitdruck, ohne Ziel, lässt es mich nicht mehr los. Die Landschaft, die kleinen Dörfer, die Schlösser. Weißt du, wie viele Schlösser es dort gibt?“
„So genau nicht. Aber ein paar kenne ich. Das in Commercy zum Beispiel.“
„Ach nee, wirklich?“ Wie leicht es auf einmal war. Der letzte Rest von Anspannung fiel von Maria ab. Die Freude an der so normalen, aber für sie außergewöhnlichen Situation hob ihre Stimmung, und es schien, als hebe sie auch die Linien ihres Gesichts. Ihre Augen schienen offener, größer.
„. . . und Lunéville, das kennst du bestimmt auch?“
„Ja. Aber am liebsten sind mir die kleinen, bescheidenen, am Dorfrand oder an einem Flüsschen, mit großen Bäumen, einem kleinen Park, und der darf ruhig ein bisschen verwildert sein. Wenn ich vor so einem Schlösschen steh, denk ich manchmal, vielleicht war ich schon mal hier, in einem früheren Leben, vielleicht war ich so ein Schlossfräulein mit tollen Kleidern und einer Kutsche . . .“
„Glaubst du denn an – wie sagt man? Renaissance – Wiedergeborensein?“
„Ich weiß nicht. Vorstellen kann ich mir’s nicht, aber das heißt ja nicht, dass es so was nicht geben könnte.“
Es war kein Rendez-vous mehr mit einem Fremden, sondern die angeregte Unterhaltung mit einem jungen Mann, dessen Gesellschaft sich schon vertraut anfühlte und dem sie Dinge sagte, die nicht einmal ihre Eltern wussten.
Als ihr Blick zufällig auf die Uhr hinter der Theke fiel, war es halb sechs, und Maria begriff nicht, wie anderthalb Stunden vergangen sein konnten.
„Oh je“, sagte sie, „so spät schon. Meine Eltern werden sich Sorgen machen.“
„Sei froh. Um mich macht sich schon lange keiner mehr Sorgen.“
Maria sah ihn fragend an. „Das ist eine traurige Geschichte. Ich würde sie dir lieber ein anderes Mal erzählen.“
Maria wusste nichts zu sagen. Lief das auf ein zweites Treffen hinaus?
„Nur wenn du willst natürlich.“
Plötzlich waren Scheu und Unsicherheit wieder da – aber jetzt vermischt mit etwas Neuem, mit etwas, das sie voller Staunen als Glücksgefühl erkannte. Sie nickte stumm.
„Ja? Dann lass uns doch mal essen gehen. Am besten abends, dann haben wir mehr Zeit zum Plaudern.“ Wieder nickte sie, unfähig zum Sprechen.
„Très bien. Wann hättest du denn Zeit?“ – Immer. „Kommt drauf an. Wann sollen wir denn?“
Oh, Maria, ungeschickter geht’s ja wohl nicht.
„Wie wär’s mit dem nächsten Wochenende?“ Ein drittes Nicken, und dann: „Ja, gern.“
„Fein. Dann Freitagabend. Treffpunkt um sieben Uhr hier. Ich wohne hier auf dem Campus und hab ein Auto. Ich kenne drüben, ich meine in Frankreich, ein paar schöne Lokale. Und wenn es zu spät wird, übernachtest du bei mir.“
„Nein!“
Also das war’s. Wie konntest du nur so blöd sein!Der will ein leichtes Abenteuer mit einer, die allzu bereit ist, weil sie anders keine Chancen hat.
Abrupt stand sie auf und ging zur Tür. Er folgte ihr.
„Maria! Das war doch nicht ernst gemeint! Bitte! Das sollte ein Scherz sein. Aber es war dumm. Einmal mehr habe ich mich dumm benommen. Sag deswegen nicht nein.“
Mit hängenden Armen stand er vor ihr.
Maria fühlte sich hilflos. Sie hatte keine Erfahrung mit Situationen wie dieser, und als sie sprach, kamen die Worte unreflektiert, unkontrolliert.
„Was willst du von mir? Schau mich an! Ich bin nicht grad eine Schönheit. Ich weiß, dass ich nicht zur Freundin taug, aber für ’ne schnelle Nummer bin ich mir trotzdem zu schade.“
Pierres Gesicht war ernst. „Ich schau nicht auf das Äußere. Ich schau tiefer. Und ich kann warten.“
Maria schaute ihm in die Augen. Sie sah nichts Falsches.
„Pas mal pour un homme“, sagte sie langsam. Dann wandte sie sich ab und ging.
„Ich warte am Freitagabend hier auf dich“, rief er ihr nach.
Bis zum Mittwoch stand die Zeit still, angefüllt mit den widersprüchlichsten Gedanken und Gefühlen.
Ein Rendez-vous. Wenn sie es wollte, dann hatte sie das jetzt. Und sie wollte es.
Warum konnte sie sich dann nicht einfach darauf freuen? Weil nichts einfach ist. Weil es nichts werden wird.
Maria sah Pierre vor sich.
Kein Schönling. Ein schlanker junger Mann, mittelgroß, mit kurzem, dunkelblondem Haar und einem offenen, sympathischen Gesicht. Er hatte sicher keine Schwierigkeiten, eine Freundin zu finden. Oder doch? Vielleicht stimmte etwas nicht mit ihm? War er jähzornig?
Aggressiv? Hatte er etwas, was die Frauen abstieß? Abartige Vorlieben?
Nichts von alldem konnte sie mit Pierre in Verbindung bringen.
Aber er hatte gleich von Übernachten gesprochen. Im Scherz! – Und wenn schon. Wäre es denn so etwas Schlimmes? – Maria, was für Gedanken! Lass ihn nicht so nah an dich heran.
Nicht körperlich und auch nicht emotional. Dann kann er dir nicht wehtun.
Er wird mir wehtun.
Und wenn schon. Vielleicht ist es das wert. Vielleicht ist ein kurzes Glück besser als gar kein Glück. Auch schöne Menschen sind nicht ununterbrochen glücklich. Nimm, was dir geboten wird.
Mittwochabend. Maria stand vor ihrem Kleiderschrank. Ein voller Schrank und nichts anzuziehen. Ein Grinsen verzog ihr Gesicht, aber es war ohne Freude. Was sie bisher bei andern belächelt hatte, sollte das nun zu ihrem eigenen Problem werden? Ja. Steh dazu.
Maria stand dazu. Am Donnerstagnachmittag schwänzte sie „Die glaziale Serie“ und fuhr in die Stadt hinunter.
Die kleinen Boutiquen – zu chic, zu extravagant – mied sie und betrat das größte Bekleidungshaus am Platze.
Rock oder Kleid, dezent, und am besten nicht neu aussehend, das war es, was sie suchte.
Letzteres war kaum zu schaffen – second hand mochte sie nicht – aber das andere fand sie fast sofort. Sie wusste schon, als sie es auf dem Bügel sah, dass sie es nehmen würde.
Ein Kostüm. Anthrazit, kurzer glatter Rock, leicht taillierte Jacke. Eine schmale türkisfarbene
Einfassung an der Knopfleiste und am Rocksaum. Sie würde den Blick von ihrem Gesicht ablenken, wenigstens kurzfristig. Nur pro forma probierte sie es an und trat vor den Spiegel – und erlebte zum ersten Mal das sinnliche Wohlbefinden, das ein schönes und gutsitzendes Kleidungsstück einer Frau schenkt. Fast musste sie sich zwingen, das Kostüm wieder auszuziehen. Das Blüschen in türkis, etwas heller als die Paspelierung, das die Verkäuferin ihr zur Anprobe gereicht hatte, ließ sie gleich mit einpacken.
Als sie aber am Abend in dem Ensemble vor ihrem Spiegel stand, schien es ihr übertrieben, zu elegant für den Anlass. Und zu neu. Sie probierte eine weiße Bluse und ein blassgelbes T-Shirt. Schließlich entschied sie sich für ein beiges Top mit geradem Ausschnitt. Sie würde das Jäckchen offenlassen und so die etwas strenge, förmliche Wirkung des Kostüms abmildern.
Die feinen Antennen der Mutter nahmen die Veränderung wahr. Sie spürten die Unruhe ihrer Tochter. Deren längere Verweildauer vor dem Spiegel, der Jeansrock am Montag und das neue Kostüm signalisierten ihr aber auch, dass dieser Veränderung zunächst keine besorgniserregende Ursache zugrunde lag. Zunächst.