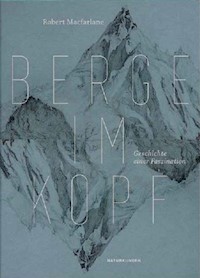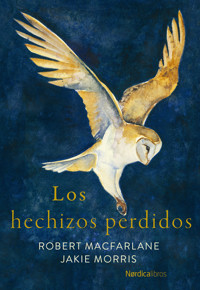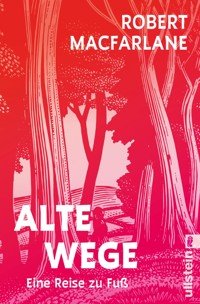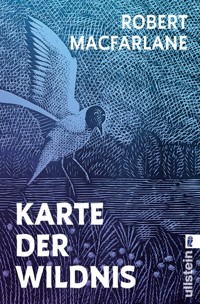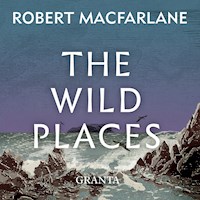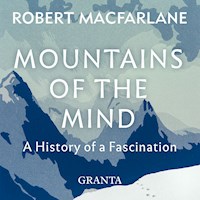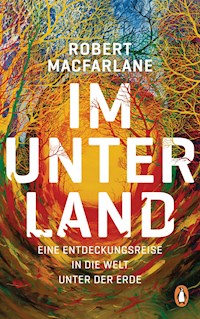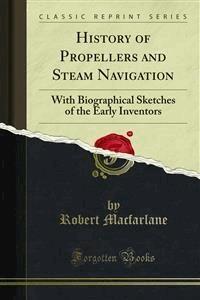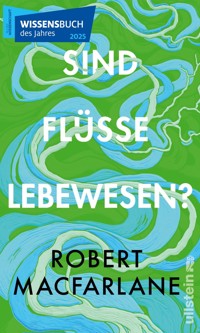
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sind Flüsse bloße Materie und Ressource für Menschen und Tiere? Keineswegs, sagt Robert Macfarlane: Sie sind eigenständige Lebewesen mit Rechten. Flüsse sollen frei von Verschmutzung fließen – und ein gesundes, von Menschenhand ungestörtes Ökosystem entwickeln dürfen. Mit diesem radikalen Konzept nimmt uns Macfarlane in seinem neuen Buch mit auf eine globale Reise, die unser Bewusstsein verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sind Flüsse Lebewesen?
Robert Macfarlane geboren 1976 in Nottinghamshire, gilt als bedeutendster Naturschriftsteller der Gegenwart. Seine Bücher Berge im Kopf,Karte der Wildnis und Alte Wege wurden allesamt Bestseller und sind mehrfach ausgezeichnet worden. Sein BuchIm Unterland bekam den NDR-Kultur-Sachbuchpreis 2019. Im Jahr 2017 verlieh ihm die American Academy of Arts and Letters den E.M. Forster Prize for Literature, und 2022 wurde er in Toronto mit dem Weston International Award für sein Gesamtwerk im Bereich Sachbuch ausgezeichnet. RoberMacfarlane ist Fellow des Emmanuel College, Cambridge. Für Publikationen wie The Guardian, The Sunday Times und The New York Times schreibt er über Umweltschutz, Literatur und Reisen.
Frank Sievers, Jahrgang 1974, und Andreas Jandl, Jahrgang 1975, übersetzen seit zehn Jahren die Prosawerke von Robert Macfarlane (Karte der Wildnis, Alte Wege, Im Unterland). 2017 erhielten sie den Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis für Der Wanderfalke von J.A. Baker.
Sind Flüsse bloße Materie und Ressource für Menschen und Tiere? Keineswegs, sagt Robert Macfarlane: Sie sind eigenständige Lebewesen, die als solche in unserer Vorstellung wie auch im Gesetz anerkannt werden sollten. Mit diesem radikalen Konzept nimmt uns der bekannte Schriftsteller und Naturbeobachter mit auf eine globale Reise, die unser Bewusstsein verändern wird.In fließender Prosa führt Macfarlane durch drei große Reisen – von hohen Gipfeln bis hinunter ans Meer. Zunächst blicken wir ins nördliche Ecuador, wo ein einzigartiger Nebelwald und seine Flüsse durch den Abbau von Gold bedroht sind. Auf der zweiten Reise erleben wir den verzweifelten Kampf, der in Südindien zur Rettung versehrter Flüsse, Bäche und Lagunen ausgefochten wird. Und zuletzt entdecken wir den Nordosten Québecs, wo sich eine Flussrechte-Kampagne für den Fluss Mutehekau Shipu einsetzt, um den Bau von Staudämmen zu verhindern.Macfarlanes bisher persönlichstes und zugleich politischstes Buch wird Herzen öffnen, Debatten entfachen und uns zu der Erkenntnis führen, dass unser Schicksal mit dem der Flüsse zusammenfließt – und dies schon immer getan hat.
Robert Macfarlane
Sind Flüsse Lebewesen?
Aus dem Englischen von Frank Sievers und Andreas Jandl
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2025 by Robert Macfarlane© der deutschen Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: © Privatarchiv Robert MacfarlaneE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3580-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Die Quellen
Einleitung
Anima
ERSTER TEIL
Der Fluss der Zedern(Ecuador)
Die Quellen (Winter)
ZWEITER TEIL
Geister, Monster und Engel (Indien)
Die Quellen (Frühling)
DRITTER TEIL
Der lebende Fluss(Nitassinan/Kanada)
Epilog
Die Quellen(Herbst)
Glossar
Bibliografie und Quellen
Verordnungen, Gesetze, Erklärungen, Urteile und Resolutionen
Danksagung und Nachhall
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für die Flüsse und ihre Hüter,und für Julia
In Erinnerung an Josef DeCoux (1951–2024)
Motto
Wie kann ich es übersetzen – nicht in Wörter, sondern in Glauben –, dass Flüsse auch Körper sind, lebendig wie du und ich, und dass es ohne sie kein Leben gibt?Natalie Diaz (2020)1
Ihr lieben zerstörten Flüsse … Alexis Wright (2019)2
Prolog
Die Quellen
Vor zwölftausend Jahren wird ein Fluss geboren.
In einer Senke am Fuß eines mit augenweißem Flint bedeckten Hügels entspringt erstmals aus einem Kreidespalt Wasser – und fließt davon. Entspringt und fließt, entspringt und fließt: über Tage, über Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte, betrachtet von einem Tagmond zu Mittsommer und einer beerenroten Wintersonne, betrachtet bei jeder Witterung, von zwei Meter hohen Hirschen, von spähenden Falken und Füchsen, bei Hagel und Graupel, betrachtet von – Schnauze bis Schwanz – drei Meter langen Auerochsen.
Das Quellwasser fiel als Schnee zur Erde, sammelte sich, schmolz dann und sickerte durchs Felsgestein, bis es als Quelle wieder zutage trat – ein schlafloses, silbern sich kräuselndes Wallen in einem Gumpen, den es sich flüsternd und murmelnd selbst erschuf.
Das Wasser ist rein von den Jahren in der Tiefe. Es ist klar wie Glas mit einer blauen Note. Im Norden ziehen sich missmutig die Gletscher zurück: breite Kristallzungen und Bugspriete aus Eis, die knarzen und ächzen, während das sich erwärmende Klima sie zum letzten Kampf ins Hochland hinaufdrängt. Das große Eisschild hinterlässt aufgescheuerten Grund, Plateaus aus vernarbtem Fels, Seen und Moränen aus Schmelzwasser.
Ein unermessliches Gewicht ist vom Land abgerückt, das sich nun erleichtert hebt. Bäume stellen den Gletschern auf ihrer Flucht gen Norden nach: erst Birke und Hasel, dann füllt Grauweide die Lücken. Unten im Süden hat der Frost endlich seinen ehernen Griff gelöst, sodass das Wasser nun tief in die Erde einsickert, bis hinab zur Grundwasserschicht, wo es sich sammelt, um am Fuße des Hügels als Quell zu entspringen.
Aus dem Quell wird ein Bach wird ein Fluss, und sie alle zieht es zum Meer.
Jetzt sind wir achttausend Jahre vor unserer Zeit, in der Zeit der Linden. Ein wilder Wald streckt sich über das Land bis zu den Küsten und bis zum Rand der Senke, aus der die Quelle entspringt. Von Regen gespeist, strömt die Quelle stärker zur See: aus Schwerkraft oder aus einer Art Sehnsucht. Dann trifft das Rinnsal auf den Fluss, der feist zu seiner Mündung mäandert und schließlich – zwischen bronzenen Stränden – ans Meer gelangt, wo er durch Tide und Wind in den Wellen zerrinnt.
Durchs Baumgeäst an der Quelle schieben sich Schatten: Zum ersten Mal finden sich hier Menschen ein, vom Born des Wassers angezogen. Die Quelle wird zum Anker ihres Wanderns, ein seltsamer Fixpunkt in den Schleifen und Kreisen ihres jahreszeitlichen Ziehens. Hier trinken, essen und schlafen sie, hauen Flint mit Geweihstücken zu Ringen als Werkzeug, außen weiß, innen blau. Sie klemmen Holzschäfte an Klingen, zimmern Ahle und Deichseln, spitzen Stichel, mit denen sie in Knochen ritzen. Bauen sich Herdstellen aus Stein und lassen sie angekohlt in der Kreide zurück. Ihre Nachtfeuer lodern in der großen Einsamkeit des dünn besiedelten Landes und der noch größeren Einsamkeit des Universums. In einer Winternacht tanzt das Polarlicht über den Himmel: wechselnd helle Lichtflüsse, die sich in Strudeln winden und grünrosa auf die erstaunten Gesichter der Menschen fallen, bis das alles umspannende Dunkel sie wieder verschluckt.
Die Geschichte rast und lahmt, verwirbelt und bildet, wo Strom auf Gegenstrom trifft, Strudel. Leben und Tod erstehen und vergehen – und die Quelle ordnet das Leben um sie herum, wie seit jeher, sie drückt dem Land ihren Willen auf. Dann die ersten Siedlungen: Auf einem Hügel über der Quelle wird ein erhöhter Hag eingefriedet, groß genug für etwa zehn Familien. Jahrhunderte vergehen. Die Anlage wird verlassen, überwuchert, vom Grün verschlungen. Neue Tote finden in der alten Kreide ihre letzte Ruhe, Grabbeigaben werden zugefügt: Töpfe, Perlen und die riesigen Hörner eines Auerochsen, dem eine Streitaxt mit einem einzigen Hieb zwischen die lodernden Augen den Schädel zertrümmert hat.
Die Bilder der Laterna magica wechseln schneller und schneller. Zweitausend Jahre vergehen. Die Kreidehügel werden erneut zur Festung – ein riesiger Ringwall mit Graben und Palisaden. In dem kleinen Wald entspringen nun noch mehr Quellen: neun an der Zahl, sie füllen zwei Senken. Wasserträger kommen immer wieder hierher, trampeln auf ihren Gängen von der Festung zur Quelle einen Pfad in den Boden. Wasseranbetung flutet rundum das Land. Quellen und Bäche werden zu Heiligtümern, an denen das Wasser in Stimmen spricht, die niemand verstehen oder widerlegen kann. Zu dieser Zeit gelten Flüsse rundheraus als Götter und werden auch so benannt: Dana (die spätere Donau), Deva (der Dee), Tamesa (die Themse), Sinnann (der Shannon). Doch wenn der Wasserlauf, der aus den Quellen am Fuß des weißen Hügels entspringt, jemals einen Namen erhielt, ist er an die Zeit verlorengegangen.
Unzählig oft wird das Jetzt zu Einst. Die Pax Romana bringt Frieden ins Quelltal. Kleinbauern teilen das Land unter sich auf. In der Dämmerung schlagen ihre Eisenpflüge orange Funken aus dem Flint und lassen ihn bersten. Die scharfen Splitter bleiben liegen, ununterscheidbar von den Feuersteinen, die vor vier- oder fünftausend Jahren von Menschenhänden erschaffen wurden. Die Römer verehren die Dryaden der Bäume und die Naiaden des Wassers. Das Wasser einer bestimmten Quelle oder eines Baches ist nicht austauschbar. Woher es entstammt, ist bedeutsam. Auch wo entlang es geflossen kam, ist bedeutsam. Jeder Fluss trägt in sich einen anderen Geist und eine andere Sprache – und muss anders verehrt werden. Weit oben im Norden, wo die Gletscher ihre Bäuche einst übers Land schleiften, bauen batavische Soldaten auf einer Quelle einen Tempel und widmen ihn der Göttin Coventina, deren Name vom keltischen Wort gover abgeleitet ist, »kleiner Wasserlauf«. Massenhaft werden Coventina Geschenke dargebracht: Münzen, Perlen aus Knochen, Blei, Gagat, eine Kupferbrosche mit Wasserschlangen. Und wegen der kleinen Quellen mit dem klaren Wasser kommen von der befestigten Landstraße, die einen Kilometer entfernt verläuft, Jahr für Jahr Legionäre her, um Dolch und Speer niederzulegen, ihren Durst zu löschen und Gebete zu sprechen. Sie nennen den Ort Nona, nach einer der Schicksalsgöttinnen. Im Laufe der Zeit wird Nona zu Nine. Nine Wells, neun Brunnen – die Quellen des Schicksals, die einen Fluss gebären.
Die Zeit fließt dahin, wiederholt sich, und die Quellen sprudeln weiter, Jahr für Jahr. Blütenfolge: Schwarzdorn, Pflaume, Weißdorn, Hundsrose, Spindel. Blätter in verschiedenstem Grün: Hainbuche, Hasel, Eiche und Ahorn. Im Wald rund um die Quellen rufen die Eulen aus Eschen und Buchen einander zu, immerfort, Jahr für Jahr. Irgendwer befestigt an einem Baum am Rand der Senke eine lange Kette mit einer eisernen Schöpfkelle, damit die Menschen das kalte Quellwasser daraus trinken können.
Jahrhunderte vergehen. Die Pest schreitet in großen Schritten vom europäischen Festland bis hierher. Scharfzahnig und hungrig stürzt sie sich auf die junge Stadt Cambridge, die nun nahe der Quellen wächst – und verschlingt ihre Bewohner. Die halbe Stadt stirbt. Halb Europa stirbt. Ein alter Dornbaum blüht an den Quellen, und Bittsteller kommen, um an den Ästen Stofffetzen anzubinden und zu hoffen, dass das Leben des Wassers sie vor dem Tode bewahrt. Aber die Beulen in ihren Achseln und Leisten eitern weiter. Einige der Toten werden behutsam und allein beerdigt, andere in Gräben geworfen, die auf Kirchhöfen ausgehoben worden sind. Die Quellen aber fließen weiter, und den Fluss zieht es weiterhin zum Meer.
Dann kommen die 1530er-Jahre. Heinrich VIII. hat mit Rom gebrochen und sich vom Papst abgewandt. Die Reformation ist in vollem Gange, doch werden nicht nur Altäre geplündert und Lettner zerstört. Eine reinigende Wut ergießt sich auch über das lebende Land, darauf versessen, den Menschen die verabscheuungswürdigste Sünde, den Götzendienst, auszutreiben.3 Ortsgarden ziehen umher. Dem fließenden Wasser – mit seiner Macht, zu heilen, zu segnen und zu handeln – wird besonders heftig nachgestellt. Heilige Brunnen werden zugeschüttet und versiegelt. Eine Kapelle, die tief im Westen an der Quelle eines Heiligen errichtet wurde, wird zerstört, und die Angreifer schwören, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Einige, die weiterhin zu den Quellen und Flüssen pilgern, werden verhaftet und vor Gericht gestellt. Dennoch kommen die Menschen, manches Mal im Schutz der Dunkelheit, und hinterlassen weiter Opfergaben. Für viele bestätigt die Unterdrückung der Quellen durch die Obrigkeit nur die numinose Kraft des Wassers, das wie von Zauberhand aus der Erde sprudelt – wie schon seit Jahrtausenden.
Fast dreihundert Jahre später badet ein überwältigend schöner junger Dichter mit lahmem Bein, der sich in seinem Zimmer an der Universität angeblich einen Bären hält, nackt in einem grünen Gumpen nahe der Quellen. Später beschreibt er in einem Gedicht einen Albtraum, in dem die Sonne ausgelöscht wurde und die eiskalte Erde blind und schwarz durchs All trudelte, und Flüsse, Seen und Meer standen still, und in ihren stillen Tiefen war keinerlei Regung.4
An den Hängen des Weißen Hügels, wie die Erhebung nun heißt, werden Pferde von Traktoren abgelöst. Ein Krieg überzieht die Welt, bedroht das Land. Die Menschen gehen zu Tausenden vor die Stadt und graben einen zehn Kilometer langen Graben, in den die Panzer der Wehrmacht mutmaßlich fallen werden, wenn sie von Süden her angreifen. Doch die grauen Soldaten sollen das Land nie betreten, der Graben wird wieder zugeschüttet, und nach dem frisch geschlossenen Frieden ersteht nahe den Quellen ein neues, großes Krankenhaus.
Der härteste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen kommt 1967: Sechs Wochen sind die Quellen zugefroren, und unter der Last des Eises brechen die Äste der Bäume. Die härteste Dürre folgt 1976: Straßen schmelzen, Waldbrände wüten, und Milliarden von Blattläusen treiben wie grüne Rauchschwaden über Stadt und Land. Angelockt von den Blattläusen, schwärmt eine Marienkäferplage über den Süden, in Scharen setzen sich die Tiere auf die Menschen, denen plötzlich, von Tausenden Insekten bedeckt, scheinbar ebenfalls Deckflügel wachsen. Zum ersten Mal seit dem Rückzug der Gletscher versiegen die Quellen. Und im August, auf dem Höhepunkt der Dürre, wird ein Junge geboren, mit sehr dunklen Haaren, die aber bald strohblond werden.
Die schnell wachsende Stadt dürstet nach Wasser: zum Spülen, zum Waschen, zum Trinken. Brunnen werden gegraben, das Grundwasser angezapft, aus Bächen und Flüssen wird Wasser entnommen. Felder, Hähne und Schläuche fordern ihren Tribut, bis schließlich der Grundwasserspiegel sinkt. Fast niemand mehr besucht die Quellen, die immer schwächer fließen. Der Bach gerät in Vergessenheit, erstickt in Algen und Entengrütze. Der Fluss wird langsamer und dreckiger. Die Wasserwerke fürchten schlechte Presse, wenn die Quellen unter ihrer Obhut versiegen, und schicken Männer mit Baggern und blauen Kunststoffrohren, um ein »Zuleitungssystem« zu bauen: Von anderswo im System wird Wasser in die Quellen gepumpt, um sie am Leben zu halten.
Fünfhundert Meter weiter liegen Dutzende menschlicher Körper an Beatmungsgeräten im Krankenhaus. Ihre Brust hebt und senkt sich im Takt der Pumpen, begleitet vom Piepen der Herzmonitore. Hier im kleinen Wald hängen auch die Quellen am Tropf.
Der Junge mit den strohblonden Haaren, der jetzt ein Mann und zum ersten Mal Vater ist, lebt inzwischen am Stadtrand, ein paar Hundert Meter vom Fuß des Weißen Hügels entfernt. Es dauert zwei Jahre, bis er die Quellen entdeckt, so vergessen sind sie, so versteckt liegen sie im Hain aus Buchen und Eschen, zwischen Weizen- und Gerstenfeldern nahe den Eisenbahnschienen. Schnell packt ihn eine Faszination für diese Quellen. Er besucht sie oft: zu Fuß, mit dem Fahrrad oder beim Joggen, nicht selten drei- oder viermal die Woche. Er trinkt gern eine Handvoll Quellwasser. Es hat einen runden Geschmack und die seidige Kühle von Stein. Er entdeckt, dass der kleine Wasserlauf, der aus den Quellen kommt, einer von nur zweihundert Kreidebächen auf der ganzen Welt ist und dass ein Quell-Kreidebach zu den seltensten Lebensräumen der Erde gehört. Er erfährt, dass das gesamte englische Kreidebachnetz bei den aktuellen Verschmutzungs- und Entnahmeprognosen die zweite Hälfte des Jahrhunderts nicht überleben wird.
Zehn weitere Jahre vergehen. Der Mann, der ich bin, hat jetzt drei Kinder. Es ist der Sommer des Jahres 2022, der heißeste Sommer, der jemals weltweit verzeichnet wurde und in dem fast alle Flüsse drohen zu sterben.
Im Juni hört es auf zu regnen. Die dürren Tage strecken sich zu Wochen, dann zu Monaten. Das Getreide zerbröselt auf den Feldern, der Boden reißt in sternförmigen Mustern auf. Grelles Licht umrahmt die Vorhänge und Fensterläden vom frühen Morgen bis zur sogenannten Abenddämmerung. Ich träume wie wir alle sehr oft von Regen.
Eines Morgens wachen wir auf, um festzustellen, dass ein starker Südwind feinen roten Staub aus der Sahara heraufgetragen und eine Pulverschicht auf Autos, Fenster und Pflanzen gelegt hat. Wenn er in den Mund gelangt, schmeckt er nach Erschöpfung. Die Sonne scheint rostorange durch den Dunst wie in Katastrophenfilmen oder Kalifornien.
Die Zeit gerät aus den Fugen. Der Verstand kann die Ungereimtheit nicht verarbeiten. In diesem Jahr gibt es zwei Herbste. Der erste kommt Anfang August, als die Bäume vor lauter Hitzestress ihre Blätter abwerfen. Eichen und Buchen stehen kahl. Der glänzende Asphalt schmilzt auf den Gehwegen und klebt wie schwarzes Kaugummi an unseren Sohlen. Jeder neue Tag bringt das gleiche altbekannte Wetter. Wir tragen die Hitze wie eine Rüstung.
Den Flüssen geht es am schlechtesten. Der Po dörrt zu einem Tümpel aus. Manche Abschnitte des Rheins sind für die flachen Kähne, die in Deutschland den Warenfluss in Bewegung halten, nicht mehr befahrbar. In Westkanada werden laichende Lachse in den Kiesbetten bei lebendigem Leib gekocht. An den Ufern des Jangtse in Sichuan setzen Eltern ihre kleinen Kinder in Wassereimer, damit sie keinen Hitzschlag erleiden. Im Grenzgebiet von England und Wales vergiftet das Abwasser riesiger Hühnerfarmen das träge Wasser des Wye.
Im Radio heißt es: Die Quelle der Themse hat sich fünfzehn Kilometer flussabwärts verlagert.
Während die Wasserstände weltweit sinken, kommt immer mehr Verborgenes an die Oberfläche, oft Erstaunliches: buddhistische Statuen aus dem Mittelalter, der 100 000 Jahre alte Schädel eines Hirsches und an den Ufern des Tigris im heutigen Irak eine bronzezeitliche Stadt. Archäologen eilen zur Fundstelle, laufen durch die sonnengetränkten Straßen der einstigen Stadt und kartografieren sie. Sie finden fünf Keramikgefäße, die über hundert ungebrannte Tontafeln mit Schriftzeichen enthalten, und staunen, dass die Texte unter Wasser so lange überdauern konnten.
Der Lake Mead am Colorado River schrumpft tief in sein Bett aus Sandstein hinein, bis seine Ufer von den millionenschweren Schnellbooten gepflastert sind. Geister aus längst vergangenen Zeiten tauchen auf: ein verwester Mensch, der mit einem Schuss getötet und in ein 200 Liter fassendes Stahlfass gestopft wurde, an den Füßen Turnschuhe aus den 1980er-Jahren. Sechs weitere menschliche Überreste werden freigelegt, eine Leiche hält man zunächst für das Skelett eines Dickhornschafs. Im nahe gelegenen Death Valley filmen sich Männer, wie sie Eier auf den sonnenheißen Motorhauben ihrer Lamborghinis braten, um das Video anschließend gewinnbringend im Internet zu posten.
Entlang der Elbe tauchen die Hungersteine auf: große Brocken im Fluss, die sichtbar werden, wenn die Wasserstände zum Verzweifeln sinken. Jahreszahlen und Inschriften aus früheren Dürrejahren sind in sie gehauen: 1417, 1473, 1616, 1830. Nahe Děčín, an der tschechisch-deutschen Grenze, erhebt sich ein Stein mit der Mahnung aus dem Wasser: »WENN DU MICH SIEHST DANN WEINE.«
Eines Tages gehe ich nach langer Dürre mit meinem jüngsten Sohn Will zu den Quellen hinauf.
Ich weiß, was wir dort vorfinden werden, und verstehe nicht so recht, warum wir hingehen, aber ich fasse Will an den Händen und überquere mit ihm die Schwelle zwischen dem heißen Licht der Felder und der Kühle des Waldes.
Nachtschatten, Elstergackern. Fliegen ziehen wieder und wieder dieselben Lettern in schwebende Sonnenflecken.
Die Quellen sind nahezu versiegt. Die übermäßige Entnahme von Grundwasser und mehrere trockene Sommer haben ihre Vorarbeit geleistet – jetzt gibt die Dürre ihnen den Rest. Der Wasserstand in der größten Senke ist so niedrig wie noch nie, die Mulde verstopft mit stinkendem Laub. Nicht einmal mehr daumentief ist das Rinnsal, das von den Quellen fortführt, und es zeigt keine wahrnehmbare Strömung.
»Ist das Wasser tot?«, fragt Will. Er ist erst neun Jahre alt. Der Anblick schmerzt ihn. Er versteht, dass hier etwas nicht stimmt, ganz und gar nicht stimmt, kann es aber nicht benennen. Etwas im Hinblick auf die alte Kraft des Ortes und seine jüngste Versehrung bekümmert ihn.
»Nein, natürlich nicht«, sage ich, doch meine Gewissheit ist gespielt.
Als wir den Wald verlassen, sehen wir einen Reiher, weiß wie eine Scheibe aus Schnee, der reglos im erschöpften Bachbett steht, als könnte er allein kraft seiner Geduld das Leben des Wassers zurückholen.
Einleitung
Anima
Wir suchen nach den Booten, die wir vergessen haben zu bauen.Barry Lopez (2022)5
Dieses Buch erkundet den weltverändernden Gedanken, dass Flüsse Lebewesen sind.
Es lässt uns Geschichten, Menschen, Orte und Zukünfte dieser und ähnlicher Ideen entdecken, etwa dass ein Wald denkt oder ein Berg sich erinnert. Es fragt danach, was passiert, wenn wir Flüsse ernsthaft als lebende Wesen anerkennen. Was würde dieses Verständnis für Politik und Gesetzgebung bedeuten? Sind Flüsse Lebewesen? unternimmt den Versuch, Wasser neu zu denken.
Wir werden in diesem Buch drei Landschaften bereisen. Zuerst einen ecuadorianischen Nebelwald, den Los Cedros (»Zedernwald«), in dem das Quellgebiet des Río Los Cedros (»Fluss der Zedern«) liegt. Dann die versehrten Bäche, Lagunen und Buchten der Wasserstadt Chennai in Südostindien. Und zuletzt die Weite von Nitassinan, der Heimat der Innu, durch die der Mutehekau Shipu verläuft, auch bekannt als Magpie River, bis er sich knapp tausend Kilometer nordöstlich von Montréal in den Sankt-Lorenz-Golf ergießt.
An allen drei Orten wurde der »Naturvertrag«6, wie der Philosoph Michel Serres ihn nennt, auf revolutionäre Weise neu gedacht. Flüsse werden demnach in grundlegender Weise als eigenständige Lebewesen verstanden – und zugleich ist das Überleben der Flüsse in allen drei Fällen ernsthaft gefährdet: in Ecuador durch Bergbau, in Indien durch Verschmutzung und in Nitassinan durch Staudämme.
»Wasser spricht«7, sagte die schottische Schriftstellerin Nan Shepherd. Aber was sagt es? Auf allen meinen Reisen stellte ich den Menschen diese Frage: »Was sagt der Fluss?« Eine elementare Frage, die uns seit Urzeiten begleitet. Die Antworten, die ich bekam, waren schön, kryptisch, verstörend und erhellend. Allen gemein ist das Zugeständnis, dass wir in einer vielstimmigen Welt leben, in der jedoch den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern – menschlichen wie nicht-menschlichen – das Sprechen verwehrt bleibt.
Stumm gehalten zu werden, ist etwas anderes, als zu schweigen, nicht angehört zu werden etwas anderes, als sprachlos zu sein. Keine Landschaft spricht mit nur einer Stimme.
Ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass dieses Buch mit den Flüssen geschrieben wurde, die nun durch seine Seiten fließen, dem Río Los Cedros, dem Adyar, dem Cooum und dem Kosasthalaiyar, dem Mutehekau Shipu, dem mächtigen Sankt-Lorenz-Strom und dem klaren, namenlosen Bach, der einen Kilometer hinter meinem Haus im Nine Wells Wood entspringt und der auf den folgenden Seiten den Rhythmus vorgibt. Sie alle sind meine Co-Autoren.
Als ich einmal morgens meinen Sohn Will zur Schule brachte, fragte er mich, wie mein neues Buch heißen wird. »Sind Flüsse Lebewesen?«, antwortete ich. »Hm, Papa, das wird ja ein kurzes Buch«, sagte er, »denn die Antwort ist Ja!«
Wahrscheinlich wussten wir alle schon einmal, dass Flüsse Lebewesen sind. Als Kinder erkunden wir das »Leben um uns herum« – im Sinne des alten lateinischen Wortes vividus, das so viel wie »beseelt, lebendig, voller Leben« bedeutet. Kleine Kinder leben instinktiv in einer Welt voller geschwätziger Bäume, singender Flüsse und gedankenvoller Berge. Deshalb gibt es auch in vielen Kinderbüchern – etwa in Märchen und Sagen, über Jahrhunderte und Sprachen hinweg – ganz selbstverständlich sprechende, lauschende, gesellige Landschaften.
In der englischen Wasserwirtschaft werden Flüsse, Bäche und Seen als »waterbodies« bezeichnet, für uns Briten haben Gewässer also einen Körper. Zu den 40 000 erfassten Wasserkörpern in England, Wales und Schottland müssten wir allerdings noch 65 Millionen hinzuzählen, da auch jeder Mensch ein Wasserkörper ist. Wasser fließt in und durch uns. Bewegen wir uns fort, sind wir Flüsse. Wenn wir sitzen, sind wir Tümpel. Unser Gehirn und unser Herz bestehen zu drei Vierteln aus Wasser, unsere Haut zu zwei Dritteln. Sogar in unseren Knochen findet sich Wasser. Wir schwimmen, noch bevor wir laufen können, drehen uns wie Freitaucher langsam im dunklen Floating-Becken der Gebärmutter.
In vielen Städten werden überbaute Bäche und Flüsse wieder »ans Licht gebracht«, die zuvor in Kanäle oder Tunnel gezwängt waren und unsichtbar im Dunkeln dahinflossen. Die weggesperrten Wasserläufe heißen mancherorts auch »Geisterflüsse«. Ihre Stimmen vernehmen wir allenfalls noch als leises Flüstern, das durch Gullydeckel oder Abflussgitter zu uns aufsteigt.8
In London gibt es über zwanzig solcher Geister. Viele Menschen laufen jahrelang durch Londons Straßen, ohne zu ahnen, dass unter ihnen, unterm Asphalt, ein Fluss verläuft. Nördlich der Themse durchqueren auch Fleet, Moselle, Walbrook, Tyburn und Westbourne die Stadt, während es südlich von ihr Quaggy, Peck, Neckinger, Effra, Falconbrook und einige andere sind, die überwiegend unter Beton und in Röhren eingesperrt wurden. Auf der berühmten »Viele Map« von New York aus dem Jahr 1865 sind die Quellen, Wasserläufe und Sumpfgebiete auf der Insel Manhattan verzeichnet. Die Karte zeigt New York als die Wasserstadt, die sie einst war. Der West Broadway: ein Feuchtgebiet. Am Madison Square Garden flossen drei Bäche zusammen wie die Zinken eines Dreizacks, bevor sie in Mäandern vereint davonzogen. Der Bach Minetta floss von der Fifth Avenue Ecke 20th Street über den Washington Square bis zu seiner sumpfigen Mündung im heutigen Greenwich Village.
Dank der Renaturierung kommt das Wasser einst begrabener Flüsse endlich wieder ans Tageslicht. Geisterflüsse werden zum Leben erweckt, und wir begegnen ihnen wie alten Freunden oder alten Bewohnern unserer Stadt. Wo Flüsse ans Licht zurückgeholt wurden, hatte zuvor meist ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden. Nachdem in Seoul der Cheonggyecheon von der Autobahn befreit wurde, die ihn verdeckt hatte, lockt nun die an seinem Ufer entstandene öffentliche Parkanlage täglich 90 000 Menschen zum Spazierengehen. Im Sommer ist es in Wassernähe bis zu fünf Grad kühler als in der Umgebung, die Luftverschmutzung ist am Flussstreifen um über ein Drittel niedriger. Auch in Seattle, Yonkers, Singapur, San Antonio und vielen anderen Städten der Welt wurden Flüsse und somit Stadtviertel wiederbelebt. Als die Stadt München in einer visionären urbanen Neugestaltung die blaue Isar aus der Flutmulde befreite, in die sie zuvor geleitet worden war, und ihr ein breites Flussbett zurückgab, veränderte sich damit das gesamte Stadtbild. Heute schnellen im Schatten von Weiden an seichten Stellen Äschen vorbei. Saftige Auen säumen das Kiesufer mit seiner bewegten Kontur, an dem sich die Menschen treffen, spazieren gehen, reden, sich ausruhen, träumen und in Sonne und Fluss baden. Doch nicht die Stadt hat dem Fluss zu neuem Leben verholfen, vielmehr hat der Fluss die Stadt belebt.9
Ich möchte in diesem Buch althergebrachte Gedanken und Gefühle zum Wasser zurück ans Licht holen, die in der Geschichte und in uns selbst verborgen liegen, und ergründen, was es bedeutet, wenn wir Flüsse als lebende Wesen betrachten – die folglich auch getötet werden können.
Wenn es Ihnen schwerfällt, einen Fluss als Lebewesen zu betrachten, können Sie sich auch einen toten oder sterbenden Fluss vorstellen. Das macht es vielleicht einfacher.
Wir wissen, wie ein sterbender Fluss aussieht und was der Anblick mit uns macht. Ein sterbender Fluss verendet, noch ehe er das Meer erreicht. Die Fische treiben rücklings in Gumpen ohne Strömung. Im Oberlauf der Themse haben Schwäne auf ihren weißen Brustfedern braune Flutmarken von den Abwässern, durch die sie hindurchkamen. In den 1930er- und 1940er-Jahren war der Don in Toronto von den Raffinerien an seinen Ufern so stark mit Öl verseucht, dass er zweimal in Brand geriet.10 Und der Ontario-See war in den 1990er-Jahren chemisch derart verunreinigt, dass sich in einem Eimer Wasser, den man dort geschöpft hatte, Fotonegative entwickeln ließen.11 Im Herbst 2023 wurde für den Lough Neagh, das größte Gewässer Nordirlands, eine Totenmesse abgehalten: Schwarz gekleidete Trauergäste trugen einen Sarg ans Ufer des Sees, dessen Wasser zum Himmel stank und durch giftige Algenblüten schon Hunde das Leben gekostet hatte.
Flüsse sollten nicht brennen, Seen keine Totenmesse brauchen. Wie konnte es so weit kommen?
Der US-amerikanische Geologe, Anthropologe und Ethnologe William John McGee schrieb 1909: »Die Eroberung der Natur, die mit der fortschreitenden Nutzung des Bodens und seiner Erzeugnisse begann und sich alsdann auf Minerale ausweitete, findet fortan auch im Wasser auf, über und unter der Erdoberfläche statt. Diese Eroberung wird erst vollendet sein, wenn alles Wasser vollständig unter unserer Herrschaft steht.«12
In den gut einhundert Jahren, seitdem sich McGee der »Eroberung« allen Wassers auf Erden anzunehmen gedachte, hat sich sowohl die Verwaltung als auch das grundlegende Verständnis der Flüsse verändert. Die vielen verschiedenen Wesensarten fließender Gewässer wurden auf den Begriff »Fluss« im Sinne eines grenzenlosen Quells und grenzenlosen Auffangbeckens reduziert: ein Objekt, das gibt und nimmt, wie wir es wollen. Die Unterscheidung zwischen »Lebendigem« und »Nicht-Lebendigem«, die darin ihren Anfang fand, entstand unter einer Weltanschauung, die Flüsse ohne großes Federlesen dem »Nicht-Lebendigen« zuordnete. Für Menschen, die wie ich im Rationalismus aufgewachsen sind, ist es schier unmöglich, sich vorzustellen, dass Flüsse über die Summe der in ihnen lebenden Wesen hinaus belebt sein könnten. Dafür müssen wir alte Denkmuster verlernen, was uns ungleich schwerer fällt, als neue zu erlernen. Man könnte sagen, der Rationalismus hat die Flüsse eindimensional gemacht.13 Er sprach ihnen systematisch jeden Geist ab und reduzierte sie, wie Isaac Newton es formulierte, auf einen »unbelebten Rohstoff«.14
Seitdem der Mensch versuchte, die Bewegungen des Wassers zu kontrollieren – wie erstmals im großen Maßstab vor über 5 000 Jahren am Mittellauf des Jangtsekiang –, beschleunigte sich diese Entwicklung im 19. Jahrhundert durch die Erfindung von Stahlbeton (1849) und Dynamit (1867) rasant. Viele Flüsse wurden damit in den »Bestand«15 überführt, wie Heidegger es nannte. Was er damit meinte, erklärt dieses Beispiel: Für Hölderlin sei der Rhein ein Quell der Inspiration gewesen, in seinen Versen habe der Strom noch seine eigene Persönlichkeit und Handlungsmacht besessen. Sobald aber ein »Wasserkraftwerk in den Rheinstrom gestellt« worden sei, hätten wir selbst den mächtigen Rhein unserem Befehl unterworfen, schrieb Heidegger. In seinem Essay Die Frage nach der Technik verändert der Wasserbau – trotz aller Wunder, die er vollbringt – unser Verhältnis zum Fluss auf grundlegende Weise. Aus einem autonomen, lebendigen Wesen wird ein unterworfener Sklave. Diese infrastrukturelle Neudeutung des Flusses stehe symbolisch für die noch weit umfassenderen Folgen der Technokratie, die »der Natur als einem berechenbaren Kräftezusammenhang nachstellt«16. Nichts ist an und für sich gut. Alles muss für etwas gut sein. Der Fluss wird in seiner Identität eingedämmt und seine Bedeutungsbreite verkleinert, bis nur noch Kategorien wie Strömungsmenge oder Wattleistung übrig sind.
In der Drei-Schluchten-Talsperre im Jangtsekiang wurden derart große Mengen Wasser aufgestaut, dass sich die Erdrotation dadurch messbar verlangsamt hat. Inzwischen gibt es allein im Einzugsgebiet des Jangtsekiang 50 000 Staudämme. Europa ist der Kontinent mit dem am stärksten bebauten Flusssystem der Welt, über eine Million Sperren behindern hier den natürlichen Wasserfluss, frei fließende Gewässer gibt es nur noch eine Handvoll.17 Wer das neun Kilometer lange Oosterscheldekering-Sperrwerk in den Niederlanden – ein wahres Königreich gigantesker Wasserregulierung – bis zum Ende abläuft, findet dort in den Beton geritzt die Worte: hier gaan over het tij, de wind, de maan en wij: »Die Gezeiten steuern hier der Wind, der Mond und wir«.18 Viele Staudämme haben den Menschen ungeahnte Blütezeiten ermöglicht und ihr Überleben gesichert. Sie haben ganze Städte mit Strom versorgt, den Durst von Milliarden gestillt und wurden von den unterschiedlichsten Personen als Symbol der Hoffnung besungen und bejubelt: von Jawaharlal Nehru über Woody Guthrie bis Josef Stalin.
Aber Begriffe und Zuschreibungen können sich ebenso aufstauen wie Wasser, sie können sich hinter den Staumauern des Denkens sammeln und dort hängen bleiben. So steht der Begriff »Fluss« fortan für »Dienstleister«, und seine Identität wird in unseren Köpfen sowie in der realen Welt in Beton gegossen. Wir alle sind wasserundurchlässig geworden, begrifflich versiegelt gegen nuancierte Beziehungen zu den Flüssen, wenngleich sie nach wie vor unsere Gedanken, Körper, Lieder und Geschichten durchziehen. Flüsse fließen nicht nur durch Landstriche, sondern eben auch durch Menschen.
Einer der vielen Tricks der Moderne besteht darin, die Vorläufigkeit ihrer Grundannahmen zu verbergen. Wir halten es für selbstverständlich, dass wir Flüsse für selbstverständlich halten. Es scheint keiner Erwägung wert, dass fließendes Süßwasser einen Besitzer haben könnte – dass es privatisiert und verkauft und damit auf einen flüssigen Vermögenswert reduziert wird – oder dass jemand den Zugang zu einem Flussufer einschränkt oder gar verbietet, anstatt es als eine blaue Allmende zu sehen. Inzwischen gilt es als vollkommen normal, dass ein Unternehmen vor dem Gesetz eine Rechtspersönlichkeit ist, mit gesetzlichem Status und Rechten, zum Beispiel dem Recht zu klagen, dass aber ein Fluss, der seit Tausenden von Jahren über die Erde fließt, derlei Rechte nicht hat.
Unsere Flüsse werden von der Logik der Verdinglichung und des Gewinns definiert. Es braucht starke Kräfte, um ältere, vielschichtige Zuschreibungen aus dieser Beschlagnahme zu befreien und unsere Beziehung zu den geheimnisvollen großen Wesen, mit denen wir die Welt teilen, neu aufleben zu lassen. Ein berühmter Satz des Wirtschaftswissenschaftlers Erich Zimmermann lautet: »Ressourcen existieren nicht, sie werden gemacht.«19 Das heißt, was ver-dinglicht wurde, kann auch wieder ent-dinglicht werden.
In seinem ungewöhnlichen Bändchen H20 und die Wasser des Vergessens von 1985 untersucht der österreichische Kulturkritiker Ivan Illich, in welchem Maße wir Wasser »vergessen« haben. Er erzählt die Geschichte einer Entzauberung und Homogenisierung. Die komplexen sozialen und metaphysischen Bedeutungen seien vom Wasser abgespült worden, um es nurmehr auf eine »Reinigungsflüssigkeit« zu reduzieren.20 Illich bedient sich einer Metapher von einem Fluss mit negativem Einfluss und sagt, der Westen habe vom Lethe getrunken, jenem mythologischen Fluss der Unterwelt, der die Erinnerungen auslöscht und alle Fantasie damit trockenfallen lässt.21
Mit einem markanten Bild entwirft Illich sodann ein mögliches Gegenmittel zum Gedächtnisschwund: »Folgt er dem Strom der Traumwasser flußaufwärts, so wird der Historiker das gewaltige Register ihrer Stimmen unterscheiden lernen.«22
Während die Lebendigkeit der Welt in immer weitere Ferne gerückt und zum »Rohstoff« reduziert wurde, verebbte auch zunehmend die Sprache, die anerkennt, dass Land und Wasser lebendig sind. Robin Wall Kimmerer nennt diese Sprache in einer schönen Wendung die »Grammatik der Lebendigkeit«23. Wir haben keine Sprache der Liebe mehr für unsere Flüsse.
Gelegentlich ist die beseelte Grammatik aber doch noch zu vernehmen – und schließt unser inneres Ohr auf. Im April 2021 richteten vier Frauen verschiedener indigener Gruppen in einem gemeinsamen offenen Brief die Bitte an Joe Biden, ihr heiliges Land zu schützen. Donald Trump hatte Bears Ears, ein Wüstengebiet in Utah, für Bohrarbeiten und Rohstoffabbau freigeben wollen. Die New York Times druckte den Brief mit dem Titel »Unsere Geschichten sind tief verwurzelt«, in dem es heißt:
Wir identifizieren uns mit diesem Land. Es ist lebendig. Wir kennen die Namen der Berge, Pflanzen und Tiere, die uns alles beibringen, was wir zum Überleben wissen müssen … Wir kennen dieses Land wie eine Mutter ihr Kind und ein Kind seine Mutter. Überall auf der Welt wissen die indigenen Frauen, wo die heiligen Quellen sind, wo sie die Pflanzen finden, die sie als Nahrung und Medizin brauchen, und wo die Tiere, die unsere Lehrerinnen und Lehrer sind.24
Im englischen Text heißt es »these lands who are alive«. Indem die Autorinnen »who« schreiben, zeigen sie an, dass ihr Land, die Flüsse, Bäume, Berge, Meere, Vögel und Tiere für sie keine Gegenstände sind – für sie nutzt man im Englischen die Pronomen »which« oder »that« –, sondern Personen. Land und Tiere werden nicht auf ihre Stofflichkeit reduziert und damit nicht vom Menschen unterschieden.
Ich möchte ebenfalls von Flüssen und Wäldern als Personen sprechen. Im Englischen gibt es kein Verb »to river«. Aber was könnte ein aktiveres Verb sein als »flussen«?
Eine Grammatik regelt die Beziehungen zwischen den Dingen. Der Begriff mag langweilig klingen, doch liegt in ihm große Macht: Im Mittelenglischen bedeutet »Grammatik« auch »Zauberei«. Ein »gramarye« war ein Buch mit Zaubersprüchen oder Hexenwerk. Eine echte Grammatik des Lebens könnte unserem Dasein wieder Zauber verleihen.
Wenn wir uns vorstellen, dass Flüsse Lebewesen sind, erhält das Wasser wieder einen neuen Glanz. Es entstehen ganz andere Möglichkeiten der Begegnung – und unsere Einsamkeit wird ein wenig zurückgedrängt. Wir verlieben uns »nach außen«, wie Robinson Jeffers es so wunderbar formuliert hat.25
In der Sprache der Māori kann man Fremde mit der Frage begrüßen: »Ko wai koe?«26, was wörtlich heißt: »Wo sind deine Wasser?« Meine Wasser sind der Dee, der auf dem Cairngorm-Plateau auf 1200 Metern Höhe, umgeben von Alpenschneehühnern und Schneeammern, im winterlichen Sonnenlicht aus dem Granit sprudelt, und jener namenlose Bach, der in einer Niederung am Fuße des White Hill entspringt.
Breiten Sie einmal vor Ihrem inneren Auge die Landkarte Ihres Landes auf. Stellen Sie sich nun vor, alles bis auf die Bäche und Flüsse sei geschwärzt, und lassen Sie die Gewässer in den lebendigsten Farben erstrahlen, in Blau und Grün, Scharlachrot und Violett. Eine neue Topografie eröffnet sich Ihrem Blick. Plötzlich besteht das Land aus einem stark verzweigten Adernetz. Bergkämme werden düster dahinwandernde Abwesenheit, die Einzugsgebiete der Flüsse sammeln Wasserfädchen und flechten sie geschickt zu Strängen und Seilen. Heben Sie nun die Karte an, und zoomen Sie hinein. Bei jedem Maßstabswechsel dasselbe Muster: fraktale Verästelungen von Zuflüssen und Rinnen, Farnwedel und Stämme wie ein Gefäßsystem. Oder ein Nervensystem.
Wir alle leben in Wassereinzugsgebieten.
In meiner englischen Heimat widerfuhr unseren Bächen und Flüssen eine schleichende, unentrinnbare Katastrophe. Bestehende Gesetze und Regularien vermochten unsere Wasserläufe nicht zu schützen. Und auch unser enges Verhältnis zu fließendem Wasser hielt das nahende Unheil, das unseren Gewässern drohte, nicht ab.
»Kollektive Wahrnehmungsverschiebung«27 heißt ein Phänomen, bei dem die fortdauernde Schädigung und Störung der Natur über viele Jahre hinweg irgendwann als normal angesehen wird, da jede neue Generation die Verluste an einer bereits geminderten Bezugsgröße misst. Eine Person, die in den 1970er-Jahren geboren wurde, erinnert sich vielleicht noch, dass in ihrer Kindheit nach einer langen Autofahrt auf der Windschutzscheibe unzählige Insekten klebten. Heute ist die Insektendichte deutlich geringer – doch wer ein Kind des frühen 21. Jahrhunderts ist, erkennt darin, da es die vormalige Überfülle nicht mehr selbst erlebt hat, keine drastische Abnahme der Populationen. »Generationelle Amnesie« wird dieser Effekt bisweilen auch genannt. Er ist ein wirkmächtiges Instrument, um die ständig fortschreitende Zerstörung der Umwelt zu verschleiern und zu legitimieren.
Auch das Sterben unserer Flüsse hat die kollektive Wahrnehmungsverschiebung kaschiert. Einst sauberes Flusswasser wurde gesundheitsgefährdend, und sogar das Schwimmen darin machte krank. Als wir endlich die Augen öffneten und die Katastrophe sahen, war es schon fast zu spät. Der Flussanwalt Feargal Sharkey sagt, es sei heute »schlicht ein Fakt, dass quasi alle Flüsse in England im Sterben liegen«28. Sie sterben durch unsere Unachtsamkeit, und ihre Tötung erfolgt in voller Absicht.
So muss es aber nicht sein. Kollektive Wahrnehmungsverschiebung kann auch in die andere Richtung stattfinden.29 Wir können Verbesserungen als genauso normal ansehen wie Verschlechterungen und uns weitere Verbesserungen wünschen: eine kollektive Wahrnehmungsverschiebung zum Besseren. Wir lassen den Film rückwärts abspielen und erschaffen eine Zukunft, in der es für künftige Kinder Normalität ist, dass Flüsse sauber sind und ungehindert fließen.
Flüsse sind leicht verwundbar. Doch werden sie in Ruhe gelassen, erholen sie sich auch wieder in ungeahnter Geschwindigkeit. Sehr schnell durchströmt sie neues Leben.
Als im US-Bundesstaat Washington der Damm am Unterlauf des Elwha im September 2011 – also einhundert Jahre nach dessen Errichtung – wieder entfernt wurde, fand der Fluss in atemberaubender Schnelligkeit zu neuem Leben zurück.30 Millionen Kubikmeter Sediment, die sich hinter dem Staudamm angesammelt hatten, wurden ins Mündungsdelta gespült, wo bald Kies- und Sandbänke entstanden, die die Küste vor Stürmen schützten und komplexe neue Habitate entstehen ließen. Auf dem trockengefallenen Grund des Stausees schoss bald ein junger Wald mit üppigem Unterholz auf: Schösslinge von Ahorn, Tanne und Zeder, breite purpurne Streifen von Lupinen, dazu Pappeln und Weiden. Schwarzbären und Pumas schlichen durchs Gesträuch und platschten durch den Fluss. Wasseramseln saßen wippend auf Steinen und wirkten in ihren eleganten Kleidern wie aufmerksame Kellner. Unterdessen ereigneten sich unter der Wasseroberfläche weitere Wunder. Da ihre Wege nicht mehr durch Staudämme verbaut waren, kehrten in das nun klare Wasser die Lachse zurück, zuerst einige Hundert, dann einige Tausend. Sie schwammen, schicksalhaft getrieben von ihrem uralten Instinkt, den Fluss hinauf, um am Oberlauf zu laichen und dann – beim großen, jährlichen Lachswanderspektakel, das wie eine griechische Tragödie verstört und betört – zu sterben.
Nachdem sich der Fluss den Lachs zurückgeholt hatte, kam mit ihm auch das ganze Geflecht des Lebens wieder, von dem er sich ernährt. Lachse sind eigentlich Meerestiere, sie tragen, wenn sie zum Laichen in die Flüsse kommen, Nährstoffe aus dem Meer tief ins Binnenland. Am Oberlauf des Elwha schleppten Aasfresser sterbende und tote Lachse in den Wald, fraßen das Fleisch und die Eingeweide und ließen die Gräten auf Moos und Laub gebettet verrotten. Pilze griffen mit ihren weißen Geisterfingern danach, zogen die Gräten zu sich in die Tiefe und zersetzten sie, um das nahrhafte Gut dann mit den Wurzeln der Bäume zu teilen. Durch die Mithilfe des Flusses nährte das Meer den Wald.
Auch die Menschen kehrten zurück, auf Wanderungen, Familienausflügen, Paddeltouren, Politikveranstaltungen – und weil ihre Vorfahren hier gelebt hatten. Mitglieder des Lower Elwha Klallam Tribe fanden sich ein, dessen heiliges Land vor hundert Jahren durch den Stausee geflutet worden war und der seit Langem für den Abriss der Staudämme gekämpft hatte. Per Hand verstreuten sie tonnenweise die Samen der einheimischen Pflanzen, die bald die Gebiete entlang des Elwha wieder begrünten.
Mehr als alles andere brauchen Flüsse Hoffnung.
Ideen wandern durch Raum und Zeit. Sie schwimmen wie Fische. Fliegen wie Pollen. Ziehen wie Vögel. Manchmal reisen sie auf diese Weise einmal um die ganze Welt und finden neue Nischen, in denen sie gedeihen.
Im Oktober 1971 hielt der noch junge Wissenschaftler Christopher Stone an der University of Southern California in Los Angeles ein Seminar zum sogenannten property law, dem Sachenrecht. Die Sitzung war anstrengend, am Ende waren die Studierenden erschöpft und unkonzentriert. Sie kauten an ihren Stiften und blickten zerstreut aus dem Fenster. Da versuchte Stone ein letztes Mal, ihr Interesse zu wecken. Und tatsächlich rüttelten seine Worte die Teilnehmenden wach – und seine Äußerung überraschte sogar ihn selbst.
»Wie würde«, begann er zögernd, »ein neues, juristisches Weltverständnis aussehen, bei dem … auch die Natur Rechte hätte. Ja, die Natur. Flüsse, Seen, Bäume, Tiere. Inwiefern würde ein solcher rechtlicher Status den Blick eines Gemeinwesens auf sich selbst verändern?«31
Die Studierenden waren empört! Ein Fluss sollte Rechte haben? Ein Wald eine juristische Person sein? Die dann mit lästigen Klagen vor Gericht zieht? Das wäre ja wohl ein Affront gegenüber all jenen Menschen, die keine Rechte haben. Und wer würde vor Gericht für einen Fluss sprechen – und woher wüsste man, was der Fluss genau will? Und wenn ein Fluss klagen darf, kann er dann umgekehrt auch verklagt werden, zum Beispiel wenn er ein Grundstück überflutet hat? Viele berechtigte Fragen waren das. Aber eines war sicher: Stone hatte ihre Aufmerksamkeit gewonnen.
Nach der Sitzung musste er lange darüber nachdenken. Woher war ihm diese Idee gekommen? Er hatte keine Ahnung. Aber er wusste, dass er es ernst gemeint hatte. Flüsse sollten Rechte haben. Ein Wald konnte eine juristische Person sein. Nur wusste er noch nicht, wie sich das bewerkstelligen ließe. Deshalb zückte er seinen gelben Notizblock und machte sich daran, die Idee auszuarbeiten.
Sie nahm schnell Gestalt an, zunächst in dem Essay »Haben Bäume Rechte?«32, den Stone 1972 verfasste und der heute als Meilenstein der Rechtswissenschaft gilt, dann in dem gleichnamigen Buch, das auch fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen noch nachgedruckt wird. Anfangs erntete seine Idee allerdings nicht nur Widerstand, sondern vor allem Spott und Hohn. Richter und Anwälte lachten ihn aus. Aber das war Stone gleichgültig. Er wusste, dass jeder umwälzend neue Gedanke eine Phase durchlaufen muss, in der er auf den Prüfstand gestellt wird. »Bei jeder Initiative, die irgendeiner neuen ›Entität‘ Rechte zusprechen will«33, heißt es in seinem Essay von 1972:
klingt der Vorschlag zuerst einmal befremdlich oder beängstigend oder lächerlich … teils weil wir das rechtlose Objekt, bevor es Rechte erlangt, eben nur als Objekt ansehen können, dessen »wir« – also jene, die bereits Rechte besitzen – uns bedienen.
Fast vierzig Jahre nachdem Stone den Gedanken erörterte, dass auch die Natur über Rechte verfügen müsse, stieß Jacinta Ruru, eine Rechtsgelehrte der Māori, auf sein Werk. Dabei bemerkte sie, dass Stones recht neue Idee, natürliche Entitäten könnten juristische Personen sein, mit der uralten Beziehung der Māori zu den Flüssen übereinstimmte: Für sie waren die Flüsse ihre lebenden, heiligen Urahnen.
2010 veröffentlichte Jacinta Ruru zusammen mit ihrem Studenten James Morris einen Artikel unter dem Titel »Giving Voice to Rivers« (Flüssen eine Stimme geben). »Indigene Menschen weltweit haben eine starke Verbindung zum fließenden Wasser in ihren Flüssen«34, lautet der erste Satz. Danach führen die beiden Stones Arbeit an und erklären die große Bedeutung der Fluss-Rechte für Aotearoa – wie Neuseeland in der maorischen Sprache heißt. »Unserer Ansicht nach ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, dieses Konzept im spezifischen Kontext unserer Flüsse anzuwenden«, schrieben sie. Dadurch könne »eine spannende Verbindung zwischen dem Rechtssystem der Māori und dem Rechtssystem des Staates entstehen«35:
Das Konzept der »juristischen Person« entspricht der maorischen Rechtsauffassung, in der die Naturwelt personifiziert ist. Gestehen wir dem Fluss ein Klagerecht zu, erkennen wir ihn mit seinem Mana (der Macht) und seinem Mauri (der Lebenskraft) als ganzheitliches Wesen an, statt die Entität in fließendes Wasser, Flussbett und Flussufer zu unterteilen.
Nur sieben Jahre später fand die Synthese von Morris und Ruru in einem bemerkenswerten Gesetz Einzug in die offizielle Rechtsprechung: Am 20. März 2017 wurde der Te Awa Tupua Act im Parliament House in Wellington verabschiedet, umrahmt von Liedern, Tanz und Freudentränen. Gegenstand des Gesetzes ist der Fluss Whanganui, der sich als Schmelzwasser auf den schneebedeckten Hängen dreier Vulkane auf der Nordinsel sammelt und dann fast 300 Kilometer weit durch Regenwald, Schluchten und Buschland fließt, bis er bei dem Ort Whanganui in die Tasmanische See mündet. Dem Gesetz zugrunde liegt eine radikale Behauptung: dass der Whanganui ein lebendiges Wesen und ein Urahn der Gemeinschaft der Whanganui Iwi ist. Der Fluss wird darin auf unmissverständliche Weise als ein »unteilbares lebendes Wesen« und als »eine spirituelle und physische Entität« mit eigener »Lebenskraft« bezeichnet.36
Ein Wort taucht in der Beschreibung des Flusses immer wieder auf, und dasselbe Wort benutzen auch Morris und Ruru immer wieder: Mauri (oder Mouri), ein kraftvoller Begriff, der so viel wie »Lebensprinzip, Wesenskern alles Lebendigen, wesentliches Merkmal und Kraft eines Wesens oder einer Entität«37 bedeutet. Diesem Begriff am nächsten kommt im Englischen wohl das Wort »anima«, im Sinne von »Atem- oder Windhauch, Lebensprinzip, Leben, Seele«, aus dem die Wörter »animal« (Tier), »animate« (belebt), »animism« (Animismus) und »animus« im Sinne von »Geist« hervorgegangen sind.
Der Gesetzestext erklärt außerdem, sein Gegenstand sei »der Whanganui von den Bergen bis zum Meer, einschließlich all seiner physischen und metaphysischen Elemente«. Ist das nicht eine anrührend weit gefasste Definition für einen Fluss? So wie ein Baum nicht nur aus seinem Stamm besteht, sondern auch aus den Ästen, Blättern, Wurzeln und den Lebewesen, die auf ihm und durch ihn existieren, wird auch hier anerkannt, dass Flüsse nicht nur aus einem zentralen Flusslauf bestehen, sondern dass Quellen, Zuflüsse, Schwemmflächen und Mündung ebenfalls dazugehören – und außerdem das Leben und die Gesundheit der menschlichen und nicht-menschlichen »Flussgemeinschaften«, wie es im Gesetzestext heißt, die in seiner Umgebung leben und deren Wohlergehen mit dem des Flusses korrespondieren. Ko au te Awa; ko te Awa ko au, besagt eine Redensart der Whanganui, die im Gesetz zitiert wird: »Ich bin der Fluss; der Fluss ist ich.«38
Neben der Anerkennung des Flusses als eigenständigem Lebewesen gibt es aber noch einen zweiten bewegenden Aspekt: Der Fluss wird als »juristische Person« definiert, das heißt, er kann selbst vor Gericht gehen und besitzt auch eigene Rechte – etwa das Recht, ungehindert und unverschmutzt zum Meer zu fließen, oder das Recht auf Selbstentfaltung. Zudem werden Flusswächter benannt, die Te Pou Tupua, die das »menschliche Gesicht« des Flusses sein sollen. Ihre Aufgabe und Pflicht ist es, mit und für den Fluss zu sprechen, seine Lebenskraft zu stärken und zu schützen.
Dem Te Awa Tupua Act voran ging eine an die 180 Jahre währende Auseinandersetzung zwischen der britischen Krone und den Whanganui Iwi über die Land- und Wasserrechte, der die Unvereinbarkeit ihres jeweiligen Verständnisses von Flüssen zugrunde lag.
Die britische Krone vertrat ein utilitaristisches Verständnis, sie hat den Whanganui immer schon als Ressource und Leistungsträger angesehen, der vom Staat nach Belieben genutzt und ausgebeutet werden darf. Zu diesem Zweck wurde der Fluss in seine einzelnen kommodifizierbaren Elemente unterteilt: Bett, Ufer, Wasser, Fische und Gestein. Nachdem ihn die britische Krone im 19. Jahrhundert in ihren Besitz genommen hatte, war er entwaldet, verschmutzt, umgelenkt, ausgepumpt und streckenweise gesprengt worden, bis er zu Anfang des neuen Jahrtausends schließlich kaum mehr als ein krankes, schwächliches Rinnsal war.
Dagegen steht das Verständnis der Whanganui Iwi. »Wir wollen mit der Einsicht beginnen, dass Flüsse Lebewesen sind, und ausgehend von dieser Überzeugung über ihre Zukunft nachdenken«39, sagte Gerrard Albert, der Verhandlungsführer der Whanganui Iwi. »Wir haben für eine gesetzliche Angleichung gekämpft, damit alle Menschen verstehen, dass der Fluss aus unserer Sicht wie eine lebende Entität zu behandeln ist, als ein unteilbares Ganzes, und dass er nicht wie im traditionellen Modell aus dem Blickwinkel von Eigentum und Bewirtschaftung betrachtet werden darf.«
Der Te Awa Tupua Act schallte wie ein Gongschlag über den gesamten Erdball. Die Tatsache, dass ein »großer Fluss« auf der höchsten Gesetzesebene einer modernen Demokratie als ein »Lebewesen« anerkannt wird, das eigene Rechte hat, beflügelte weltweit die Fantasie der Menschen.
Und sie gab dem revolutionären Ideenstrom, der heute in die »Bewegung für die Rechte der Natur« gemündet ist, einen belebenden Impuls.
Es gibt wenig Wirkmächtigeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Bewegung für die Rechte der Natur hat in den vergangenen zwanzig Jahren – angetrieben durch die ökologische Notlage – immer wieder neue Formen der Zukunftsträumerei gefunden, hat auf unsere Vorstellungskraft wie auf die Gesetzeslage eingewirkt und einigen überalterten Irrglauben entkräftet.
Rund um den Globus wurden Fälle vor die Gerichte gebracht, um die anthropozentrische Grundhaltung der bestehenden Gesetzeslage auf den Prüfstand zu stellen, und die vielen Versuche, Flüssen, Bergen und Wäldern zu neuem Leben, zu Rechten und zu einer Stimme zu verhelfen, haben immer mehr Aktivistinnen, Gesetzgeber, Politikerinnen, Künstler und Vorkämpferinnen auf den Plan gerufen. Bahnbrechende Ideen kamen dabei oft »von unten«40, wie Gustavo Esteva es nennt: von »Graswurzelbewegungen, die die Welt im Hier und Jetzt verändern«41, vor allem lokalen Gruppen und indigenen Gemeinschaften, die der drohende Verlust ihrer Natur zum Protest getrieben hat. Viele Aktionen wurden von Frauen initiiert, die ein ums andere Mal als Anführerinnen in die Schlacht zogen.
Inzwischen stehen die Flüsse im Mittelpunkt der Bewegung. In Dutzenden Ländern weltweit bilden »Flussrechte« die häufigste Form neuer Rechtssubjektivität, von Australien und Kanada über Bolivien bis Kolumbien. In Bangladesch veranlasste die Justiz die Schließung von 231 nicht genehmigten Fabriken, da diese die Rechte des Buriganga verletzten. In England sprach ein Gemeinderat in Sussex dem Fluss Ouse eigene Rechte und den Status einer juristischen Person zu. Und es wurde eine »Universal Declaration of River Rights« aufgesetzt – eine universelle Flussrechteerklärung –, in der Flüsse als lebende Entitäten mit fundamentalen Rechten anerkannt werden, darunter dem »Recht, zu fließen« und dem »Recht, nicht verschmutzt zu werden«.42
Dass Flüsse im Mittelpunkt dieses weitreichenden neuen Denkens stehen, ist nicht verwunderlich. Als eigenwillige, kraftvolle, verehrte und misshandelte Wesen waren sie lange Zeit im Grenzbereich zwischen Geologie und Theologie verortet. Sie schenken uns lebenskluge Metaphern und widersetzen sich allen Versuchen einer allzu eindeutigen Zuschreibung. Flüsse sind mächtige Wesen, so ungebärdig, ungreifbar und radikal anders, dass sie uns Wasser anders denken lassen. Niemals werden wir wie ein Fluss denken können, aber wir werden vielleicht mit einem Fluss denken können.
Die Bewegung für die Rechte der Natur ist in meinen Augen in ihrem Wesenskern eine juristische »Grammatik der Belebtheit« und mithin der Versuch, Machtstrukturen mit einer Wahrnehmung der Welt vereinbar zu machen, in der sich viel mehr Lebewesen finden, als die Mächtigen für gewöhnlich zulassen. »Das Gesetz«, sagt die Gelehrte und Aktivistin Anne Poelina, eine Nyikina Warrwa (australische Erstbewohnerin), »wird auf kreative Weise genutzt, um Menschen dazu zu bringen, Flüssen zuzuhören, sich ihnen zuzuwenden und von ihnen zu lernen.«43 Die Rechte der Natur anzuerkennen, ist eine Möglichkeit, um eine andere Geschichte von der lebendigen Welt zu erzählen: eine sehr alte Geschichte in neuem Gewand. Eine Geschichte, in der die Welt »endlich keine Maschine« mehr ist, wie D. H. Lawrence es formuliert hat, sondern »gesund und munter«.44
Am Tag der Sommersonnenwende des sehr warmen und trockenen Sommers 2022 stand ich mit etwa einhundert Menschen am Ufer des Cam, der durch meine Heimatstadt fließt und von den Quellen gespeist wird, die in der Nähe meines Hauses entspringen. Das Licht war an diesem heißen Nachmittag zähflüssig golden, das Gras nach wochenlanger Dürre strohtrocken. Staub hing in der Luft, und alle konnten sehen, dass der Fluss krank war. Der Schweiß kroch über unsere Gesichter, der Fluss kroch ölig dahin. Dürre Pflanzen trieben wie Haarsträhnen im Wasser.
Gemeinsam verlasen wir eine Erklärung der Flussrechte des Cam – so als würden seine Rechte allein durch den Akt des Sprechens in Kraft treten: »Hiermit erklären wir, dass der Cam und alle seine Zuflüsse das Recht haben, ungehindert zu fließen und vor übermäßiger Wasserentnahme und Verschmutzung geschützt zu werden …«, und mitten im Text kam plötzlich ein Moment, an dem ich nicht mehr weiterlesen konnte, überwältigt von einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Ein ungekanntes Gefühl, das mich mit einer solchen Macht überkam, dass ich nicht mehr sprechen konnte.
Seit jeher ist das Schicksal der Flüsse auch unser Schicksal.