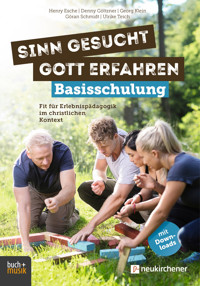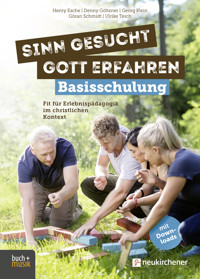
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Praxisverlag buch+musik bm gGmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Erlebnisse und Erfahrungen prägen das Menschsein. Deshalb ist Erlebnispädagogik eine wichtige Form des Lernens. Erlebnispädagogik im christlichen Kontext geht noch weiter. Sie hilft Menschen, das Evangelium zu erleben. Angst und Vertrauen, Gerechtigkeit und Verantwortung, Zweifel und Hoffnung können den Blick zu Gott hin öffnen – auch im Alltag. Die Basisschulung aus der bekannten Reihe "Sinn gesucht – Gott erfahren" erklärt, wie die Anwendung von Erlebnispädagogik im christlichen Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelingen kann. Hauptamtliche und Ehrenamtliche erhalten das nötige Praxiswissen, um erlebnispädagogische Übungen so anzuleiten, dass sie einen Zugang zum Glauben schaffen können. Dieses Buch enthält alle Schulungsinhalte, kompakt verteilt auf 4 Tage. Lernimpulse vermitteln die Inhalte und Übungen setzen diese in Erlebnis und Erfahrung um. Ein Handbuch für die Durchführung einer Schulung. Ein Begleitbuch für die Teilnahme an einer Schulung. Ein Praxisbuch für die persönliche Fortbildung. – Eine Basisschulung für alle, die bei Freizeiten und in Gruppen durch erlebnispädagogische Übungen die Erfahrung ermöglichen wollen: "Guck mal, so ähnlich ist das auch bei Gott!" "Die Autorin und Autoren haben ein fundiertes Theorie- und Praxiswerk entwickelt, das einen praxistauglichen Leitfaden für eine qualitativ hochwertige Basisschulung Erlebnispädagogik gibt." (Stefan Westhauser, Leitung Institut für Erlebnispädagogik der CVJM-Hochschule)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Esche | Denny Göltzner | Georg Klein | Göran Schmidt | Ulrike Teich
Sinn gesucht – Gott erfahren Basisschulung
Fit für Erlebnispädagogik im christlichen Kontext
Praxisverlag buch+musik bm gGmbH
In unseren Veröffentlichungen bemühen wir uns, die Inhalte so zu formulieren, dass sie allen Menschen gerecht werden, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen, wo alle gemeint sind, oder dass ein Geschlecht spezifisch genannt wird. Nicht immer gelingt dies auf eine Weise, dass der Text gut lesbar und leicht verständlich bleibt. In diesen Fällen geben wir der Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes den Vorrang. Dies ist ausdrücklich keine Benachteiligung einzelner Geschlechter.
Die im Titel enthaltenen Bibeltexte sind i. d. R. zitiert aus Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Für in diesem Titel enthaltene Links auf Websites/Webangebote Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns deren Inhalt nicht zu eigen machen, sondern sie lediglich Verweise auf den Inhalt darstellen. Die Verweise beziehen sich auf den Inhalt zum Zeitpunkt des letzten Zugriffs: 05.05.2025
Dieser Titel ist entstanden in Zusammenarbeit mit Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, Evangelische Landeskirche in Baden, Evangelische Gemeindejugend in Baden, Projektgruppe Erlebnispädagogik des CVJM Deutschland.
Impressum
© 1. Auflage 2025 Praxisverlag buch+musik bm gGmbH, Stuttgart 2025 All rights reserved.
Praxisverlag buch+musik bm gGmbH Haeberlinstraße 1–3, 70563 Stuttgart, [email protected] www.praxisverlag-bm.deISBN Buch 978-3-86687-407-7 ISBN E-Book 978-3-86687-408-4
Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH Andreas-Bräm-Str. 18/20, 47506 Neukirchen-Vluyn, [email protected] www.neukirchener-verlage.deISBN Buch 978-3-7615-7086-9 ISBN E-Book 978-3-7615-7087-6
Lektorat: buch+musik – Dorothea Zarbock, Gießen Umschlaggestaltung: buch+musik – Toby Wolf, Stuttgart Satz: buch+musik, Stuttgart – unter Verwendung von parsX, pagina GmbH, Tübingen Satz Downloads: buch+musik – Toby Wolf, Stuttgart Bildrechte Umschlag: Tyler Olson/stock.adobe.com; Westhauser: CVJM-Hochschule, 2023 Bildrechte Illustrationen: Grafik+Illustration Simone Struve, Renningen Bildrechte Autorenfotos: Göltzner: Fruchsfotos, Erfurt; Teich: Jan-Paul Herr CVJM Karlsruhe; andere: beim Autor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Navigator durch Sinn gesucht – Gott erfahren Basisschulung
Einleitung – Erlebnisse und Erfahrungen
Einführung Erlebnispädagogik
Was ist Erlebnispädagogik und was will sie?
Einführung in die Erlebnispädagogik im christlichen Kontext
Schulungsaufbau und Schulungsablauf
Übersicht über die Gesamtschulung
Tag 1: Kooperation
Übersicht über den Ablauf des Tages
Einführung zum ersten Tag
Kooperationsübungen Block I
Kooperationsübungen Block II
Kooperationsübungen Block III
Reflexion des Tages am Lagerfeuer
Tag 2: Kommunikation & Vertrauen
Übersicht über den Ablauf des Tages
Einführung zum zweiten Tag
Kommunikationsübungen
Vertrauensübungen Block I
Vertrauensübungen Block II
Reflexion des Tages am Lagerfeuer
Tag 3: Erlebnispädagogik als Brücke zum christlichen Glauben
Übersicht über den Ablauf des Tages
Einführung zum dritten Tag
Den Schöpfer in der Schöpfung entdecken
Jesus an meiner Seite entdecken
Den Heiligen Geist in mir entdecken
Tag 4: Skills für den Pfarrgarten
Übersicht über den Ablauf des Tages
Einführung zum vierten Tag
Workshop 1: Knoten und Biwakbau
Workshop 2: Feuer
Workshop 3: Orientierung
Reflexion des Tages am Lagerfeuer
Abschluss der Schulung
Anhang
Abschlussgedanken
Danke
Literaturverzeichnis
Die Autoren
Reihe Sinn gesucht - Gott erfahren
Vorwort
Zeitreise in die Vergangenheit. Es ist der Sommer 1998. Das traditionelle Jungscharzeltlager meines Heimat-CVJM in Lauben im Unterallgäu stand an. Ich war zum zweiten Mal als ehrenamtlicher Mitarbeiter mit von der Partie. Und mit 19 Jahren noch ziemlich grün hinter den Ohren, zumindest was pädagogische Grundkenntnisse angeht. Und damit war ich nicht allein. Was wir jedoch hatten: jede Menge Begeisterung, Kreativität und Motivation, für die Kinder eine unvergessliche Woche zu gestalten. In diesem besagten Sommer 98 kam dann ein Mitarbeiter mit der Idee um die Ecke, wir könnten ja einen erlebnispädagogischen Tag für die rund 80 Kinder durchführen. Erlebnis klang ziemlich gut für uns. Also haben wir ein kleines Team gebildet, in dem wir diesen Tag ausgearbeitet und vorbereitet haben. Dabei haben wir versucht, alles in diesen Tag zu packen, was wir an erlebnispädagogischen Aktivitäten in Erfahrung bringen konnten und wovon wir selbst begeistert waren. Am Ende standen 10 Stationen: Abenteuerliche Kooperationsübungen, eine Riesenschaukel, Kanu-Challenge, Baumklettern und vieles mehr.
Der Tag war ein voller Erfolg. Die Kinder hatten außergewöhnliche und prägende Erlebnisse und auch die Mitarbeitenden waren begeistert.
Wenn ich heute, fast 30 Jahre später zurückblicke, habe ich vor allem zwei Gedanken:
Begeisterung und Stolz. Über das, was wir damals gemeinsam auf die Beine gestellt haben und was wir damit für die Kinder ermöglicht haben.
Gott sei Dank! Dass das alles gut ausgegangen ist. Denn ich muss mir eingestehen, dass wir eigentlich nicht wirklich Ahnung von Sicherheit und Erlebnispädagogik hatten und ich bin froh, dass nichts passiert ist.
Heute ist die Erlebnispädagogik deutlich bekannter und etablierter, als noch in den späten 90er Jahren. Und ich freue mich, dass viele CVJMs, Kirchen und Gemeinden diese vielfältigen Möglichkeiten der Erlebnispädagogik entdeckt haben und einsetzen. Wenn ich heute mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus der Jugendarbeit spreche, dann spüre ich immer noch die gleiche Begeisterung und die Motivation, für Kinder und Jugendliche unvergessliche und prägende Erfahrungen zu ermöglichen. Gleichzeitig stelle ich häufiger fest, dass ein tiefergehendes Verständnis fehlt, was Erlebnispädagogik eigentlich ist. Und wie diese Methoden sicher und gewinnbringend eingesetzt werden können. Und das ist kein Vorwurf, sondern sollte vielmehr Ansporn sein, dieses Wissen über die Erlebnispädagogik noch stärker an die Basis der Kinder- und Jugendarbeit zu bringen. Damit Menschen sich in erlebnispädagogischen Aktivitäten sicher fühlen, dass sie unvergessliche Erlebnisse haben und daraus wertvolle Erkenntnisse über sich, den Glauben und das Leben gewinnen.
Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Menschen, die dieses Wissen verbreiten und wir brauchen gutes Handwerkszeug, das Haupt- und Ehrenamtlichen dabei hilft, sich dieses tiefergehende Verständnis über die Erlebnispädagogik anzueignen.
Das vorliegende Buch ist ein solches Handwerkszeug. Ein Hervorragendes noch dazu. Die Autorin und Autoren haben ein fundiertes Theorie- und Praxiswerk entwickelt, das einen praxistauglichen Leitfaden für eine qualitativ hochwertige Basisschulung Erlebnispädagogik gibt. Auf verständliche Weise wird Schritt für Schritt beschrieben, wie diese Schulung sinnvoll aufgebaut und welche Inhalte und Methoden vermittelt werden sollten. Man merkt dem Buch deutlich an, dass es von Menschen geschrieben wurde, die selbst professionell in der Erlebnispädagogik ausgebildet wurden und zugleich über ein hohes Maß an Praxiserfahrung verfügen. Also beste Voraussetzungen, dass das Buch nicht in einem Regal verstaubt, sondern die Inhalte auch wirklich praktisch angewandt werden.
Viel Vergnügen beim Lesen und viel Erfolg beim Durchführen von erlebnispädagogischen Basisschulungen!
Stefan WesthauserLeitung Institut für Erlebnispädagogik der CVJM-Hochschule
Navigator durch Sinn gesucht – Gott erfahren Basisschulung
Es gibt drei Arten, wie du dieses Buch nutzen kannt. Als Vorlage, um selbst eine Erlebnispädagogik-Schulung durchzuführen (in diesem Fall solltest du bereits Vorwissen und praktische Erfahrungen in der Erlebnispädagogik haben). Als Begleitbuch, wenn du als Teilnehmerin/Teilnehmer auf einer solchen Schulung bist. Oder zum Selbststudium, falls du auf deine Grunderfahrungen in der Erlebnispädagogik aufbauen möchtest.
Das Buch startet mit einer Einführung zur Erlebnispädagogik und ihren Merkmalen im christlichen Kontext. Der restliche Teil des Buches ist in vier Schulungstage untergliedert. Am ersten Tag geht es um Kooperation und um grundlegende Prinzipien der Erlebnispädagogik. Am zweiten Tag drehen sich die Übungen um Kommunikation und Vertrauen. Der dritte Tag richtet seinen Fokus darauf, wie Erlebnispädagogik eine Brücke zum christlichen Glauben bilden kann. Und am vierten Tag gibt es noch grundlegende Outdoor-Skills zu erlernen.
Ein einzelner Tag ist so aufgebaut, dass es zunächst eine Übersicht über die verschiedenen Übungen und Lernimpulse (Theorie-Einheiten, die mit den Übungen verknüpft sind) gibt, sodass auch die jeweilige Dauer gut eingeschätzt werden kann. (Hier werden z.T. andere Zeiten angegeben, als bei den Übungen selbst. Das liegt daran, dass es hier um die Tagesplanung geht und auch Zeiten für die Metaebene berücksichtigt wurden.) Außerdem gibt es eine Einführung zum Tag mit Lernzielen und Anker-Vers. Diese Einführung richtet sich an die Trainingsleitung. Anschließend folgen die Übungen und Lernimpulse, in verschiedene Blöcke unterteilt. Die Übungen selbst enthalten eine Illustration, die das Geschehen verbildlicht, die wichtigsten Rahmendaten, den Aufbau, die Instruktion an die Teilnehmenden, die Zielsetzung der Übung und – wo möglich – auch eine Auswertung und Varianten. Manchmal gibt es auch noch Expertentipps. Für dich noch gut zu wissen: Wann immer etwas in grauer Schrift ist, dann handelt es sich um eine Erklärung/Instruktion, die sich an die Teilnehmenden richtet und vorgelesen werden kann.
Aus den verschiedenen Nutzungsarten des Buches ergibt sich, dass einige Teile eine Doppelrolle erfüllen: Die Übungen im Buch richten sich bspw. in erster Linie an die Teilnehmenden der Schulung, sind aber gleichzeitig so aufgebaut, dass die dann geschulten Teilnehmenden sie selbst in ihren Gruppen mit Kindern und Jugendlichen durchführen können. Wenn also im Buch von „Trainingsleitung“ oder „Teilnehmenden“ die Rede ist, kann sich das letztlich auf beide Kontexte beziehen: Den Schulungskontext (an erster Stelle), aber auch den Kontext der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in deiner Heimat-Gruppe, Freizeit, o.Ä.
An manchen Stellen im Buch verweisen wir auf den Downloadbereich. Dort gibt es die Ablauf-Tabellen und weitere Vorlagen zum Ausdrucken. Diese Vorlagen können mithilfe des Passworts L7&F7cq unter download.praxisverlag-bm.de und ebenso unter www.neukirchener-verlage.de/zusatzmaterial als digitale Daten heruntergeladen werden. Dieses Passwort darf nicht weitergegeben werden. Nur der Kauf des Buches berechtigt zum Downloaden, Ausdrucken, Kopieren und Verwenden dieser Daten, sofern sie zur Vorbereitung und Durchführung der Inhalte dieses Buches verwendet werden. Eine Vervielfältigung, Verwendung oder Weitergabe darüber hinaus ist ohne Erlaubnis ausdrücklich nicht gestattet.
Einleitung – Erlebnisse und Erfahrungen
Als Jesus – damals in Israel – den Menschen Wahrheiten über Gott erklären wollte, hat er oft „Gleichnisse“ erzählt: Dafür hat er eine Erfahrung aufgegriffen, die die Menschen aus ihrem Alltag kannten und dann gesagt: „Guckt mal, so (ähnlich) ist das auch bei Gott ...!“ Heute, gut 2.000 Jahre später, ticken wir Menschen anders. In unserer pluralen Welt macht jede und jeder ganz unterschiedliche Erfahrungen. Damals war Alltag bspw. vorranging Landwirtschaft und Fischerei.
Glaube wurde immer mehr zur „Kopfsache“, wir würden Gott heute gern rational verstehen. Die Erlebnispädagogik im christlichen Kontext bildet dazu einen Gegenpol. Sie unternimmt den Versuch, ein modernes Gleichnis zu „erzählen“. Sie initiiert eine gemeinsame Erfahrung in einer Gruppe und kommt an den Punkt, an dem auffällt: „Guckt mal, so ähnlich ist das auch bei Gott!“
Was ist das Besondere einer Erfahrung? Erlebnisse werden erlebt – Erfahrungen müssen gemacht werden. Okay, das klingt seltsam, aber ich meine damit, dass wir (und alle anderen Menschen um uns) ständig irgendetwas erleben. Unser Alltag besteht aus einer Aneinanderreihung von Erlebnissen ... selbst dann, wenn ich nur gähnende Langeweile erlebe. Ob ein Erlebnis zu einer Erfahrung wird, hängt davon ab, was wir daraus machen. Also wie wir ein Erlebnis „verarbeiten“. Manche Erlebnisse sind so eindrücklich, dass wir ganz automatisch anfangen, sie zu verarbeiten: Wir „müssen drüber nachdenken“, „können es nicht vergessen“ oder „wollen unbedingt darüber reden“. Bei manchen Erlebnissen ist nicht entscheidend, was wir erleben, sondern mit wem wir etwas erleben. Eine Zugfahrt ist z.B. möglicherweise unspektakulär – mit spannenden Menschen im Abteil kann sie zu einer Erfahrung werden. Bei manchen Erlebnissen wiederum ist für die Qualität der Erfahrung wichtig, dass wir sie bewusst „verarbeiten“ und dabei unterstützt werden. Das können professionelle Gespräche bei traumatischen Erlebnissen sein, oder eben die zielgerichtete Reflexion eines Erlebnisses in der Erlebnispädagogik.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass für eine echte Erfahrung drei Faktoren entscheidend sind:
das Erlebnis selbst, also die die Qualität des Erlebten
die Menschen, die das Erlebnis mit mir teilen, also die Gruppe
die „Verarbeitung“ des Erlebten, also die (bewusste) Reflexion.
Das Buch, das du gerade in deinen Händen hältst, ist entstanden, weil Trainingsleitungen von erlebnispädagogischen Übungen ein gewisses Maß an Knowhow brauchen, um erlebnispädagogische Ereignisse und deren Reflexion gut anleiten zu können. Wenn man sich für Erlebnispädagogik interessiert, sieht man schnell, dass es viele erlebnispädagogische Ausbildungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gibt. Um das Niveau zu sichern, zertifiziert in Deutschland der „Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.“ Trainingsleitungen und Ausbildungsanbieter. Mit unserer Basisschulung gehen wir einen anderen Weg, auch wenn wir aus eigener Erfahrung eine umfassendere Weiterbildung als Erlebnispädagogin/Erlebnispädagoge nur wärmstens empfehlen können.
Dieses Buch hat folgende Zielrichtung: mit unser Basisschulung wollen wir Ehren- und Hauptamtliche befähigen, Erlebnispädagogik im christlichen Kontext in Gemeinden und Verbänden/Vereinen sinnvoll einzusetzen. Wir wünschen uns, dass in der christlichen Jugendarbeit durch die Erlebnispädagogik ein Zugang zum Glauben entstehen kann.
Jetzt liegt es in deinen Händen, mach was draus und übernimm Verantwortung, damit Menschen eine christliche Erfahrung machen können!
Was ist Erlebnispädagogik und was will sie?
Die Erlebnispädagogik ist ein vielschichtiges pädagogisches Konzept, das sich gar nicht so leicht definieren lässt. Es gibt jedoch einige pädagogische Grundgedanken und Grundprinzipien, die wir in der Basisschulung und in diesem Handbuch vorstellen wollen.
Im Kern wird Erlebnispädagogik heute als ganzheitlicher Bildungsansatz verstanden, der darauf abzielt, Menschen nicht nur auf der kognitiven Ebene anzusprechen, sondern sie ganzheitlich in ihrer Persönlichkeit zu fordern und fördern. Oft wird der erlebnispädagogische Ansatz daher in der Trias von „Kopf, Herz und Hand“ zusammengefasst. Diese drei Dimensionen, auch übersetzt mit Denken, Fühlen und Handeln, stehen ganz in der Tradition des Schweizer Pädagogen J.H. Pestalozzi (18./19. Jahrhundert). Der Mensch lernt und wächst demnach nicht nur durch die intellektuelle Auseinandersetzung (Kopf) mit einem Thema, sondern durch die Einbeziehung seiner emotionalen Kompetenzen (Herz) und praktischen Fähigkeiten (Hand). Was ist damit gemeint? Das werden wir weiter auffächern und uns so einer Definition der Erlebnispädagogik annähern:
Kopf (Denken): Erlebnispädagogische Methoden regen die Teilnehmenden dazu an, Situationen und Verhaltensweisen zu analysieren und neue Wege und/oder Lösungen (individuell und gruppenspezifisch) zu entwickeln. Dabei sollen vielfach neue Perspektiven eingenommen und gewonnen werden. Erlebnisse und daraus resultierende Erkenntnisse können und sollen im Entwicklungsprozess auf unterschiedliche Lebenssituation abstrahiert (transferiert) werden.
Herz (Fühlen): Ein wesentlicher Aspekt der Erlebnispädagogik ist es, emotionale Prozesse in das Lernen zu integrieren, zu beleuchten und zu verstehen. Durch intensive Herausforderungen werden Emotionen angesprochen und die Selbstwahrnehmung für diese geschärft (u.a. durch den Abgleich mit der Fremdwahrnehmung). Gefühle wie bspw. Freude, Stolz oder Angst werden aktiv reflektiert und bewusst gemacht, was zur persönlichen Weiterentwicklung beiträgt (Stichwort „emotionale Kompetenz“).
Hand (Handeln): Erlebnispädagogik ist im höchsten Maße handlungsorientiert und aktivierend. Die Teilnehmenden lernen, indem sie aktiv und praktisch miteinander interagieren. Ob bei einem Klettererlebnis, einer kooperativen Gruppenübung oder einer Übernachtung in der Wildnis. Das praktische Tun und Erleben steht im Mittelpunkt.
Damit hätten wir nun bereits einige Grundlagen für die moderne Erlebnispädagogik festgehalten. Als Zwischenfazit lässt sich sagen, dass Erlebnispädagogik weit über das bloße kognitive Vermitteln von Wissen („Frontload“) hinausgeht. Im Mittelpunkt steht das direkte und oft ganzheitliche Erleben von Situationen, die eine tiefgreifende persönliche Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen ermöglichen. Herausforderungen, sowohl individueller als auch gruppenspezifischer Natur, sind dabei zentrale Elemente. Sie offenbaren nicht nur persönliche Stärken und Entwicklungspotentiale, sondern verdeutlichen auch die Wechselwirkungen innerhalb der Gruppe.
Betrachten wir beispielhaft den Teamentwicklungsprozess einer Schulklasse. Selbstverständlich könnte dieser auch im Klassenzimmer – auf eher kognitiver Ebene – thematisiert werden. Ein erlebnispädagogischer Ansatz hingegen nutzt ein verändertes Setting außerhalb des Klassenzimmers und bezieht unmittelbare Erfahrungen auf weiteren Ebenen ein. So können die Themen der Klasse zum Beispiel im Rahmen eines Abenteuertages im Wald aufgegriffen werden – in einem bewusst gestalteten Setting, das durch Spannung, Herausforderung und Abwechslung eine hohe intrinsische Motivation erzeugt. Indem die Gruppe vor ungewohnte und motivierende Herausforderungen gestellt wird, wird der Teamentwicklungsprozess nicht nur theoretisch besprochen, sondern kann direkt erlebt, reflektiert und aktiv bearbeitet werden. Ein solcher Perspektivwechsel kann zu wertvollen Aha-Momenten führen („So haben wir das noch nie gesehen!“) und damit nachhaltige Veränderungen ermöglichen. Die Erlebnispädagogik geht davon aus, dass unmittelbare und ganzheitliche Erfahrungen im veränderten Setting dazu beitragen, persönliche und gruppendynamische Fragestellungen sichtbar zu machen und gewinnbringend zu thematisieren.
Mit diesem ersten Impuls zum „Denken, Fühlen und Handeln“ im Hinterkopf, möchten wir tiefer eintauchen und eine tatsächliche Definition aus der Fachliteratur betrachten. Diese liefern uns Heckmair und Michl in ihrem Grundlagenwerk „Erleben und Lernen“ (2018). Einige der zuvor genannten Aspekte finden sich darin wieder und werden innerhalb dieser Definition sinnvoll ergänzt.
„Das Konzept der Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Natur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten.“[1]
Erlebnispädagogik stellt das Lernen durch aktives Erleben in den Vordergrund. Sie ermöglicht es den Teilnehmenden, durch direktes Erfahren statt durch bloße theoretische Wissensvermittlung zu lernen. Unserer Ansicht nach macht dies das Konzept auch für junge Menschen so attraktiv: Die Partizipation ist durch den praktischen, handlungsorientierten Ansatz meist recht niederschwellig und zugleich attraktiv (spannende Methoden).
Lernen in der Erlebnispädagogik geschieht innerhalb exemplarischer und „inszenierter“ Lernsituationen mit Ernsthaftigkeitscharakter. Was ist damit gemeint? Wir können uns die „Lernsituationen“, also bspw. eine Kooperationsübung, vorstellen wie eine Straße: Die Teilnehmenden bewegen sich auf dieser Straße. Die Straße, also die Lernsituation, ist durch klare Regeln und Strukturen (vergleichbar mit Leitplanken) begrenzt. Die Leitplanken sind die Regeln der Übung und die Vereinbarungen des gemeinsamen Miteinanders. Sie bieten Orientierung und geben den Teilnehmenden Sicherheit, ohne die Ernsthaftigkeit der Situation zu mindern (also so gestaltet, dass sich Aufgabe und Anforderung wie ein natürlicher Sachzwang ergeben und die Teilnehmenden die Situation als realitätsnah und bedeutungsvoll erleben). All das haben wir in einer klassischen Kooperationsübung. Aus diesem Grund sprechen wir von exemplarischen Lernprozessen: Sie spiegeln die reale Welt in einem geschützten Rahmen wider, einer Art „kleiner exemplarischer Kuppel der Realität“[2]. Die Teilnehmenden werden in eine Lernsituation geführt, in der sie sich beweisen und eigene Lösungswege finden. Diese Erfahrungen übertragen sie reflektierend (s. Reflexions- und Transfermodelle) auf ihren (gemeinsamen) Alltag, sodass der Lernprozess als Modell für zukünftige Herausforderungen dient.
Im Zentrum stehen, zumindest im Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, junge Menschen, die durch erlebnispädagogische Ansätze in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Die Methoden lassen sich jedoch auch flexibel auf andere Altersgruppen anwenden.
Die Lernprozesse in der Erlebnispädagogik basieren auf Herausforderungen, die sowohl körperliche, mentale als auch soziale Fähigkeiten der Teilnehmenden ansprechen. Diese ganzheitliche Herangehensweise fördert das Wachstum auf verschiedenen Ebenen, ohne eine Priorisierung oder Hierarchisierung dieser Bereiche vorzunehmen. Die Herausforderungen existieren gleichwertig nebeneinander, auch wenn sich der Fokus individuell oder gruppenspezifisch (sowie thematisch) verschieben kann.
Es ist wichtig bereits hier zu betonen (eine Vertiefung erfolgt an Tag 2, s. „Vertrauensübungen Block I“ und „Vertrauensübungen Block II“), dass jede Herausforderung von den Teilnehmenden unterschiedlich wahrgenommen wird. Was für die Einen scheinbar „einfach“ oder „problemlos“ zu bewältigen ist, kann für Andere eine erhebliche Hürde darstellen. Diese Subjektivität des Erlebens, auf Basis bisheriger Erfahrungen im Leben, verdeutlicht die Vielschichtigkeit von erlebnispädagogischen Prozessen. Für uns als Trainingsleitung im Kontext der Gruppenarbeit bedeutet dies in der Konsequenz: Wir dürfen mit maximalem Fingerspitzengefühl vorgehen und bedenken, dass wir nicht in unsere Teilnehmenden „hineinschauen können“. Erst das Offenlegen und Thematisieren der Erlebnisse, bspw. über gezielte Fragen, kann hier Klarheit bringen. Besonders im Bereich emotionaler Herausforderungen bleiben viele individuelle, emotionale Prozesse unsichtbar und (zunächst) verborgen. Die sichtbaren Anteile der emotionalen Prozesse mögen klein erscheinen („das war doch scheinbar eine ganz einfache Herausforderung für ihn“), während die tieferen, emotionalen Prozesse oft verborgen bleiben („das war absolut krass für mich“).
Das Hauptziel der Erlebnispädagogik ist es, die individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Die Teilnehmenden lernen, Verantwortung für sich selbst, ihre Lebenswelt, zu übernehmen und ihre Umwelt bewusst, vor allem aber eigenverantwortlich, zu gestalten.
Mit diesem Abschnitt hätten wir eine Definition von Erlebnispädagogik eingeführt und ausgestaltet. Wir schlagen vor, diese Definition praxisnah, gern Schritt für Schritt, nach den ersten Kooperationsübungen am ersten Tag (zum Thema Kooperation) einzuführen. Im jeweiligen Kapitel zum ersten Tag wird darauf verwiesen. Die methodischen Grundprinzipien werden ebenfalls im Kapitel des ersten Tages detailliert aufgeführt und ergänzen die Definition.
Nun schauen wir, was das Besondere an „Erlebnispädagogik im christlichen Kontext“ ist.
Einführung in die Erlebnispädagogik im christlichen Kontext
Erlebnispädagogik dient der Persönlichkeitsentwicklung, weil die Methoden und Arbeitsformen Menschen herausfordern und etwas in Bewegung bringen. Wenn diese Methoden und Formen genutzt werden, um im christlichen Kontext Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen, dann geschieht Ähnliches. Bibeltexte oder biblische Geschichten können von einer bestimmten Erfahrung her entdeckt werden. Urworte des Lebens und des Glaubens wie Angst und Vertrauen, Gerechtigkeit und Verantwortung, Zweifel und Hoffnung können durch erlebnispädagogisches Setting erschlossen und mit Hilfe von Bibeltexten vertiefend gedeutet werden (s. www.ejwue.de/ejw_arbeitsbereich/erlebnispaedagogik). Erfahrungen werden gemacht, in der persönlichen Gottesbeziehung und im eigenen christlichen Glauben.
Drei Erfahrungsebenen – Dimensionen der Erlebnispädagogik im christlichen Kontext
Erlebnisse und Erfahrungen sind wertvoll. Erfahrungen machen uns reicher. Sie prägen unser Menschsein, egal ob es gute oder schlechte Erfahrungen sind. Alle haben in ihrem Leben bereits Erfahrungen gemacht, über die sie froh sind, und solche, auf die sie lieber verzichtet hätten. Aber reich an Erfahrungen werden wir nur durch die Vielfalt unserer Erlebnisse.
Besonders wertvoll sind die Erfahrungen aus erster Hand (First Hand Experience), also solche, die auf unserem eigenen Erleben beruhen. Erfahrungen aus zweiter Hand, also solche, die auf dem Erleben anderer beruhen, begegnen uns sehr häufig: in den Medien, in Computerspielen, in Geschichten, in Erzählungen anderer Menschen. Nur selten berühren sie unsere unmittelbare Persönlichkeit. Nur selten fordern sie zur Deutung heraus. First Hand Experiences werden zu persönlichkeitsprägenden Erfahrungen, weil der Mensch, dem das Erlebnis widerfährt, es mit sich selbst in Verbindung setzt, es sich zu eigen macht. Erlebnispädagogische Erfahrungen im christlichen Kontext finden auf drei Ebenen statt.
Die erste Dimension: zwischenmenschliche Erfahrung (OUT)[3]
In dieser Dimension geht es um das das konkrete Empfinden und Verhalten der Teilnehmenden einer Aktion. Wie beteiligen sich die einzelnen Teilnehmenden an der Lösung einer Aufgabe? Stellen sie sich den Herausforderungen? Wie gehen sie mit Schwierigkeiten, Konflikten, Angst oder Frustration um?
Zu Beginn der Übung (Frontload) kann die Trainingsleitung die Wahrnehmung der Teilnehmenden auf bestimmte Bereiche richten, indem sie Beobachtungsaufgaben stellt, bestimmte Ziele setzt oder zu erwartende Schwierigkeiten beschreibt. In der Reflexion können sich die Einzelnen mit ihren Erlebnissen in der Aktion auseinandersetzen und so wichtige neue Erfahrungen aufnehmen. Gelingt dies gut, können die Teilnehmenden nicht nur in den folgenden Aktionen, sondern auch im anschließenden Alltag von diesen neuen Erfahrungen profitieren. So wird es ihnen vielleicht leichter fallen, in alltäglichen Situationen gut gemeinte Hilfe anzunehmen. Oder es gelingt ihnen, in einem familiären Konflikt nach Kompromissen zu suchen, anstatt standhaft auf einer eingefahrenen Position zu beharren.
Dies alles sind Erfahrungen im menschlichen bzw. zwischenmenschlichen Bereich, die es den Teilnehmenden ermöglichen, ihre Persönlichkeit weiter positiv zu entfalten, Gaben zu entdecken und bisher unterentwickelte Fähigkeiten zu fordern. Gelingt es uns, Menschen in dieser Dimension zu erreichen und zu fördern, leisten wir einen konkreten Beitrag zur Menschlichkeit unserer Gesellschaft. Zugleich erfüllen wir den Auftrag Jesu, unserem Nächsten Gutes zu tun (Mt 25,40 u.a.). In besonderem Maße gilt dies, wenn es uns gelingt, Menschen zu erreichen, die im zwischenmenschlichen Bereich immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen. So erleben viele Kinder in unserer Gesellschaft, dass sie nicht erwünscht sind, stören, ihre Meinung nicht gefragt ist und ihre Gaben nicht gefördert werden. Jugendliche erleben häufig Abwertung durch Lehrkräfte oder Eltern, sei es z.B. aufgrund mäßiger schulischer Leistungen oder als Reaktion auf ihren sich abgrenzenden Lebensstil. Ihnen und allen anderen Menschen sollten wir als Christinnen/Christen Mut machen, Menschen zu werden, wie Gott sie gemeint hat. Liebe zu sich selbst und zu anderen zu empfinden, ist ein wesentlicher Gesichtszug des von Gott geschaffenen Menschen (Mt 22,39).
Beide können nur wachsen, wenn ein Mensch bestimmte Erfahrungen macht und durch sie bestimmte Fähigkeiten erlernt. Erlebnispädagogische Angebote können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, wenn wir sie gezielt einsetzen und ihre Möglichkeiten nutzbar machen.
Die zweite Dimension: die eigene Erfahrung (IN)
Die zweite Dimension geht über die erstgenannte Dimension hinaus. Immer wieder kommt es in erlebnispädagogischen Aktionen zu Momenten, in denen Teilnehmende ein Erlebnis haben, das sie in ihrer Identität als Mensch tief betrifft. Dies können sowohl positive wie negative Erlebnisse sein (z.B. Faszination, Stolz, Frustration oder Angst). Eigene und unmittelbare Erfahrungen (First Hand Experience) betreffen die Teilnehmenden als Person. Sie gehen über bloßes „Verfügungswissen“, das in Schule oder Internet erworben werden kann, hinaus und sprechen vor allem emotionale Schichten des Menschseins an. Das Gefühl: „es betrifft mich“ oder „ich bin gemeint“ oder „das war mein persönliches Abenteuer“. Das Gefühl also Ich – als Person – habe etwas geschafft und erreicht. Wir sprechen hier auch von der Erfahrung der Selbstwirksamkeit