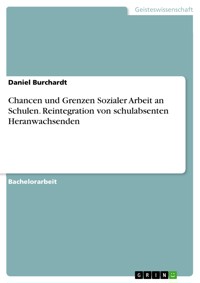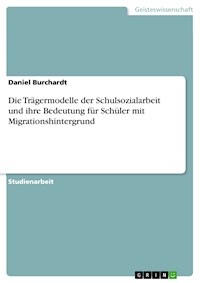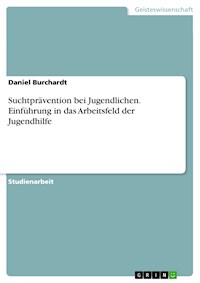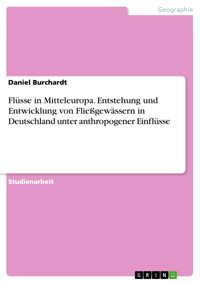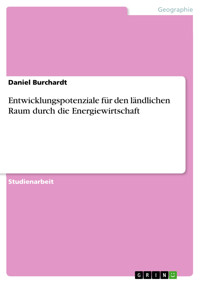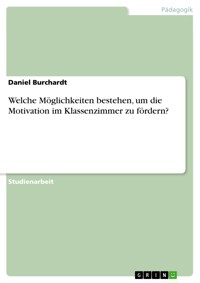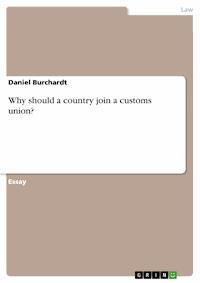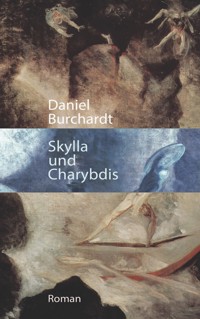
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Predigt von Hass, Gewalt und einer toxischen kriegerischen Männlichkeit - droht sie nur von einer Seite oder kann sie sich in jedem politischen Lager hören lassen? Was wollen diese jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen? Gibt es für sie einen gemeinsamen Feind, einen gemeinsamen Nenner? Dieses Buch geht diesen Fragen nach und wird nicht Wenige überraschen. Vor allem schon einmal darin, dass es auch dem friedlichen Geist radikale Positionen nachvollziehbar macht. Das ist notwendig - natürlich nicht zur Radikalisierung der Friedvollen, sondern um den politischen Diskurs führen zu können und das Problem der Radikalität in seiner Wurzel zu verstehen. Das Buch leistet aber mehr. Es arbeitet Geschichte auf, und zwar nicht aus der Perspektive der Sieger. Elementare geopolitische Zusammenhänge erscheinen nicht mehr nur im gemütlichen Licht der bürgerlichen Nachttischlampe. Und dennoch geht es dem Autor keinesfalls um "alternative Fakten". Und um keine Apologie - für niemanden. Das Überraschendste an dem Buch sind wahrscheinlich die Missverständnisse, von denen es befreit. Insbesondere die Missverständnisse über einen selbst. Viele Menschen verlieren in diesen Zeiten den Überblick. Einige davon radialisieren sich. Dieses Buch wirkt dagegen wie ein Panazee, wie eine Kur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Zweites Buch
1. Kapitel
Erstes Buch
“Du kannst jetzt nicht gehen”, sagt Pit und hebt die Arme dabei fragend, “die Party fängt ja gerade erst an und du hast keinen Schluck getrunken”. Pit ist in ein komplett weißes Kostüm gekleidet, das mit seinem glänzenden, paillettierten Umhang fast an das Kleid eines Engels erinnerte, wäre nicht durch die roten Hörner auf dem Kopf und die zwar ebenfalls weiße aber grotesk verzerrende Schminke des Gesichts ganz klar, dass es sich um niemand anders als den Satan persönlich handeln kann. Pit ist Mitarbeiter von USAID, einer Abteilung des US-Außenministeriums, welche die Entwicklungshilfe der Vereinigten Staaten in Afghanistan organisiert.
“Sicher werdet ihr eine Menge Spaß haben. Aber ich muss los. Ich habe noch eine Verabredung auf Skype und ich war jetzt auch lange genug hier.” gibt Mark lächelnd zurück und lässt den Teufel und den neben ihm sich an seinem Bier festhaltenden Papst stehen. Es dauert eine Weile bis sich Mark durch das Gedränge zum Ausgang kämpfen kann. Mittlerweile ist das enge Restaurant mit dem Namen “Kela”, persisch für “Banane”, das heute eine Halloween-Party beherbergt, gut gefüllt. Es befindet sich auf dem Gelände der Europäischen Gesandtschaft, also auf diplomatischem Grund. Daher ist es dem afghanischen Restaurantpächter möglich, Alkohol zu beziehen und zu verkaufen; etwas, das in dem muslimischen Land sonst eigentlich streng unter Strafe steht.
Marks Entschuldigung ist zutreffend. Er ist kein Typ, der lügt. Aber sie ist nicht vollständig. Denn Mark würde vielleicht etwas länger bleiben und hätte auch seine Verabredung vertröstet, wenn er sich in dem Umfeld besser fühlen würde. Dass er sich auf solchen Partys wirklich wohl fühlt, ist eher selten. Das liegt auch daran, dass er sich vor einigen Jahren das Alkoholtrinken abgewöhnt hat und nun immer befürchtet, den Besoffenen um ihn herum in seiner Nüchternheit die gute Laune zu verderben.
Bei seinem Weg durch das Gedränge blickt Mark in viele ihm bekannte Gesichter. Mittlerweile ist er schon fast zwei Jahre in Afghanistan. In dieser Zeit hat er schon einige Kollegen kommen und gehen sehen. Denn viele hält es maximal ein Jahr oder auch nur kürzer in dem Land, das für die Internationalen, die im militärischen Bereich oder der Entwicklungshilfe arbeiten, zwar eine Menge an Privilegien und recht gut bezahlte Jobs zu bieten hat, insgesamt für die meisten aber bedrohlich und fremd wirkt und aufgrund der starken Sicherheitsbestimmungen unterm Strich auch nur wenig Freiheit gewährt.
Etwas verkniffen lächelnd schiebt sich Mark an July und ihrer Gin-Tonic trinkenden Gruppe vorbei. July, die für die französische Botschaft arbeitet und gleichsam warme wie leuchtende blaue Augen hat, hat ihm schon häufiger mehr oder minder versteckte Avancen gemacht. Jemand aus ihrer Gruppe sagt gerade in jovialem Ton: “Dem Grunde nach kritisieren alle genau das, was in der EU im Moment die Realität ist: Wir haben nur den Markt und Währung, nicht aber das politische Haus für all das, die Europäische Demokratie. Es ist wie ein Haus ohne Dach, in das es immerfort reinregnet.” July hört nicht zu, sie hat das Glas am Mund und die Augen über den Glasrand fest auf Mark geheftet. Sie gefällt ihm, aber Marks Interesse an ihr hatte aber kürzlich einen starken Dämpfer bekommen. Bei einer Botschaftsparty hatten sich beide vor einigen Wochen über einen ihrer Kollegen kennengelernt und die gegenseitige körperliche Anziehung auf Anhieb in ein kurzweiliges Gespräch verwandelt. Dann erzählte July davon, dass einige ihrer afghanischen Kollegen ohne ihre Hilfe kaum etwas selbständig hinbekommen und sie auch im Urlaub mit Fragen nerven würden, die sie ohne Weiteres selbst lösen könnten. Mark konnte das gut in seine eigenen Erfahrungen einsortieren und wollte etwas Bestätigendes dazu sagen. Vielleicht war es der Lautstärke der Musik geschuldet, July hatte es nicht verstanden und geglaubt, Mark würde sie kritisieren. Offenbar ging ihr die ganze Sache mit den Kollegen so besonders nahe, dass das Missverständnis einen Finger auf eine Wunde gelegt hatte. Denn July verfing sich für einen kurzen Moment in einer emotionalen Anspannung, als sie sich daraufhin gegenüber Mark noch einmal unnötig rechtfertigen wollte. Es stellte kaum mehr als eine kleine Entgleisung dar, die unaufmerksamen Außenstehenden womöglich nicht einmal aufgefallen wäre. Aber July war durch ihren kleinen Ausraster, der ihr schnell peinlich war, genau wie Mark etwas erschrocken und verunsichert. Der sensible Mark versuchte zwar, sich nichts anmerken zu lassen. Aber auf eigentümliche Weise war beiden intuitiv klar, dass nichts mehr aus ihnen werden würde. Er fragt sich, wie lange ihn July noch so anlächeln würde, wie sie es gerade getan hatte. Die meisten Frauen waren da seiner Erfahrung nach viel zurückhaltender und ihr Interesse erlahmte schnell, wenn Mark es nicht erwidern würde. Er wirft ihr noch einen letzten Blick zu, kombiniert mit einem etwas zu scheuen “à plusse”, und hat das Gefühl, dass es ihm wieder einmal nicht gelungen war, auf eine souveräne Art klar, aber dennoch freundlich zu sein.
Endlich tritt er aus dem Restaurant heraus. Die Tür schlägt hinter ihm zu und die Musik – der DJ spielt gerade Deep Purple’s ‚Smoke on the River‘ – wird sofort um etliche Dezibel leiser. Drinnen war es so voll. Hier draußen, im Garten des Restaurants, ist dagegen gerade niemand. Grillen zirpen durch den noch relativ jungen aber bereits nächtlich dunklen Abend. Es ist erst gegen halb zehn, aber der Siedepunkt der Party rückt sichtlich immer näher. Mark betrachtet sich alles für einen Moment: die Bäume im Garten; die leeren Stühle und Tische unter den Sonnenschirmen und Baldachinen; die flirrenden Lichter der Häuser an den Hängen des Kabuls Innenstadt westlich eingrenzenden Berges. Und darüber der Sternenhimmel, aus dem heraus Orion seine Arme schützend über die Stadt zu halten scheint. Alles wirkt so friedlich. Mark kann sich gut vorstellen, dass das Land leicht einen neuen touristischen Schub erleben würde, herrschte nur endlich Frieden. Die Afghanen sind sehr herzlich und gastfreundlich. Zudem ist die Natur in Afghanistan zwar grundsätzlich karg, aber eben in dieser Kargheit auch sehr eindrücklich. Für Mark scheint es, als ob sich diese besondere Charakteristik des Landes auf eigenwillige Weise auch in den Gesichtern und Charakteren der Menschen widerspiegelt. Mit diesen Gedanken macht er auf den Weg zu dem Auto, das auf dem großen Vorplatz auf ihn wartet.
Selbst zu fahren, ist ihm und seinen Kollegen, die mit ihm bei der GIZ, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit arbeiten, der deutschen Entwicklungshilfe-Organisation, verboten. Aus Sicherheitsgründen gibt es einen Fahrdienst, den jeder immer und ausnahmslos zu nutzen hat. Auf öffentlichem Gelände ohne den Fahrdienst, also zu Fuß oder mit Fahrrad, einem Taxi oder im Auto eines afghanischen Kollegen unterwegs zu sein, ist vollkommen ausgeschlossen und kann sogar zur Kündigung führen. Im letzten Jahr waren zwei Kollegen Marks entführt worden und jeweils erst nach rund einem Monat wieder freigekommen. Daher hat die Organisation die Sicherheitsbestimmungen stark verschärft, und der Zwang, jederzeit ausschließlich in einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs zu sein, ist eingeführt worden.
Mark kann den Schatten des auf ihn wartenden Fahrzeugs, ein großer gepanzerter Geländewagen, hinter der lichten Baumreihe vor dem Parkplatz des Geländes schon sehen. Der Vorplatz ist am Tor durch Scheinwerfer hell erleuchtet. Mark läuft auf dieses Licht zu, so dass alles davor wie ein Scherenschnitt aussieht. Auf dem Weg zum Auto kommt ihm ein junger Afghane entgegen, der Mark stumm grüßt. Er trägt die Kleidung eines Kellners des Restaurants und war offenbar entweder deutlich zu spät zur Schicht erschienen oder als Zusatzkraft gerufen worden, da die Luft im Restaurant heute nur so brennt. Für einen kurzen Moment wundert sich Mark über ihn. Die Begegnung scheint dem Kellner irgendwie unangenehm gewesen zu sein — so als wäre er Mark am liebsten aus dem Weg gegangen. Mark hat den Kellner aber noch nie gesehen.
Weil die Türen des Autos durch die Panzerung extrem schwer sind, muss Mark eine Menge Kraft aufwenden, um sie zu öffnen. Zuerst die hintere auf der Beifahrerseite, über die er seine Tasche hinter den Beifahrersitz stellt. Dann die Beifahrertür selbst. Er grüßt Mahmood, einen seiner Lieblingsfahrer, auf persisch und schließt die vordere Tür – wobei er aufgrund des nötigen Kraftaufwands leicht stöhnt, und das zeitgleich mit dem Türscharnier, das die Schwere der Tür ebenfalls anzustrengen scheint. Zur Begrüßung ist es in Afghanistan an sich üblich, dass man sich zunächst einmal für eine vergleichsweise lange Zeit darüber austauscht, wie es einem selbst und der Familie geht. Das kann sich mitunter über ein mehrfaches gegenseitiges Befragen hinziehen, und auch immer wieder neu aufflammen, selbst wenn man diese Prozedur für schon abgeschlossen gehalten hat. Da es aber auf westliche Ausländer häufig den Eindruck einer reinen Förmelei macht und sich daher kaum jemand gekonnt darauf einlassen möchte, haben sich die afghanischen Angestellten in den internationalen Organisationen an die kurzen und meist unpersönlichen Begrüßungen der Westler gewöhnt und sind entgegen ihrer eigentlichen Natur mitunter ähnlich wortkarg geworden. Mahmood startet also den Wagen und fährt auf das noch geschlossene Tor des Parkplatzes zu, eines von insgesamt drei Toren, die sie zu passieren haben, um das Gelände zu verlassen.
Sie sind gerade rund zehn Meter weit gekommen, als der Wagen von einer starken Druckwelle erfasst und einige Meter zur Seite geschleudert wird. Das Restaurant ist gerade in die Luft gesprengt worden.
*** (Zwei Wochen zuvor)
Die Tür zu Tamaras Büro steht wie immer einen Spalt offen. Mark klopft dennoch kurz, bevor er die Tür weiter öffnet. Tamara antwortet prompt mit einem beschwingten “Jaa-aa”. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch und schaut noch konzentriert auf einen der beiden vor ihr aufgebauten Bildschirme bevor sie sich freundlich lächelnd Mark zuwendet. Tamaras Büro ist nicht besonders groß, bietet aber genügend Platz für einen Eckschreibtisch, ein schlankes Sideboard und einen kleineren runden Besprechungstisch. Zwei der Wände bestehen zu einem wesentlichen Teil aus Fenstern, die auch noch fast vom Boden bis zur Decke reichen, so dass der Raum recht hell ist. Tamara selbst ist klein und zierlich, was ihr aber nichts von der Präsenz nimmt, die sie natürlich ausstrahlt. Sie hat ebenso kurze wie dünne blonde Haare und immer leicht verschmitzt wirkende grün-braune Augen.
“Na, wie sieht’s aus”, fragt Mark. “Alles gut” erwidert Tamara fröhlich. Mark ist einmal mehr davon angetan, dass Tamara offenbar beständig gut gelaunt ist, auch wenn sie viel zu tun hat und die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich wünscht — eine Eigenschaft, die nur wenige Menschen zu haben scheinen. Tamara wirkt deshalb wie ein Magnet auf die Menschen in ihrem Umfeld. Und daher besucht sie auch alle Nase lang ein Kollege in ihrem Büro. Auch Mark genießt es, Zeit mit ihr zu verbringen. Und er wünschte sich, mehr von ihren Eigenschaften zu haben. Zwar hat er begriffen, dass es keinen Sinn macht, die eigene Stimmung von dem, was man erlebt, abhängig zu machen. Aus dieser Abhängigkeit vom Äußeren aber wirklich auszubrechen, so wie es Tamara zu gelingen scheint, ist ihm bislang nicht gelungen.
“Wirst du nun deinen Vertrag verlängern?”, fragt Tamara und schaut Mark erwartungsvoll an. “Ich bin mir immer noch nicht sicher.”, antwortet Mark. “Als ich nach Afghanistan kam, habe ich noch über die gelacht, die es hier kaum zwei Jahre aushalten. Und nun mache ich es vielleicht genauso.”
Tamara lacht. “Immerhin warst du jetzt zweieinhalb Jahre hier. Damit gehörst du ja schon zu denen, die es hier richtig lange aushalten. Schau, Christoph ist jetzt nach einem guten Jahr weg, und Miranda hat es nicht mal sechs Monate ausgehalten.”
“Naja, das macht es nicht gerade besser.”, gibt Mark zurück, “all das Wissen, das ich mir mühsam in meiner Zeit hier erarbeitet habe, all die Kontakte… es wird schwer sein, das für unseren Laden zu erhalten. Es ist echt unfassbar, wieviel Kraft uns durch den permanenten Personalwechsel verloren geht. Ich würde mal schätzen, dass wir mindestens doppelt so effektiv arbeiten könnten, würden die Leute länger bleiben, sagen wir mal so fünf Jahre… so wie beispielsweise Peter Dührmann vom Bildungsprogramm. Immerhin sollte für eine bessere Übergabe gesorgt werden. Wenn ich jetzt gehe, kommt mein Nachfolger erst Monate später. Damit wird er oder sie sich mehr oder minder vollkommen neu in alles einarbeiten müssen. Das ist doch Schwachsinn!”
“Ja, das stimmt wohl”, nickt Tamara und presst die Lippen zusammen. Sie greift zu der Büchse Light-Cola, die wie immer vor ihr steht. Bevor sie zum Trinken ansetzt, fragt sie: “Wirst du eigentlich noch den Umzug ins Camp mitmachen?”
“Das ist ja mein zweites Lieblingsthema!”, lacht Mark, “Dieses dämliche Camp! Als ob wir dadurch auch nur einen Deut an Sicherheit gewinnen würden. Ich glaube, wir setzen uns dadurch eher sogar einer viel größeren Gefahr aus. Das Camp war bis vor kurzem ein Militärlager, und schon mehrmals haben die Taliban versucht, es zu stürmen. Dass es da jetzt für einige Zeit ruhig war, hat nur wenig zu sagen.”
“Und wir scheinen ja jetzt auch etwas höher auf der Abschussliste zu stehen.” stimmt Tamara zu. “Khaled und Ikram haben jedenfalls schon mal angekündigt, dass sie nicht mit ins Camp umziehen werden, sondern vorher kündigen.”
“Um Khaled tut es mir nicht wirklich leid.”, wirft Mark nachdenklich ein. “Aber um Ikram ist es wirklich schade, und Ajmal will übrigens auch nicht bleiben.” Mark setzt sich an den Besprechungstisch und schaut aus dem Fenster auf ein gegenüberliegendes Häuserdach, auf dem eine junge afghanische Familie offenbar kürzlich Zuflucht gefunden hat. Sie haben ein einfaches Zelt vor einen vielleicht fünf Quadratmeter großen gemauerten Abstellraum montiert und ihn damit etwas erweitert. Vor dem Zelt hängt Wäsche auf einer über das Dach gespannten langen Leine zum Trocknen, in einem Topf kocht etwas auf einem kleinen rauchenden Blechfass und ein Mädchen von ungefähr fünf sowie ein Junge von vielleicht drei Jahren spielen auf dem vollkommen ungesicherten Dach. Etwas Vergleichbares ist in Deutschland nicht vorstellbar, denkt Mark. Helikopter-Eltern würden nur so aufschreien. Und obwohl es heute ungewöhnlich kühl ist, haben die Kinder nach Marks Einschätzung zu alledem auch deutlich zu wenig Kleidung an. Aber sie lachen und wirken glücklich — Kinder eben. Das bringt Mark erneut zu dem Gedanken daran, was es eigentlich zum Lebensglück braucht. Die Kinder waren trotz all der offenkundigen Armut und Not ihrer Familie offenbar wahre Meister darin, sich nicht von Äußerem beeindrucken zu lassen.
“Die Entscheidung, ins Camp zu ziehen, war ja abzusehen.”, unterbricht Mark selbst sein Abschweifen, “das CMT, unser liebes Country Management Team, hat kaum eine andere Wahl. Es muss beweisen, dass es alles getan hat, um unsere Sicherheit zu garantieren.” Mark ist von der Leistung des CMT nicht überzeugt. Bei dem Team handelt es sich um eine Gruppe der obersten Ränge der GIZ in Afghanistan, sozusagen um die erweiterte Landesdirektion. Die Eigenart der GIZ, und wahrscheinlich jeder Entwicklungshilfeorganisation bringt es mit sich, dass die Einsätze nicht durch in einem klassischen Sinne geformte Manager geleitet werden, sondern durch solche Mitarbeiter, die einmal als reguläre Fachkräfte angefangen, also häufig etwa als Ingenieure oder Politologen, sich dann aber für Führungsrollen qualifiziert hatten. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Führung sehr sachnah erfolgt, und dass sich in der Organisation nur wenig des üblichen Hierarchie-Muffs riechen lässt. Es bringt aber auch mit sich, dass die Entscheidungsprozesse häufig etwas hölzern wirken oder die Willkürlichkeit der Entscheidungen offensichtlich ist. Und im Hinblick auf Sicherheitsfragen ist die Sache sogar noch etwas komplizierter. Denn es gibt neben dem CMT, das jede Entscheidung letztlich zu treffen und auch zu verantworten hat, auch noch eine Sicherheitsabteilung, die das CMT in allen sicherheitsrelevanten Fragen zu beraten hatte. Diese Sicherheitsabteilung rekrutiert häufig ehemalige Militärs. Zu diesen fiel Mark immer ein wohl Paul Watzlawick zuzurechnender Spruch ein: “Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel”. Im Ergebnis war es dann so, dass das CMT sich zu schwach zeigte, den Lösungsvorschlägen der Sicherheitsabteilung etwas Ausgleichendes entgegenzusetzen. Damit wurde also mehr oder minder jeder Vorschlag der Sicherheitsabteilung auch tatsächlich umgesetzt. Das brachte es mit sich, dass die Entscheidungen des CMT häufig fremdbestimmt und wenig authentisch wirkten — ein Effekt, der in Marks Wahrnehmung nebenbei bemerkt mittlerweile die gesamte internationale Arbeit in Afghanistan bestimmt. In einem gewissen Sinne wirkt die Entwicklungshilfe auf ihn insgesamt militarisiert. Sie scheint ihren diplomatischen Charakter eingebüßt zu haben und kommt eher erratisch als geplant rüber. Viele der Mitarbeiter halten die richtungsweisenden Entscheidungen daher entweder für vollkommen übertrieben oder für vollkommen unzureichend. Sicher ist lediglich, dass niemand der Beteiligten, weder das CMT noch die Sicherheitsabteilung, um ihre jeweiligen Posten wirklich zu beneiden sind.
“Ich werde jedenfalls nicht verlängern”, sagt Tamara und schaut Mark erwartungsvoll an.
Mark ist überrascht. “Was? Du gehst auch? Etwa ins Hauptquartier nach Frankfurt?” In diesem Moment wird die Tür aufgestoßen und Christa, die Vorgesetzte der beiden, tritt ins Zimmer. Die Endvierzigerin strahlt stets eine nervöse Unruhe aus, was auf viele verunsichernd wirkt. Vielleicht ist Christa aber auch gerade daher überall respektiert. Als Vorgesetzte wirklich beliebt ist sie allerdings nicht. Und das obwohl sie ihren Mitarbeitern relativ viele Freiheiten lässt. Sie ist weder für gerechte Entscheidungen noch dafür bekannt, sich sonderlich um die Belange ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Mark hat sich allerdings eine besondere Strategie angewöhnt, die bislang noch immer funktioniert hat — sowohl im Privaten als auch Beruflichen. Irgendetwas Positives hat jeder zu bieten, und daran hält er sich fest. So fällt es ihm leicht, bei Menschen auch das an ihnen Schwierige anzunehmen.
Christa gehört sicher zu den ersten beiden klassischen Typen eines Entwicklungshelfers. Da gibt es zunächst die Söldner, nicht nur im Militär, die es fürs Geld machen. Dann, mit dem ersten Typ verwandt, gibt es die Karrieristen, die sich von ihrer Tätigkeit einen beruflichen und/oder gesellschaftlichen Vorteil erwarten. Der dritte Typ, dessen Motivation rein humanistisch ist, ist selten zu finden. Mit dieser Motivation hatte Mark angefangen. Aber auch er muss sich mittlerweile eingestehen, dass all die Verlockungen, die das Leben in der Entwicklungshilfe trotz all seiner Schwierigkeiten zu bieten hat, einen nicht mehr ganz unerheblichen Anteil an seiner Motivationslage haben. Zum einen verdient er soviel Geld wie noch nie zuvor in seinem Leben. Zum anderen sind da die vielen Reisen, die mit seiner Tätigkeit verbunden sind. Dabei geht es insbesondere um internationale Konferenzen und Workshops, die an verschiedenen Orten weltweit abgehalten werden. Für jemanden, der gerne reist, ist das traumhaft. Hinzu kommt, dass Mark auch noch nie so viel Urlaub gehabt hat wie jetzt. Zum Ausgleich für die aufgrund der schlechten Sicherheitslage eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die ständige Bedrohung durch mögliche Anschläge haben die Mitarbeiter in der deutschen Entwicklungshilfe alles in allem deutlich mehr Urlaub als normale Arbeitnehmer.
“Gut, dass ich euch beide antreffe”, sagt Christa, “möchte noch jemand etwas vom Fahrer? Dann können wir ihn jetzt gemeinsam losschicken”. Aufgrund der Sicherheitslage ist es den Mitarbeitern der GIZ nicht erlaubt, selbst einkaufen zu gehen. Einkäufe müssen stattdessen von den afghanischen Fahrern erledigt werden. Wenn man sich hinsichtlich der Einkäufe nicht abspricht, müssen die Fahrer für jeden einzeln fahren.
Mark schaut zu Tamara, die lächelnd den Kopf schüttelt. “Ich brauche heute nichts weiter. Ich bin ja zum Abendessen mit Conny im Main-Office verabredet”. Das MainOffice ist das Hauptquartier der GIZ in Afghanistan. Dort arbeiten und leben insbesondere die Mitglieder der Landesdirektion, also auch das CMT. Untergebracht sind dort aber auch einzelne weitere Abteilungen. Die Mitarbeiter der GIZ besuchen sich häufig gegenseitig — schon aufgrund eines Mangels an Alternativen für die Freizeitbeschäftigung. Das MainOffice hat den großen Vorteil einer beachtlichen Sportanlage, die neben einem größeren Fitnessraum auch ein Außenspielfeld mit Kunstrasen umfasst. Dort spielen die Kollegen regelmäßig Badminton oder Fußball. Und wenn Frauen mitspielen, ist das immer eine besondere Freude für das afghanische Wachpersonal, das von dem nahestehenden Wachturm aus einen guten Blick auf die in Sportmontur nur vergleichsweise spärlich bekleideten Westlerinnen werfen kann. Natürlich gibt es die Anweisung, das nicht zu tun. Ebenso natürlich werden diese Art Anweisungen aber auch wann immer möglich missachtet.
“Danke, ich brauche auch nichts weiter.”, stimmt Mark ein. “Eine andere Sache, Christa. Was ist mit dem Artikel?”
Christa zieht die Augenbrauen hoch und bemüht sich, milde zu lächeln. “Das wird offenbar nichts.” sagt sie, “Die von der Öffentlichkeitsarbeit bestehen darauf, dass der Artikel nicht veröffentlicht wird. Wahrscheinlich ist ihnen die Sache mit den Amerikanern zu heikel.”
“Aha.” sagt Mark etwas irritiert. Er ist einerseits enttäuscht, da die Ablehnung bedeutet, dass ein wesentlicher Teil seiner Arbeit der letzten zwei Monate nicht den krönenden Abschluss findet, den er sich erhofft hatte, nämlich eine größere Veröffentlichung. Für ihn, den Autor des Artikels, ist das ein bisschen so wie eine Fehlgeburt. Man betrachtet das heranwachsende Leben eine Weile, freut sich auf die Geburt, bei einem Artikel eben die Veröffentlichung, auf die es beim Verfassen ja ankam — und dann bleibt diese aus. Andererseits ist Mark auch ein bisschen erleichtert. Sein Artikel befasst sich mit dem Ausmaß von Korruption in Afghanistan und deren Hintergrund. Dabei hat er es auch nicht vermieden, über Verantwortlichkeiten zu schreiben, was in diplomatischer Hinsicht natürlich nicht unbedingt empfehlenswert erscheinen mag. Und das hatte ihm tatsächlich etwas Unbehagen bereitet.
Vereinfacht gesagt geht es dabei um Folgendes: Nach dem Einmarsch der Alliierten in 2001 und der Vertreibung der Taliban, vornehmlich nach Pakistan, bestand die Notwendigkeit, das Land wieder regierbar zu machen. Wie immer in vergleichbaren Situationen lag es dabei natürlich nahe, auf die Kräfte zurückzugreifen, welche sich bislang in Opposition zu den Taliban gestellt hatten. Viel Auswahl gab es dabei freilich nicht, da die Taliban fast das gesamte Land eisern regiert hatten. Nennenswerte oppositionelle Kräfte fanden sich — abgesehen von der schlecht organisierten Opposition im Ausland — nur noch im Norden des Landes. Und diese galten auch gleichzeitig als die mächtigsten Kräfte, da sie den stärkeren Rückhalt unter der Bevölkerung zu genießen schienen. Mit diesen Kräften also traten die Alliierten unter der Führung der USA recht schnell in einen Dialog. Dabei glaubte man anscheinend tatsächlich, dass der anstehende Wiederaufbau des Landes lediglich eine Frage der Vertreibung der Taliban und der Verhinderung ihrer Neugruppierung sei. Hier zeigte sich nach Marks Dafürhalten derselbe Fehler, den die USamerikanische Interventionspolitik immer wieder gerne macht: Man denkt, einfach nur die alten Machthaber beseitigen zu müssen und schon würde das “befreite” Land zwangsläufig blühen. Es läuft dabei immer nach dem gleichen Muster: Der Westen sucht sich die für ihn verlässlichsten Gesprächspartner heraus und verhandelt dann nur noch mit denen. Der Rest wird ausgeschlossen und damit dazu provoziert, das Ganze als illegitim zu verurteilen. Die Parteien, welche ihre Macht durch den Westen erhalten haben, verurteilen die Opposition nun ihrerseits, bekämpfen sie und zwingen sie in der Folge mitunter sogar in die Illegalität, weil sie ihren Einfluss fürchten. Nun nimmt die verfolgte Partei Zuflucht außerhalb der Städte und versucht, das Land gegen die Stadt aufzuhetzen. Jedes Argument ist dabei gut genug, besonders das der Religion und der Tradition, indem man sich auf alles Rückständige, Obskure und Emotionale stützt, das den Charakter der Landbevölkerung so stark bestimmt. Verschwörungstheorien und Gerüchte werden gezielt verstärkt oder gar lanciert, um das Reaktionäre der ländlichen Bevölkerung zu entfesseln. Irak und Libyen sind neben Afghanistan nur zwei weitere Beispiele für dieses Muster. Die Gründe, die Verschwörungstheorien insoweit liefern, können für sich häufig auch eine gewisse Folgerichtigkeit in Anspruch nehmen. Mark hält viel davon daher für wahr oder immerhin für möglich. Unterm Strich sieht er jedoch nicht nur eine Begründung, sondern derer gleich mehrere, die miteinander zusammenspielen — ein komplexes System aus menschlicher Gier, Unzulänglichkeit, politischem Kalkül, oberflächlich geratenem Gutmenschentum und echtem Mitgefühl.
In gewissem Umfang reichten die US-amerikanischen Beweggründe zurück in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, in der die Amerikaner relativ leichtes Spiel mit Nachkriegsdeutschland hatten. Viele der alten Kader konnten dort für den Neuaufbau eingespannt werden und die kulturelle wie wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands verlief fast wie von selbst. Diese positive Erfahrung im tiefsten Europa hatte den Amerikanern zweifellos das nachhaltige Gefühl gegeben, Systemumstürze seien ohne große Schwierigkeiten möglich und vielversprechend, und so wirkte diese Erfahrung bei allen außenpolitischen Entscheidungen immerhin noch mit. Darüber hinaus existiert in den USA eine mächtige politische Lobby, der jede militärische, jede bewaffnete Auseinandersetzung nur allzu willkommen ist. Nicht nur, um die US-Armee möglichst effektiv zu halten — jeder Militär würde wohl behaupten, dass eine Armee, die mehr als zehn Jahre nicht gekämpft hat, ineffektiv ist. Sondern natürlich auch, um die einflussreiche Waffenindustrie am Laufen zu halten oder deren Wachstum sogar noch zu beschleunigen. Aber der wesentliche Grund für die Kurzsichtigkeit lag wohl darin, dass sich die Bush-Administration gezwungen sah, nach den Anschlägen auf die Twin-Towers schnell zu reagieren. Der unbeholfene Präsident aus Texas, der, selbst wenn 9/11 ein Inside-Job gewesen sein sollte, nach Marks Meinung sicher nicht eingeweiht war, konnte natürlich nicht anders reagieren als eben in Wild-West-Manier. Insoweit fehlte den Amerikanern also schon in Anbetracht ihrer innenpolitischen Situation die Einsicht in die Komplexität ihres außenpolitischen Vorhabens. Die Opferbereitschaft im amerikanischen Volk war trotz des Vietnamtraumas, trotz der Schmach von Somalia und trotz des Schwurs, dass nie wieder amerikanisches Blut auf fremdem Boden vergossen werden sollte, wiedererwacht.
Der militärische Einsatz wurde zunächst so geplant, dass möglichst wenig internationale Truppen (sie sollten allerdings später auf rd. hundertdreißigtausend Mann ansteigen) eingesetzt werden müssten, der Hauptteil der Arbeit am Boden also von afghanischen Kampfverbänden übernommen werden sollte — natürlich unterstützt durch internationale Luftschläge. Aus diesen Gründen war also ein Pakt mit den afghanischen Warlords, denselben Leuten, die vor der Machtübernahme der Taliban das Land in unerbittlichen Verteilungskämpfen in Schutt und Asche gelegt hatten, nun das Mittel alliierter Wahl.
Darunter ist etwa Abdul Raschid Dostum, der während der sowjetischen Besatzungszeit zum General der afghanischen Armee aufstieg. Kurz nach dem 11. September 2001 soll Dostum über Satellitentelefon in Washington angerufen und den USA seine Unterstützung dabei angeboten haben, auf die Taliban Jagd zu machen. Wenige Wochen später kam es dann auch tatsächlich zum Einmarsch mithilfe Dostums. Wie gesagt, wollten die Amerikaner den Einsatz zunächst sehr klein halten, im Wesentlichen mit Präzisionsbomben aus der Luft und nur mit wenigen Truppen am Boden führen. Alles begann dazu in Mazar-e-Sharif, der Hauptstadt der Provinz Balch, einer der nördlichen Zentralprovinzen und aufgrund ihrer Lage wesentlich für das gesamte Land. Sie sollte als erste von den Taliban befreit werden. Mitte Oktober 2001 landet dort eine Eliteeinheit von US-Soldaten mit einem Hubschrauber. Das Problem aber: weder die Amerikaner noch Dostum hatten Autos; die Amerikaner hatten noch kein schweres Material im Land und Dostum und seine Männer hatten nur Pferde. Man beschließt also kurzerhand, auf die Pferde zu setzen, was aber ein weiteres Problem erzeugt: die meisten US-Soldaten können nicht reiten. Nun ist Dostum, der Führer der usbekischen Ethnie in Afghanistan, die sich als Nachfolger Dschingis Khans betrachtet, ein brillanter Reiter, er ist ein Meister des Buzkaschi, der afghanische Nationalsport zu Pferde. Bei diesem Spiel ist es Ziel, zu Pferde eine tote Ziege vom Boden aufzunehmen und dem Preisrichter vorzulegen. Das klingt einfach, ist es aber nicht, da man gegen mindestens zwanzig Gegenspieler antritt (es ist schon von Spielen mit mehreren hundert Spielern berichtet worden), denen de facto alles erlaubt ist, auch der Einsatz der Reitpeitsche und der Fäuste, um einen daran zu hindern, und um es selbst zu schaffen. Ein Spiel kann dabei mehrere Tage dauern. Auf den weiten staubigen Steppenfeldern tat sich der kräftige Dostum immer hervor und war regelmäßig der Sieger. Denn er ist zu Brutalität fähig wie kaum ein Zweiter. Als einer seiner Soldaten beispielsweise des Diebstahls bezichtigt wurde, ließ Dostum ihn auf die Ketten eines Panzers binden und ihn vor der versammelten Mannschaft im Hof seines Hauptquartiers platt walzen. Der Panzer verteilte Blut und Körperteile im gesamten Hof.
Dostum wurde von den Russen in den Achtzigern als Soldat ausgebildet. Er machte sich dann schnell einen Namen als Verräter. Erst war er mit den Kommunisten, dann, als das Blatt sich gegen sie wendete, gegen sie, dann mit den Tadschiken gegen die Paschtunen, dann mit den Paschtunen gegen die Tadschiken. Seine Truppen plündern, rauben und vergewaltigen, wann immer er sie lässt. Und er lässt sie oft.
Dieser Dostum beschließt also, den US-Soldaten das Reiten beizubringen. Mit der Unterstützung durch amerikanische Luftangriffe ging es dann los. Schon bald waren die Taliban aus Mazar-e-Sharif vertrieben.
Heute ist Dostum Vizepräsident Afghanistans. Wer aber glaubt, dass ihn, der nicht lesen und schreiben kann, das Amt domestizieren würde, irrt. Zuletzt soll er etwa einen Rivalen aus der eigenen Partei der Nationalen Muslimischen Bewegung Afghanistans, einen gewissen Ahmad Ishchi, am Rande eines Buzkaschi-Turniers von seinen Leibwächtern zusammenschlagen, entführen und vergewaltigen lassen haben.
Der Pakt mit solchen Warlords wie Dostum mochte zwar für das gesetzte Ziel der Vertreibung der Taliban effektiv gewesen sein. Er machte es aber schon von vornherein praktisch unmöglich, die Warlords und ihre Leute für all die Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen, die sie früher begangen hatten und auch weiter unternahmen. Dieser Umstand wiederum führte und führt zu erheblicher Frustration unter der Bevölkerung, die ihren Wunsch nach Gerechtigkeit hinsichtlich der erlebten Gräueltaten endgültig unbeantwortet sehen muss. Ferner wurde Korruption dadurch von Anfang an de facto legitimiert, da die Warlords nicht nur bereits in korrupte Machenschaften verwickelt waren, sondern diese unter dem Schutzschirm der Alliierten sogar noch weiter ausbauen konnten. Sie terrorisierten die Bevölkerung beispielsweise weiter durch illegale Landnahmen, illegale Kontrollpunkte und Abgaben, handelten weiter mit Drogen und Waffen und das alles nicht etwa an den neuen Polizeikräften vorbei, sondern mit deren Unterstützung oder sogar durch diese, da die durch die Warlords korrumpierte Neuordnung der Polizei in weiten Teilen nicht mehr als eine gewalttätige Miliz hervorbrachte, die bis dato schlicht als Erfüllungsgehilfe der Warlords fungiert.
Im Ergebnis verhinderten die Alliierten so von Beginn an selbst, dass der afghanische Staat ein Gewaltmonopol begründen konnte, was aber ein unabdingbarer Eckstein für eine demokratische Entwicklung ist. Das ist insofern besonders tragisch, als die Taliban in den neunziger Jahren Legitimation und Unterstützung seitens der Bevölkerung ganz besonders deshalb für sich beanspruchen konnten, weil sie exakt das gerade beschriebene räuberische Verhalten der Warlords, das diese nun also sogar noch geschützt und unterstützt durch die Alliierten fortführten, angeprangert und bekämpft hatten.
Und schließlich begann auch die neue politische Klasse, deren Vertreter in der Hauptstadt wie in den Provinzen häufig nur aufgrund ihrer Verbindung zu den Warlords zu Rang und Namen kamen, sich an dem Verhalten der Warlords zu orientieren, und bediente sich ebenso als Oligarchen an den Milliarden, die durch die gleichsam spendable wie gegenüber der Korruption anscheinend gleichgültige internationale Hilfe seit 2001 ins Land geflutet wurden.
Einer der insoweit vielleicht eindrücklichsten Fälle ist sicher der Muhammad Zia Salehis. Als die USA 2010 versuchten, ein weitreichendes Korruptionsnetzwerk zu enttarnen, wurde besagter Salehi, einer der engsten Berater des damaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karzai und Administrationschef des Afghanischen Nationalen Sicherheitsbüros, als ein wesentliches Mitglied des Netzwerks von afghanischen Kräften festgenommen. Kurz nach der Festnahme telefonierte Salehi mit Karzai, der daraufhin, obwohl er die Festnahme zuvor eigens autorisiert hatte, Salehis Freilassung anordnete und das Verfahren einstellen ließ. Noch eindrücklicher wird der Fall, wenn man sich vor Augen führt, dass Salehi auf der Gehaltsliste der CIA gestanden hat und für diese regelmäßig Säcke voller Bargeld an die afghanische Regierung übergeben haben soll, mit denen sich die CIA die Gewogenheit der Regierung und anderer wichtiger Spieler auf dem afghanischen Feld zu sichern suchte. Die CIA hatte also offenbar eine ganz eigene Agenda, die der offiziellen Anti-Korruptions-Strategie der USA vollkommen entgegenlief. Die USA schafften es auf diese Weise, sich offiziell für ein stabiles Afghanistan einzusetzen und inoffiziell genau diese Stabilität selbst zu unterminieren. Die Tragik dessen liegt darin, dass viele Afghanen keine andere Möglichkeit sahen, als sich mit Gewalt gegen korrupte afghanische Amtsträger zu richten, deren Korruptheit durch das CIA gestützt und angefeuert wurde, wodurch sie aber zum Ziel der regulären US-Aufstandsbekämpfung wurden.
Und die afghanischen Akteure haben natürlich keinerlei Interesse daran, dass sich an der bestehenden Situation, die sie reicher und reicher werden lässt, irgendetwas ändert. Nach ihrem Dafürhalten soll sich das Land weder entwickeln, so dass die Milliarden ungebrochen weiter ins Land fließen, noch soll die internationale Gemeinschaft ihr Interesse an Afghanistan verlieren, so dass Terror und Aufstand also nicht beendet werden dürfen.
Es mag einen verwundern, aber bis heute scheint einigen der internationalen Akteure in Afghanistan und zuhause dieser Zusammenhang nicht oder nicht hinreichend klar zu sein. Auch die USA sind noch dabei, die von ihnen gewollt oder ungewollt gemachten Fehler zu begreifen. Und dies obwohl schon in der Ära Karzai eindrückliche Erfahrungen gemacht worden sind, die das bereits eingetretene Ausmaß der Misere verdeutlichten. So etwa im Fall von Mohammad Akhundzada, dem früheren Provinzgouverneur in Hilmend, einer im Süden Afghanistans liegenden Region. Die Provinz, die im Wesentlichen von Paschtunen bewohnt wird, ist insbesondere für ihre Opiumproduktion bekannt, und dafür, in weiten Teilen von den Taliban regiert zu werden. Akhundzada war offenbar aktiv in den Drogenhandel eingebunden, und zwar mit Unterstützung der Polizei, die sich wie eine ungezähmte Miliz verhielt und die Menschen tyrannisierte, anstatt sie zu beschützen. Mit diplomatischer Unterstützung der Briten schafften es die Amerikaner schließlich, den damaligen afghanischen Präsidenten Karzai davon zu überzeugen, Akhundzada abzusetzen. Akhundzada hatte aber viel Einfluss und war so mächtig, dass Karzai es für notwendig hielt, ihm eine Kompensation anzubieten und ihn zum Senator in Kabul zu machen. Die Versetzung Akhundzadas führte aber zu erheblicher Instabilität in Hilmend, welche die Taliban für sich zu nutzen wussten und ihre Macht dort weiter ausbauten. Unterm Strich wurde bewirkt, dass ein wahrscheinlich Hochkrimineller nun Mitglied des Senats war und die Taliban gestärkt wurden.
Vor dem Hintergrund solcher Geschichten wurde die Chance verpasst, ein nationales Gefühl zu erzeugen und die Probleme gemeinsam anzugehen. Der Eigendünkel und die Selbstbereicherung der neuen Machtelite führte dazu, dass das Volk sich von jedem übergeordneten Gemeinschaftsgedanken abwendete und keine Alternative dazu sah, wieder in Stammespositionen zurückzufallen.
Die mit der systematischen Durchsetzung Afghanistans durch kriminelle und korrupte Strukturen nach wie vor einhergehende weitreichende Verschwendung von finanziellen Mitteln und Arbeitskraft stört in der Entwicklungshilfe aber kaum jemand. Denn hier gehen die Uhren vollkommen anders als etwa in der Wirtschaft. Kommt es in letzterer darauf an, mit möglichst geringem finanziellen Einsatz möglichst großen Erfolg zu erzielen, scheint die Entwicklungshilfe genau andersherum zu funktionieren: Die Entwicklungshilfeorganisationen haben de facto auf eigentümliche Weise tatsächlich ein Interesse daran, mit möglichst viel Geld möglichst wenig zu erreichen. Das gründet darauf, dass die Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklungshilfe denen in der freien Wirtschaft diametral entgegengesetzt sind. Zwar ist es mittlerweile in beiden Bereichen notwendig, möglichst viel Umsatz zu machen. Auch die Entwicklungshilfe ist heute in Deutschland aufgrund der in den letzten Jahrzehnten heftig vorangetriebenen Modernisierung und Rationalisierung der öffentlichen Hand nur noch unternehmensmäßig organisiert. In der Entwicklungshilfe ist es aber so, dass sie sich selbst erübrigt, wenn sie tatsächlich erfolgreich ist. Während also beispielsweise Herstellung und Verkauf von Mobiltelefonen nicht zu einer endgültigen Sättigung des Marktes führt, sondern nach der Marktlogik eher zur Nachfrage nach immer neuen Entwicklungen und Produktstufen, wäre die Arbeit der Entwicklungshilfe-Organisation dann zu Ende, wenn das betreffende Land den angestrebten Entwicklungsstatus erreicht hat. Wenn man also, wie in Deutschland zwischenzeitlich geschehen, die Entwicklungshilfe so organisiert, dass sie wie ein Wirtschaftsunternehmen mit Kennzahlen und Umsatzzielen funktioniert, muss man quasi zwangsläufig zu merkwürdigen Ergebnissen kommen. Natürlich ist dabei nicht jedem einzelnen Mitarbeiter vorzuwerfen, dass er die der Entwicklungshilfe gesetzten Ziele sabotieren würde. So offenkundig wirkt die sich dahinter verbergende Psychologie nicht, und viele sind vollen Herzens dabei. Aber der Vergleich mit früher macht die heutigen Probleme deutlich. Wer in der Entwicklungshilfe tätig war, hatte einen sicheren Job, musste sich nicht viele Sorgen darum machen, wie er im nächsten Jahr seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Damit konnte er sich tatsächlich erlauben, in seiner Arbeit mutig zu sein, zu probieren und gewisse Risiken einzugehen. Ferner arbeitete man für staatliche Organisationen, die nicht als Unternehmen organisiert und also den marktwirtschaftlichen Gesetzen nicht unterlegen waren. Heute dagegen hat auch in der Entwicklungshilfe kaum jemand mehr einen festen Arbeitsvertrag; und wer ihn hat, wurde ausgewählt und wird dazu angetrieben, zur stetigen Erhöhung des Umsatzes des Unternehmens beizutragen, und zwar auch noch so, dass man sich dabei am besten nicht selbst das Wasser abgräbt. Es ist viel Geld in der Entwicklungshilfe vorhanden — und das besonders in Ländern wie Afghanistan, die politisch von erheblichem Interesse sind. Die neuen Gesetze der Entwicklungszusammenarbeit, wie sie heute genannt wird, erleichtern und provozieren aber dessen Verschwendung.
Im Ergebnis haben also die Alliierten mit ihren Milliarden, mehr oder minder sehenden Auges, eine wesentliche Rolle dabei gespielt, den neuen afghanischen Staat nicht nur zu einem machtlosen Spielball der lokalen, regionalen und internationalen Kräfte zu machen, der seinem Zweck, dem afghanischen Volk zu dienen, nicht nachkommen kann, sondern ihn damit von vornherein für viele Afghanen im Ergebnis auch vollkommen inakzeptabel gemacht. Was sollte das einfache afghanische Volk von dem Schauspiel halten? Versprechungen von Menschenrechten, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle blieben so allzu hohl und werden nur noch als Beweis für die Doppelmoral des Westens gedeutet, die sich häufig als Fluch einer Einstellung verdankt, die die Welt als sein bloßes Abbild begreift. Das Resultat ist in Afghanistan kein anderes als in anderen Ländern, in denen die US-Amerikaner und Westalliierten eingriffen: Sie werden nahezu überall von einem wesentlichen Teil der Bevölkerung verteufelt, nachdem dieses seine Erfahrungen mit ihnen gemacht hat.
“Ich habe mir deinen Artikel übrigens jetzt auch einmal in Ruhe durchlesen können.”, sagt Christa, “Vieles stimmt sicher, aber ich finde… ich finde, dass die Afghanen sich auch an die eigene Nase fassen müssen.”
“Klar!”, erwidert Mark, “Das denke ich auch. Aber ich glaube, dass man da realistisch bleiben muss. Die einfachen Leute haben gar nicht die Möglichkeit, sich mit den Dingen differenziert auseinanderzusetzen. Natürlich sind sie enttäuscht und sauer, wenn sie sehen, dass sie von einigen Oligarchen ausgebeutet werden. Und wenn sie dann noch sehen, dass diese Oligarchen auch noch von der internationalen Gemeinschaft mit ihrer Entwicklungshilfe-Industrie beschenkt und beschützt werden, wenden sie sich natürlich mit Ekel ab. Dieser Ekel wandelt sich dann aber nicht in einen politischen Schrei nach sozialer Gerechtigkeit um, was in unserer säkularisierten Gesellschaft passieren würde, sondern es wird ein religiöser Schrei, weil man keinen anderen Begriff von Gerechtigkeit hat. Diese Oligarchen sind für sie genauso gottlos wie die Westler, sie sind die Handlanger der ungläubigen Westler.” Während er spricht, nestelt Mark etwas an seinem linken Hosenbein herum; über seinen Artikel zu sprechen macht ihn nervös. Tamara dreht sich zum Fenster um, ohne etwas zu sagen. Mark würde ihre Meinung aber gerne hören und glaubt, das durch weiteres Ausholen provozieren zu können: “Das Problem mit diesen Oligarchen ist, dass sie keine echte Bourgeoisie abgeben können. Diese Leute gefallen sich nur in der Rolle des Gebieters und des Genießers. Der dynamische Aspekt eines klassischen Bourgeois, Avantgarde, Pionier, Entdecker und Erfinder zu sein, fehlt vollends. Diese Leute wollen keinerlei Risiko eingehen, wenn es um ihre Pfründe geht. Sie essen nur von Bäumen, die andere gepflanzt haben. Selbst kümmern sie sich nicht ums Pflanzen. Sie wollen schnelle Profite für die eigenen Taschen, die sie in nichts anderes als Luxusgüter und maximal noch in Anlagegeschäfte ausländischer Banken investieren wollen. Sie vertrauen der afghanischen Zentralregierung noch weniger, als es das afghanische Volk tut oder die Internationalen. In demselben Maß, in dem sie dem Staat und seinem Volk all ihren Reichtum und ihre Privilegien zu verdanken haben, sind sie ihnen gegenüber respektlos und undankbar. An das Volk geben sie nur Krümel weiter und sichern ihre Herrschaft dadurch, dass sie weitere Krümel an Handlanger abgeben. Diese dekadente Elite, die das Land im Mangel hält, kann sich auch nicht mehr entwickeln oder gar Etappen überspringen. Sie muss wahrscheinlich erst aussterben, bis wirkliche Veränderung geschehen kann.”
Beim Recherchieren für den Artikel hatte Mark viel Neues über Afghanistan und dessen Misere gelernt. Natürlich waren ihm gewisse Umstände schon vorher klar. Aber er hatte bis dato nur einen Teil des Bildes gesehen, das sich für ihn nun langsam immer mehr vervollständigte. Karzai, der erste Präsident Afghanistans nach dem Einmarsch der Alliierten 2001, war für die Oligarchen des Landes der perfekte Führer. Weit davon entfernt, die Bedürfnisse des Volkes im Auge zu haben und das Land durch wirtschaftlichen Aufbau zu einen, hat er es mit massiver internationaler Hilfe auf allen Ebenen geschafft, ein antidemokratisches Regime einer Elite profitgieriger und korrupter Nutznießer aufzubauen und zu festigen. Und dieser Elite kommt es weder auf die Ethnie noch auf die Religion an. Das Syndikat der individuellen Bereicherung ist sogar ganz kosmopolitisch, da es ihm nicht darauf ankommt, mit wem es Geschäfte macht. Zwar wurde Karzai diplomatisch dazu gebracht, das Thema Korruption formal auf die politische Agenda zu bringen. Er ließ sogar zwei Anti-Korruptionsbehörden schaffen. Die erste wurde jedoch schon schnell nach ihrer Gründung einfach wieder aufgelöst, und die zweite blieb im Wesentlichen untätig — aufgrund, wen wundert’s, fehlender politischer Unterstützung und interner Korruption.
Während also die Korruption in Afghanistan grassiert, die Skandale sich häufen, die Oberen sich bereichern, die Abgeordneten schieben, gibt es kaum einen Polizisten, kaum einen Ermittler, der nicht an diesem Selbstbedienungsladen beteiligt sein will. Wo sie sich nicht verschlechtert, stagniert dagegen die Situation des Volkes. Die Verhältnisse der Bauern und der Arbeitslosen, des Großteils der afghanischen Bevölkerung also, haben sich entgegen aller Versprechungen nicht um einen Deut verbessert. Und so wird sich das Volk langsam des Verrats ihrer Führer bewusst. Es versteht, dass Reichtum nicht die Frucht ehrlicher Arbeit, sondern das Produkt eines organisierten und von höchster Hand protegierten Diebstahls ist. Die gesamte Karzai-Ära ging schließlich in 2014 zu Ende, also weit mehr als ein Jahrzehnt nach dem alliierten Einmarsch, ohne dass der afghanische Staat auch nur einen ernsthaften Schritt zur Bekämpfung der mittlerweile systemischen Korruption getan hätte. Und das bringt das Volk gegen die selbstbezogene Elite und gegen den diese unterstützenden Westen auf. Die Situation gleicht der, welche sich in vielen Staaten Nord- und Südafrikas nach der Dekolonisierung ergeben hat. Dass diese Staaten noch heute an ihrer sozialen Befreiung arbeiten, lässt nichts Gutes für Afghanistan vermuten. Je mehr sich die schutzlose Bevölkerung der skandalösen und unerbittlichen Bereicherung des Eliten-Syndikats zulasten des Volkes bewusstwird, desto mehr muss es sich vom Staat abwenden, und umso mehr muss das zwangsläufig zu einer Radikalisierung führen, die ein friedliches Morgen immer unwahrscheinlicher werden lässt. Die Polit-Mafia Afghanistans ahnt natürlich, dass sie ihr Spiel nicht unbegrenzt fortsetzen können wird. Der Wille, davon vorher maximal zu profitieren, ist jedoch deutlich größer. Er übermannt häufig auch die, die sich zunächst voll Lauterkeit und dem Duktus der Unbestechlichkeit für die Sache einsetzen wollten, in Anbetracht der schieren Macht der korrupten Netzwerke und ihrer mal perfiden, mal brutalen Überzeugungsmethoden aber nicht dauerhaft widerstehen können. Hinzu tritt eine fatale Dynamik kollektiven Handelns. Je mehr Menschen davon überzeugt sind, dass das System aufgrund seiner andauernden Schwäche irgendwann zusammenbrechen wird, und je mehr sie in diesem Rahmen korruptes Verhalten anderer beobachten, desto mehr fühlen sie sich selbst zu korruptem Verhalten angestiftet. Nur noch wenige können sich dann an der Überzeugung festhalten, dass sie durch ihr Verhalten ein positives Beispiel dagegensetzen könnten. Das ist nun genau der Hintergrund, den der radikale Islam braucht, um sein Narrativ vom dekadenten Westen, von dessen hohlen Werten, hinreichend abheben zu können. Inkonsequenz war schon immer die Achillesferse des liberalen Denkens. Viele der jungen Muslime sehen keinen anderen Ausweg, als sich dem Extremen zuzuwenden. Als Mark das erste Mal davon gehört hatte, dass sich viele der jungen und selbst gebildeten Menschen in Afghanistan trotz all der Hilfen radikalisierten, konnte er sich zunächst keinen Reim darauf machen. Jetzt kann er es.
Mark erscheint das als einer der tragischsten Aspekte des Ganzen: Die Tatsache, dass der Westen seine Sympathien weltweit einbüßt, weil er seine Werte für kurzfristige Ziele verkauft. Es geht um das Gewinnen, um das Oberhandhaben oder -erreichen. Ein Interessenkonflikt wird dann nicht mehr aufgrund von Werten aufgelöst, sondern vermittels einer Strategie gewonnen oder verloren. Ganz so wie ein Spiel. Der stärkste Spieler gewinnt. Dabei ist vollkommen unerheblich, an welchen Werten er sich orientiert, solange er die Regeln einhält. Und auf politischer Ebene kommt aber noch hinzu, dass es dort kaum ein durchsetzungsfähiges Regelungssystem gibt, dass das existierende Bisschen auch noch zu einfach, teilweise sogar provokativ, umgangen werden kann. Es fehlt an einem neutralen Schiedsrichter.
Je mehr Mark das einsah, desto mehr zweifelte er an der Afghanistan-Mission. Wie schon die Russen versuchten, gegen die Mujaheddin zu gewinnen, so versucht der Westen die Taliban zu besiegen. Der Westen mit seinen lokalen Verbündeten kämpft für seine kurzfristigen Interessen: Sicherheitspolitik, also ‘Sicherheit, die am Hindukusch verteidigt wird’, Wirtschaft und Bodenschätze, politisch-strategischer Einfluss in der Region. Die Mudschaheddin und die Taliban kämpfen nicht selten für ihr Leben, ihr Land, ihre Ideale.
Nachdem der Kalte Krieg entschieden war, sahen sich die USA als die Sieger und glaubten, ihren Willen nun dem gesamten Globus aufdrücken zu können. Diese Selbstsicherheit machte die USA unvorsichtig und führte dazu, dass sie nun davon überzeugt waren, dass ihr Wertenarrativ weltweit unanfechtbar geworden war und sie nun ihre kurzfristigen Interessen zukünftig ohne Rücksicht auf ihre Werte durchsetzen könnten. Das Versprechen der Freiheit erschien so häufig nur noch als Farce. Das war ein schwerer Fehler, da die UdSSR nicht der letzte mögliche Gegner war. Schon bald sollten sich neue erheben. Und je kurzfristiger und werteunabhängiger die verfolgten Interessen, desto schärfer die Gegenwehr. Das brachte die USA in eine vollkommen neue Situation. Während sie im Kalten Krieg noch klar sagen konnte, was sie nicht wollte, nämlich den Kommunismus, hatte sie nach dem Kalten Krieg kein klares Feindbild mehr. Das kurzfristige Verfolgen ihrer Interessen gegenüber dem Rest der Welt brachte sie aber immer mehr und mehr in die Situation, dass ihre Gegenüber die USA als Feindbild ansahen. Denn die USA und mit ihr der Westen verfolgten nur noch Interessen und keine Werte mehr. Niemand wusste mehr, für was die USA und der Westen eigentlich stehen. Und damit verloren die Entscheidungen nicht nur gegenüber den anderen, sondern — was vielleicht noch wichtiger ist — auch gegenüber der eigenen Bevölkerung an Durchsetzungskraft. Langfristig können die USA und der Westen so also nur verlieren. Mark ist sich daher sicher, dass jede Entscheidung, jedes Ziel, das eine Gemeinschaft, sei diese nun ein Staat oder ein Staatenbund, verfolgt, schon aus diesem Grund immer konsistent mit den Werten der Gemeinschaft übereinstimmen muss. Das allein gibt Verlässlichkeit, und Verlässlichkeit allein kann auf lange Sicht Vertrauen schaffen. Interessen und Werte dürfen nicht miteinander verwechselt werden, sonst kann jeder Gegner das im eigenen Interesse nach Belieben ausnutzen und die Werte erfolgreich diskreditieren, bekämpfen und schließlich auch auslöschen.
Christa hat Mark noch immer den Rücken zugewandt. Tamara schaut stumm und anscheinend etwas gedankenverloren auf einen ihrer Monitore und nippt dabei an ihrer Light-Cola. An Christa vorbei schaut Mark noch einmal zu der Familie auf dem Dach gegenüber. Die Kinder spielen noch immer auf dem Dach im kühlen Wind. Irgendetwas haben sie dort gefunden, um das sie kniend herumsitzen. Der Topf köchelt noch vor sich hin. Von der Mutter oder irgendeinem anderen Erwachsenen ist nichts zu sehen. In der Ferne beginnt nun der erste Muezzin zum Mittagsgebet zu rufen, gleich würden auch die aus der Nachbarschaft einstimmen und ein Chor der Rufe sich über der gesamten Stadt ausbreiten.
Mit verschränkten Armen und laut durch die Nase ausatmend dreht sich Christa zu Mark und Tamara um. Sie schaut Mark kurz etwas mitleidig an, so als wollte sie sagen, dass er sich besser nicht den Kopf zerbrechen sollte. “Ich gehe dann mal wieder in mein Büro.”, sagt sie “Wir können ja heute Abend miteinander was kochen.”
“Ich bin doch bei Conny im MainOffice.”, sagt Tamara.
“Ahja, na dann eben nicht.” Christa wirkt fast ein bisschen beleidigt. Das ist typisch für sie, wenn einer ihrer Vorschläge abgelehnt wird. Sie scheint die Dinge schon automatisch persönlich zu nehmen.
Mark rechnet damit, dass sie nun immerhin mit ihm wird kochen wollen. Doch weit gefehlt. Ohne weitere Bemerkung verlässt Christa Tamaras Büro. Tamara und Mark lächeln sich amüsiert an.
Mark ist für einen kurzen Moment unentschieden, ob er in das Gespräch mit Tamara noch einmal einsteigen möchte, entscheidet sich dann aber dagegen. “Du musst mir in Ruhe mehr darüber erzählen, dass du auch gehst.”, sagt er im Aufstehen.
“Klar, mach ich noch.”
“Komm doch bei mir vorbei, bevor du nachher ins MainOffice fährst, ja?”
“Gut, dann bis später.”
Noch ist etwas Zeit bis zum Mittagessen. Mark geht zurück in sein Büro und setzt sich vor seinen Bildschirm, beantwortet erst ein paar zwischenzeitlich eingegangene Emails und arbeitet dann an seinen Kommentaren zum Entwurf des neuen afghanischen Strafgesetzbuches weiter. Sein Augenmerk gilt dabei insbesondere der Garantie der Menschenrechte, das Fachgebiet für das er nicht nur viel Expertise besitzt, sondern auch innerlich brennt. Heute erscheint Mark aber alles ein bisschen zäh, selbst die Menschenrechte. Er kann sich kaum auf seine Arbeit konzentrieren. Daher öffnet er immer wieder seinen Internetbrowser, um sich etwas berieseln zu lassen. Gefühlt schon das zehnte Mal hat er in der letzten halben Stunde die Seite von ToloNews geöffnet und sich dort Zerstreuung gesucht. ToloNews ist eine der wesentlichen afghanischen Nachrichtenseiten. Naturgemäß sind daher nur wenige der Meldungen wirklich unterhaltsam. Aber Mark ist in seinem Pflichtbewusstsein darauf bedacht, zur Ablenkung immerhin irgendetwas Sachnahes zu machen. Wenn er sich auf der wichtigen afghanischen Nachrichtenseite umschaut, erscheint ihm das noch etwas vertretbarer als würde er seine Arbeitszeit mit Shopping oder Filmchengucken verschwenden. In seiner Sehnsucht nach Ablenkung ist er für alles dankbar. Ihm kommt der Gedanke, dass er aus Langeweile sogar für einen Anschlag dankbar wäre. Er verdrängt den Gedanken schnell wieder.
Endlich klopft es an seiner Tür. Eine der Küchenfrauen schaut freundlich hinein und verkündet, dass das Mittagessen aufgetragen sei. Mark fühlt sich erlöst und dankt ihr von Herzen. Als erster erscheint er im Speisesaal des Compounds. Der Koch und die weiteren zwei Küchenfrauen sind gerade noch dabei, das Getränkebuffet zu vervollständigen. Marks erster Blick gilt aber dem Essen auf dem Tisch. Voll Freude stellt er fest, dass es heute wieder mal eine seiner Lieblingsspeisen gibt. Jedenfalls eine seiner Lieblingsspeisen in Afghanistan. Mark ist Vegetarier. In Afghanistan gibt es aber meist Fleisch mit Fleisch und Fleisch. In Anbetracht dessen ist Mark schon zufrieden, wenn es mal ein bisschen Gemüse gibt. Heute aber gibt es nicht nur Gemüse, sondern auch eine Art Soja-Bolognese mit Pasta. Obwohl fleischlos, handelt es sich dabei tatsächlich um ein bekanntes afghanisches Gericht. Fleisch ist natürlich auch für arme Afghanen nicht bezahlbar. Soja hat sich insoweit als eine Alternative für die Armen etabliert. Seine afghanischen Kollegen, unter denen natürlich nicht ein Vegetarier ist, halten das Essen für zu einfach, einige vielleicht sogar für etwas unter ihrer Würde. Als Mitarbeiter in der internationalen Entwicklungshilfe gehören sie zu den Topverdienern in Afghanistan. Die wenigsten wollen sich mit einem Arme-Leute-Essen zufriedengeben. So wird der Koch von den Afghanen immer dazu angehalten, Fleisch auf den Tisch zu bringen. Aber der Koch scheint Mark zu mögen und richtet deshalb immer mal wieder einen vegetarischen Tag ein. Vielleicht liegt es auch einfach an dem Trinkgeld, das Mark ihm von Zeit zu Zeit zusteckt.
Mark bedankt sich überschwänglich bei dem Koch und seinem Team und beginnt damit, sich den Teller zu füllen. Noch durch die geschlossene Tür kündigen sich die ersten Kollegen an, indem sie laut auf dem Gang miteinander lachen. Die Tür geht auf und drei der afghanischen Komponentenleiter sowie Nasir, der Büroleiter betreten den Raum. Das Programm, für das Mark arbeitet, hat insgesamt fünf Komponenten. Die Arbeit mit dem Justizministerium, mit der Polizei, der Rechtsanwaltskammer, dem Religionsministerium und der Zivilgesellschaft. Daneben gibt es die Mitarbeiter, die wie Nasir Verwaltung und Finanzen des Programms sicherstellen. Während Mark als Berater für mehrere Komponenten tätig ist, weil er von Christa auch für Querschnittsaufgaben eingesetzt wird, sind die nationalen und die anderen internationalen Kollegen im Regelfall nur einer Komponente zugewiesen.
Die afghanischen Kollegen begrüßen Mark freundlich und setzen sich zu ihm an die Kopfseite des großen Tisches, der rund dreißig Personen Platz bietet. Hamzi, einer der drei Komponentenleiter, kann sich in Anbetracht des nur vegetarischen Essens einen enttäuschten Kommentar nicht verkneifen. Die beiden anderen tragen ihr kulinarisches Schicksal mit stiller Fassung, denn sie wissen, dass Mark sich über das Essen freut und gönnen es ihm. Nun kommt Tamara hinein. Sie hat ein neues Gesicht im Schlepptau. Mark hatte tatsächlich ganz vergessen, dass heute eine neue Kollegin ankommt. Dabei handelt es sich um Elisabeth, eine Mitarbeiterin, die als Beraterin die Programmkomponente Zivilgesellschaft unterstützen wird. Elisabeth soll verstärkt die Zusammenarbeit mit den Jugendgefängnissen ausbauen, die für eine Resozialisierung junger Straftäter sorgen sollen. Es ist Elisabeths erster Tag im Programm vor Ort. Sie ist gerade vom Flughafen herchauffiert worden.
Die beiden Frauen scheinen sich gut miteinander zu verstehen — was in Anbetracht Tamaras außergewöhnlicher Herzlichkeit allerdings auch nicht anders zu erwarten war. Elisabeth — oder Elli, wie sie sich vorstellt — macht überraschender Weise einen ausgeschlafenen Eindruck. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn die Anreise von Deutschland kann mit An- und Abfahrten zum und vom Flughafen gerne mal zwanzig Stunden dauern. Es gibt keine Direktflüge von Deutschland nach Afghanistan. Reist man über Istanbul, was die meisten tun, startet der Weiterflug nach Kabul erst nach Mitternacht. Wenn man im Flugzeug nicht gut schlafen kann, kommt man erschöpft in Kabul an. Immerhin stellt die GIZ Business-Class-Flüge zur Verfügung. Hat man aber Pech und fliegt Turkish Airlines an dem Tag nur mit einer kleinen Maschine nach Kabul, was durchaus häufiger vorkommt, hat die Business-Class keine Liegesitze. Vielen ist es dann nicht möglich, richtig zu schlafen. Entsprechend zerknautscht kommen sie in Kabul an. Elli hat also entweder Glück gehabt oder ist hart im Nehmen.
“Du bist Mark, nicht wahr?”, spricht sie ihn freundlich an, nachdem sie sich jedem Einzelnen der anwesenden afghanischen Kollegen vorgestellt hat. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie bei ihm ankam, denn im Sekundentakt öffnete sich jetzt die Tür und weitere Kollegen traten ein. “Tamara ist mit mir schon das Gruppenfoto durchgegangen. Ein paar Namen konnte ich mir bereits merken. Internationale sind ja auch nicht so viele hier. Mit den Afghanen wird es aber sicher noch ein Weilchen brauchen.”, lacht sie.
“Ja, klar, ich kenne auch nach zwei Jahren noch nicht alle Namen.”, scherzt Mark. Und das ist auch so falsch nicht. Zwar kennt Mark mittlerweile alle männlichen Mitarbeiter gut. Bei einzelnen der weiblichen Kollegen hat er aber immer noch Probleme. Abgesehen von wenigen, mit denen er gemeinsam arbeitet, hat er nämlich mit den meisten vom Aufgabengebiet her gar nichts zu tun. Und die Frauen bleiben auch sonst meist unter sich. Selbst beim Mittagessen sitzen männliche und weibliche Kollegen regelmäßig getrennt. So kommt kaum Kontakt zwischen den Geschlechtern zustande. Das ist eben der Standard in Afghanistan wie in vielen muslimischen Ländern. Mark schmerzt das besonders, weil er daran glaubt, dass ein unbefangenerer Umgang zwischen den Geschlechtern dem Land sehr guttun würde. Viele der jungen Männer, die sich als Kämpfer rekrutieren lassen, hätten so vielleicht etwas Besseres zu tun. Die in Marks Programm tätigen afghanischen Frauen machen auch grundsätzlich einen sehr aufgeschlossenen Eindruck auf Mark. Jedenfalls gehen sie mit ihm sehr offen um. Das liegt zum Teil sicher an Marks persönlicher Ausstrahlung. Zum anderen aber auch schlicht daran, dass er ein Westler ist, denen gegenüber sich afghanische Frauen in ihrer Weiblichkeit grundsätzlich wohler fühlen. Die besondere kulturelle Ladung, die die Beziehung der Geschlechter zueinander in der muslimischen Welt auf den Schultern trägt, ist gegenüber den Westlern nicht gegeben. Mark hat wohl daher nicht nur einmal den Eindruck gehabt, dass ihm die eine oder andere afghanische Kollegin recht deutlich gemacht hatte, dass sie ihn attraktiv findet — etwas, das sie einem Afghanen gegenüber häufig wahrscheinlich eher hinter dem Kopftuch verborgen halten würde. Ganz besonders stach insoweit eine junge Praktikantin heraus. Sie war erst Mitte zwanzig. Mark ist dagegen schon in seinen Vierzigern und hätte also fast ihr Vater sein können. Allerdings sieht Mark deutlich jünger aus, so dass sich die junge Frau vielleicht einfach nur in seinem Alter getäuscht hatte. Wie dem auch sei. Bei jeder Morgenbesprechung saß sie ihm gegenüber, suchte seinen Blick und schmachtete ihn an. Mark fand sie sehr hübsch und die Vorstellung prickelnd, dass sie allein in sein Büro käme, ihr Kopftuch abnähme und sich einfach auf seinen Schoß setzte. Vielleicht irrte er sich, aber er bildete sich ein, dass sie sich ganz ähnlichen Fantasien hingab. Aber Mark hält sich zurück. Nicht nur wegen des Altersunterschieds. Und auch nicht nur, weil er gerade grundsätzlich einmal für eine Zeit mit allen Beziehungsgeschichten aussetzen möchte. Selbst wenn das alles anders wäre, würde Mark sich kaum auf eine bloße Affäre mit einer Afghanin einlassen. Hierzu wäre er einfach zu feige. Er hätte zum einen Angst, mögliche Erwartungen der Frau zu enttäuschen. Es mag zum Beispiel sein, dass sich hinter der Affäre der Wunsch nach einem besseren Leben im Westen verbirgt, den Mark dann nicht zu erfüllen helfen würde. Vielleicht hätte sie aber auch ernste Absichten und würde ihn heiraten wollen. Vor allem hätte er aber Angst davor, dass sie sich durch die Affäre gegenüber der prüden afghanischen Gesellschaft, vielleicht sogar unter den Kollegen, Probleme aufhalsen würde. Daran möchte er keinen Anteil haben. Noch eher würde er mit einer der vielen Internationalen, ob nun der GIZ oder der anderen Organisationen, etwas anfangen. Vielfältige Affären waren im Kreis der internationalen Community sehr üblich.
Natürlich sind an diesem Tag alle an dem Neuankömmling interessiert. Höflich laden die Afghanen Elli dazu ein, von ihrer Anreise zu erzählen, davon, was sie vorher beruflich gemacht hat und warum sie sich dazu entschieden hat, nach Afghanistan zu kommen. Elli verschafft sich bei allen sofort schon alleine dadurch Respekt, dass jede ihrer Antworten nicht nur präzise und druckreif formuliert ist, sondern sich auch eine Menge Sachkunde und Humor dahinter zu verbergen scheint. Sie verfügt offenbar über einen sehr wachen Geist. Dennoch ist keinerlei Eitelkeit oder gar Überheblichkeit bei ihr festzustellen.
Eines der ungeschriebenen Gesetze in Afghanistan ist es, dass so ziemlich jedes Gespräch früher oder später auch das Thema Islam immerhin streift. So auch heute. Einer der Kollegen hatte Elli dazu angeraten, im Hinblick auf ihre Arbeit mit den Gefängnisanstalten auch um die Kooperation der lokalen Mullahs zu werben, da diesen ein recht großer Einfluss auch auf die Insassen zugesprochen wurde. Elli zeigt sich demgegenüber sehr aufgeschlossen, und das nicht nur, weil sie neu ist. Sie macht klar, dass sie alle Möglichkeiten nutzen möchte, und dass die Religion im kulturellen Kontext Afghanistans auch in ihren Augen ein wesentlicher Faktor sein kann, um die Arbeit zu ergänzen. Offenbar stört sich eine der afghanischen Kolleginnen nun doch einmal an einer von Ellis präzisen Formulierungen. Das Wort ‘ergänzen’ scheint ihr in diesem Zusammenhang missfallen zu haben. Es handelt sich um Souad, die im Programm die Komponente führt, die mit dem Religionsministerium zusammenarbeitet. Souad hat ein Schari’a-Studium absolviert, das sie in Afghanistan genauso für jeden juristischen Beruf qualifiziert wie ein generelles Studium der Rechtswissenschaften. Sie ist für Mark immer eine widersprüchliche Person geblieben. Ganz offenkundig ist sie eine Feministin; keine Gelegenheit lässt sie aus, die Gleichberechtigung der Frau im Islam zu betonen, selbst wenn sie es dafür mit den Formulierungen des Korans nicht immer ganz genau zu nehmen scheint. Gleichzeitig tritt sie aber als glühende und unbedingte Vertreterin des Islam auf, an dem sie kein schlechtes Haar lassen möchte. “Der heilige Koran”, unterrichtet sie Elli ganz sachlich, “gibt die modernste von allen Religionen. Er ist vollkommen und die abschließende Offenbarung. Es gibt kein anderes Wissen, das den Menschen retten und leiten kann.”
Elli, die Souad noch nicht kennt, ist ob der Rigidität der Behauptung zunächst etwas perplex, fängt sich aber schnell und versucht, Souads Hinweis als eine spielerische Herausforderung zu nehmen. “Nunja,” sagt sie wieder lächelnd, “genau genommen setzt die Richtigkeit ihrer Behauptung ein paar Kleinigkeiten voraus. Da ist natürlich erstens, dass es Gott überhaupt gibt, das können wir hier aber mal voraussetzen. Dann müsste es dem Menschen zweitens intellektuell überhaupt möglich sein, Gottes Wort zu folgen. Das wollen wir hier auch mal voraussetzen. Drittens müsste die Schrift wirklich von Gott stammen. Das ist sicher schon etwas schwieriger, da wir wissen, dass Menschen den Koran erst nach Ableben Mohammeds aufgeschrieben haben, es zunächst mehrere Versionen gab und dann keine gemeinsame Version abgefasst, sondern schließlich eine als verbindlich durchgesetzt wurde. Aber nehmen wir an, dass sei auch kein Problem und wir verfügen also über das richtige Wort Gottes. Dann müssten wir es viertens auch richtig entziffern, also verstehen können. Und da gehen die Meinungen ja nun bekanntlich drastisch auseinander.”
Alle Gespräche am Tisch sind verstummt. Die meisten am Tisch schauen demonstrativ auf ihren Teller und scheinen absichtlich den Eindruck machen zu wollen, nur mit dem Essen beschäftigt zu sein. Souad guckt zunächst etwas verlegen, dann spannt sich ihr Gesicht und sie sagt bestimmt, “Wir kennen die richtige Auslegung.”