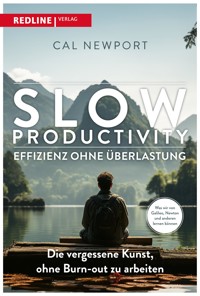
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Natürliches Arbeitstempo statt digitales Dauerfeuer Dauerhafte Ablenkung und ständige Erreichbarkeit sorgen dafür, dass es immer mehr Menschen schwerfällt, sich zu konzentrieren und produktiv zu arbeiten. Doch es gibt einen Ausweg aus diesem Hamsterrad: Auf Basis der Arbeitsgewohnheiten berühmter Denker – von Galileo und Isaac Newton bis hin zu Jane Austen und Georgia O'Keefe –verfasst Newport seine Philosophie der Slow Productivity, einer nachhaltigen Alternative zur heillosen Überforderung unserer Zeit. Der Bestsellerautor beschreibt die Schlüsselprinzipien seines Ansatzes, durch dessen Hilfe man stressfreier arbeitet und Überlastung vermeidet. So zeigt er, wie man sich auf die wichtigsten Aufgaben fokussiert, seinen digitalen Konsum reduziert und sinnvolle Ziele verfolgt. Statt in hektische Geschäftigkeit zu verfallen, plädiert der Experte für konzentriertes Arbeiten dafür, in einem natürlicheren Tempo zu arbeiten und sich nicht mehr auf Quantität zu fokussieren, sondern auf Qualität zu besinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cal Newport
SLOW
Productivity
Effizienz ohne Überlastung
Die vergessene Kunst, ohne Burn-out zu arbeiten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis:
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
2. Auflage 2024
© 2024 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
© 2024 by Cal Newport. Die Originalausgabe erschien 2024 bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel Slow Productivity.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Jordan Wegberg
Redaktion: Matthias Höhne
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Adobe Stock/Syed Qaseem Raza
Satz: inpunkt[w]o, Wilnsdorf (www.inpunktwo.de)
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-953-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-556-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-557-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Familie, weil sie mich jeden Tag an die Freuden der Langsamkeit erinnert.
Inhalt
Einleitung
Teil 1 GRUNDLAGEN
Kapitel 1 Aufstieg und Fall der Pseudoproduktivität
Kapitel 2 Eine langsamere Alternative
Teil 2 PRINZIPIEN
Kapitel 3 Weniger tun
Kapitel 4 Arbeiten mit natürlicher Geschwindigkeit
Kapitel 5 Qualität an oberste Stelle setzen
Fazit
Danksagung
Über den Autor
Anmerkungen
Slow Productivity
Einleitung
Im Sommer 1966, gegen Ende seines zweiten Jahres als Redaktionsmitglied des New Yorker, lag John McPhee in seinem Garten bei Princeton, New Jersey, rücklings auf einem Picknicktisch unter einer Esche. »Dort lag ich fast zwei Wochen lang, starrte hinauf in die Äste und Blätter und kämpfte gegen das Gefühl von Angst und Panik an«, erinnert er sich 2017 in seinem Buch Draft No. 4.1 McPhee hatte bereits fünf lange Beiträge im New Yorker veröffentlicht und war zuvor sieben Jahre Mitherausgeber der Time gewesen.2 Mit anderen Worten, er war kein Neuling im Geschäft des Journalismus, aber der Artikel, der ihn in jenem Sommer auf seinem Gartentisch lähmte, war der komplizierteste, den er je zu schreiben versucht hatte.
Zuvor hatte McPhee Porträts verfasst, so etwa seine erste große Arbeit für den New Yorker, »A Sense of Where You Are«, die sich mit Bill Bradley befasste, dem Basketballstar der Universität Princeton.3 Er hatte auch Beiträge zu historischen Themen geschrieben: Im Frühjahr 1966 war sein zweiteiliger Artikel über Orangen veröffentlicht worden, in dem er die Spuren der bescheidenen Frucht bis zu ihrer ersten Erwähnung 500 vor Christus in China zurückverfolgte.4 Doch McPhees aktuelles Projekt, in dem es um die unfassbar umfangreiche Thematik der Pine Barrens im südlichen New Jersey ging, sollte noch viel mehr leisten. Anstelle eines fokussierten Porträts musste er die Geschichten zahlreicher Figuren miteinander verknüpfen und dabei auch Dialoge und Besuche an speziellen Örtlichkeiten ausführlich wiedergeben. Statt die Historie eines einzelnen Objekts zusammenzufassen, musste er sich mit der geologischen, ökologischen und sogar politischen Hintergrundgeschichte einer gesamten Region beschäftigen.
McPhees Picknicktischparalyse waren achtmonatige Recherchen zu diesem Thema vorausgegangen, in denen er »genug Material, um ein Silo damit zu füllen«, zusammentrug, wie er es später beschrieb.5 Er war öfter von seinem Zuhause in Princeton in die Pine Barrens hinuntergereist, als er überhaupt zählen konnte, und nahm häufig einen Schlafsack mit, um seinen Aufenthalt zu verlängern. Er hatte alle wichtigen Bücher gelesen und mit allen wichtigen Personen gesprochen. Jetzt, da er mit dem Schreiben beginnen musste, fühlte er sich überfordert. »Es kommt mir ganz logisch vor, dass es einem zunächst an Selbstvertrauen fehlt«, erklärte er. »Es spielt keine Rolle, dass etwas, das man schon mal gemacht hat, gut gelaufen ist. Deine letzte Arbeit schreibt nicht deine nächste für dich.«6 Und so lag McPhee auf seinem Gartentisch, starrte hinauf in das Astwerk der Esche und grübelte, wie er diese enorme Menge an Quellen und Geschichten ineinanderfügen sollte. Er blieb zwei Wochen auf dem Tisch liegen, ehe endlich eine Lösung für sein Dilemma erschien: Fred Brown.
Schon zu Beginn seiner Recherchen hatte McPhee Brown kennengelernt, einen Neunundsiebzigjährigen, der tief in den Pine Barrens in einer »bescheidenen Hütte« lebte.7 Die beiden waren tagelang gemeinsam durch den Wald gewandert. Die Erkenntnis, die McPhee von seinem Picknicktisch hochschnellen ließ, war, dass Brown in gewisser Weise eine Verbindung zu den meisten der Themenbereiche hatte, die er in seinem Artikel behandeln wollte. Er konnte Brown zu Beginn des Beitrags einführen und die Themen, die er ausloten wollte, dann entlang des roten Fadens seiner Abenteuer mit Brown als Exkurse strukturieren.
Selbst nach diesem Augenblick der Erkenntnis brauchte McPhee noch über ein Jahr, um seinen Artikel zu Ende zu schreiben. Er arbeitete daran in einem bescheidenen Büro, das er abseits der Nassau Street in Princeton gemietet hatte, oberhalb eines Optikergeschäfts und gegenüber einem schwedischen Massagesalon. Die fertige Arbeit sollte mehr als 30.000 Wörter umfassen und wurde in zwei Teilen in aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift veröffentlicht. Sie ist ein Wunderwerk der Langreportage und einer der beliebtesten Einträge in McPhees umfangreicher Bibliografie. Doch sie wäre nie zustande gekommen ohne McPhees Bereitschaft, alles andere zurückzustellen und einfach auf dem Rücken zu liegen, in den Himmel hinaufzustarren und angestrengt darüber nachzudenken, wie er etwas so Wunderbares erschaffen sollte.
Wie ich bald herausfand, beschränkte sich diese Anti-Produktivitäts-Einstellung nicht auf meine Leserinnen und Leser. Zwischen dem Frühjahr 2020 und dem Sommer 2021, in einem Zeitraum von weniger als anderthalb Jahren, wurden mindestens vier wichtige Bücher veröffentlicht, die unmittelbar auf die verbreitete Auffassung von Produktivität Bezug nahmen. Dazu gehörten Do Nothing von Celeste Headlee, Can’t Even von Anne Helen Petersen, Laziness Does Not Exist von Devon Price und das wunderbar boshafte 4000 Wochen von Oliver Burkeman. Diese Erschöpfung durch Arbeit spiegelte sich auch in zahlreichen, ausführlich besprochenen gesellschaftlichen Trendwellen wider, die sich während der Pandemie in rascher Folge aneinanderreihten. Zunächst war da die sogenannte Kündigungswelle. Zwar umfasste dieses Phänomen den Ausstieg aus dem Berufsleben in vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, aber unter den vielen Subnarrativen gab es auch einen klaren Trend unter Wissensarbeitern, die Ansprüche an ihre berufliche Laufbahn zu senken. Die Kündigungswelle wurde gefolgt von einer Zunahme der inneren Kündigungen (häufig auch Quiet Quitting genannt), bei denen eine jüngere Kohorte von Berufstätigen sich aggressiv gegen die Produktivitätsforderungen ihrer Arbeitgeber auflehnte.
»Wir sind überarbeitet und ausgelaugt, ständig unzufrieden und auf der Jagd nach einer Messlatte, die pausenlos höher steigt«, schreibt Celeste Headlee in ihrer Einleitung zu Do Nothing.8 Ein paar Jahre früher hätte diese Auffassung vielleicht provokativ gewirkt. Doch während die Pandemie ihrem Höhepunkt zustrebte, stieß sie auf immer mehr Zustimmung.
Während ich diesen rasch wachsenden Unmut beobachtete, wurde mir bewusst, dass etwas Bedeutsames passierte. Die Wissensarbeiter waren erschöpft – ausgebrannt von einer zunehmend gnadenlosen Hektik. Dieser Trend wurde von der Pandemie nicht ausgelöst, sondern auf die Spitze getrieben, über die Grenze des Erträglichen hinaus. Nicht wenige Wissensarbeiter, die plötzlich zum Homeoffice verdonnert waren und deren Kinder im Nebenzimmer brüllten, während sie sich durch eine weitere Zoom-Konferenz quälten, fragten sich allmählich: »Was machen wir hier eigentlich?«
Ich begann, mich intensiv mit dem Groll der Wissensarbeiterinnen und -arbeiter sowie mit alternativen Konzepten beruflicher Sinnhaftigkeit zu befassen, sowohl in meinem seit Langem bestehenden Newsletter als auch in einem neuen Podcast, den ich zu Beginn der Pandemie ins Leben rief. Als die Anti-Produktivitäts-Bewegung an Geschwindigkeit zulegte, nahm ich das Thema auch häufiger in meine Beiträge für den New Yorker auf, für den ich ebenfalls schreibe – was schließlich dazu führte, dass ich im Herbst 2021 mit einer vierzehntäglichen Kolumne namens »Office Space« begann, die sich dieser Problematik widmete.
Die Geschichten, die ich aufdeckte, waren kompliziert. Die Leute waren überfordert, doch die Quellen dieser wachsenden Erschöpfung waren nicht offensichtlich. In den online geführten Diskussionen über die Thematik mangelte es nicht an den verschiedensten, einander gelegentlich widersprechenden Theorien: Die Arbeitgeber steigern gnadenlos die Ansprüche an ihre Beschäftigten, im Bemühen, mehr Gewinn aus deren Tätigkeit zu ziehen. Nein, eigentlich ist es eine verinnerlichte Kultur des Hochhaltens von Geschäftigkeit – vorangetrieben von Produktivitäts-Influencern –, die zu unserer Erschöpfung führt. Oder vielleicht erleben wir in Wirklichkeit den unvermeidlichen Zusammenbruch des »Kapitalismus der letzten Phase«. Es gab Schuldzuweisungen und Ausbrüche von Frustration, und die ganze Zeit wurde die Unzufriedenheit der Wissensarbeiter größer und größer. Die Lage schien düster, doch als ich mit meinen eigenen Recherchen zu diesem Thema fortfuhr, zeigte sich ein Funken Optimismus, ausgelöst durch ebenjene Geschichte, mit der wir diese Diskussion eröffnet haben.
Als ich die Geschichte zum ersten Mal hörte, wie John McPhee in seinem Garten tagelang in die Blätter hinaufgeschaut hatte, kam sie mir nostalgisch vor – eine Szene aus längst vergangenen Zeiten, als Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Verstand verdienten, noch genügend Zeit und Raum bekamen, um Beeindruckendes zu schaffen. »Wäre es nicht wunderbar, eine solche Arbeit zu haben, bei der man sich keine Gedanken um Produktivität machen muss?«, dachte ich. Doch allmählich formte sich eine nachdrückliche Erkenntnis. McPhee war produktiv. Wenn wir einmal davon absehen, was er an diesen Sommertagen 1966 auf seinem Gartentisch tat, und uns stattdessen seine gesamte Karriere anschauen, so begegnen wir einem Autor, der bis heute neunundzwanzig Bücher veröffentlicht hat, von denen eines den Pulitzerpreis erhielt und zwei für nationale Buchpreise nominiert waren. Er verfasste außerdem über fünfzig Jahre lang unverwechselbare Artikel für den New Yorker, und mit seinem legendären Seminar für kreatives nicht-fiktionales Schreiben, das er lange an der Princeton University gab, unterstützte er viele junge Schreibende, die später ihre eigenen charakteristischen Karrieren beschritten – darunter Richard Preston, Eric Schlosser, Jennifer Weiner und David Remnick. Es gibt keine sinnvolle Definition von Produktivität, die nicht auch auf John McPhee zuträfe, und doch ist nichts an seinen Arbeitsgewohnheiten hektisch, unruhig oder überfordernd.
Diese anfängliche Erkenntnis entwickelte sich zu der Grundidee, um die es in diesem Buch gehen soll: Vielleicht haben Wissensarbeitende gar kein Problem mit der Produktivität an sich, sondern vielmehr mit einer bestimmten falschen Definition dieses Begriffs, die sich in den letzten Jahrzehnten verbreitet hat. Die gnadenlose Überlastung, die uns so auslaugt, wird von der Überzeugung ausgelöst, dass »gute« Arbeit zunehmende Geschäftigkeit erfordert – schnelleres Reagieren auf E-Mails und Chats, mehr Meetings, mehr Aufgaben, mehr Arbeitsstunden. Doch wenn wir uns diese Prämisse näher anschauen, finden wir einfach keine solide Grundlage dafür. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass alternative Herangehensweisen an die Produktivität ebenso gerechtfertigt sind, darunter auch solche, bei denen endlosen Aufgabenlisten und ständiger Aktivität eine geringere Bedeutung beigemessen und so etwas wie John McPhees gelassene Intentionalität zelebriert wird. Tatsächlich wurde deutlich, dass die Gewohnheiten und Rituale traditioneller Wissensarbeiter wie McPhee nicht nur inspirierend sind, sondern unter hinreichender Berücksichtigung der Arbeitsrealität des 21. Jahrhunderts auch eine Quelle von Ideen darstellen, wie wir unser modernes Verständnis von beruflicher Leistung verwandeln könnten.
Diese Erkenntnisse führten zu neuen Vorstellungen davon, wie wir an unsere Arbeit herangehen können, und mündeten schließlich in eine voll ausgeprägte Alternative zu den Grundannahmen, die unsere derzeitige Erschöpfung verursachen:
SLOW PRODUCTIVITY
Eine Philosophie, um Wissensarbeit auf nachhaltige und sinnvolle Weise zu organisieren, basierend auf den drei folgenden Prinzipien:
Weniger tun.
Mit natürlicher Geschwindigkeit arbeiten.
Qualität an oberste Stelle setzen.
Wie Sie auf den folgenden Seiten erfahren werden, lehnt diese Philosophie die Geschäftigkeit ab und betrachtet Überlastung als Hindernis für bedeutsame Ergebnisse, nicht als Anlass für Stolz. Sie geht auch von der Annahme aus, dass berufliche Leistungen mit einem vielfältigeren und menschlicheren Rhythmus erbracht werden sollten, in dem anstrengende Phasen sich mit Entspannung in vielen unterschiedlichen Zeiträumen abwechseln; zudem sollte allem die Konzentration auf eindrucksvolle Qualität zugrunde liegen statt auf performative Aktivität. Im zweiten Teil dieses Buches werde ich die Grundprinzipien der Philosophie ausführen und Ihnen sowohl eine theoretische Begründung dafür liefern, warum sie korrekt sind, als auch konkrete Ratschläge dazu, wie Sie sie in Ihrem Berufsleben umsetzen können – egal ob Sie selbst ein Unternehmen führen oder unter der Anleitung eines Vorgesetzten arbeiten.
Mein Ziel ist es nicht, lediglich Tipps zu geben, wie Sie Ihre Arbeit ein bisschen weniger anstrengend machen. Ebenso wenig will ich einfach nur einen metaphorischen Kampf für Sie führen gegen diese ausbeuterischen Unmenschen, denen Ihre Überforderung völlig gleichgültig ist (auch wenn wir sicherlich auch hierauf gelegentlich zurückkommen). Ich möchte Ihnen vielmehr einen völlig neuen Denkansatz für Sie selbst, Ihr kleines Unternehmen oder Ihren großen Arbeitgeber vorstellen, was es bedeutet, Dinge anzupacken und etwas zu schaffen. Ich möchte die Wissensarbeit vor der zunehmend unerträglichen Hektik retten und zu etwas Nachhaltigerem und Menschlicherem umgestalten, das es Ihnen ermöglicht, Dinge zu schaffen, auf die Sie stolz sind – und zwar ohne dass Sie sich dafür zugrunde richten müssen. Natürlich lässt sich dieser absichtsvollere Rhythmus nicht bei jedem Bürojob augenblicklich umsetzen, doch wie ich erläutern werde, ist er in einem größeren Umfang anwendbar, als Sie zunächst vielleicht annehmen. Mit anderen Worten, ich will Ihnen beweisen, dass Leistung ohne Burn-out nicht nur möglich ist, sondern der neue Standard sein sollte.
Ehe wir uns auf den Weg machen, müssen wir jedoch begreifen, wie die Wissensarbeit überhaupt in ihre gegenwärtige problematische Beziehung zur Produktivität hineingeraten ist. Denn es wird einfacher sein, den Status quo abzulehnen, wenn wir die Willkürlichkeit seiner Entstehung wirklich verstanden haben. Mit dieser Zielsetzung wollen wir unsere Reise nun beginnen.
Teil 1
Grundlagen
1
Aufstieg und Fall der Pseudoproduktivität
Im Sommer 1995 durchstreifte Leslie Moonves, der neue Unterhaltungschef von CBS, die Flure des riesigen Sendehauses von Television City. Was er sah, machte ihn nicht gerade froh: Es war Freitag, 15.30 Uhr, und die Büros waren zu drei Vierteln leer. In seinem 2006 erschienenen Buch Desperate Networks über die Fernsehbranche dieser Zeit beschrieb der Medienjournalist Bill Carter, wie der frustrierte Moonves ein erzürntes Memo zu den leeren Büros seiner Beschäftigten verfasste. »Falls irgendwer es noch nicht mitgekriegt hat: Wir liegen [bei den Einschaltquoten] an dritter Stelle«, schrieb er. »Ich vermute mal, dass ABC und NBC freitags um 15.30 Uhr noch arbeiten. Das wird nicht länger geduldet.«9
Auf den ersten Blick stellt diese Szene eine typische Fallstudie dar über die verschiedenen Einstellungen, die der Wissenssektor im Laufe des 20. Jahrhunderts in Bezug auf Produktivität einnahm: »Arbeit« ist irgendeine vage Angelegenheit, die Beschäftigte in einem Büro verrichten. Mehr Arbeit führt zu besseren Ergebnissen als weniger Arbeit. Aufgabe eines Vorgesetzten ist es, dafür zu sorgen, dass genug gearbeitet wird, denn ohne diesen Druck werden die faulen Mitarbeiter versuchen, mit dem absoluten Minimum davonzukommen. Die erfolgreichsten Unternehmen haben die fleißigsten Angestellten.
Aber wie sind wir zu diesen Überzeugungen gekommen? Wir haben sie oft genug gehört, um uns zu vergewissern, dass sie vermutlich zutreffen, doch bei näherem Hinsehen ist die Sache komplizierter. Es ist nicht schwierig, herauszufinden, dass wir im Bereich Wissensarbeit tatsächlich viel weniger wissen, als wir vorgeben, wenn es um die grundlegende Zielsetzung geht, Aufgaben zu erledigen …
Was bedeutet »Produktivität«?
Als in den letzten Jahren das volle Ausmaß der zunehmenden »Produktivitätsmüdigkeit« in unserer Kultur deutlich wurde, beschloss ich, meine Leser zu diesem Thema zu befragen. Mein Ziel war ein nuancierteres Verständnis der Ursachen dieser Veränderung. Letztlich nahmen fast 700 Personen an meiner informellen Studie teil, fast alle Wissensarbeitende. Meine erste substanzielle Frage sollte einfach sein, so eine Art Aufwärmübung: »Wie würden in Ihrem speziellen beruflichen Umfeld die meisten Menschen ›Produktivität‹ oder ›produktiv sein‹ definieren?« Die Antworten auf diese Einstiegsfrage überraschten mich allerdings. Und zwar nicht so sehr in Bezug darauf, was gesagt wurde, sondern eher darauf, was nicht gesagt wurde. In den wirklich meisten Antworten wurden einfach die Arten der Aufgaben aufgeführt, die der Befragte an seinem Arbeitsplatz übernahm.
»Inhalte und Dienstleistungen zum Nutzen unserer Mitgliedsorganisationen schaffen«, antwortete eine Führungskraft namens Michael. »Die Fähigkeit, [Predigten] zu schreiben, und sich gleichzeitig im Rahmen persönlicher Besuche um die Gemeindemitglieder kümmern«, sagte ein Pastor namens Jason. Eine Wissenschaftlerin namens Marianna verwies auf: »an Meetings teilnehmen … Laborversuche durchführen … und extern begutachtete Artikel schreiben«. Ein leitender Ingenieur namens George definierte Produktivität als: »das tun, was man zu tun versprochen hat«.
In keiner dieser Antworten ging es um konkrete zu erreichende Ziele oder Leistungsmessgrößen, die gut versus schlecht ausgeführte Arbeit unterscheiden konnten. Wenn Quantität überhaupt erwähnt wurde, dann tendenziell in dem allgemeinen Sinn, dass mehr immer besser ist. (Produktivität ist, »die ganze Zeit zu arbeiten«, erklärte eine erschöpfte Postdoc namens Soph.) Während ich immer mehr meiner Umfrageergebnisse las, machte sich eine beunruhigende Erkenntnis in mir breit: Bei all unseren Klagen über den Begriff haben Wissensarbeiter keine allgemein akzeptierte Definition dessen, was »Produktivität« überhaupt bedeutet.
Diese Schwammigkeit geht über die Selbstreflexion von Individuen hinaus; sie spiegelt sich auch in wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema. Der Managementtheoretiker Peter Drucker veröffentlichte 1999 eine einflussreiche Arbeit mit dem Titel »Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge«. Schon zu Beginn des Aufsatzes räumt Drucker ein, dass »die Forschung zur Produktivität des Wissensarbeiters kaum begonnen hat«.10 Im Bemühen, diese Tatsache geradezurücken, führt er daraufhin sechs »Hauptfaktoren« an, die Produktivität im Wissensbereich beeinflussen, darunter ein klares Verständnis von Aufgabenstellungen und die Verpflichtung zu fortwährendem Lernen und zur Innovation. Wie auch bei meinen Umfrageergebnissen wird hier nur um das Thema herumgeredet – es werden Dinge identifiziert, die möglicherweise produktive Arbeit im allgemeinen Sinne fördern, ohne dass spezielle Messbarkeitskriterien oder Verbesserungsprozesse genannt werden. Vor ein paar Jahren interviewte ich für einen Artikel Tom Davenport, einen angesehenen Professor für Management am Babson College. Ich interessierte mich für Davenport, weil er zu einem früheren Zeitpunkt seiner Laufbahn einer der wenigen Akademiker gewesen war, die sich ernsthaft darum bemühten, Produktivität im Wissensbereich zu untersuchen, was zu seinem 2005 veröffentlichten Buch Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers führte. Am Ende war Davenport frustriert darüber, wie schwer sich bei diesem Thema spürbare Fortschritte erzielen ließen, und wandte sich lohnenswerteren Bereichen zu. »In den meisten Fällen messen die Menschen die Produktivität von Wissensarbeitern nicht«, erklärte er. »Und falls doch, dann auf wirklich idiotische Weise, zum Beispiel danach, wie viele wissenschaftliche Arbeiten sie produzieren, ungeachtet der Qualität. Wir befinden uns noch im Anfangsstadium.«11 Davenport hat fünfundzwanzig Bücher geschrieben oder mit herausgegeben. Er erzählte mir, dass sich Thinking for a Living von allen am schlechtesten verkauft hat.
Man kann gar nicht genug hervorheben, wie ungewöhnlich es ist, dass es einem derart großen Wirtschaftssektor wie der Wissensarbeit an hilfreichen Standarddefinitionen für Produktivität fehlt. In fast allen anderen Bereichen unserer Wirtschaft ist Produktivität nicht nur ein genau definiertes Konzept, sondern häufig auch wesentlich für den Ablauf der Arbeit. Tatsächlich kann ein Großteil des erstaunlichen wirtschaftlichen Wachstums, das unsere modernen Zeiten vorantreibt, einer systematischeren Behandlung dieser grundlegenden Idee zugeschrieben werden. Eine frühe Anwendung des Begriffs lässt sich in die Landwirtschaft zurückverfolgen, wo seine Bedeutung unmissverständlich ist. Für einen Bauern lässt sich die Produktivität einer Landfläche anhand der Nahrung bemessen, die sie hervorbringt. Dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ist wie eine Art Kompass, der es Landwirten erlaubt, sich innerhalb der verschiedenen Kultivierungsmethoden zurechtzufinden: Besser funktionierende Systeme bringen messbar höhere Erträge pro Hektar hervor. Eine solche Anwendung klarer Produktivitätskennzahlen zur Verbesserung von klar definierten Prozessen mag offensichtlich erscheinen, doch die Einführung dieser Vorgehensweise ermöglichte eine explosionsartige Weiterentwicklung der Effizienz. Im 17. Jahrhundert beispielsweise führte genau diese Form des messwertorientierten Experimentierens zum Vier-Phasen-Saatsystem von Norfolk, durch das es nicht mehr nötig war, Felder brachliegen zu lassen. Das wiederum machte viele Landwirte plötzlich viel produktiver und kurbelte die britische landwirtschaftliche Revolution an.12
Als die Industrielle Revolution sich im 18. Jahrhundert auch außerhalb Großbritanniens auszuweiten begann, übernahmen die ersten Kapitalisten ähnliche Produktivitätsvorstellungen wie bei den landwirtschaftlichen Flächen für ihre Mühlen und Fabriken. Mit steigenden Erträgen war der zentrale Gedanke, den Ausstoß für eine bestimmte Menge an eingesetztem Material zu messen und dann mit verschiedenen Prozessen zu experimentieren, um diesen Wert zu verbessern. Landwirte interessieren sich für Erträge pro Hektar, während Fabrikbesitzer sich für Automobile pro bezahlter Arbeitsstunde interessieren. Bauern können ihre Werte durch den Einsatz eines klügeren Saatrotationssystems verbessern, während Fabrikbesitzer ihre Werte vielleicht durch die Umstellung der Produktion auf kontinuierliche Fließbandarbeit erhöhen können. In diesen Beispielen werden unterschiedliche Dinge produziert, aber die Antriebsfeder für eine Veränderung der Methoden ist dieselbe: Produktivität.
Natürlich hatte diese Betonung der messbaren Verbesserung einen wohlbekannten Preis für die Menschen. Fließbandarbeit ist repetitiv und langweilig, und die Forderung, dass der Einzelne mit jeder seiner Handlungen effizienter werden soll, erzeugt Bedingungen, die zu Beeinträchtigungen und Erschöpfung führen. Doch weil die Produktivität in diesen Bereichen ein erstaunliches wirtschaftliches Wachstum hervorbringen konnte, wurden derartige Bedenken zum größten Teil beiseitegewischt. Fließbänder sind eintönig für Arbeiter, aber als Henry Ford 1913 seine Fabrik in Highland Park, Michigan, auf diese Methode umstellte, sank die Zahl der Arbeitsstunden, die für die Produktion eines Modell T benötigt wurden, von 12,5 auf ungefähr 1,5 – eine umwerfende Verbesserung.13 Bis zum Ende des Jahrzehnts war die Hälfte aller Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten von der Ford Motor Company hergestellt worden.14 Die entsprechenden Gewinne waren zu verlockend, um ihnen zu widerstehen. Die Geschichte des Wirtschaftswachstums in der modernen westlichen Welt ist in vielerlei Hinsicht die Geschichte des Triumphs von Produktivitätsdenken.
Doch dann bildete sich Mitte des 20. Jahrhunderts der Wissenssektor als maßgebliche Kraft heraus, und diese profitable Abhängigkeit von griffigen, quantitativen, formalen Produktivitätsvorstellungen schwand dahin. Wie sich herausstellte, gab es dafür einen guten Grund: Die alte Vorstellung von Produktivität, die in Landwirtschaft und Produktion so gut funktioniert hatte, schien sich auf diese neue Form des kognitiven Arbeitens nicht anwenden zu lassen. Ein Problem ist die Variabilität des Einsatzes. Als der berüchtigte Effizienzberater Frederick Winslow Taylor Anfang des 20. Jahrhunderts die Produktivität bei Bethlehem Steel optimieren sollte, konnte er davon ausgehen, dass jeder Arbeiter in der Gießerei für eine einzelne, klar umrissene Aufgabe verantwortlich war, zum Beispiel für das Wegschaufeln der Eisenschlacke. Das ermöglichte es ihm, die Leistung eines jeden pro Zeiteinheit genau zu messen und nach Wegen zu suchen, wie sich diese Kennzahl verbessern ließe. In diesem speziellen Beispiel gestaltete Taylor letztlich eine bessere Schaufel für die Gießereimitarbeiter, die ein sorgfältiges Gleichgewicht herstellte zwischen dem Wunsch, mehr Eisen pro Hub zu bewegen, und der Vermeidung von unproduktiver Überlastung. (Falls Sie es genau wissen wollen, er legte fest, dass die optimale Schaufelladung 21 Pfund betrug.15)
In der Wissensarbeit dagegen befassen sich die Individuen häufig mit komplizierten und ständig wechselnden Aufgabenstellungen. So arbeitet man etwa an einem Kundenbericht, trägt gleichzeitig Referenzen für die Unternehmenswebsite zusammen und organisiert eine Büroparty, während man eine Erklärung zu einem Interessenkonflikt aktualisiert, über die man soeben von der Personalabteilung per Mail informiert wurde. In einer solchen Umgebung lässt sich kein einzelnes klares Ergebnis nachverfolgen. Und selbst wenn Sie diesen Sumpf der Aktivitäten durchwaten, um die Tätigkeit zu identifizieren, die am wichtigsten ist – erinnern Sie sich an Davenports Beispiel, bei dem die akademischen Veröffentlichungen eines Professors gezählt wurden –, selbst dann lässt sich nicht einfach steuern, welche Auswirkungen die nicht damit zusammenhängenden Verpflichtungen auf die Produktivitätsfähigkeit jedes einzelnen Individuums haben. Vielleicht habe ich letztes Jahr mehr wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht als Sie, doch das mag zum Teil auch daran gelegen haben, dass Sie den Vorsitz in einem zeitraubenden, aber wichtigen Ausschuss innehatten. Bin ich in diesem Szenario wirklich der produktivere Mitarbeiter?
Auch die Henry-Ford-Vorgehensweise zur Verbesserung von Systemen statt Individuen konnte sich im Kontext der Wissensarbeit nicht durchsetzen. Ford konnte auf jeder Stufe seiner Entwicklung des Fließbands genau bestimmen, wie die T-Modelle in seiner Fabrik hergestellt wurden. Im Wissenssektor dagegen werden die Entscheidungen über die Organisation und die Durchführung der Arbeit weitgehend dem Einzelnen überlassen, der selbst einen Umgang damit finden muss. Die Unternehmen legen vielleicht fest, welche Software ihre Beschäftigten verwenden, aber die Systeme der Zuteilung, Lenkung, Organisation sowie Zusammenarbeit bei und letztlich Ausführung von Aufgaben werden im Allgemeinen jedem Einzelnen überlassen. »Der Wissensarbeiter kann nicht engmaschig oder im Detail kontrolliert werden«, sagte Peter Drucker in seinem einflussreichen Buch The Effective Executive von 1967. »Man kann ihn nur unterstützen. Aber lenken muss er selbst.«16
Wissensarbeitsorganisationen haben diese Empfehlung ernst genommen. Die sorgfältig entwickelten Fabriksysteme wurden durch die »persönliche Produktivität« in Büros ersetzt, bei der Individuen ihre eigenen ad hoc und oft mangelhaft definierten Werkzeuge und Tricks nutzen, um ihren Job zu erledigen, wobei keiner so genau weiß, wie andere ihre Arbeit organisieren. In einer derart willkürlichen Umgebung gibt es kein leicht verbesserbares System, kein Wissensäquivalent zu der zehnfachen Produktivitätssteigerung, die dem Fließband zugeschrieben wird. Auch Drucker selbst erkannte schließlich, wie schwierig es ist, bei so viel Autonomie die Produktivität zu verfolgen. »Meiner Meinung nach glaubte er, sie sei schwer zu verbessern … wir lassen die Insassen das Irrenhaus leiten, lassen sie nach ihren Wünschen arbeiten«, erzählte mir Tom Davenport in Erinnerung an Gespräche, die er in den 1990er-Jahren mit Drucker geführt hatte.
Diese Fakten schufen ein echtes Problem für den sich entwickelnden Wissenssektor. Ohne konkrete Produktivitätsmesswerte und gut strukturierte Verbesserungsprozesse waren sich die Unternehmen nicht darüber im Klaren, wie sie ihre Mitarbeiter führen sollten. Und als es in diesem Sektor immer mehr Freiberufler und Kleinunternehmer gab, wussten diese Individuen, die nur für sich selbst verantwortlich waren, nicht so recht, wie sie sich selbst führen sollten. Aus dieser Ungewissheit entwickelte sich schließlich eine einfache Alternative: die sichtbare Aktivität als primitiven Ersatz für tatsächliche Produktivität zu verwenden. Solange ich in meinem Büro zu sehen bin – oder, falls ich im Homeoffice arbeite, regelmäßig meine E-Mails und Chatnachrichten beantworte –, wissen Sie zumindest, dass ich irgendetwas mache. Je mehr Aktivität Sie sehen, desto eher können Sie davon ausgehen, dass ich zum Nettoprofit der Organisation beitrage. Auch für Freelancer und Entrepreneure gilt: Je emsiger ich bin, desto gewisser kann ich sein, dass ich alles mir Mögliche tue, um voranzukommen.
Mit dem Fortschreiten des 20. Jahrhunderts wurde diese Heuristik der sichtbaren Aktivität zu unserer vorherrschenden Denkweise über Produktivität in der Wissensarbeit. Deshalb versammeln wir uns in Bürogebäuden im Rahmen derselben Vierzigstundenwoche, die ursprünglich zur Begrenzung der körperlichen Erschöpfung durch Fabrikarbeit eingeführt wurde; deshalb haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir unseren Posteingang ignorieren; und deshalb verspüren wir diesen verinnerlichten Druck zur freiwilligen Leistung oder zum »demonstrativen Beschäftigtsein«, wenn wir sehen, dass der Chef in der Nähe ist. In Ermangelung komplexerer Effektivitätsmesswerte bewegen wir uns auch weg von tiefergehenden Bemühungen und hin zu oberflächlicheren, konkreteren Aufgaben, die sich auf einer To-do-Liste besser abhaken lassen. Lange Arbeitszeiten, die keine unmittelbaren, deutlich erkennbaren Spuren der aufgewendeten Mühe hinterlassen, werden zu einer Quelle der Angst – es ist sicherer, E-Mails abzuarbeiten oder an Meetings teilzunehmen, als intensiv nachzudenken und eine wagemutige neue Strategie zu entwickeln. Eine Sozialarbeiterin, die sich selbst N. nannte, beschrieb in ihrer Antwort auf meine Leserumfrage die Notwendigkeit, »keine Pausen zu machen und den ganzen Tag unter Dampf zu stehen«, während ein Projektmanager namens Doug erklärte, seine Arbeit gut zu erledigen, bedeute im Kern lediglich »das Abliefern zahlreicher Produkte«, ob sie nun von Bedeutung seien oder nicht.
Der Wechsel von konkreter Produktivität zu dieser schwammigeren Ersatzheuristik ist so wichtig für unsere nachfolgende Diskussion, dass wir ihr einen formalen Namen und eine Definition geben sollten:
PSEUDOPRODUKTIVITÄT
Der Einsatz sichtbarer Aktivität als primäres Mittel, um sich einem tatsächlichen produktiven Bemühen anzunähern.
Es war die Unbestimmtheit dieser Philosophie, die meinen Lesern so viele Probleme bereitete, als ich sie bat, »Produktivität« zu definieren. Es ist kein leicht zu erklärendes formales System, sondern eher so etwas wie eine Stimmung – eine allgemeine Atmosphäre sinnvoller Aktivität, die durch hektische Betriebsamkeit aufrechterhalten wird. Auch ihre Schwächen sind subtiler. Für die ersten Wissensarbeiter hatte die Pseudoproduktivität klare Vorteile im Vergleich zu den konkreten Systemen, nach denen die Fabrikarbeit organisiert war. Viele Menschen spielten lieber in einem Büro mit Klimaanlage Emsigkeit vor, als den ganzen Tag in einer überhitzten Fabrik Metallblech zu stanzen. Wie wir gleich sehen werden, ist die auf Pseudoproduktivität fokussierte Arbeitsweise erst in den letzten Jahrzehnten gescheitert. Nachdem es dazu gekommen war, zeigte sich allerdings der erhebliche Schaden.
Warum sind wir so erschöpft?
Die einführende Fallgeschichte über CBS ist ein klassisches Beispiel von Pseudoproduktivität. Les Moonves brauchte mehr Leistung, also drückte er den offensichtlichen Knopf: Er verlangte von seinen Beschäftigten längere Arbeitszeiten. Doch ein weiterer Grund, warum ich gerade diese Geschichte ausgewählt habe, ist der Zeitpunkt. Mitte der 1990er-Jahre, als Moonves sein frustriertes Memo verschickte, hatte die Nachhaltigkeit von Pseudoproduktivität als Mittel der Organisation von Wissensarbeit stillschweigend, aber rapide zu schwinden begonnen.
Der Grund für diesen Rückgang war das Auftauchen von Netzwerkcomputern im Büro, das zu dieser Zeit stattfand. In einer Umgebung, in der Aktivität als Ersatz für Produktivität dient, hatte die Einführung von Tools wie E-Mails (und später Messaging-Diensten wie Slack), die ein sichtbares Signalisieren von Geschäftigkeit mit minimalem Aufwand ermöglichen, zur Folge: Wissensarbeiter wandten durch das unaufhörliche Empfangen und Versenden elektronischer Nachrichten im Durchschnitt immer mehr Zeit ihres Arbeitstags für das Reden über die Arbeit auf, und das so schnell und hektisch wie möglich. (Eine besonders vernichtende Analyse, durchgeführt vom Softwareunternehmen RescueTime auf Basis der Logdateien von über 10.000 Wissensarbeitern, ergab, dass die Studienteilnehmer im Durchschnitt alle sechs Minuten ihren Posteingang überprüften.17) Die anschließende Verbreitung von tragbaren Rechen- und Kommunikationsgeräten in Form von Laptops und Smartphones verschlimmerte diese Tendenz sogar noch, denn nun konnte die Forderung nach demonstrativer Tätigkeit sich über den Arbeitstag hinaus erstrecken und verfolgte uns abends bis nach Hause oder am Wochenende zum Fußballspiel der Kinder. Computer und Netzwerke eröffneten zahlreiche neue Möglichkeiten, aber in Kombination mit Pseudoaktivität führten sie schließlich zu einem übersteigerten Gefühl von Überlastung sowie Ablenkung und brachten uns auf Kollisionskurs mit der Burn-out-Krise, die uns heute plagt.
Es ist wichtig, das Ausmaß dieser aktuellen Leiden zu betonen. Eine kürzlich durchgeführte Studie von McKinsey und Lean In mit 65.000 nordamerikanischen Arbeitnehmern, hauptsächlich aus dem Wissenssektor, ergab zum Beispiel einen maßgeblichen Zuwachs derjenigen, die sich nach eigenen Angaben »oft« oder »fast immer« ausgebrannt fühlten.18 Eine darauffolgende Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup zeigte, dass amerikanische Beschäftigte jetzt zu den am meisten gestressten der Welt gehören. Jim Harter, leitender Arbeitswissenschaftler bei Gallup, merkte an, dass diese Stresswerte parallel zu anderen Kennzahlen gestiegen sind, die die zunehmenden Anstrengungen von Arbeitskräften aufzeigen. »Die Verschränkung von Arbeit und Leben erfordert noch einige Arbeit«, sagte er.19
Wir brauchen aber keine Daten, die uns lehren, was so viele bereits in ihrem eigenen Leben erfahren haben. Die Reaktionen auf meine Leserumfrage zum Beispiel waren voller Berichte von Überforderung und Erschöpfung durch die neue Bürotechnologie. Ein strategischer Planer namens Steve fasste diese Erfahrung gut zusammen:
Es scheint, als hätten die Vorzüge der Technologie die Möglichkeit geschaffen, mehr in unseren Tag und unseren Terminkalender zu packen, als wir zu bewältigen in der Lage sind, wenn wir gleichzeitig ein Qualitätsniveau wahren, das die Arbeit überhaupt lohnenswert macht … Ich glaube, das ist der Punkt, an dem der Burn-out richtig wehtut – wenn einem etwas am Herzen liegt, man aber nicht in der Lage ist, es zu tun beziehungsweise es gut zu tun und ihm seine Leidenschaft und volle Aufmerksamkeit und Kreativität zu widmen, weil gleichzeitig so viel anderes von einem erwartet wird.
Eine Professorin namens Sandra bemerkte ein ähnliches Eindringen dieser Hyperaktivität in die akademische Welt und beschrieb sie folgendermaßen: Es sei ein Ansturm von »jeder Menge E-Mails, die hin- und hergehen, Slack, kurzfristigen Zoom-Meetings und so weiter, die mich (und überhaupt alle, wie es mir vorkommt) daran hindern, mir noch die Zeit für konzentriertes Arbeiten, Denken, Schreiben in hoher Qualität zu nehmen«. Eine virtuelle Assistentin mit Namen Myra hatte eine besondere Perspektive, denn sie konnte zusammenfassen, was ihr bei den zahlreichen Wissensarbeitern auffiel, die sie unterstützte. »Meine Kunden sind sehr beschäftigt, aber oft so überfordert von all dem, was sie tun wollen oder müssen, dass schwer herauszufinden ist, wo ihre Prioritäten liegen«, teilte sie mir mit. »Also versuchen sie einfach, mit voller Kraft weiterzuarbeiten, und hoffen, auf diese Weise voranzukommen.«
Diesen Beschreibungen kann ein gewisses Gefühl von Hoffnungslosigkeit innewohnen. Konkrete Produktivitätsmesswerte von der Art, wie der industrielle Sektor sie geprägt hat, werden für die schwerer fassbare Umgebung der Wissensarbeit niemals recht passen. (Und das sollten wir auch gar nicht anstreben, denn dieser quantitative Arbeitsgedanke führt wiederum zu eigenen unmenschlichen Bedingungen.) In Ermangelung von Klarheit kann Pseudoproduktivität allerdings wie die einzige praktikable Option erscheinen. Und wenn diese mit reibungslos funktionierenden Kommunikationswerkzeugen und tragbaren Computern kombiniert wird, ist das Ergebnis der sich ständig beschleunigende Aktivitätskreislauf, der uns, wie Myra es so passend beschrieb, dazu treibt, einfach eine Menge zu arbeiten – das berufliche Streben in jeden Winkel unseres Lebens zu pressen, in der Hoffnung, dieses unablässige Handeln möge sich irgendwie zu etwas Sinnvollem addieren. Ehe wir vor dieser düsteren Realität jedoch vollends kapitulieren, sollten wir die angenommene Unvermeidbarkeit der Pseudoproduktivität noch einmal näher überprüfen. Kehren wir ein letztes Mal zu unserer CBS-Geschichte zurück: Wenn wir hinter den schlichten Handlungsbogen von Les Moonves’ kompromisslosem Management-Heroismus schauen, so beginnen sich Hinweise auf eine nuanciertere Auffassung von Leistung in der Wissensarbeit abzuzeichnen.
Ist eine bessere Vorgehensweise möglich?
Das ermutigende Ende der CBS-Geschichte ist, dass der ins Straucheln geratene Sender letztlich das Blatt wenden konnte und bei den Einschaltquoten vom letzten auf den ersten Platz vorrückte, wo er sich viele Jahre lang behauptete. Doch wie lässt sich dieser Umschwung eigentlich erklären? Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass Les Moonves’ Forderung an seine Beschäftigten, sie sollten länger arbeiten, damit nur sehr wenig zu tun hatte. Überzeugender ist da schon die Erklärung, die sich in den verschlungenen Bemühungen von Anthony Zuiker finden lässt, einem Casino-Shuttlefahrer aus Las Vegas. Im Jahr 1996 erhielt der 26-jährige Zuiker 8 Dollar pro Stunde dafür, dass er Touristen zwischen dem Hotel Mirage und dem Hotel Treasure Islands hin- und herbeförderte, und er war verzweifelt. Als junger Erwachsener hatte er sich bei seinen Familienangehörigen und Freunden durch sein Naturtalent für aufmerksamkeitsstarkes Schreiben hervorgetan. Jetzt hatte er keine Ahnung, wie er diese Fertigkeit zum Einsatz bringen sollte. »In [Zuikers] dunkelsten Momenten fragte er Gott, warum ihm dieses ungewöhnliche Talent geschenkt worden war, wenn er nie die Chance erhalten sollte, es zu nutzen«, schreibt Bill Carter in Desperate Networks.20
Das Blatt wendete sich für Zuiker, als er einen originellen Monolog schrieb, den ein befreundeter Schauspieler bei seinem Vorsprechen nutzen sollte. Ein Hollywoodagent, der diesen Monolog hörte, verfolgte die Arbeit bis zu Zuiker zurück und fragte ihn, ob er einmal probieren wolle, ein Drehbuch zu schreiben. Zuiker kaufte sich ein Buch über das Drehbuchschreiben von Syd Field und verfasste ein Skript mit dem Titel The Runner, das von einem Spielsüchtigen handelt, der als Laufbursche für einen Gangster arbeitet. Das Skript wurde zu einem bescheidenen Preis verkauft, doch es genügte, damit Zuiker auf dem Radar einer neuen Abteilung der Produktionsfirma von Regisseur Jerry Bruckheimer erschien, die mehr in den Fernsehbereich vordringen wollte. Sie luden Zuiker ein, ihnen seine Ideen vorzustellen. Inspiriert von einer Reality-Sendung auf dem Discovery Channel namens The New Detectives: Case Studies in Forensic Science, die er sehr mochte, entwickelte Zuiker die Grundlagen einer Krimiserie ähnlich wie Law & Order, in der Hightech-Tools zur Aufklärung von Verbrechen zum Einsatz kamen.





























