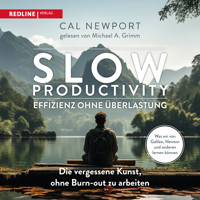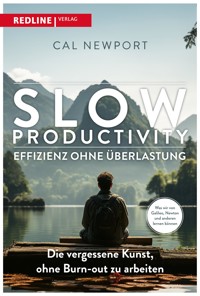15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Im Büro, im Urlaub, immer und überall, sogar im Bad, werden Nachrichten gecheckt und E-Mails geschrieben. Doch der kommunikative Dauerbeschuss macht Menschen unglücklich und unproduktiv. Wir sind schlicht nicht dafür gemacht! Bestsellerautor Cal Newport plädiert für einen bewussteren Umgang mit Kommunikationskanälen und für Arbeitsplätze, an denen Menschen arbeiten können, ohne ständig Nachrichten senden oder empfangen zu müssen – nichts weniger als eine Revolution der Arbeitswelt! Er ist überzeugt, dass der Trend hin zu einer Welt mit weniger E-Mails geht – mit positiven Auswirkungen für uns, unsere Produktivität und unser Wohlbefinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CAL NEWPORT
EINE WELTOHNE E-MAIL
Für Max, Asa und Josh:
Möge eure Zukunft nicht vom Posteingang bestimmt sein.
CAL NEWPORT
EINE WELTOHNE E-MAIL
Konzentrierter arbeiten in der Kommunikationsflut
Übersetzung aus dem Englischen von Friederike Moldenhauer
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2021
© 2021 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH, Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2021 by Cal Newport.
Die englische Originalausgabe erschien bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel A World without Email.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Friederike Moldenhauer, Hamburg
Redaktion: Britta Fietzke, Frankfurt a. Main
Umschlaggestaltung: Marc Fischer, München
Umschlagabbildung: grebeshkovmaxim/Shutterstock
Satz: Daniel Förster, Belgern
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-760-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-142-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-143-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Einleitung
Das hyperaktive Schwarmdenken
TEIL I
DIE CAUSA E-MAIL
1 E-Mails senken die Produktivität
2 E-Mails machen uns unglücklich − eine Welle stillen Leids
3 E-Mails haben einen eigenen Kopf
TEIL II
PRINZIPIEN FÜR EINE WELT OHNE E-MAILS
4 Das Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie
5 Das Prozessprinzip
6 Das Protokollprinzip
7 Das Spezialisierungsprinzip
Fazit
Mondlandung im 21. Jahrhundert
Über den Autor
Dank
Anmerkungen
Einleitung
Das hyperaktive Schwarmdenken
Ende 2010 kam Nish Acharya in Washington D.C. an, bereit, seinen Job anzutreten. Präsident Barack Obama hatte ihn zum Leiter Innovation und Entrepreneurship ernannt und zum leitenden Berater des Wirtschaftsministeriums gemacht. Zu Acharyas Aufgaben zählte die Koordination von 26 verschiedenen Bundesbehörden und über 500 Universitäten, um Fördergelder in Höhe von insgesamt 100 Millionen Dollar zu verteilen. In anderen Worten entwickelte er sich gerade zu einem der typischen Macher aus der Hauptstadt: ständig das Smartphone in der Hand, Nachrichten fliegen hin und her, 24 Stunden am Tag. Aber dann brach das Netzwerk zusammen.
Eines Dienstagmorgens, erst einige Monate, nachdem er seinen neuen Posten angetreten hatte, bekam Acharya eine E-Mail von seinem IT-Verantwortlichen, der ihm erklärte, dass das Büronetzwerk aufgrund eines Computervirus vorübergehend heruntergefahren werden müsse. »Wir gingen alle davon aus, dass sich das innerhalb weniger Tage beheben ließe«, erzählte mir Acharya in einem Interview, das ich später wegen dieses Ereignisses mit ihm führte. Doch diese Vorhersage erwies sich als außerordentlich optimistisch. In der folgenden Woche berief eine Staatssekretärin des Wirtschaftsministeriums eine Besprechung ein und erklärte, dass man davon ausgehe, dass der Virus seinen Ursprung im Ausland habe. Der Heimatschutz empfehle, dass man das Netzwerk bis auf Weiteres ‒ also bis zur Rückverfolgung des Angriffs ‒ abgeschaltet lassen solle. Zur Sicherheit müssten daher die Festplatten aller Computer, Laptops, Drucker – also alle Geräte im Büro mit einem Chip – gelöscht werden.
Eine der wichtigsten Folgen dieses vollständigen Abschaltens war, dass das Büro nun keine E-Mails empfangen oder versenden konnte. Aus Sicherheitsgründen durften generell keine privaten E-Mail-Adressen für die Kommunikation zu Regierungsbelangen verwendet werden. Außerdem verhinderten bürokratische Hürden, übergangsweise die Netzwerke anderer Bundesbehörden zu nutzen. Damit waren Acharya und sein Team praktisch von dem hektischen Pingpong digitaler Nachrichten abgeschnitten, das zur Arbeit übergeordneter Institutionen der US-Bundesregierung einfach dazugehörte. Der Black-out dauerte sechs Wochen. Der Tag, an dem das all dies begann, ging als »Dunkler Dienstag« in die Geschichte von Acharyas Büro ein ‒ man nahm es mit Galgenhumor.
Wenig überraschend verwandelte der plötzliche und unerwartete Ausfall der E-Mails einige Aspekte von Acharyas Arbeit »zu einer ziemlichen Hölle«. Weil der Rest der Regierung nach wie vor von diesem Kommunikationsinstrument abhängig war, fürchtete er, wichtige Meetings oder Anfragen zu verpassen. »Es gab also eine existierende Leitung«, beschrieb er die Situation, »aber ich war davon abgeschnitten.« Auch die Logistik war schwierig. So gehörte es zu Acharyas Aufgaben, zahlreiche Besprechungen anzusetzen, dies war aber ohne E-Mails eine recht mühsame Angelegenheit.
Allerdings geschah etwas, womit Acharya nicht gerechnet hätte: Entgegen seiner Erwartung kam seine Arbeit in diesen sechs Wochen nicht zum Erliegen, sondern er musste stattdessen feststellen, dass er seine Aufgaben tatsächlich besser erledigt bekam. Da er bei einer Frage nun nicht mehr die Möglichkeit hatte, einfach kurz eine E-Mail zu schicken, erhob er sich von seinem Schreibtisch, um die betreffende Person persönlich zu sprechen. Weil es nun so schwierig war, diese Besprechungen zu organisieren, plante er längere Termine ein, während deren er die Menschen wirklich kennenlernen und die Feinheiten der Themen begreifen konnte, mit denen sie sich beschäftigten. Wie sich herausstellte, erwiesen sich diese längeren Sitzungen Acharya zufolge als »sehr wertvoll«, gerade für ein neu berufenes Mitglied des Stabs, das versuchte, die subtilen Dynamiken innerhalb der US-Regierung zu verstehen.
Da er in dieser Zeit aber keinen E-Mail-Eingang zwischen den Besprechungen checken musste, entstand eine Phase der kognitiven Ruhe, die Acharya »Leerraum« nannte. Sie ermöglichte es ihm, tiefer in die Forschungsliteratur und Gesetzestexte einzutauchen, die für seine Themenbereiche relevant waren. Aufgrund der ruhigeren und bewussteren Art und Weise, in der er jetzt Denkarbeit verrichtete, kam Acharya auf einige bahnbrechende Ideen, die schließlich die Agenda seiner Behörde für das ganze folgende Jahr bestimmen sollten: »In Washingtons Politikszene nimmt sich niemand diese Zeit. Alle gucken ständig neurotisch auf ihr Handy, um E-Mails zu checken – das aber bremst den Einfallsreichtum.«
In unserem Gespräch über den Dunklen Dienstag und dessen Nachwirkungen fiel mir auf, dass viele Schwierigkeiten, die den Totalausfall zur »Hölle« machten, lösbar schienen. Wie Acharya einräumte, konnte er seine Besorgnis, er wäre vom Kommunikationsstrom abgeschnitten, lindern, indem er täglich das Weiße Haus anrief. Mithilfe dieser Telefonate fand er heraus, welche Sitzungen stattfanden, bei denen er dabei sein musste. Vermutlich hätte auch ein engagierter Assistent oder ein jüngeres Teammitglied diese Anrufe tätigen können. Aber darüber hinaus gab es noch das Ärgernis, Meetings planen zu müssen, aber das hätte ebenso von einem Assistenten oder einer Art automatisiertem System zur Terminplanung übernommen werden können. Kurzum: Scheinbar war es möglich, die grundlegenden Vorteile des E-Mail-Blackouts beizubehalten, während viele der lästigen Begleiterscheinungen vermieden werden konnten. »Was würden Sie von dieser Arbeitsweise halten?«, fragte ich Acharya, nachdem ich ihm meine Vorschläge unterbreitet hatte. Für einen Moment war es still in der Leitung. Ich hatte eine derart absurde Idee vorgeschlagen – nämlich vorübergehend ohne E-Mails zu arbeiten –, dass Acharyas Gedanken einen Moment lang innehielten.
Seine Reaktion überraschte mich nicht. Eine allgemein akzeptierte Prämisse moderner Wissensarbeit lautet, dass die E-Mail unsere Rettung sei. Sie verwandelte schwerfällige, altmodische Büros, in denen Sekretärinnen Telefonnotizen und Aktenvermerke auf Papier schrieben, die dann mittels Rollwagen verteilt wurden, in eine schnittigere und effizientere Sache. Dieser Prämisse entsprechend ist es, wenn Sie sich von Hilfsmitteln wie E-Mail oder Messenger-Diensten überfordert fühlen, ein sicheres Zeichen dafür, dass Sie zu Schludrigkeit neigen. Sie müssen ganz einfach Ihren E-Mail-Eingang in konzentrierten Blöcken überprüfen, Ihre Benachrichtigungen abschalten und Ihre Betreffzeilen präziser formulieren! Wenn Ihnen die Belastung durch den Posteingang wirklich zu viel wird, dann muss vielleicht Ihr ganzes Unternehmen seine »Regeln« optimieren, was beispielsweise den Zeitrahmen betrifft, innerhalb dessen eine E-Mail zu beantworten ist. Nie aber wird der Wert konstanter elektronischer Kommunikation grundsätzlich hinterfragt, die unser modernes Arbeiten definiert. Dies gilt als absolut reaktionär und nostalgisch ‒ als würde man etwa den guten alten Tagen der Pferdekutschen oder des romantischen Kerzenlichts hinterherjammern.
Aus dieser Perspektive betrachtet war Acharyas Dunkler Dienstag eine Katastrophe. Aber was ist, wenn wir das Ganze umkehren? Was wäre, wenn E-Mails Wissensarbeit nicht retten würden, sondern wir stattdessen kleine Vorteile gegen große Nachteile bezüglich wahrer Produktivität (keine hektische Betriebsamkeit, sondern echte Ergebnisse) eintauschten? Was, wenn dies in den letzten 20 Jahren zu einem langsameren Wirtschaftswachstum geführt hätte? Was, wenn unsere Probleme mit diesen Instrumenten nicht auf schlechten Gewohnheiten basierten (die sich leicht ändern ließen), sondern darauf, dass sie unsere Arbeitsweisen unerwartet und drastisch verändert haben? Was, wenn ‒ in anderen Worten ‒ der Dunkle Dienstag keine Katastrophe war, sondern ein Vorgeschmack darauf, wie die innovativsten Führungskräfte und Unternehmer ihre Arbeit in naher Zukunft organisieren werden?
Schon seit mindestens fünf Jahren bin ich von der Frage besessen, wie E-Mail unsere Arbeit grundlegend verändert hat. In diesem Prozess war das Jahr 2016 ein wichtiger Wendepunkt, das Jahr, in dem ich ein Buch mit dem Titel Konzentriert Arbeiten (Deep Work) herausgebracht habe, das sich dann zu einem Überraschungshit entwickelte.
In diesem Buch vertrete ich die Hypothese, dass die Wissensbranche die Konzentrationsfähigkeit unterschätzt. Während die Fähigkeit, mittels digitaler Nachrichten blitzschnell zu kommunizieren, nützlich ist, erschweren die ständigen Unterbrechungen durch diese Tools das Fokussieren. Das wiederum hat mehr Einfluss auf unsere Fähigkeit, wertvollen Output zu produzieren, als wir annehmen. Bei dem Schreiben von Konzentriert Arbeiten habe ich nicht viel Zeit auf die Reflexion verwandt, wie es dazu kam, dass wir in der Flut unserer E-Mails ertrinken, ohne eine Veränderung des Systems vorzuschlagen. Ich dachte, bei diesem Problem gehe es vorwiegend um einen Informationsmangel. Sobald Organisationen oder Firmen die Bedeutung von Konzentration begriffen – so lautete meine Überlegung –, könnten sie ihre Arbeitsweise spielend leicht ändern, um die Prioritäten richtig zu setzen.
Ich musste feststellen, dass ich da etwas zu optimistisch war. Während meiner Lesereise lernte ich sowohl Führungskräfte als auch Angestellte kennen und schrieb in meinem Blog neben weiteren Artikeln über dieses Thema auch für The New York Times und The New Yorker. Dabei wurde mir bewusst, wie düster und komplex der Istzustand der Wissensbranche ist. Permanente Kommunikation ist nichts, was hin und wieder mal der eigentlichen Arbeit im Wege steht, sondern ist mittlerweile untrennbar damit verknüpft, wie wir arbeiten. Leicht umsetzbare Versuche, die Ablenkungen zu minimieren, indem man schlechte Angewohnheiten ablegt oder kurzlebige Interventionen wie Freitage ohne E-Mail initiiert, werden davon torpediert. Eine echte Verbesserung – das begriff ich nun – würde einen grundsätzlichen Wandel voraussetzen, wie wir unsere beruflichen Aufgaben erledigen. Ebenso begriff ich, dass diese Veränderungen nicht auf die Schnelle zu haben waren: Während es in den frühen 2000er-Jahren noch schick war, sich über diese neue Flut von zu vielen E-Mails zu beschweren, ist daraus mittlerweile ein viel ernsteres Problem geworden. Diese Flut hat inzwischen für viele einen Punkt erreicht, an dem sie ihren eigentlichen produktiven Output nur früh morgens, abends oder am Wochenende schaffen können. Die Werktage hingegen kämpfen sie wie Sisyphos gegen einen überquellenden Posteingang an – eine Herangehensweise, die wahrlich Grund für Kummer ist.
Dieses Buch stellt meinen Versuch dar, dieser Krise zu begegnen. Zum ersten Mal fasse ich die Erkenntnisse darüber, wie wir in diese Kultur der nicht enden wollenden Kommunikation geraten sind, zusammen und stelle die Effekte dar, die sie sowohl auf unsere Produktivität als auch auf unsere geistige Gesundheit hat. Darüber hinaus erkunde ich einige überzeugende Visionen alternativer Arbeitsformen. Die Vorstellung einer Welt ohne E-Mail war derart radikal, dass sie Nish Acharya kalt erwischte. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass eine solche Welt nicht nur umsetzbar, sondern tatsächlich wünschenswert ist. Mein Ziel mit diesem Buch ist es, einen Entwurf für die zu erwartende Revolution zu skizzieren. Bevor ich darstelle, was Sie von den folgenden Seiten erwarten können, müssen wir ein besseres Verständnis des derzeitigen Problems bekommen.
Als sich E-Mails in den 1980er- und 1990er-Jahren immer weiter in der Berufswelt verbreiteten, brachten sie eine Neuerung mit: reibungslose Kommunikation im großen Stil. Mit diesem neuen Instrument sanken die beachtlichen Kommunikationskosten hinsichtlich Zeit und sozialem Kapital auf fast Null. Wie der Autor Chris Anderson in seinem Buch Free von 2009 bemerkte, können die Dynamiken, Kosten auf Null zu reduzieren »äußerst mysteriös« sein.1 Das erklärt auch, warum nur wenige Menschen die Veränderungen, die diese kostenlose Kommunikation ausgelöst hat, voraussagten. Nicht nur haben wir die schon existierende Masse an Sprachnachrichten, Faxe und Notizen auf dieses neue, bequeme elektronische Medium verlagert: Wir haben auch die zugrunde liegenden Arbeitsabläufe komplett transformiert, die unseren Arbeitsalltag bestimmen. Wie noch nie zuvor führten wir nun einen Dialog. Die zuvor holprige Abfolge einzelner Arbeitsschritte, die unseren Berufsalltag ausmachten, glätteten wir zu einem gleichmäßigen Teppich kontinuierlichen Geredes, in dem die Ecken und Kanten dessen, was wir früher für unsere eigentliche Arbeit hielten, verschmelzen.
Einer Studie zufolge verschickte und erhielt ein durchschnittlicher Angestellter im Jahr 2019 durchschnittlich 126 berufliche E-Mails täglich. Das heißt, ungefähr alle vier Minuten ging eine Nachricht ein oder aus.2 Die Softwarefirma RescueTime untersuchte dieses Verhalten mit einer Zeiterfassungssoftware und berechnete, dass ihre Nutzer durchschnittlich alle sechs Minuten nach E-Mails oder in die Nachrichtentools wie Slack schauten.3 An der University of California, Irvine, führte ein Forscherteam ein ähnliches Experiment durch. Es untersuchte das Verhalten am Computer von vierzig Mitarbeitern eines großen Unternehmens über den Verlauf von zwölf Arbeitstagen. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Angestellten an einem Tag durchschnittlich siebenundsiebzig Mal ihren E-Mail-Eingang kontrollierten ‒ der aktivste von ihnen tat dies mehr als vierhundert Mal täglich.4 Eine von Adobe durchgeführte Befragung ergab, dass Wissensarbeiter angeben, sich mehr als drei Stunden am Tag mit dem Versenden oder Empfangen beruflicher E-Mails zu beschäftigen.5
Das Problem ist also nicht das Instrument an sich, sondern die neue Art zu arbeiten, die damit einherging. Um diese neuen Arbeitsabläufe besser verstehen zu können, definiere ich sie folgendermaßen:
Das hyperaktive Schwarmdenken
Ein Arbeitsablauf, bei dem eine fortwährende Konversation im Zentrum steht, die von unstrukturierten und ungeplanten Mitteilungen angetrieben wird – übermittelt von digitalen Kommunikationsmedien wie E-Mail und Messenger-Diensten.
Der Workflow, die Arbeitsabläufe, des hyperaktiven Schwarmdenkens hat im ganzen Wissenssektor Verbreitung gefunden. Ob Sie nun Softwareprogrammierer, Marketingberaterin, Manager, Zeitungsredakteurin oder Professorin sind – Sie gestalten Ihren Arbeitstag so, dass Sie sich mit den laufenden Dialogen des Schwarmdenkens in Ihrer Organisation beschäftigen. Dieser Arbeitsvorgang bringt uns aber dazu, dass wir uns ein Drittel unserer Arbeitszeit um unseren E-Mail-Eingang kümmern und alle sechs Minuten überprüfen, ob neue Nachrichten eingetroffen sind. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, aber wenn man dieses Verhalten im Kontext der jüngeren Vergangenheit betrachtet, dann stellt dies eine dermaßen radikale Verschiebung unserer Arbeitskultur dar, dass sich ein genauerer Blick darauf durchaus lohnt.
Gerechterweise muss man einräumen, dass das hyperaktive Schwarmdenken offensichtlich keine so schlechte Idee ist. Zu den Vorteilen dieses Arbeitsablaufes gehört, dass er einfach und unglaublich anpassungsfähig ist. Wie mir von einem Wissenschaftler erklärt wurde, bestach die E-Mail zum Teil durch die Tatsache, dass dieses eine simple Hilfsmittel bei fast jeder Art von geistiger Arbeit angewendet werden konnte. Es bedurfte einer viel niedrigeren Lernkurve, als für jede einzelne Aufgabenstellung eine andere maßgeschneiderte digitale Anwendung zu erlernen. Unstrukturierte Konversationen sind darüber hinaus eine effektive Methode, unerwartete Problemstellungen zu identifizieren und daraufhin die entsprechenden Reaktionen schnell zu koordinieren.
Doch wie ich im ersten Teil dieses Buches aufzeigen werde, erweist sich der erst durch E-Mail ermöglichte Workflow des Schwarmdenkens als spektakulär ineffektiv. Die Erklärung für dieses Scheitern liegt in unserer Psychologie begründet. Über eine kleine Gruppe von etwa zwei bis drei Personen hinaus ist diese Art unstrukturierter Zusammenarbeit nicht für den Menschen gemacht: Unser Gehirn ist nicht entsprechend entwickelt, um so zu arbeiten. Gründet sich die Arbeit Ihrer Organisation auf Schwarmdenken, dann können Sie weder Ihren Posteingang noch Chats über längere Zeit ignorieren, ohne den gesamten Ablauf auszubremsen. Das ständige Hin und Her des Schwarmdenkens zwingt Sie dazu, Ihre Aufmerksamkeit häufig abwechselnd auf die Arbeit an sich und auf die Kommunikation über Ihre Arbeit zu lenken. Wie ich ausführen werde, zeigt die zukunftsweisende Forschung in der Psychologie und den Neurowissenschaften, dass dieser Wechsel zwischen Kontexten ‒ seien diese auch noch so kurz ‒ viel geistige Energie kostet. Nicht nur wird die kognitive Leistung gemindert, sondern es stellt sich auch ein Gefühl von Erschöpfung und eine reduzierte Effektivität ein. In der Momentaufnahme scheint es, dass die Fähigkeit der schnellen Aufgabenverteilung und Rückmeldungsvergabe zu einer Verschlankung des Prozesses führt, aber wie ich zeigen werde, sorgt sie vermutlich auf lange Sicht dafür, dass die Produktivität sinkt, denn es sind für die Bewältigung desselben Arbeitsaufkommens mehr Zeit und höhere Kosten nötig.
In dem ersten Teil des Buchs zeige ich, inwiefern der soziale Aspekt der Arbeitsabläufe gemäß des Schwarmdenkens unseren »sozialen« Schaltkreisen im Gehirn widerspricht. Sie wissen auf rationaler Ebene, dass die sechshundert ungelesenen E-Mails in Ihrem Posteingang nicht entscheidend sind. Daher erinnern Sie sich selbst daran, dass die Verfasser dieser Nachrichten Besseres zu tun haben, als ungeduldig auf Ihre Antwort zu warten, sehnsüchtig auf ihren Monitor zu starren und diese Wartezeit zu verfluchen. Aber ein älterer Teil Ihres Gehirns, der sich mit der Zeit auf die Wahrnehmung des subtilen Gefüges sozialer Verbindungen spezialisiert und so dafür gesorgt hat, dass wir als Spezies seit dem Paläolithikum so wahnsinnig gut gediehen sind, ist beunruhigt. Er sorgt sich, dass Sie Ihren sozialen Verpflichtungen nicht nachkommen. Was diese sozialen Schaltkreise betrifft, versuchen Mitglieder Ihres Stammes, Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Sie ignorieren sie ‒ das nimmt Ihr Gehirn als einen Notfall wahr. Dieser permanente Zustand des Unbehagens ist das leise besorgte Hintergrundrauschen, von dem viele Wissensarbeiter glauben, es würde zum Posteingang einfach dazugehören, dabei ist es ein Artefakt einer unglücklichen Diskrepanz zwischen modernen Arbeitsmethoden und vorzeitlichen Gehirnen.
Die einleuchtende Frage lautet also: Warum sollten wir überhaupt einem Arbeitsablauf folgen, der mit so vielen negativen Folgen verbunden ist? Wie ich am Schluss von Teil I erläutern werde, ist die Entstehung des hyperaktiven Schwarmdenkens kompliziert. Es war nie eine aktive Entscheidung, sondern ist irgendwie aus eigenem Antrieb so gekommen. Unser Glaube, dass hektische Kommunikation gleichzusetzen sei mit Arbeit, ist hauptsächlich eine aufgeladene Narration, die wir uns selbst erzählen, um den plötzlichen Veränderungen, die von komplexen Dynamiken angetrieben werden, einen Sinn zu verleihen.
Vielleicht sollte uns vor allem der Versuch, die Willkür hinter unserer Arbeitsweise zu verstehen, uns zu einer Suche nach besseren Alternativen motivieren. Darum geht es im zweiten Teil. Hier stelle ich ein Konzept vor, das ich die Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie nenne. Sie besagt, dass wir Arbeitsabläufe so auf speziell angelegte Prozesse aufbauen, dass sie das meiste aus unseren menschlichen Gehirnen herausholen, gleichzeitig aber unnötige Qualen minimieren. Das mag offensichtlich erscheinen, aber tatsächlich widerspricht es der üblichen Sichtweise, wie Wissensarbeit erledigt wird. Ich werde zeigen, dass wir – geleitet von den Gedanken des äußerst einflussreichen Ökonomen Peter Drucker – davon ausgehen, dass Wissensarbeiter autonome Blackboxes sind. Damit ignorieren wir die Details, wie sie etwa ihre Arbeit erledigen, sondern beschränken uns stattdessen darauf, ihnen klare Ziele und motivationale Führung zu unterstellen. Das ist ein Fehler. Im Wissensbereich liegt zurzeit großes Produktivitätspotenzial brach. Um dieses zu heben, müssen wir uns viel systematischer Gedanken über die Erreichung unseres gemeinsamen Ziels machen: eine Anzahl in Netzwerken verbundener menschlicher Gehirne dazu zu bringen, den größtmöglichen Wert möglichst nachhaltig zu erwirtschaften. Tipp: Die richtige Antwort hat vermutlich nichts damit zu tun, alle sechs Minuten in den E-Mail-Eingang zu schauen.
Ein großer Abschnitt von Teil II untersucht verschiedene Prinzipien für die Anwendung des Aufmerksamkeitsökonomie-Gedankens, um die Arbeitsabläufe auf organisationaler, Team- und individueller Ebene entsprechend zu fördern. Das bedeutet, sich von dem hyperaktiven Schwarmdenken weg und zu stärker strukturierten Ansätzen hinzubewegen. Denn Letztere vermeiden die Probleme, die entstehen, wenn man permanent miteinander kommuniziert, was ich in Teil I ausführlich schildere. Einige der auf diesen Prinzipien basierenden Ideen stammen von innovativen Organisationen, die mit neuen Workflows experimentieren und ungeplante Kommunikation minimieren. Andere Ideen entstanden aus der Praxis komplexer Wissensorganisationen, die schon vor der Erfindung digitaler Netzwerke effektiv gearbeitet haben.
Die Prinzipien, die ich in Teil II beschreibe, verlangen jedoch nicht, dass Sie Nachrichtentools wie E-Mails und Messenger-Dienste aus Ihrem Arbeitsalltag verbannen, denn diese stellen sehr nützliche Kommunikationswege dar und es wäre rückständig, wollte man, nur um des Arguments willen, zu den alten und komplizierteren Vorgehensweisen zurückkehren. Doch diese Prinzipien werden Sie dazu bringen, die digitale Nachrichtenübermittlung von einer selbstverständlichen Gegebenheit auf ein Mittel zu reduzieren, das man hin und wieder einsetzt. Eine Welt ohne E-Mails, wie es der Titel dieses Buches vorschlägt, ist also kein Universum ohne SMTP oder POP3, sondern es ist eine Welt, in der Sie den Großteil des Tages tatsächlich Ihre Aufgaben voranbringen, statt über diese Aufgaben zu sprechen. Ständig kleine Aufträge via E-Mail hin- und herzuschieben, wird es dann nicht mehr geben.
Meine Ratschläge richten sich an ganz verschiedene Leserinnen und Leser. Dazu gehören Geschäftsführer, die den Betrieb ihres Unternehmens anders organisieren möchten, Teams, die effektiver arbeiten wollen, Soloselbstständige sowie Freiberufler, die ihren Produktionswert maximieren wollen, und sogar der einzelne Mitarbeiter, der seine Kommunikation verbessern möchte, indem er sie aus aufmerksamkeitsökonomischer Sicht betrachtet. Entsprechend geht es in den genannten Beispielen nicht nur im Großen um den CEO, der seine Unternehmenskultur drastisch verändern möchte, sondern auch um meine eigenen Experimente im Kleinen mit einem aus der Softwareentwicklung stammenden System, mit dem ich meine administrativen Aufgaben aus meiner Inbox ausgelagert und strukturierter bewältigt bekommen habe.
Nicht jeder Vorschlag aus Teil II kann auf jede Situation angewendet werden. Arbeiten Sie beispielsweise in einer Firma, deren Mitarbeiter schon immer zu den Jüngern des hyperaktiven Schwarmdenkens gehörten, können Sie nur in Grenzen Veränderungen anstoßen, ohne den Zorn dieser auf sich zu ziehen. Daher bedarf es einer besonderen Aufmerksamkeit, die für Sie nützlichen und umsetzbaren Strategien auszuwählen. (Ich versuche Sie bei dieser Auswahl zu unterstützen, indem ich verschiedene Beispiele anführe, wie die Prinzipien in den einzelnen Kontexten funktioniert haben.) Sind Sie Gründer eines Start-ups, haben Sie wahrscheinlich mehr Erfahrung mit radikal neuen Arbeitsprozessen als der Geschäftsführer eines Großunternehmens.
Aber ich glaube fest daran, dass jeder – sei es der einzelne Freiberufler oder eine ganze Organisation – seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern wird … Wenn er denn die Arbeitsweise hyperaktiven Schwarmdenkens kritisch reflektiert und daraufhin gewisse Elemente systematisch durch Prozesse ersetzt, die besser an die Struktur des menschlichen Gehirns angepasst sind. Die Zukunft der Arbeit wird immer kognitiver sein. Das bedeutet, je früher wir die wahre Funktionsweise des Gehirn ernst nehmen und Strategien entwickeln, die diesen Voraussetzungen am besten entsprechen, desto schneller wird uns bewusst, dass das hyperaktive Schwarmdenken zwar bequem, aber katastrophal ineffektiv für die Organisation unserer Arbeit ist.
Daher sollte man dieses Buch nicht als rückständig oder technologiefeindlich abtun. Ganz im Gegenteil – seine Botschaft ist zutiefst zukunftsorientiert. Wenn wir das ganze Potenzial digitaler Netzwerke in unserem beruflichen Umfeld ausschöpfen wollen, dann müssen wir kontinuierlich und offensiv weiter an der Optimierung ihrer Nutzung arbeiten. Gegen die Mängel des hyperaktiven Schwarmdenkens anzugehen, ist keineswegs der Akt einer technologiefeindlichen Revolte … Wenn überhaupt, besteht die wahre Fortschrittsbremse darin, dieses stumpfe Arbeitsinstrument der Bequemlichkeit halber zu nutzen, obwohl es Wege der deutlichen Verbesserung gibt.
Diesem Ansatz zufolge ist eine Welt ohne E-Mail kein Schritt zurück, sondern ein Schritt nach vorn – in eine aufregende technologische Zukunft, die wir erst langsam beginnen zu verstehen. In der Wissensarbeit gibt es noch keinen Henry Ford, aber Arbeitsabläufe optimierende Innovationen werden denselben Einfluss bekommen wie seine Erfindung des Fließbands – das ist unvermeidlich. Unsere Zukunft kann ich nicht im Einzelnen voraussagen, aber ich bin davon überzeugt, dass der Blick in den E-Mail-Eingang alle sechs Minuten nicht dazugehören wird. Diese Welt ohne E-Mail wird kommen, und ich hoffe, dieses Buch trägt dazu bei, dass Sie von ihren Möglichkeiten genauso begeistert sind wie ich.
TEIL I
Die Causa E-Mail
1
E-Mails senken die Produktivität
DIE VERBORGENEN KOSTEN DES HYPERAKTIVEN SCHWARMDENKENS
Als ich Sean kennenlernte, berichtete er mir von der Kommunikation in seinem Büro, und mir kam dies alles sehr bekannt vor. Er war Mitbegründer einer kleinen Technologiefirma, die Anwendungen für den internen Bereich großer Organisationen entwickelte. In dem Londoner Büro waren sieben Angestellte mit dieser Aufgabe beschäftigt, die alle bekennende Verfechter des hyperaktiven Schwarmdenkens und entsprechender Arbeitsweisen waren. »Gmail war bei uns immer geöffnet«, erklärte mir Sean. »Wir haben alles per E-Mail gemacht.« Sobald Sean morgens die Augen aufschlug, fing er sofort an, Nachrichten zu schreiben und zu lesen – so ging das bis nach Feierabend. Einer von Seans Mitarbeitern bat ihn sogar, spät abends keine E-Mails mehr zu schicken, denn allein das Wissen, dass sich die E-Mails seines Chefs morgens im Posteingang stapelten, stresste ihn.
Doch dann legte die Überaktivität noch einen Gang zu. »Es gab diesen Hype über Slack, also beschlossen wir, diesen Instant-Messaging-Dienst auszuprobieren.« Die Anzahl der hin- und hergeschickten Textnachrichten stieg insbesonders, als ein anstrengender Kunde Zugang zu den Firmenchannels bekam. Was es diesem ermöglichte, Kontrolle auszuüben und Fragen zu stellen, wann immer er dazu Lust hatte. Sean erinnerte sich: »Andauernde Unterbrechungen, jeden Tag.« Er spürte, dass seine Aufmerksamkeit zwischen den Nachrichten und seiner Aufgabe vor und zurück peitschte, bis er schließlich nicht mehr klar denken konnte. Irgendwann hasste er den Ton des Nachrichteneingangs: »Ich hasste es – und kriege heute noch Gänsehaut von diesem Geräusch.« Sean fürchtete, dass diese mentale Plackerei seine Firma ineffektiver machte. »Ich habe bis nachts um eins gearbeitet«, erklärte er, »weil das die einzige Zeit war, in der ich nicht abgelenkt wurde.« Darüber hinaus kamen ihm Zweifel, ob all dieses unaufhörliche Geplapper überhaupt notwendig war. Als er sich anschaute, wie sein Team Slack nutzte, fand er heraus, welche die häufigste Funktion bei ihnen war: das Plug-in, das animierte GIFs in die Nachrichten einfügte. Sean erkannte den neuesten Tiefpunkt, als zwei seiner Projektleiter plötzlich kündigten. »Sie waren ausgebrannt.«
Sean ist nicht der Einzige, der das Gefühl hat, dass dieses ganze digitale Hin und Her unserer Produktivität schadet. Im Herbst 2019 lud ich meine Leser dazu ein, im Rahmen meiner Recherchen zu diesem Buch an einer Umfrage zum Thema E-Mail und verwandten Anwendungen wie Slack im Beruf teilzunehmen. Über 1.500 Leser folgten diesem Aufruf und viele von ihnen teilten Seans Frust. Dabei ging es nicht um die Programme an sich, die offensichtlich eine effiziente Kommunikationsart sind, sondern darum, dass sie die Arbeitsabläufe, die das hyperaktive Schwarmdenken hervorruft, erst ermöglichen. Ein Teil dieser Umfrageantworten betrafen die schiere Anzahl der Kommunikationsschritte, die durch diesen Workflow generiert würden. »Jeden Tag gibt es dieses Sperrfeuer aus E-Mails, in denen es um Terminabsprachen und Deadlines geht, und sie sind nicht mal sinnvoll«, beklagte Art, ein Rechtsanwalt. George, ebenfalls Anwalt, verglich seinen Posteingang mit »einer Lawine von Nachrichten«, in der Wichtiges untergehe.
Ein anderer Themenschwerpunkt befasste sich mit der Ineffektivität, wenn Klärungen in einen endlosen Dialog ausarten. »Dass E-Mails asynchron verfasst werden, ist Fluch und Segen zugleich«, kommentierte eine Finanzanalystin namens Rebecca. »Es ist insofern ein Segen, als dass ich eine Frage stellen oder eine Aufgabe delegieren kann, ohne eine bestimmte Person dafür ausfindig machen zu müssen. Der Fluch besteht darin, dass unterschwellig immer die Erwartung da ist, dass wir rund um die Uhr unsere E-Mails checken und umgehend reagieren.« Ganz ähnlich beklagte ein IT-Projektmanager: »Eine einfache E-Mail-Anfrage, die man innerhalb weniger Stunden hätte bearbeiten können, kann einen unglaublichen Schwanz an weiteren E-Mails hinter sich herziehen, der von immer mehr Leuten in cc gelesen wird.« Eine Angestellte aus der öffentlichen Verwaltung merkte an, dass die Tatsache, dass diese Kontakte digital stattfinden, dazu führe, dass die Nachrichten »übermäßig formal« und »weniger kreativ oder auf den Punkt« seien. Sie führte ihren Gedanken weiter aus: »Ein Projekt oder eine Aufgabe, die ziemlich einfach von einer Arbeitsgruppe gemeinsam an einem Tisch erledigt werden könnte, wird viel komplizierter, wenn man versucht, das ganze Gespräch per E-Mail zu führen – es geht immer hin und her.«
Ein anderes weit verbreitetes Argument dafür, dass E-Mails die Produktivität hemmen, lautet, sie sorgten dafür, dass man viel mehr irrelevante Informationen verarbeiten müsse. »Die laufenden Updates, die ich erhalte, sind frustrierend … das hat nichts mit meinen Aufgaben zu tun«, beklagte sich Jay, ein Lehrer. »Mittlerweile glauben die Leute, dass das Schreiben von E-Mails wirklich ›arbeiten‹ bedeute«, schrieb die Redakteurin Stephanie. »Das Schreiben von E-Mails hat eine performative Dimension, insbesondere wenn man alle in cc setzt. So etwa ›Guck mal, wie viel Arbeit ich erledige‹. Das nervt.« Andrea, eine Personalberaterin, formulierte es folgendermaßen: »Bei mindestens der Hälfte der E-Mails bleiben immer noch Fragen offen … Es fühlt sich teilweise so an, als würden manche einfach eine E-Mail losschicken, ohne sich zu überlegen, ob und wie ich sie beantworten könnte.«
Nicht nur bei Sean, sondern auch bei meinen Lesern kamen Messenger-Dienste wie Slack nicht gut weg. Viele, die meine Umfrage beantworteten, brachten mit ihnen nur noch die gesteigerte Erwartung an noch schnellere Reaktionszeiten in Verbindung. »Slack ist einfach nur eine Kette von Messages. Es lädt die Leute dazu ein, fast unbegrenzt zu posten«, stellte ein Führungskräfte-Coach namens Mark fest. »Es ist fürchterlich.«
Natürlich sind die obigen Berichte nur anekdotenhaft. Aber wie ich noch ausführen werde, sind laut der relevanten Literatur zu dem Thema die von meinen Lesern geschilderten Probleme sogar noch schlimmer, als sie selbst sie wahrnehmen. Vielleicht haben E-Mails dazu geführt, dass bestimmte Tätigkeiten effizienter erledigt werden. Doch die Wissenschaft zeigt, dass die Arbeitsweise des hyperaktiven Schwarmdenkens, die durch diese Technologie erst ermöglicht wurde, für die allgemeine Produktivität bislang katastrophal ist.
DER STETE, STETE MULTITASKING-WAHN
Ende der 1990er-Jahre befand sich Gloria Mark in einer beneidenswerten beruflichen Situation, denn ihre Forschung beschäftigte sich mit dem Bereich der computergestützten kollaborativen Arbeit (computer-supported collaborative work, CSCW). Wie der Name verrät, untersucht CSCW, wie die entstehende Technologie Menschen bei einer produktiveren Zusammenarbeit hilft. Seit seinem Aufkommen in den 1970er-Jahren konzentrierte sich CSCW auf so trockene Themen wie Management-Informationssysteme und Prozessautomation. Das Fach nahm in den 1990er-Jahren erneut Fahrt auf, als Computernetzwerke und das Internet dafür sorgten, dass Arbeit ganz anders angegangen werden konnte.
Zu jener Zeit war Mark bei dem Forschungszentrum Informationstechnik in Bonn tätig. Wie sie mir erzählte, konnte sie dort »an allem arbeiten, was mich interessierte«. Praktisch hieß das, dass sie in einige wenige Projekte »tief eintauchen« konnte, bei denen es meist um neue Kollaborationssoftware ging, wie beispielsweise die Arbeit an einem medienübergreifenden System DOLPHIN. Dessen Zweck war die Optimierung von Besprechungen. Ein anderes, PoliTeam, sollte dazu dienen, die Schreibarbeiten innerhalb von Ministerien zu vereinfachen. Wie es nun mal üblich ist, verbrachte Mark ihre Mittagspause mit den Kollegen und Kolleginnen. Nach der ausgedehnten Mahlzeit ging sie mit ihnen eine »Runde« über das Institutsgelände und sie diskutierten ihre Ideen während dieses Verdauungsspaziergangs. »Auf dem Gelände stand ein Schloss [das Frauenhofer-Institutszentrum Schloss Birlinghoven], das war wunderschön«, erzählte sie mir.
Im Jahr 1999 beschloss Mark, wieder in ihre Heimat, die USA, zurückzukehren. Ihr und ihrem Mann war es gelungen, eine Stelle an der University of California, Irvine zu bekommen. So packten sie also ihre Sachen, verabschiedeten sich von den intensiven Arbeitssessions, den entspannenden Mittagspausen und nachmittäglichen Spazierrunden um das Schloss, und zogen gen Westen los. Nachdem sie ihren neuen Job angetreten hatte, fiel Mark auf, wie beschäftigt alle schienen. »Es fiel mir wirklich schwer, mich zu konzentrieren«, erinnerte sie sich, »denn ich hatte all diese verschiedenen Projekte, mit denen ich mich auseinandersetzen musste.« Schnell verblasste die Erinnerung an die ausgedehnten Mittagspausen in Deutschland. »Ich hatte kaum die Zeit, um mir ein Sandwich oder einen Salat zu besorgen. Und wenn ich wieder zurückkam, sah ich, wie all meine Kollegen ihr Mittagessen an ihrem Schreibtisch vor dem Monitor aßen.« Mark beschäftigte die Frage, wie verbreitet diese Arbeitsgewohnheiten waren, und überzeugte eine Firma in Irvine davon, mit einem Forschungsteam den Büroalltag zu begleiten. Sie schauten der vierzehnköpfigen Arbeitsgruppe aus dem Wissenssektor drei Tage lang über die Schulter und dokumentierten haarklein, womit sie ihre Zeit am Arbeitsplatz verbrachten. Das Ergebnis ist mittlerweile eine berühmte – oder berüchtigte, je nach Perspektive – Studie, die 2004 bei einer Konferenz über die Interaktion von Mensch und Computer vorgestellt wurde. »Constant, Constant, Multitasking Craziness«1 (Der stete, stete Multitasking-Wahn) lautete ihr provokanter Titel. So nämlich beschrieb eine Untersuchungsteilnehmerin ihren typischen Arbeitstag.
»Unsere Studie bestätigt, was viele unserer Kollegen und wir selbst schon seit längerer Zeit im Alltag beobachtet haben: Die Arbeit mit Information läuft sehr fragmentiert ab«, formulieren es Mark und ihr Koautor Victor González in der Diskussion ihrer Ergebnisse. »Was uns allerdings überraschte, war, wie sehr diese Arbeit zerstückelt ist.« Die Haupterkenntnis dieses Papers lautet, dass ‒ sobald formal angesetzte Besprechungen abgeschafft wurden ‒ alle beobachteten Untersuchungsteilnehmer durchschnittlich alle drei Minuten ihre Aufmerksamkeit einer anderen Aufgabe zuwandten. Die Erfahrung, die Mark machte, als sie ihre Arbeit in Kalifornien anfing, nämlich plötzlich in alle Richtungen gezerrt zu werden, war nicht nur subjektiv. Vielmehr war dies anscheinend ein Merkmal eines Arbeitsalltags, das sich allmählich in der gesamten Wissensarbeit ausbreitete.
Auf meine Frage hin, was die Ursache dieser Zerfaserung war, antwortete Mark ohne Zögern mit »E-Mail«. Zu diesem Schluss kam sie teilweise durch die Lektüre der einschlägigen Literatur. Spätestens seit den 1960er-Jahren erforschten Wissenschaftler, wie Manager ihre Arbeitszeit verbringen. Obwohl sich die verschiedenen aufgezeichneten Kriterien über die Jahre verändert haben, blieben doch zwei Faktoren gleich: »planmäßige Sitzungen« und »Schreibtischarbeit«. Forschungsergebnisse zu diesen beiden Kategorien arbeitete Mark aus Studien ab 1965 heraus. Im Jahr 2006 führte sie abschließend ihre ursprüngliche Studie über den Multitasking-Wahn erneut durch.
Mark erstellte eine Tabelle mit allen Daten, aus der ein klarer Trend ersichtlich wurde. Zwischen 1965 und 1984 verbrachten die untersuchten Mitarbeiter ca. 20 Prozent ihres Arbeitstages mit Schreibtischarbeit und ca. 40 Prozent mit termingebundenen Meetings. In den Untersuchungen ab 2002 sind die Anteile ungefähr vertauscht. Wie kam es zu dieser Verschiebung? Wie Mark betont, »waren E-Mails dann weit verbreitet«2 in dem untersuchten Zeitraum zwischen 1984 und 2002.
Sobald sich E-Mails am modernen Arbeitsplatz durchgesetzt hatten, mussten sich Menschen zur Besprechung ihrer Aufgaben nicht länger in einem Raum gegenübersitzen, sie konnten nun einfach elektronische Nachrichten verschicken, wie es ihnen passte. Da das Bearbeiten von E-Mails in diesen Studien als »Schreibtischarbeit« zählte, verringert sich die Zeit, die in Besprechungen verbracht wird, um die Zeit, die man nun am Schreibtisch sitzt. Im Gegensatz zu persönlichen Besprechungen entwickeln sich jedoch Gespräche, die in E-Mails geführt werden, asynchron. Normalerweise vergeht eine gewisse Zeit zwischen dem Absenden einer Nachricht und deren Lesen. Das bedeutet, dass die kondensierte Interaktion, die früher das Merkmal synchroner Besprechungen war, nun auf eine größere Zeitspanne verteilt wird: Im Laufe des Tages entsteht ein eigener Rhythmus durch das wiederholte kurze Checken des Posteingangs. Laut Marks und Gonzáles’ Studie dauerte ein durchschnittliches termingebundenes Meeting ca. 42 Minuten. Im Gegensatz dazu beträgt die durchschnittliche Zeit, um in den Posteingang zu schauen, bevor man sich wieder etwas anderem zuwendet, nur zwei Minuten und 22 Sekunden. Interaktion beschränkt sich nun auf kleine Zeitabschnitte, die alle anderen typischen Aufgaben eines Wissensarbeiters fragmentieren.
In diesen unscheinbaren Datentabellen in den Forschungspapers von CSCW, die vor über zehn Jahren veröffentlicht worden sind, finden sich einige der ersten empirischen Belege für meine Hypothese des hyperaktiven Schwarmdenkens, die ich in der Einleitung angerissen habe. Da man bekanntlich nicht zu viel Gewicht auf eine einzelne Studie legen sollte, ist es gut, dass andere Forscher ebenfalls anfingen, sich ähnliche Fragen zu stellen, während Gloria Mark die Transformation von Wissensarbeit durch Kommunikationstechnologie untersuchte.
Ein Forschungsbeitrag, der 2011 in dem Magazin Organizational Studies erschien, dokumentierte die Wiederholung von Marks und González’ Pionierstudie, bei der dieses Mal vierzehn Angestellte einer australischen Telekommunikationsfirma begleitet wurden. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die untersuchten Mitarbeiter ihren Arbeitstag in 88 klar von einander getrennte »Episoden« einteilten, von denen 60 der Kommunikation galten.3 In der Zusammenfassung heißt es: »Diese Daten … stützen anscheinend die Annahme, dass Wissensarbeiter sehr fragmentierte Arbeitstage erleben.« Mit ihrem Team untersuchte Gloria Mark 2016 die Angewohnheiten von Angestellten der Forschungsabteilung eines großen Unternehmens. Mithilfe von Tracking-Software ermittelten die Forscher, dass die Mitarbeiter durchschnittlich über 77-mal am Tag ihre E-Mails überprüften.4
Forschungsarbeiten, die sich mit der durchschnittlichen Anzahl von gesendeten und erhaltenen E-Mails pro Tag beschäftigen, zeigen ebenfalls einen Trend zu zunehmender Kommunikation auf: Im Jahr 2005 waren es noch 50 E-Mails pro Tag,5 2006 schon 696 und 2011 war die Zahl auf 927 angestiegen. Die Technologieforschungsfirma Radicati Group veröffentlichte in ihrem Bericht von 2015 die Prognose, dass im Jahr 2019, als ich mit meiner Arbeit an diesem Kapitel begann, ein Berufstätiger am Tag durchschnittlich 126 E-Mails schicken und erhalten würde.8
Diese gesamte Recherche dokumentierte also eingehend sowohl den Anstieg als auch die realen Arbeitsabläufe des hyperaktiven Schwarmdenkens im Wissenssektor seit 2006. Aber die genannten Studien sind nur ein kleiner Ausschnitt unseres derzeitigen Dilemmas, denn die Untersuchungen bezogen sich nur auf maximal einige Dutzend Angestellte und einige wenige Tage. Um ein umfassenderes Bild davon zu bekommen, was eigentlich in einem normalen Büro vorgeht, das mit digitalen Netzwerken arbeitet, müssen wir uns die Ergebnisse einer kleinen Softwarefirma anschauen. RescueTime beschäftigt sich mit dem Thema Produktivität und hat in den letzten Jahren still und heimlich mithilfe eines Wissenschaftsduos eine bemerkenswerte Datenmenge erhoben, die es wie noch nie zuvor erlaubt, einen Blick in die Feinheiten der Kommunikation von modernen Wissensarbeitern zu werfen.
Das wichtigste Produkt von RescueTime ist das gleichnamige Zeiterfassungstool, das auf verschiedenen Endgeräten im Hintergrund mitläuft und aufzeichnet, wie viel Zeit man mit den diversen Applikationen und Webseiten verbringt. Die Unternehmensgeschichte geht ins Jahr 2006 zurück, als eine Gruppe von Entwicklern von Webapplikationen die Nase voll hatte, jeden Tag schwer zu schuften, um am Ende doch nur das Gefühl zu haben, nichts geschafft zu haben. Von der Neugier getrieben wollten sie herausfinden, wo ihre ganze Zeit geblieben war, und schusterten ein paar Skripte zusammen, um ihre Tätigkeiten zu tracken. Wie Robby MacDonnell, der aktuelle CEO von RescueTime, mir erzählte, machte ihr Experiment unter ihren Freunden schnell die Runde: »Immer mehr Leute wollten mithilfe unserer Applikation herausfinden, wie es bei ihnen aussah.« Im Winter 2008 hatte ihre Idee das Interesse des angesehenen Inkubators Y Combinator in Kalifornien gewonnen und die Firma wurde gegründet.
Das Hauptziel von RescueTime besteht darin, den einzelnen Nutzern eine eingehende Rückmeldung bezüglich ihrer Tätigkeiten zu geben und ihnen somit eine Steigerung ihrer Produktivität zu ermöglichen. Da das Tool eine Webanwendung ist, werden alle Daten auf zentralen Servern gespeichert und man kann daher die Daten von Zehntausenden Usern zusammenfassen und analysieren. Nach einigen Fehlstarts war RescueTime entschlossen, diese Analysen gründlich durchzuführen. Im Jahr 2016 stellten sie zwei Datenwissenschaftler in Vollzeit ein, die die Daten in das richtig Format brachten, um die Trends zu extrahieren, während gleichzeitig die Privatsphäre der Kunden gewahrt blieb. Dann machten sie sich daran, zu ergründen, wie diese modernen, zielorientierten Wissensarbeiter im Alltag ihre Zeit verbrachten. Die Ergebnisse waren erstaunlich.
In einem Bericht von 2018 wurde das anonymisierte Verhalten von über 50 000 aktiven Nutzern der Zeiterfassungssoftware analysiert.9 Wie sich zeigte, schaute die Hälfte dieser Nutzer alle sechs Minuten oder noch häufiger in ihre Kommunikationskanäle, wie E-Mail und Slack. Der häufigste Intervall, in dem Nachrichten gecheckt wurden, lag sogar bei einmal in der Minute. Mehr als ein Drittel der analysierten Nutzer schauten alle drei Minuten oder häufiger in ihrem Postfach nach. Dabei muss man bedenken, dass diese Durchschnittswerte vermutlich sogar noch höher sind, denn es wurden auch Phasen berücksichtigt, in denen die Mitarbeiter nicht an ihren Monitoren saßen, etwa in der Mittagspause oder während persönlicher Gespräche. (Als es darum ging, die durchschnittlichen Zeiten zu berechnen, in denen die Probanden ihre Aufmerksamkeit von einem Thema zum anderen lenkten, berücksichtigte Gloria Marks Studie im Vergleich dazu nicht die Zeit, die mit angesetzten Besprechungen verbracht wurde.)
Um zu verstehen, wie rar Phasen ohne Unterbrechungen waren, berechneten die Datenwissenschaftler von RescueTime ebenfalls den längsten Intervall, den jeder Nutzer ungestört arbeitete, also ohne die E-Mails oder Messenger-Nachrichten zu checken. Bei der Hälfte der untersuchten Personen dauerte der längste Intervall ohne Ablenkung nicht länger als 40 Minuten, am häufigsten betrug dieser Intervall nur mickrige 20 Minuten. Mehr als zwei Drittel der Nutzer erlebten in dem untersuchten Zeitraum nie mehr als eine Stunde ohne Unterbrechungen. Madison Lukaczyk, eine der Datenwissenschaftler, legte eine Tabelle mit ihren eigenen Kommunikationsdaten offen, um diese Beobachtungen anschaulicher zu machen. Während der gesamten Arbeitszeit von sieben Tagen hatte Lukaczyk nur acht Zeitblöcke von über 30 Minuten Länge, in denen sie keine ihrer Kommunikationstools öffnete. Das ergibt durchschnittlich pro Tag etwas mehr als eine dieser ablenkungsfreien Phasen. (Und das für eine Person, die ihr Geld damit verdient, Ablenkung durch Technologie zu untersuchen!)
In einem thematisch ähnlich angelegten Bericht versuchten die Datenwissenschaftler von RescueTime den Zusammenhang zwischen Kommunikation und Produktivität herzustellen, indem sie sich auf die Phasen beschränkten, die ihre Nutzer nach eigenen Angaben als »produktiv« bezeichneten.10 Für jeden Nutzer teilten sie diese produktiven Phasen in Fünf-Minuten-Abschnitte auf und suchten nach den Abschnitten, in denen sie weder E-Mails noch Instant-Messenger-Apps checkten. Diese isolierten Abschnitte entsprachen ungefähr der ablenkungsfreien produktiven Arbeitszeit. Der durchschnittliche Nutzer in dieser Untersuchung hatte insgesamt täglich nur 15 solcher ununterbrochenen Phasen produktiver Arbeitszeit. Etwas deutlicher: Es geht hier nicht um 75 Minuten am Stück, sondern um die Abschnitte aufmerksamer produktiver Arbeit auf den gesamten Arbeitstag verteilt.
Die Schlussfolgerung aus diesen Daten von RescueTime sind spektakulär: Es dauert fast nie länger als einige Minuten, bis der moderne Wissensarbeiter die nächste E-Mail oder Message sendet oder liest. Zu behaupten, wir würden zu häufig unsere Nachrichten checken, ist untertrieben: In der Realität nutzen wir elektronische Kommunikationsmittel kontinuierlich.
Was in der Analyse der eben dargestellten Datensätze fehlt, ist ein Eindruck, was in den ganzen E-Mails steht, die wir ständig im Laufe des Tages verschicken. Um diese Lücke zu füllen, bat ich die 1.500 Teilnehmer meiner Umfrage, sich einen typischen Tag aus den vorangegangen Wochen herauszunehmen und die eingegangenen E-Mails den folgenden sieben Kategorien zuzuordnen: Planung (Meetings ansetzen, Telefonate arrangieren etc.), Information (nach meiner Definition: Eine Antwort auf die E-Mail war unnötig), Verwaltungsaufgaben, Diskussionen, Kundenkommunikation, Persönliches und Diverses.
Ich war neugierig, welche Art berufliche E-Mails wohl bei meinen Lesern am häufigsten vorkamen. Zu meiner Überraschung waren alle Kategorien vertreten. Die durchschnittliche Anzahl der eingegangenen E-Mails zu den Themen Planung, Verwaltung, Diskussion, Kundenkommunikation und Diverses betrug zwischen acht und zehn pro Tag. Um Persönliches ging es nur unwesentlich seltener. Der einzige Ausreißer waren die E-Mails, die allein der Information dienten, es waren durchschnittlich 18 pro Tag.
Zusammengenommen führen uns diese unterschiedlichen Beobachtungen zu einer klaren, aber irritierenden Sicht auf die Interaktion im modernen Büroumfeld. Der Gedanke, Kommunikationstools würden nur gelegentlich die Arbeit unterbrechen, erweist sich als unzutreffend. In einem realistischeren Modell teilen Wissensarbeiter ihre Aufmerksamkeit im Prinzip zwischen zwei parallelen Tätigkeitsbereichen auf: einerseits Aufgaben erledigen und andererseits die stets präsente, permanente und überwältigende Menge an elektronischer Kommunikation über diese Aufgaben managen. Die Autoren der 2011 erschienen australischen Studie unterstreichen dies: »Unsere Ergebnisse führen uns zu dem Schluss, dass eine solche Unterscheidung [zwischen primärer Arbeit und Unterbrechungen aufgrund von Kommunikation, C. N.] in einem von Kommunikationsmedien geprägten Umfeld nicht trägt. Sie verlangen ständig die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter.« Nicht nur kommunizieren wir alle durchgängig, sondern auch die Anzahl der verschiedenen besprochenen Themen ist recht groß, wie die Antworten meiner Leser auf meine Umfrage zeigten. Die Organisation der modernen Wissensarbeit gleicht tatsächlich einem Schwarmdenken. Die kollektive Intelligenz verschiedener Gehirne wird elektronisch zu einer steten Ebbe und Flut von Information und simultanen Konversationen verknüpft.
Allerdings muss man dabei bedenken, dass der Ansatz dieser parallelen Arbeitssphären für Wissensarbeit – wenn auch vielleicht in seiner Schwere gewöhnungsbedürftig – offensichtlich nichts Negatives ist. Beispielsweise könnte man folgendermaßen argumentieren: Diese fortlaufende Kommunikation ist effizient, weil sie auf den Überbau verzichtet, der für die Koordination geplanter Sitzungen nötig ist. Darüber hinaus erlaubt sie allen, genau dann die präzisen Information zu bekommen, wenn sie auch benötigt werden. Zu Beginn der digitalen Revolution der Kommunikation verwandelte die in der Zwischenzeit leider verstorbene Soziologin Deirdre Boden 1994 dieses überzeugende Argument in einen Vergleich: Sie stellte eine Analogie her zwischen dem zunehmend hektischen Austausch von Nachrichten mit dem »Just-in-Time«-Prozess, der sich schon damals für die Produktion und große Einzelhandelsketten als extrem profitabel erwiesen hatte.11 Außerdem könnte man argumentieren, dass eine große Anzahl dieser unterschiedlichen täglich kommunizierten Themen auch flexibel ist: Der größere Datendurchlauf wurde nur dadurch möglich, dass extrem effiziente Messaging-Methoden vorhanden waren.
Jedoch hat dieser Optimismus eine rissige Fassade, denn der abstrakte Wert der Arbeitsabläufe im hyperaktiven Schwarmdenken löst sich schnell in Luft auf, wenn wir uns gezwungenermaßen mit der konkreten Realität unseres Gehirns auseinandersetzen müssen. Wie funktionieren unsere uralten Echsenhirne, die sich in einer Umwelt entwickelt haben, wie sie konträrer zu elektronischen Netzwerken und reibungsarmer Nachrichtenübertragung nicht sein könnte, wenn sie plötzlich ihre Aufmerksamkeit auf viele unterschiedliche Aspekte aufteilen müssen?
DAS SEQUENZIELLE HIRN IN EINER PARALLELEN WELT
Wir setzen es als selbstverständlich voraus, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten können. Grundlegende Erkenntnisse der Neurowissenschaften zeigen, dass wir uns von unseren Vorfahren, den Primaten, unter anderem durch eine Fähigkeit unterscheiden: Unser präfrontaler Kortex funktioniert wie ein Verkehrspolizist für unsere Aufmerksamkeit. Es verstärkt die empfangenen Signale von Gehirnarealen, die durch das aktuelle Objekt unserer Aufmerksamkeit angeregt werden, während es Signale aller anderen Bereiche unterdrückt.12 So reagieren andere Tiere auf unmittelbare Stimuli, wie das Reh, das vielleicht den Kopf hebt, wenn es das Knacken eines Astes wahrnimmt. Doch nur Menschen sind in der Lage, sich auch auf ein Objekt oder eine Ereignis zu konzentrieren, dass nicht in ihrer direkten Umgebung und genau diesem Moment geschieht: Dazu gehören etwa die Planung einer Mammutjagd oder ein Exposé zur neuen Unternehmensstrategie.
Aus der Perspektive des fieberhaft arbeitenden Geistesmenschen ist es von ernsthaftem Nachteil, dass sich dieser Prozess im präfrontalen Kortex nur auf ein einziges Aufmerksamkeitsziel konzentrieren kann. »Unsere Hirne verarbeiten Informationen nicht parallel«13 ‒ dies stellten Adam Gazzaley und Larry Rosen ungeschönt in ihrem Buch Das überforderte Gehirn von 2016 fest. Wenn Sie versuchen, gleichzeitig verschiedene elektronische Konversationen zu führen, während Sie eigentlich an einer übergeordneten Aufgabe sitzen, bei dem Sie etwa einen Bericht verfassen oder ein Computerprogramm schreiben sollen, ist Ihr präfrontaler Kortex maximal gefordert: Ständig muss er zwischen unterschiedlichen Objekten hin und her springen, für das er bestimmte Netzwerke im Gehirn entweder aktivieren oder hemmen muss. Es überrascht nicht, dass das Umschalten von verschiedenen Netzwerken nicht unverzüglich vonstatten geht, dafür bedarf es sowohl Zeit als auch kognitive Ressourcen. Versuchen Sie dann, es schnell hinzukriegen, geht alles schief.
Spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts machte man die Beobachtung, dass der schnelle Wechsel zwischen Aufmerksamkeitszielen unsere Denkleistung verlangsamt. Das war lange vor der Erkenntnis, dass der präfrontale Kortex für diese Wechsel zuständig ist. Einer der ersten Forschungsberichte, die dieses Phänomen dokumentierten, erschien 1927. Darin stellte Arthur Jersild eine grundlegende Versuchsanordnung vor, die die Kosten der wechselnden Aufmerksamkeit erheben sollte: Man gibt Probanden zwei verschiedene Aufgaben, misst die Zeit, die sie brauchen, um jede Aufgabe einzeln zu lösen und danach erhebt man die benötigten Zeit, wenn sie zwischen den beiden Aufgaben hin und her springen müssen.14 In einem Experiment legte Jersild beispielsweise den Teilnehmern eine Liste mit zweistelligen Zahlen vor. Die Aufgabe bestand darin, zu jeder Zahl eine 6 hinzuzuaddieren, bei einer anderen sollten die Probanden eine 3 abziehen. Wurden die Teilnehmer gebeten, einen Vorgang jeweils zu wiederholen, etwa eine 6 zu jeder Ziffer hinzuzufügen, hatten sie viel schneller die Aufgabe erledigt, als wenn sie bei jeder zweiten Ziffer 3 abziehen sollten.15 Sobald Jersild die Aufgaben noch komplizierter machte, also 17 hinzufügen und 13 abziehen ließ, wurde die Zeitdifferenz zwischen der Erledigung der beiden Aufgabenarten noch größer – ein Hinweis darauf, dass anspruchsvollere Aufgaben auch anspruchsvollere Netzwerkwechsel auslösen.
In den Jahrzehnten nach Jersilds Erkenntnissen modifizierten zahllose andere Studien sein klassisches Experiment, aber kamen im Prinzip alle zu demselben Ergebnis: Zwischen Netzwerken hin und her zu wechseln verlangsamt das Denken. Das Ziel dieser nachfolgenden Untersuchungen war jedoch, die Funktionsweise des Gehirns herauszufinden. Erst 2009 fingen Wissenschaftler an, der Frage ernsthaft nachzugehen, wie sich diese durch den Wechsel entstehenden Kosten auf die praktische Leistung am Arbeitsplatz auswirken würde. Just zu jener Zeit veröffentlichte eine gerade ernannte Hochschuldozentin namens Sophie Leroy eine Untersuchung über organisationales Verhalten, in dem sie all diese Fäden zusammenführte. In ihrem Titel stellt sie eine simple Frage, die genau das erfasst, was mit dem hyperaktiven Schwarmdenken und seiner Herangehensweise an die Zusammenarbeit schiefläuft: Warum ist es so schwierig, meine Arbeit zu erledigen?16
Wie Gloria Mark kam Leroy zu dem Thema, weil sie aufgrund persönlicher Erfahrungen ein Interesse an der Psychologie der Wissensarbeit hatte. Als sie 2001 ihre Dissertation an der New York University begann, hatte sie einige Jahre als Markenberaterin in New York hinter sich. Dort bekam sie aus erster Hand mit, wie die Arbeit im Wissenssektor immer stärker fragmentiert wurde: »Es war so viel Arbeit«, berichtete sie mir, »dass die Leute ständig zwischen unterschiedlichen Zielen [der Aufmerksamkeit, C. N.] hin und her wechselten.« Zu jener Zeit befasste man sich an den Universitäten im Kontext des organisationalen Verhaltens noch nicht mit den psychologischen Folgen all dieser Unterbrechungen. Leroy wollte dies daher ändern.
Ihre Untersuchung basierte auf folgenden Experimenten: Die Teilnehmer hatten fünf Minuten, um ein kniffliges Silbenrätsel zu lösen. Einige von ihnen erhielten eine Version, die sie leicht in der vorgegebenen Zeit lösen konnten, die andere Gruppe erhielt eine unlösbare Version des Rätsels, sodass die Aufgabe nach Ablauf der fünf Minuten unvollendet bleiben musste. Darüber hinaus wurden einige Probanden unter Zeitdruck gesetzt, indem in dem Befragungsraum eine Stoppuhr zu sehen war und sie alle 60 Sekunden mit einem Signal über die restliche Zeit informiert wurden. Anderen Teilnehmern hingegen wurden solche Signale nicht gegeben, sondern ihnen wurde versichert, dass sie das Rätsel sicher innerhalb des Zeitrahmens würden beenden können.
In dieser Anordnung waren vier Kombinationen aus Aufgabe gelöst/ungelöst und Zeitdruck/kein Zeitdruck möglich. Bei jeder dieser Kombinationen präsentierte Leroy den Probanden nach den ersten fünf Minuten unangekündigt eine psychologische Übung, die Lexikalische Entscheidungsaufgabe. Mit ihrer Hilfe sollte geprüft werden, wie viel den Teilnehmern noch von dem Silbenrätsel im Kopf geblieben war, Leroy nannte dieses Maß verbliebener Aufmerksamkeit »Aufmerksamkeitsrest« (attention residue). Sie fand heraus, dass sich dieser unter geringem Zeitdruck nicht unterschied, gleichgültig, ob die Probanden das Rätsel gelöst hatten oder nicht. In beiden Fällen blieb ein Konzept, das dem Rätsel ähnelte, den Teilnehmern stärker im Kopf als etwas völlig anderes.
Unter der Versuchsbedingung mit hohem Zeitdruck und ungelöstem Rätsel wurde ein ähnliches Maß an Aufmerksamkeitsrest erhoben. Einen Ausreißer gab es jedoch bei der Kombination aus hohem Zeitdruck und gelöstem Rätsel: Hier war der Aufmerksamkeitsrest geringer. Leroys Hypothese lautete: Ist eine Aufgabe auf eine präzise Zeit beschränkt und wird innerhalb dieser vollständig erledigt, fällt es dem Gehirn leichter, damit abzuschließen und zum nächsten Thema überzugehen. (Für unseren Zweck ist es leider so, dass das Hin- und Herspringen zwischen E-Mail-Eingang und Instant-Messengern nicht auf eine bestimmte Dauer beschränkt ist oder wir das Gefühl haben, unsere Aufgaben erfüllt zu haben, bevor wir uns wieder dem Posteingang widmen.)
Im nächsten Schritt veränderte Leroy die Versuchsbedingungen leicht: Alles blieb gleich, jedoch sollten die Teilnehmer, sobald das Rätsel gelöst war, sofort im Anschluss eine zweite Aufgabe erfüllen, bevor der Aufmerksamkeitsrest erhoben wurde. Diese zweite Aufgabe imitierte eine Tätigkeit aus dem normalen Arbeitsalltag: Die Probanden sollten Bewerbungen lesen und bewerten. Die Leistung der Probanden wurde anhand der Detailfülle gemessen, mit der sie sich an die Bewerbungen erinnern konnten, nachdem sie diese fünf Minuten lang genau betrachtet hatten. Die Relation zwischen Aufmerksamkeitsrest und Abschneiden bei dieser zweiten Aufgabe war klar: Die drei Bedingungen, auf die ein großer Aufmerksamkeitsrest zurückzuführen war, sorgten auch bei der Bewerbungsaufgabe für eine vergleichbare Leistung, diese fiel hingegen unter den Bedingungen für einen geringen Aufmerksamkeitsrest deutlich schlechter aus. Je mehr die erste Aufgabe den Probanden noch im Gedächtnis war, desto schlechter schnitten sie bei der zweiten ab.