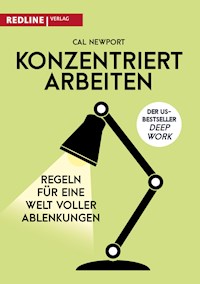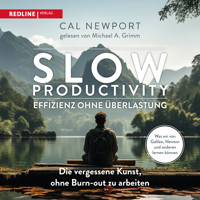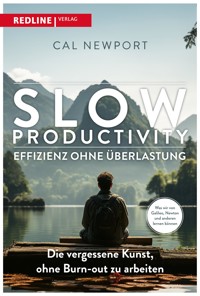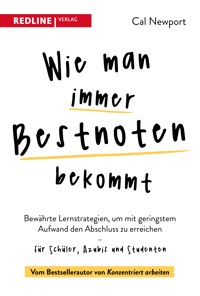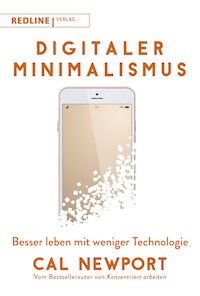
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem Bestseller Konzentriert arbeiten bewies Cal Newport bereits, dass ablenkungsfreie Konzentration die Arbeitseffektivität steigert und die Reduktion der technischen Geschäftigkeit enorm viel Zeit und Nerven einspart – so arbeitet es sich nicht nur effektiver, sondern auch glücklicher. In seinem neuen Buch Digitaler Minimalismus spinnt er diesen Gedanken noch weiter und zeigt, dass der Schlüssel zu einem guten Leben in der Hightech-Welt darin besteht, die Nutzung der Technologien in allen Bereichen des Lebens auf das Wesentlichste zu reduzieren. Mithilfe seiner Methode zum Digital Detox wird man lernen, digitalen Ablenkungen künftig zu widerstehen, Online-Tools nur intentional zu nutzen und das Leben so um ein Vielfaches zu vereinfachen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für all diejenigen, die sich nach einem entspannten Leben im Abseits der digitalen Welt sehnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cal Newport
DIGITALER MINIMALISMUS
Cal Newport
DIGITALER MINIMALISMUS
BESSER LEBEN MIT WENIGER TECHNOLOGIE
Übersetzung aus dem Englischen von Jordan Wegberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis:
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
5. Auflage 2026
© 2019 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
© der Originalausgabe 2019 by Calvin C. Newport.
Die englische Originalausgabe erschien bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel Digital Minimalism.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Jordan Wegberg, Berlin
Redaktion: Desirée Simeg, Gersthofen
Umschlaggestaltung: Marc Fischer, München
Umschlagabbildung: shutterstock/Lutsina Tatiana
Satz: Daniel Förster, Belgern
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-725-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-060-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-061-0
Weitere Informationen zum Verlag finden sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Julie:meine Partnerin, meine Muse,meine Stimme der Vernunft.
Inhalt
Einleitung
TEIL 1GRUNDLAGEN
1 Einseitiges Wettrüsten
2 Digitaler Minimalismus
3 Die digitale Entrümpelung
TEIL 2ÜBUNGEN
4 Verbringen Sie Zeit allein
5 Klicken Sie nicht auf »Gefällt mir«
6 Die Rückeroberung der Muße
7 Widerstand gegen die Aufmerksamkeitsindustrie
Fazit
Danksagung
Anmerkungen
Über den Autor
Einleitung
Im September 2016 schrieb der einflussreiche Blogger und Kommentator Andrew Sullivan für das Magazin New York einen Essay von 7000 Wörtern mit dem Titel »Ich war früher mal ein Mensch«. Der Untertitel war alarmierend: »Ein endloses Bombardement von Nachrichten und Klatsch und Bildern hat uns zu manischen Informationssüchtigen gemacht. Mich hat es kaputtgemacht. Es könnte auch Sie kaputtmachen.«1
Der Artikel erzeugte große Resonanz. Ich gebe aber zu, dass ich Sullivans Warnung beim Lesen zunächst nicht ganz verstanden habe. Ich bin einer der wenigen Vertreter meiner Generation, die keinen Social-Media-Account haben, und ich verbringe auch nicht viel Zeit mit dem Surfen im Internet. Infolgedessen spielt mein Smartphone eine relativ untergeordnete Rolle in meinem Leben – was mich zur Randfigur der weitverbreiteten Erfahrungen machte, die in diesem Artikel aufgegriffen wurden. Mit anderen Worten, ich wusste, dass die Innovationen des Internetzeitalters im Leben vieler Menschen eine immer wichtigere Rolle spielten, aber ich hatte keinen intuitiven Zugang zu ihrer Bedeutung. Zumindest so lange, bis alles anders wurde.
Etwas früher im selben Jahr war mein Buch Konzentriert arbeiten veröffentlicht worden. Darin geht es um den unterschätzten Wert der intensiven Konzentration und darum, dass der Schwerpunkt der Berufswelt auf ablenkende Kommunikationsmittel die Leute daran hindert, ihr Bestes zu geben. Während mein Buch sich ein Publikum eroberte, meldeten sich immer mehr Leser bei mir. Einige schickten mir Nachrichten, andere sprachen mich bei öffentlichen Auftritten an – und viele stellten dieselbe Frage: Was war mit ihrem Privatleben? Sie stimmten meinen Thesen über die Ablenkungen im Büro zu, aber dann erklärten sie, dass sie unzweifelhaft noch stärker davon gestresst waren, wie die neuen Technologien ihrer Freizeit zunehmend Sinn und Zufriedenheit zu rauben schienen. Das weckte meine Aufmerksamkeit und verschaffte mir einen unerwarteten Intensivkurs über die Versprechungen und Gefahren des modernen digitalen Lebens.
Fast jeder, mit dem ich mich unterhielt, glaubte an die Macht des Internets und erkannte, dass es eine Kraft sein kann und sollte, die das Leben verbessert. Diese Menschen wollten nicht unbedingt auf Google Maps verzichten oder sich bei Instagram abmelden, hatten jedoch auch den Eindruck, dass ihr derzeitiges Verhältnis zur Technologie so nicht unverändert bestehen bleiben konnte – bis zu dem Punkt, dass sie es sogar abbrechen würden, wenn sich nicht bald etwas änderte.
Ein Begriff, den ich in diesen Gesprächen über das moderne digitale Leben häufig hörte, war Erschöpfung. Es ist nicht so, als wäre irgendeine bestimmte App oder Website für sich betrachtet besonders schlecht. Wie viele meiner Gesprächspartner klarstellten, bestand das Problem mehr in der Gesamtheit so vieler unterschiedlicher bunter Spielereien, die pausenlos um ihre Aufmerksamkeit buhlten und ihre Stimmung manipulierten. Ihr Problem bei dieser fieberhaften Aktivität lag weniger in den Details als in der Tatsache, dass sie zunehmend außer Kontrolle geriet. Nur wenige wollten so viel Zeit online verbringen, aber diese Tools haben die Eigenheit, ein gewisses Suchtverhalten zu kultivieren. Der Drang, »mal schnell« bei Twitter reinzuschauen oder Reddit zu aktualisieren, wird zu einem nervösen Tick, der ununterbrochene Zeit in Bruchstücke zerteilt, die zu kurz sind, um die für ein bewusstes Leben notwendige Präsenz zu stärken.
Wie ich bei meinen nachfolgenden Recherchen herausfand und im nächsten Kapitel darlegen werde, erfolgen einige dieser Suchtverhaltensformen zufällig (kaum jemand konnte voraussehen, wie stark das Schreiben von Textnachrichten unsere Aufmerksamkeit beanspruchen würde), während andere durchaus absichtsvoll sind (exzessive Nutzung ist die Grundlage vieler Businesspläne für Social-Media-Unternehmen). Doch worin auch immer die Ursache liegt, die unwiderstehliche Anziehungskraft von Bildschirmen vermittelt den Menschen das Gefühl, dass sie mehr und mehr ihre Autonomie einbüßen, wenn es um die Lenkung ihrer Aufmerksamkeit geht. Natürlich hat sich niemand für diesen Kontrollverlust entschieden. Jeder hat schon einmal aus guten Gründen Apps heruntergeladen und Accounts eingerichtet, nur um mit bitterer Ironie festzustellen, dass diese Dienste eben jene Werte untergraben, die sie überhaupt erst so überzeugend machten: Man meldet sich bei Facebook an, um mit Freunden im ganzen Land in Kontakt zu bleiben – und sieht sich dann plötzlich nicht mehr in der Lage, ein ungestörtes persönliches Gespräch mit einem Freund am selben Tisch zu führen.
Ich erfuhr auch etwas über die negativen Folgen uneingeschränkter Onlineaktivität für das psychische Wohlbefinden. Viele Menschen, mit denen ich mich unterhielt, unterschätzten die Fähigkeit der sozialen Medien, ihre Stimmung zu beeinflussen. Wenn man ständig der von Freunden sorgfältig kuratierten Darstellung ihres Lebens ausgesetzt ist, erzeugt dies ein Gefühl der Unzulänglichkeit – insbesondere in Zeiten, da man sich ohnehin bereits schlecht fühlt –, und Teenager können dadurch auf grausam wirkungsvolle Weise öffentlich ausgegrenzt werden.
Wie die US-Präsidentschaftswahl von 2016 und ihre Nachwirkungen bewiesen haben, scheinen Onlinedebatten darüber hinaus die Tendenz zu emotional aufgeladenen und spaltenden Extremen zu beschleunigen. Der Technologiephilosoph Jaron Lanier legt überzeugend dar, dass die Vorherrschaft von Wut und Aufgebrachtheit online in gewisser Weise ein unvermeidbares Charakteristikum des Mediums ist:2 Auf einem offenen Marktplatz der Aufmerksamkeit ziehen düstere Emotionen mehr Blicke auf sich als positive und konstruktive Gedanken. Für starke Internetnutzer kann die wiederholte Begegnung mit dieser Düsterkeit ein Quell zehrender Negativität werden – ein hoher Preis, den viele für ihre zwanghafte Vernetzung bezahlen, ohne es überhaupt zu bemerken.
Die Begegnung mit dieser erschütternden Ansammlung von Bedenken – von der erschöpfenden und suchtartigen übermäßigen Nutzung dieser Tools über ihre Fähigkeit zur Verringerung der Autonomie, die Minderung von Zufriedenheit und die Auslösung dunkler Instinkte bis hin zur Ablenkung von wertvolleren Aktivitäten – öffnete mir die Augen für das angespannte Verhältnis, das so viele mittlerweile zu den Technologien unterhalten, die unsere Kultur beherrschen. Mit anderen Worten, sie verschaffte mir ein viel besseres Verständnis dessen, was Andrew Sullivan meinte, als er sich in seinem Artikel beklagte: »Ich war früher mal ein Mensch.«
Diese Erfahrung des Austauschs mit meinen Lesern überzeugte mich davon, dass die Auswirkungen der Technologie auf das Privatleben eine gründlichere Untersuchung verdienten. Ich begann, ernsthafter zu diesem Thema zu recherchieren und darüber zu schreiben, wobei ich sowohl seine Umrisse besser zu erfassen als auch die raren Beispiele für Menschen zu finden versuchte, die aus diesen neuen Technologien großen Nutzen ziehen, ohne die Kontrolle zu verlieren.*
Eines der ersten Dinge, die während dieser Untersuchung deutlich wurden, ist die Tatsache, dass unsere kulturelle Beziehung zu diesen Tools aufgrund ihrer Vermischung von Schaden und Nutzen verkompliziert wird. Smartphones, allgegenwärtiges WLAN, digitale Plattformen, die Milliarden Menschen miteinander verknüpfen – das sind großartige Innovationen! Nur wenige ernst zu nehmende Kommentatoren sind der Meinung, dass wir besser dran wären, wenn wir in ein früheres technologisches Zeitalter zurückfielen. Doch gleichzeitig sind wir es leid, uns als Sklaven unserer Mobilgeräte zu fühlen. Diese Tatsache erzeugt eine durcheinandergewürfelte emotionale Landschaft, in der Sie zu schätzen wissen, dass Sie auf Instagram inspirierende Fotos finden, und sich gleichzeitig darüber ärgern, dass die App sich in Ihren Feierabend drängt, den sie früher im Gespräch mit Freunden oder lesend verbracht haben. Die häufigste Reaktion auf diese Klagen ist die Weitergabe schlichter Lifehacks und Tipps: Wenn Sie ein digitales Sabbatical einlegen oder Ihr Smartphone nachts nicht neben das Bett legen oder die Benachrichtigungen deaktivieren und sich für mehr Achtsamkeit entscheiden, können Sie vielleicht all das Gute behalten, das Sie überhaupt erst an diesen neuen Technologien gereizt hat, und trotzdem ihre negativsten Auswirkungen umgehen. Ich verstehe den Reiz dieser schlichten Vorgehensweise, denn sie enthebt Sie der Notwendigkeit, harte Schnitte in Ihrem digitalen Leben vorzunehmen: Sie müssen nichts aufgeben, auf keine Vorteile verzichten, keinen Ihrer Freunde vor den Kopf stoßen und keine größeren Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen.
Doch wie denjenigen, die solche Formen kleinerer Korrekturen vorgenommen haben, inzwischen zunehmend klar wird, sind Willensstärke, Tipps und halbgare Lösungen nicht ausreichend, um das Eindringen der neuen Technologien in unsere kognitive Landschaft im Zaum zu halten. Das Suchtpotenzial ihrer Erscheinungsform und die Stärke des damit zusammenhängenden kulturellen Drucks sind zu stark, als dass ein Ad-hoc-Ansatz Wirkung zeigen könnte. Bei meiner Arbeit zu diesem Thema bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir stattdessen eine voll ausgereifte Philosophie der Technologienutzung brauchen, die tief in unseren Wertvorstellungen verwurzelt ist und klare Antworten auf die Fragen bietet, welche Tools wir verwenden und wie wir sie verwenden sollten, und die uns – was ebenso wichtig ist – in die Lage versetzt, selbstbewusst alles andere zu ignorieren.
Es gibt viele Philosophien, mit denen sich diese Ziele erreichen lassen. Das eine Extrem sind die Neoludditen, die eine Abkehr von den meisten modernen Technologien propagieren. Am entgegengesetzten Ende der Skala stehen die Quantified-Self-Verfechter, die sorgfältig digitale Geräte in alle Aspekte ihres Lebens integrieren mit dem Ziel, ihr Dasein zu optimieren. Von den unterschiedlichen Wertvorstellungen, die ich untersucht habe, ragte als überlegene Antwort insbesondere eine heraus für all diejenigen, die sich trotz der derzeitigen technologischen Überforderung immer noch wohlfühlen wollen. Ich bezeichne sie als digitalen Minimalismus, und sie folgt der Überzeugung, dass bei unserem Verhältnis zu digitalen Tools weniger mehr sein kann.
Diese Idee ist nicht neu. Schon lange vor Henry David Thoreaus Ausruf »Einfachheit, Einfachheit, Einfachheit«3 fragte Marc Aurel: »Siehst du, wie wenig du benötigst, um ein zufriedenes und ehrfurchtsvolles Leben zu führen?«4 Digitaler Minimalismus überträgt diese klassische Einsicht in die Rolle der Technologie auf unser modernes Leben. Die Auswirkungen dieser schlichten Übertragung können allerdings enorm sein. In diesem Buch werden Sie vielen digitalen Minimalisten begegnen, die eine äußerst positive Veränderung erlebt haben, indem sie ihre Onlinezeit massiv beschränkt haben, um sich auf eine kleine Anzahl von hochwertigen Aktivitäten zu konzentrieren. Weil digitale Minimalisten so viel weniger online sind als ihre Pendants, kann man ihre Lebensweise leicht für extrem halten, aber sie selbst würden behaupten, dass diese Wahrnehmung die Fakten auf den Kopf stellt: Extrem ist, wie viel Zeit alle anderen damit verbringen, auf ihre Bildschirme zu glotzen. Der Schlüssel zum Wohlgefühl in unserer Hightech-Welt, das haben sie gelernt, liegt darin, viel weniger Zeit mit der Nutzung von Technologien zuzubringen.
Dieses Buch soll eine Lanze brechen für den digitalen Minimalismus, ausführlich erläutern, welche Anforderungen er stellt und warum er funktioniert, und Ihnen dann vermitteln, wie Sie diese Philosophie für sich übernehmen können, wenn Sie entschieden haben, dass sie das Richtige für Sie ist. Dazu habe ich das Buch in zwei Teile untergliedert. In Teil 1 beschreibe ich die philosophischen Grundlagen des digitalen Minimalismus, angefangen mit einer näheren Untersuchung der Kräfte, die das digitale Leben so vieler Menschen zunehmend unerträglich machen, ehe ich eine detaillierte Darstellung der Philosophie des digitalen Minimalismus vornehme, in der ich auch meine Argumente dafür vorbringe, warum es sich dabei um die richtige Lösung dieser Probleme handelt. Zum Abschluss von Teil 1 schlage ich eine Methode zur Umsetzung dieser Philosophie vor: die digitale Entrümpelung.
Wie bereits erwähnt, ist ein aggressives Vorgehen notwendig, um Ihren Umgang mit Technologien grundlegend zu verändern. Die digitale Entrümpelung stellt ein solches aggressives Vorgehen dar. Dieser Prozess erfordert, dass Sie dreißig Tage lang auf optionale Onlineaktivitäten verzichten. In dieser Phase entwöhnen Sie sich von den Suchtzyklen, die viele digitale Tools auslösen können, und beginnen die analogen Tätigkeiten wiederzuentdecken, die Ihnen mehr Befriedigung bieten. Sie machen Spaziergänge, sprechen persönlich mit Freunden, engagieren sich in der Gemeinschaft, lesen Bücher und schauen den Wolken hinterher. Was das Wichtigste ist: Die Entrümpelung gibt Ihnen Raum, eine Vorstellung von den Dingen zu entwickeln, die Ihnen am meisten bedeuten. Am Ende der dreißig Tage fügen Sie wieder eine geringe Anzahl sorgfältig ausgewählter Onlineaktivitäten hinzu, von denen Sie annehmen, dass sie diesen für Sie bedeutsamen Dingen gute Dienste leisten. Im weiteren Verlauf tun Sie Ihr Bestes, um diese absichtlichen Aktivitäten zum Kern Ihres Onlinelebens zu machen – und lassen den Großteil all der anderen Zerstreuungen hinter sich, die früher Ihre Zeit fragmentiert und Ihre Aufmerksamkeit beansprucht haben. Die Entrümpelung ist so etwas wie ein holpriger Neustart: Sie gehen als erschöpfter Maximalist in den Prozess hinein und verlassen ihn als bewusster digitaler Minimalist.
Im letzten Kapitel von Teil 1 steuere ich Sie durch die Implementierung Ihrer eigenen digitalen Entrümpelung. Dabei nehme ich ausführlich Bezug auf ein Experiment, das ich im Winter 2018 mit über 1600 Menschen durchgeführt habe, die sich einverstanden erklärt hatten, unter meiner Leitung eine digitale Entrümpelung vorzunehmen und über ihre Erkenntnisse zu berichten. Sie erfahren die Geschichten dieser Teilnehmer, welche Strategien für sie gut funktioniert haben und welche der von ihnen entdeckten Fallstricke Sie vermeiden sollten.
In Teil 2 werfen wir einen genaueren Blick auf einige Ideen, die Ihnen dabei helfen können, einen nachhaltigen digitalen Minimalismus zu kultivieren. In diesen Kapiteln untersuche ich Themen wie die Wichtigkeit des Alleinseins und die Notwendigkeit von Qualitätsfreizeit, um die Zeit zu ersetzen, die jetzt hauptsächlich der gedankenlosen Gerätenutzung gewidmet ist. Ich vertrete und verteidige die möglicherweise kontroverse Auffassung, dass Ihre Beziehungen sich vertiefen, sobald Sie aufhören, Likes zu verteilen oder Kommentare zu Social-Media-Beiträgen zu verfassen, und weniger unmittelbar auf Textmitteilungen reagieren. Ich biete Ihnen auch einen Insiderblick auf den Aufmerksamkeitswiderstand – eine locker organisierte Bewegung von Menschen, die Hightech-Tools und strikte Abläufe verwenden, um aus den Produkten der digitalen Aufmerksamkeitswirtschaft Wert zu schöpfen und gleichzeitig zu vermeiden, dass sie einer übermäßigen Nutzung zum Opfer fallen.
Jedes Kapitel in Teil 2 schließt mit ausgewählten Übungen – das sind konkrete Taktiken, die Ihnen dabei helfen sollen, die wesentlichen Gedanken des jeweiligen Kapitels umzusetzen. Als angehender digitaler Minimalist können Sie diese Übungen als Handwerkskasten betrachten, mit dessen Unterstützung sie einen minimalistischen Lebensstil entwickeln können, der zu Ihren individuellen Umständen passt.
In Walden oder Leben in den Wäldern schrieb Thoreau bekanntermaßen: »Die Mehrzahl der Menschen bringt ihr Schicksal in stiller Verzweiflung hin.«5 Weniger häufig zitiert wird dagegen die optimistische Bemerkung, die im nächsten Absatz folgt:6
»Indes sind sie ehrlich davon überzeugt, keine andere Wahl zu haben. Freilich, wache und gesunde Naturen sind sich noch dessen bewusst, dass die Sonne einmal rein aufging. Es ist jedoch nie zu spät, unsere Vorurteile aufzugeben.«
Unser derzeitiges Verhältnis zu den Technologien unserer hypervernetzten Welt ist unhaltbar und führt uns näher an die stille Verzweiflung heran, die Thoreau vor so vielen Jahren beobachtete. Doch er erinnert uns daran: »Die Sonne ging einmal rein auf«, und wir sind immer noch in der Lage, diesen Zustand zu ändern. Dazu dürfen wir aber nicht passiv zulassen, dass ein wildes Durcheinander aus Tools, Unterhaltungsangeboten und Zerstreuungen, wie sie das Internetzeitalter bietet, darüber bestimmt, wie wir unsere Zeit verbringen oder wie wir uns fühlen. Stattdessen müssen wir Maßnahmen ergreifen, um das Gute dieser Technologien herauszufiltern und gleichzeitig das Schlechte zu vermeiden. Wir brauchen eine Philosophie, die unsere Erwartungen und Werte wieder von unseren täglichen Erfahrungen bestimmen lässt und zugleich den primären Verrücktheiten und Geschäftsmodellen des Silicon Valley ihre derzeitige Dominanz bei dieser Rolle entzieht; eine Philosophie, die neue Technologien akzeptiert, aber nicht um den Preis der Entmenschlichung, vor der Andrew Sullivan uns gewarnt hat; eine Philosophie, bei der langfristige Sinnhaftigkeit den Vorrang vor kurzfristiger Befriedigung hat. Mit anderen Worten: eine Philosophie wie den digitalen Minimalismus.
TEIL 1
Grundlagen
1
Einseitiges Wettrüsten
DAFÜR HABEN WIR UNS NICHT ANGEMELDET
Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Facebook: Es war im Sommer 2004; ich war in meinem Abschlussjahr am College und stellte fest, dass eine wachsende Zahl meiner Freunde über eine Website namens Thefacebook.com sprach. Der erste Mensch, der mir ein tatsächliches Facebook-Profil zeigte, war Julie, damals meine Freundin und heute meine Frau. »Ich erinnere mich noch, dass es eine Neuheit war«, sagte sie mir neulich. »Es war uns als virtuelle Version unserer gedruckten Jahrbücher verkauft worden, in denen wir die Freunde oder Freundinnen der Leute nachschlagen konnten, die wir kannten.«
Der zentrale Begriff bei dieser Erinnerung lautet »Neuheit«. Facebook trat nicht mit dem Versprechen in unsere Welt, den Rhythmus unseres sozialen oder privaten Lebens radikal zu verändern; es war nur ein Zeitvertreib von vielen. Im Frühjahr 2004 verbrachten die Menschen meines Bekanntenkreises, die sich bei Thefacebook.com anmeldeten, ziemlich sicher deutlich mehr Zeit mit Snood (einem Tetris-artigen Puzzlespiel, das unfassbar beliebt war) als mit dem Zurechtfrisieren ihrer Profile oder dem Anstupsen ihrer virtuellen Freunde. »Es war ganz interessant«, fasste Julie zusammen, »aber es kam uns sicher nicht vor wie etwas, mit dem wir nennenswert Zeit verbringen würden.«
Drei Jahre später brachte Apple das iPhone auf den Markt und löste die mobile Revolution aus. Viele haben jedoch vergessen, dass die ursprünglich von diesem Gerät versprochene »Revolution« viel bescheidener war als der Effekt, den es schließlich erzielte. In unserer Zeit haben Smartphones die menschliche Erfahrungswelt neu geformt, indem sie eine ständig präsente Verbindung mit einer summenden Matrix von Geplapper und Zerstreuung bieten. Im Januar 2007, als Steve Jobs bei seiner berühmten Macworld-Rede das iPhone präsentierte, war die Vision weitaus weniger grandios. Eines der wesentlichen Verkaufsargumente des ursprünglichen iPhones war, dass es den iPod mit dem Mobiltelefon verknüpfte und man deshalb keine zwei verschiedenen Geräte mehr mit sich herumtragen musste. (Auf jeden Fall erinnere ich mich an diesen Gedanken über die Vorteile des iPhones, als seine Markteinführung angekündigt wurde.) Dementsprechend verbrachte Jobs die ersten acht Minuten der Vorführung des iPhones auf der Bühne während seiner Rede damit, auf die Medienfunktionen hinzuweisen, und schloss mit der Bemerkung: »Das ist der beste iPod, den wir je gemacht haben!«1 Ein weiteres wichtiges Verkaufsargument des Geräts bei seiner Einführung waren die vielen Verbesserungen für Telefongespräche. Eine große Neuigkeit zu jener Zeit war, dass Apple den Telekommunikationskonzern AT&T zwang, sein Voicemail-System offenzulegen, um eine bessere Schnittstelle für das iPhone zu schaffen. Bei seinem Bühnenauftritt war Jobs zudem sichtlich begeistert von der Einfachheit, mit der man durch Telefonnummern scrollen konnte, und der Tatsache, dass die Wähltastatur direkt auf dem Bildschirm erschien, anstatt permanente Plastikknöpfe zu erfordern. »Die Killer-App ist das Telefonieren!«, rief Jobs während seiner Rede unter Beifall.2 Erst in der dreiunddreißigsten Minute seiner berühmten Präsentation kam er auf Eigenschaften wie verbesserte SMS-Funktionen und mobilen Internetzugang zu sprechen, die heute unsere Nutzung dieser Geräte dominieren.
Um sicherzugehen, dass diese begrenzte Vision keine Verschrobenheit von Jobs’ Redemanuskript war, sprach ich mit Andy Grignon, einem der Mitglieder des ursprünglichen iPhone-Teams. »Das sollte ein iPod sein, mit dem man telefonieren konnte«, bestätigte er.3 »Unsere Kernmission war Musik abspielen und telefonieren.« Wie Grignon mir erklärte, lehnte Steve Jobs die Idee zunächst ab, das iPhone könne mehr ein mobiler Allzweckcomputer mit einer Vielzahl verschiedener Drittanwendungen sein. »Falls wir jemals zulassen, dass irgendein schwachköpfiger Programmierer einen Code schreibt, der das Ding zum Absturz bringt«, hatte Jobs Grignon einmal gesagt, »sollten wir den Notruf wählen.«
Als das iPhone 2007 erstmals auf den Versandweg ging, gab es keinen App Store, keine Social-Media-Benachrichtigungen, keine Schnappschüsse bei Instagram, keinen Grund, während des Abendessens heimlich ein Dutzend Mal nach unten zu linsen – und das war absolut okay für Steve Jobs und die Millionen Menschen, die in dieser Zeit ihr erstes Smartphone kauften. Nur wenige der ersten Facebook-Nutzer hätten vorhergesagt, wie stark unsere Beziehung zu diesem glänzenden neuen Gerät sich in den folgenden Jahren wandeln würde.
Es ist allgemein anerkannt, dass neue Technologien wie soziale Netzwerke und Smartphones unsere Lebensweise im 21. Jahrhundert massiv verändert haben. Dieser Wandel lässt sich auf viele Arten darstellen. Ich finde, der Sozialkritiker Laurence Scott tut dies sehr wirkungsvoll, indem er die moderne hypervernetzte Existenz so beschreibt: »Ein Augenblick kann sich seltsam flach anfühlen, wenn er nur für sich selbst existiert.«4
Der Kern all dieser Beobachtungen ist jedoch zu unterstreichen, was viele vergessen, nämlich dass diese Veränderungen nicht nur massiv und umwälzend, sondern auch unerwartet und ungeplant waren. Ein College-Schüler, der im Jahr 2004 einen Account bei Thefacebook.com einrichtete, um seine Klassenkameraden im Blick zu behalten, hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass der durchschnittliche moderne User rund zwei Stunden täglich mit sozialen Netzwerken und verwandten Messaging-Anwendungen zubringen würde, wobei fast die Hälfte dieser Zeit ausschließlich Facebook-Produkten gewidmet ist. Und ein früher iPhone-Nutzer, der sich 2007 wegen der Musikfunktionen ein Gerät zulegte, wäre wohl weniger begeistert gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, dass er innerhalb von zehn Jahren damit rechnen könne, fünfundachtzig Mal täglich auf sein Handy zu schauen – eine »Funktion«, von der wir jetzt wissen, dass Steve Jobs sie bei der Vorbereitung seiner berühmten Rede niemals in Erwägung gezogen hat.
Diese Veränderungen haben uns schleichend und schnell erfasst, noch ehe wir eine Chance hatten, näher hinzusehen und uns zu fragen, welche von den rapiden Fortschritten des vergangenen Jahrzehnts wir eigentlich wirklich wollten. Aus nebensächlichen Gründen haben wir der Peripherie unserer Erfahrungen neue Technologien hinzugefügt, nur um eines Tages aufzuwachen und festzustellen, dass sie zu einem Kernpunkt unseres Alltags geworden waren. Mit anderen Worten: Wir haben uns nicht für die digitale Welt angemeldet, in der wir derzeit verankert sind; wir scheinen irgendwie rückwärts hineingestolpert zu sein.
Dieses Detail wird in unserem kulturellen Austausch über solche Tools häufig ausgelassen. Meine Erfahrung ist: Wenn Befürchtungen bezüglich neuer Technologien öffentlich diskutiert werden, reagieren Technologieverfechter schnell, indem sie die Diskussion auf deren Nützlichkeit lenken – sie präsentieren zum Beispiel Fallstudien, in denen ein bislang mittel- und erfolgloser Künstler über Social Media endlich sein Publikum erreicht* oder WhatsApp eine im Ausland stationierte Soldatin mit ihrer Familie zu Hause verbindet. Sie schlussfolgern dann, es sei inkorrekt, diese Technologien aufgrund ihrer Nutzlosigkeit abzulehnen – eine Taktik, die für gewöhnlich ausreicht, um die Debatte zu beenden.
Die Behauptungen der Technologieverfechter sind durchaus richtig, aber sie gehen auch an der Sache vorbei. Die wahrgenommene Nützlichkeit dieser Tools ist nicht die Grundlage unserer wachsenden Skepsis. Wenn Sie beispielsweise den durchschnittlichen Nutzer von sozialen Netzwerken fragen, warum er Facebook, Instagram oder Twitter verwendet, kann er Ihnen vernünftige Antworten liefern. Jeder dieser Dienste bietet wohl etwas Nützliches für ihn, das er woanders nur schwer findet: etwa durch gepostete Babyfotos von Nichten oder Neffen auf dem Laufenden zu bleiben oder einen Hashtag einzusetzen, um eine Grassroot-Bewegung zu beobachten.
Der Quell unseres Unbehagens wird in diesen dünn geschnittenen Fallstudien nicht offensichtlich, sondern erschließt sich nur, wenn man die dickere Realität dessen betrachtet, wie es diesen Technologien als Ganzes gelungen ist, weit über die nebensächlichen Bedeutungen hinauszugelangen, für die wir sie ursprünglich übernommen haben. Zunehmend bestimmen sie, wie wir uns verhalten und fühlen, und zwingen uns irgendwie, sie mehr zu nutzen, als uns gesund erscheint, und das häufig auf Kosten anderer Aktivitäten, die wir eigentlich für wertvoller halten. Was uns mit anderen Worten Unbehagen einflößt, ist das Gefühl des Kontrollverlusts – ein Gefühl, das sich täglich auf ein Dutzend verschiedene Arten bemerkbar macht, zum Beispiel wenn wir uns von unserem Mobiltelefon ablenken lassen, während unser Kind in der Badewanne sitzt, oder uns die Fähigkeit abhandenkommt, einen schönen Augenblick zu genießen, ohne den heftigen Drang zu verspüren, ihn für ein virtuelles Publikum zu dokumentieren.
Es geht nicht um Nützlichkeit, es geht um Autonomie.
Die offensichtliche nächste Frage ist natürlich, wie wir uns in diesen Schlamassel hineinmanövriert haben. Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Anteil der Onlineaktivitäten in ihrem Leben haben, sind meiner Erfahrung nach für gewöhnlich nicht willensschwach oder dumm. Sie sind vielmehr erfolgreiche Geschäftsleute, strebsame Studenten, liebende Eltern; sie sind gut organisiert und verfolgen anspruchsvolle Ziele. Aber den Apps und Webseiten, die sie vom Smartphone- und Tablet-Bildschirm aus verlocken, ist es irgendwie gelungen – anders als den vielen anderen Versuchungen, denen sie täglich widerstehen –, auf eine ungesunde Weise weit über ihre ursprüngliche Rolle hinaus zu metastasieren.
Ein großer Teil der Antwort auf die Frage, wie das passieren konnte, lautet, dass diese Tools nicht annähernd so unschuldig sind, wie sie zunächst erscheinen. Man erliegt einem Bildschirm nicht, weil man faul ist, sondern es wurden Milliarden Dollar investiert, um dieses Ergebnis unausweichlich zu machen. Weiter oben behauptete ich, dass wir rückwärts in ein digitales Leben gestolpert zu sein scheinen, für das wir uns nicht angemeldet haben. Im Folgenden werde ich darlegen, warum es wahrscheinlich passender wäre zu sagen, dass wir von den Highend-Geräteherstellern und der Aufmerksamkeitsindustrie gestoßen wurden, weil sie entdeckt haben, dass sich in einer von Gadgets und Apps dominierten Kultur ungeheuer viel Geld machen lässt.
TABAKPFLANZER IN T-SHIRTS
Bill Maher beendet jede Folge seiner HBO-Sendung Real Time mit einem Monolog. Die Themen sind für gewöhnlich politischer Natur. Am 12. Mai 2017 war dies allerdings nicht der Fall, als Maher in die Kamera blickte und sagte:5
»Die Magnaten der sozialen Netzwerke sollen aufhören, so zu tun, als seien sie nette Nerd-Götter, die eine bessere Welt erschaffen, und zugeben, dass sie einfach nur Tabakpflanzer in T-Shirts sind, die Kindern ein suchterzeugendes Produkt verkaufen. Denn nennen wir es doch mal beim Namen: Likes zu zählen ist das neue Rauchen.«
Mahers Besorgnis über Social Media war durch einen im vorangehenden Monat ausgestrahlten Beitrag in 60 Minutes ausgelöst worden. Der Beitrag nannte sich »Brain Hacking« und fing damit an, dass Anderson Cooper einen schlanken, rothaarigen Ingenieur mit sorgfältig gepflegtem Drei-Tage-Bart interviewte, wie er bei jungen Männern im Silicon Valley so beliebt ist. Sein Name war Tristan Harris, ein früherer Start-up-Gründer und Google-Techniker, der von seinem ausgetretenen Pfad durch die Welt der Technologie abgewichen war, um etwas in dieser geschlossenen Welt wesentlich Selteneres zu werden: ein Whistleblower.
»Das Ding ist ein Spielautomat«, sagte Harris zu Beginn des Interviews und hielt sein Smartphone in die Höhe.6
»Wie kann das denn ein Spielautomat sein?«, fragte Cooper.
»Also, jedes Mal, wenn ich auf mein Handy sehe, mache ich ein Glücksspiel, um zu gucken: ›Was hab ich gekriegt?‹«, antwortete Harris. »Es gibt ein ganzes Drehbuch mit Techniken, die [von Technologieunternehmen] angewendet werden, damit man das Produkt so lange wie möglich verwendet.«
»Werden im Silicon Valley Apps oder Menschen programmiert?«, fragte Cooper nach.
»Menschen«, sagte Harris. »Es gibt immer dieses Gerede, dass Technologie neutral sei. Und dass es an uns liegt zu entscheiden, wie wir sie nutzen. Das stimmt einfach nicht –«
»Technologie ist nicht neutral?«, unterbrach Cooper ihn.
»Sie ist nicht neutral. Es ist erwünscht, dass man sie auf eine bestimmte Weise und über einen langen Zeitraum nutzt. Denn so will man Geld machen«, lautete die Antwort.
Was Bill Maher angeht, so kam ihm dieses Interview vertraut vor. Nachdem er seinem HBO-Publikum einen Ausschnitt des Harris-Interviews gezeigt hatte, witzelte er: »Wo hab ich das bloß schon mal gehört?« Dann zeigte er Mike Wallace’ berühmtes Interview mit Jeffrey Wigand von 1995 – dem Whistleblower, der der Welt bestätigte, was die meisten ohnehin bereits argwöhnten: dass die großen Tabakunternehmen Zigaretten produzierten, die stärker abhängig machten.
»Philip Morris wollte Ihre Lunge«, schließt Maher. »Der App Store will Ihre Seele.«
Harris’ Wandlung zu einem Whistleblower ist ungewöhnlich, und das liegt zum Teil daran, dass sein vorheriges Leben nach den Standards vom Silicon Valley so normal verlaufen ist. Harris, zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buchs Mitte dreißig, stammt aus der Bay Area. Wie viele Techniker hackte er als Heranwachsender seinen Macintosh und schrieb Programmcode. Er ging nach Stanford, um Computerwissenschaften zu studieren, und erwarb anschließend noch einen Masterabschluss, während er in B.J. Foggs berühmtem Persuasive Technology Lab arbeitete, in dem erforscht wird, wie man Technologien einsetzen kann, um das Denken und Handeln von Menschen zu verändern. Im Silicon Valley ist Fogg als »Millionärsmacher« bekannt – eine Anspielung auf die vielen Leute, die in seinem Labor tätig waren und das Erlernte dann anwendeten, um lukrative Technologie-Start-ups zu gründen (eine Gruppe, zu der neben anderen Dotcom-Stars übrigens auch der Instagram-Mitgründer Mike Krieger zählt). Harris folgte diesem bewährten Weg. Nachdem er ausreichend in der Kunst der Interaktion zwischen Geist und Gerät geschult war, verließ er den Masterstudiengang und gründete Apture, ein Technologie-Start-up, das mit der Einblendung von Faktoiden arbeitete, um die von den Nutzern auf Websites verbrachte Zeit zu erhöhen.
2011 wurde Apture von Google aufgekauft und Harris im Team für den Gmail-Posteingang eingesetzt. Bei Google begann Harris, der jetzt an Produkten arbeitete, die das Verhalten von Hunderten Millionen Menschen beeinflussen konnten, sich allmählich Gedanken zu machen. Nach einer aufschlussreichen Begegnung beim Burning-Man-Festival schrieb Harris, genau wie in einem Drehbuch von Cameron Crowe, ein Manifest mit 144 Punkten und dem Titel »Ein Appell für eine Minimierung der Ablenkung & Respekt gegenüber der Aufmerksamkeit der Nutzer«. Harris verschickte das Manifest an eine kleine Gruppe von Freunden bei Google. Bald verbreitete es sich tausendfach im Unternehmen und erreichte unter anderem auch CoCEO Larry Page, der Harris zu einer Besprechung bat, um diese kühnen Ideen zu diskutieren. Page versetzte Harris auf den neu erfundenen Posten des »Produktphilosophen«.
Aber dann: keine große Änderung. In einem Porträt des Atlantic von 2016 schob Harris den fehlenden Wandel auf die »Trägheit« der Organisation und mangelnde Klarheit darüber, wofür er einstand. Die ursprüngliche Quelle der Unstimmigkeiten ist natürlich ziemlich sicher viel einfacher: Eine Minimierung der Ablenkung und der Respekt gegenüber der Aufmerksamkeit der User würde den Umsatz schmälern. Zwanghafte Nutzung fördert den Verkauf, was Harris bestätigte, indem er erklärte, dass die Aufmerksamkeitsökonomie Unternehmen wie Google in ein »Rennen um den ersten Platz im Stammhirn«7 treibe. Also kündigte Harris, gründete ein Non-Profit-Unternehmen namens Time Well Spent mit der Mission einer anspruchsvollen Technologie, die »uns dient und nicht der Werbung«8, und ging mit seinen Warnungen darüber an die Öffentlichkeit, wie weit Technologieunternehmen zu gehen bereit sind, um unseren Verstand zu »kapern«.
In Washington D. C., wo ich wohne, ist allgemein bekannt, dass die größten politischen Skandale diejenigen sind, die etwas Negatives bestätigen, von dem die meisten bereits angenommen haben, dass es zutrifft. Diese Erkenntnis erklärt vielleicht die Leidenschaft, die Harris’ Enthüllungen entfachte. Kurz nachdem er an die Öffentlichkeit getreten war, erschien er auf dem Cover des Atlantic, gab Interviews bei 60 Minutes und PBS NewsHour und wurde bestürmt, einen TED-Talk zu halten. Jahrelang waren diejenigen unter uns, die sich über die scheinbare Leichtigkeit beschwerten, mit der Menschen zu Sklaven ihrer Smartphones wurden, als Panikmacher abgestempelt worden. Doch dann kam Harris und bestätigte, was die meisten immer stärker geargwöhnt hatten: Diese Apps und schicken Websites waren nicht, wie Bill Maher es formuliert hatte, Geschenke von »Nerd-Göttern, die eine bessere Welt schaffen«. Vielmehr waren sie dazu bestimmt, uns Spielautomaten in die Hosentasche zu stecken.
Harris hatte die moralische Courage, uns vor den verborgenen Gefahren unserer Geräte zu warnen. Wenn wir jedoch ihre schlimmsten Auswirkungen vermeiden wollen, müssen wir besser verstehen, warum sie es so mühelos schaffen, unsere besten Absichten zu durchkreuzen. Glücklicherweise haben wir einen guten Leitfaden, was dieses Ziel angeht. Wie sich herausstellte, lenkte ein junger Marketingprofessor an der New York University zu eben jener Zeit, in der Harris mit den ethischen Folgen einer suchterzeugenden Technologie rang, sein Augenmerk auf die Frage, wie genau diese Technologieabhängigkeit eigentlich funktioniert.
Vor dem Jahr 2013 hatte Adam Alter nur wenig Interesse an Technologie als Forschungsgegenstand.9 Er war ein Business-Professor aus Princeton mit einem PhD in Sozialpsychologie und hatte die umfassende Frage erforscht, wie die Eigenschaften der uns umgebenden Welt unser Denken und Handeln beeinflussen. In seiner Doktorarbeit untersuchte Alter beispielsweise, wie zufällige Verbindungen zwischen zwei Personen sich darauf auswirken können, was sie füreinander empfinden. »Wenn Sie erfahren, dass Sie am selben Tag geboren sind wie jemand, der etwas Schreckliches getan hat«, erklärte Alter mir, »verabscheuen Sie ihn sogar noch mehr, als wenn Sie diese Information nicht gehabt hätten.«
Sein erstes Buch Drunk Tank Pink führt zahlreiche ähnliche Fälle auf, in denen scheinbar kleine Umgebungsfaktoren große Verhaltensänderungen hervorrufen. Der Titel zum Beispiel bezieht sich auf eine Studie, die belegte, dass aggressive betrunkene Insassen eines Marinegefängnisses in Seattle sich deutlich beruhigten, nachdem sie fünfzehn Minuten in einer kaugummirosa gestrichenen Zelle verbracht hatten, ebenso wie kanadische Schulkinder, die in einem Klassenzimmer derselben Farbe unterrichtet wurden. Das Buch offenbart auch, dass ein rotes Hemd auf einem Dating-Profil erheblich mehr Aufmerksamkeit weckt als jede andere Farbe, und je leichter Ihr Name auszusprechen ist, desto schneller kommen Sie in juristischen Berufen voran.
Den Wendepunkt in Alters Karriere bildete ein Interkontinentalflug von New York nach Los Angeles. »Ich hatte mir eigentlich (fest) vorgenommen, ein bisschen zu schlafen und ein paar Arbeiten zu erledigen«, erzählte er mir. »Aber als wir zur Startbahn geschleppt wurden, begann ich mit einem einfachen Strategiespiel namens 2048 auf meinem Smartphone. Bei der Landung sechs Stunden später spielte ich es immer noch.«
Nach der Veröffentlichung von Drunk Tank Pink fing Alter an, nach einem neuen Forschungsthema zu suchen – eine Herausforderung, die ihn immer wieder zu einer Schlüsselfrage zurückführte: »Welcher ist der entscheidendste aller Faktoren, die unser heutiges Leben prägen?« Seine Erfahrung des zwanghaften Spielens während seines sechsstündigen Flugs ließ die Antwort plötzlich in aller Deutlichkeit hervortreten: unsere Bildschirme. Zu diesem Zeitpunkt hatten natürlich auch schon andere begonnen, kritische Fragen über unser scheinbar ungesundes Verhältnis zu neuen Technologien wie Smartphones und Videospielen zu stellen, aber was Alter von ihnen unterschied, war seine psychologische Ausbildung. Statt das Thema als kulturelles Phänomen zu betrachten, konzentrierte er sich auf dessen psychologische Wurzeln. Diese neue Perspektive brachte Alter unvermeidlich und unmissverständlich auf einen nervenaufreibenden Kurs: hin zur Wissenschaft der Abhängigkeit.
Für viele ist Abhängigkeit ein furchteinflößendes Wort. In unserer Vorstellung ruft es Bilder von Drogensüchtigen wach, die der eigenen Mutter den Schmuck stehlen. Doch für Psychologen hat Abhängigkeit eine sorgsame Definition, der diese etwas grelleren Elemente fehlen. Hier ein repräsentatives Beispiel:10
»Abhängigkeit ist ein Zustand, bei dem eine Person der Nutzung einer Substanz oder einer Verhaltensweise nachgeht, deren lohnende Wirkung einen überzeugenden Anreiz schafft, das Verhalten trotz schädlicher Konsequenzen wiederholt fortzusetzen.«
Bis vor Kurzem wurde angenommen, dass Abhängigkeit nur im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen auftritt, also Substanzen mit psychoaktiven Bestandteilen, die unsere Hirnchemie unmittelbar verändern können. Um die Jahrtausendwende deutete eine zunehmende Zahl von Studien darauf hin, dass Verhaltensweisen, bei denen kein Substanzkonsum involviert ist, ebenfalls im oben definierten technischen Sinne abhängig machen können. Eine wichtige Untersuchung von 2010 beispielsweise, die im American Journal of Drug and Alcohol Abuse erschien, ergab »zunehmende Beweise dafür, dass Verhaltensabhängigkeiten in vielen Bereichen der Substanzabhängigkeit gleichen«11. Der Artikel verweist auf pathologische Spiel- und Internetsucht als zwei besonders gängige Beispiele für diese Störungen. Als die American Psychiatric Association 2013 die fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) herausgab, wurden darin erstmals Verhaltenssüchte als diagnostizierbares Problem erwähnt.
Das führt uns zurück zu Adam Alter. Nachdem er die betreffende psychologische Literatur untersucht und die relevanten Personen in der Technologiewelt interviewt hatte, wurden ihm zwei Dinge deutlich. Erstens: Unsere neuen Technologien sind besonders geeignet, um Suchtverhalten zu fördern. Wie Alter einräumt, sind die mit Technologie zusammenhängenden Verhaltenssüchte tendenziell »moderater« als die starken chemischen Abhängigkeiten, die durch Drogen und Zigaretten hervorgerufen werden. Wenn ich Sie zwinge, Facebook aufzugeben, erleiden Sie vermutlich keine ernsthaften Entzugserscheinungen oder schleichen sich nachts in ein Internetcafé, um sich einen Schuss zu besorgen. Andererseits können diese Süchte dennoch recht schädlich für Ihr Wohlbefinden sein. Vielleicht schleichen Sie sich nicht nach draußen, um sich bei Facebook einzuloggen, aber wenn die App nur einen Handgriff entfernt auf dem Smartphone in Ihrer Tasche ist, macht eine moderate Verhaltenssucht es Ihnen sehr schwer, nicht den ganzen Tag lang wieder und wieder Ihren Account zu checken.
Der zweite Punkt, der Alter bei seiner Forschung klar wurde, ist sogar noch bestürzender. Genau wie Tristan Harris es in seinen Warnungen gesagt hatte, sind diese suchterzeugenden Eigenschaften neuer Technologien in vielen Fällen kein Zufall, sondern vielmehr sorgfältig entwickelte Gestaltungselemente.
Die auf Alters Fazit logisch folgende Frage lautet: Was genau macht neue Technologien gut geeignet, um ein Suchtverhalten zu fördern? In seinem Buch Unwiderstehlich von 2017, das seine Untersuchungen des Themas ausführlich wiedergibt, erläutert Alter die vielen verschiedenen »Ingredienzen«, mit denen eine beliebige Technologie es schafft, sich in unserem Gehirn festzuhaken und eine ungesunde Nutzung zu kultivieren. Ich will zwei Wirkkräfte dieser längeren Abhandlung etwas genauer betrachten, die nicht nur besonders relevant für unsere Diskussion zu sein scheinen, sondern – wie Sie bald sehen werden – auch immer wieder in meinen eigenen Forschungen darüber auftauchten, wie Technologieunternehmen Verhaltenssüchte fördern: intermittierende positive Verstärkung und der Drang nach sozialer Anerkennung. Unsere Gehirne sind überaus empfänglich für diese Wirkkräfte. Das ist deshalb von Belang, weil viele Apps und Websites, die Menschen dazu veranlassen, ständig auf ihre Smartphones zu schauen und Browsertabs zu öffnen, genau diese Masche nutzen, um sich selbst nahezu unwiderstehlich zu machen. Um diese Behauptung verständlich zu machen, will ich auf beide kurz eingehen.
Beginnen wir mit der ersten Wirkkraft: intermittierende positive Verstärkung. Seit Michael Zeilers berühmten Experimenten mit pickenden Tauben in den 1970er Jahren wissen Forscher, dass unvorhersehbare Belohnungen weitaus verlockender sind als solche mit einem bekannten Muster.12 Irgendetwas an der Unvorhersehbarkeit setzt mehr Dopamin frei, einen entscheidenden Neurotransmitter für die Steuerung unserer Gelüste. Bei dem ursprünglichen Experiment von Zeiler sollten Tauben auf einen Knopf picken, der unvorhersehbar ein Futterkorn ausgab. Wie Adam Alter ausführt, wird eben dieses Grundverhalten in den Feedback-Buttons abgebildet, die sich in den meisten Social-Media-Beiträgen finden, seit Facebook im Jahr 2009 den »Like«-Button einführte. »Man kann gar nicht genug betonen, wie stark der ›Like‹-Button die Psychologie der Facebook-Nutzer verändert hat«, schreibt Alter.13 »Was als eine passive Methode begonnen hatte, das Leben unserer Freunde mitzuverfolgen, war jetzt zutiefst interaktiv geworden, und das mit genau jener Art unvorhersehbaren Feedbacks, die Zeilers Tauben antrieb.« Alter beschreibt das Nutzerverhalten dann als »Glücksspiel«, wann immer man etwas in einem sozialen Netzwerk postet: Erhält man Likes (oder Herzchen oder Retweets) oder bleibt der Beitrag ohne Rückmeldung? Das Erstere erzeugt etwas, das ein Facebook-Techniker als »leuchtende Pseudofreude«14bezeichnet, während sich das Letztere schlecht anfühlt. So oder so, das Ergebnis ist schwer vorauszusagen, und das, so lehrt uns die Suchtpsychologie, macht die gesamte Tätigkeit des Postens und Checkens so unerträglich verlockend.
Social-Media-Feedback ist jedoch nicht die einzige Onlineaktivität mit diesem Merkmal der unvorhersehbaren Verstärkung. Viele Menschen haben schon die Erfahrung gemacht, dass sie aus einem bestimmten Grund eine Website besuchen – beispielsweise eine Nachrichtenseite, um den Wetterbericht zu lesen –, nur um festzustellen, dass sie dreißig Minuten später immer noch gedankenlos einer Kette von Links folgen und von einer Schlagzeile zur nächsten springen. Auch dieses Verhalten kann von unvorhersehbarem Feedback ausgelöst werden: Die meisten Beiträge erweisen sich als Blindgänger, aber gelegentlich landet man bei einem, der starke Emotionen auslöst, sei es rechtschaffener Ärger oder Lachen. Jede reizvolle Überschrift und jeder verlockende Link, den wir anklicken, ist ein erneutes metaphorisches Betätigen des Hebels am Glücksspielautomaten.
Natürlich erkennen Technologieunternehmen die Macht dieses Tricks mit dem unvorhersehbaren Feedback und bauen ihn bewusst in ihre Produkte ein, um deren Reiz noch zu erhöhen. Whistleblower Tristan Harris erklärt: »Apps und Websites streuen überall in ihren Produkten intermittierende variable Belohnungen aus, denn das ist gut fürs Geschäft.«15 Aufmerksamkeit heischende Benachrichtigungssymbole oder die befriedigende Art und Weise, wie ein einziges Wischen mit dem Finger zum nächsten potenziell interessanten Beitrag führt, werden oft sorgsam darauf zugeschnitten, starke Reaktionen auszulösen. Wie Harris bemerkt, war das Benachrichtigungssymbol für Facebook ursprünglich blau, um sich in die Farbpalette der übrigen Seite einzufügen, »aber keiner hat es benutzt«16. Deshalb wurde die Farbe in Rot verändert – eine Alarmfarbe –, und die Klickrate schoss in die Höhe.
Die vielleicht vielsagendste Äußerung machte Sean Parker im Herbst 2017. Der Gründungspräsident von Facebook sprach bei einem Event offen über die von seiner früheren Firma angewendeten Aufmerksamkeitstechniken:17