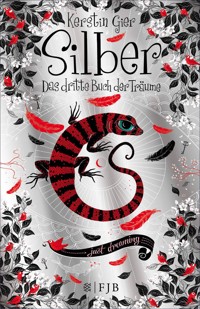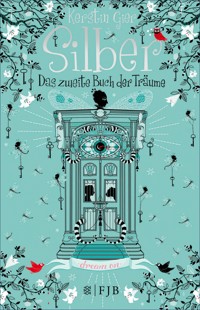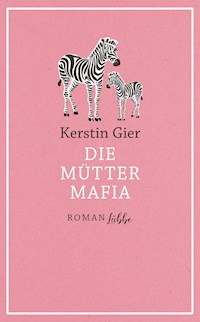14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Gwendolyn ist am Boden zerstört. War Gideons Liebesgeständnis nur eine Farce, um ihrem großen Gegenspieler, dem düsteren Graf von Saint Germain, in die Hände zu spielen? Fast sieht es für die junge Zeitreisende so aus. Doch dann geschieht etwas Unfassbares, das Gwennys Weltbild einmal mehr auf den Kopf stellt. Für sie und Gideon beginnt eine atemberaubende Flucht in die Vergangenheit. Rauschende Ballnächte und wilde Verfolgungsjagden erwarten die Heldin wider Willen und über allem steht die Frage, ob man ein gebrochenes Herz wirklich heilen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Titel
Kerstin Gier
Smaragdgrün.Liebe geht durch alle Zeiten
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2013 © 2010 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenEinbandillustration: Eva Schöffmann-DavidovISBN 978-3-401-80118-6www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.dewww.smaragdgruenlesen.de
Widmung
Für alle Marzipanherzen-Mädchen dieser Welt(und ich meine wirklich alle Mädchen. Es fühlt sich nämlich immer gleich an,egal ob man 14 Jahre alt ist oder 41.)
Hope is the thing with feathersThat perches in the soulAnd sings the tune without wordsAnd never stops at all.Emily Dickinson
Prolog
Belgravia, London, 3. Juli 1912
»Das wird eine hässliche Narbe geben«, sagte der Arzt, ohne den Kopf zu heben.
Paul lächelte schief. »Na, auf jeden Fall besser als die Amputation, die Mrs Überängstlich hier prophezeit hat.«
»Sehr witzig!«, fauchte ihn Lucy an. »Ich bin nicht überängstlich, und du… Mr Dämlich-Leichtsinnig, mach bloß keine Scherze! Du weißt genau, wie schnell sich solche Wunden infizieren können, und dann kann man froh sein, wenn man in diesen Zeiten überhaupt noch am Leben bleibt: Keine Antibiotika weit und breit und die Ärzte sind alle unwissende Stümper!«
»Na, besten Dank auch«, sagte der Arzt, während er eine bräunliche Paste auf der frisch genähten Wunde verstrich. Es brannte höllisch und Paul konnte nur mit Mühe eine Grimasse unterdrücken. Er hoffte nur, dass er keine Flecken auf Lady Tilneys gute Chaiselongue gemacht hatte.
»Sie können ja nichts dafür.« Paul merkte, dass Lucy sich große Mühe gab, freundlicher zu klingen, sie versuchte sogar ein Lächeln. Ein ziemlich grimmiges Lächeln, aber es war schließlich die Absicht, die zählte. »Ich bin überzeugt, Sie geben Ihr Bestes«, sagte sie.
»Dr. Harrison ist der Beste«, versicherte Lady Tilney.
»Und der Einzige…«, murmelte Paul. Er war plötzlich unglaublich müde. In dem süßlich schmeckenden Trank, den der Arzt ihm eingeflößt hatte, musste sich ein Schlafmittel befunden haben.
»Vor allem der Verschwiegenste«, ergänzte Dr. Harrison. Pauls Arm erhielt einen schneeweißen Verband. »Und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass man Schnitt- und Stichwunden in achtzig Jahren anders behandelt, als ich es getan habe.«
Lucy holte tief Luft und Paul ahnte schon, was nun folgen würde. Aus ihrer Hochsteckfrisur hatte sich eine Locke gelöst und sie strich sie sich mit kämpferischer Miene hinter das Ohr. »Na ja, grob betrachtet vielleicht nicht, aber wenn Bakterien… also, das sind so einzellige Organismen, die…«
»Jetzt hör schon auf, Luce!«, fiel Paul ihr ins Wort. »Dr. Harrison weiß sehr wohl, was Bakterien sind!« Die Wunde brannte immer noch fürchterlich, gleichzeitig fühlte er sich so erschöpft, dass er nur zu gern die Augen geschlossen hätte und einfach ein bisschen weggedämmert wäre. Aber das hätte Lucy nur noch mehr aufgebracht. Obwohl ihre blauen Augen wütend funkelten, verbargen sich doch nur Sorge und – schlimmer noch – Angst dahinter, das wusste er. Ihr zuliebe durfte er sich weder seine schlechte körperliche Verfassung noch die eigene Verzweiflung anmerken lassen. Also redete er einfach weiter. »Wir befinden uns schließlich nicht im Mittelalter, sondern im 20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der bahnbrechenden Entwicklungen. Das erste EKG ist bereits Schnee von gestern, seit ein paar Jahren kennt man auch den Erreger der Syphilis und hat eine Behandlung dagegen gefunden.«
»Ach, da hat aber jemand im Mysterien-Unterricht gut aufgepasst.« Jetzt sah Lucy aus, als würde sie jeden Augenblick explodieren. »Schön für dich!«
»Und im letzten Jahr hat diese Marie Curie den Nobelpreis für Chemie erhalten«, steuerte Dr. Harrison bei.
»Und was hat die noch gleich erfunden? Die Atombombe?«
»Manchmal bist du erschreckend ungebildet. Marie Curie hat radio…«
»Ach, halt die Klappe!« Lucy hatte die Arme vor der Brust verschränkt und starrte Paul zornig an. Lady Tilneys tadelnden Blick bemerkte sie gar nicht.
»Deine Vorträge kannst du dir im Augenblick sonst wohin schieben! Du! Hättest! Tot! Sein! Können! Kannst du mir bitte verraten, wie ich diese Katastrophe ohne dich abwenden sollte?« An dieser Stelle brach ihre Stimme. »Oder wie ich ohne dich weiterleben könnte?«
»Es tut mir leid, Prinzessin.« Sie hatte ja gar keine Ahnung, wie leid es ihm tat.
»Pah«, machte Lucy. »Du brauchst gar nicht diesen zerknirschten Hundeblick aufzusetzen.«
»Wie überflüssig, sich damit zu beschäftigen, was hätte sein können, Kind«, sagte Lady Tilney kopfschüttelnd, während sie Dr. Harrison half, seine Utensilien wieder in der Arzttasche zu verstauen. »Es ist doch alles gut gegangen. Paul hatte Glück im Unglück.«
»Nur weil es noch schlimmer hätte enden können, heißt es nicht, dass alles gut gegangen ist!«, rief Lucy. »Nichts ist gut gegangen, gar nichts!« Ihre Augen füllten sich mit Tränen und Paul brach bei diesem Anblick beinahe das Herz. »Wir sind jetzt seit drei Monaten hier und haben nichts von dem erreicht, was wir geplant hatten, im Gegenteil: Wir haben alles nur noch schlimmer gemacht! Endlich hatten wir diese verdammten Papiere in den Händen und da gibt Paul sie einfach weg!«
»Das war vielleicht ein bisschen voreilig.« Er ließ den Kopf auf das Kissen sinken. »Aber in diesem Augenblick hatte ich einfach das Gefühl, das Richtige zu tun.« Und zwar deshalb, weil er sich in ebendiesem Augenblick dem Tod verdammt nahe gefühlt hatte. Viel hätte nicht mehr gefehlt und Lord Alastairs Degenklinge hätte ihm den Rest gegeben. Das allerdings durfte er Lucy auf keinen Fall sagen. »Wenn wir Gideon auf unserer Seite hätten, gäbe es noch eine Chance. Sobald er die Papiere gelesen hat, wird er begreifen, worum es uns geht.« Hoffentlich.
»Aber wir wissen selber nicht genau, was in den Papieren steht! Vielleicht ist es verschlüsselt oder… ach, und du weißt ja nicht mal, was du Gideon da überhaupt gegeben hast«, sagte Lucy. »Lord Alastair könnte dir alles Mögliche untergejubelt haben: alte Rechnungen, Liebesbriefe, leere Blätter…«
Dieser Gedanke war Paul auch längst gekommen, aber was geschehen war, war nun einmal geschehen. »Manchmal muss man ein bisschen Vertrauen in die Dinge haben«, murmelte er und wünschte, diese Aussage würde auf ihn zutreffen. Noch mehr als der Gedanke, Gideon möglicherweise wertlose Papiere überreicht zu haben, folterte ihn die Vorstellung, der Junge könne mit den Unterlagen direkt zum Grafen von Saint Germain gegangen sein. Das würde bedeuten, er hätte ihren einzigen Trumpf aus der Hand gegeben. Aber Gideon hatte gesagt, dass er Gwendolyn liebte, und die Art und Weise, wie er es gesagt hatte, war irgendwie… überzeugend gewesen.
»Er hat es mir versprochen«, wollte Paul sagen, aber es kam nur als unhörbares Flüstern heraus. Außerdem wäre es ohnehin eine Lüge gewesen. Er hatte Gideons Antwort gar nicht mehr mitbekommen.
»Es war eine dumme Idee, mit der florentinischen Allianz zusammenarbeiten zu wollen«, hörte er Lucy sagen. Seine Augen waren ihm zugefallen. Was immer Dr. Harrison ihm verabreicht hatte, es wirkte rasend schnell.
»Ja, ich weiß, ich weiß«, fuhr Lucy fort. »Es war meine dumme Idee. Wir hätten die Sache selber in die Hand nehmen müssen.«
»Ihr seid aber nun mal keine Mörder, Kind«, sagte Lady Tilney.
»Macht es moralisch einen Unterschied, ob man jemanden selber ermordet oder nur den Auftrag dazu erteilt?« Lucy seufzte schwer, und obwohl Lady Tilney ihr energisch widersprach (»Mädchen, nun sag nicht so etwas! Ihr habt doch keinen Mordauftrag erteilt, ihr habt lediglich ein paar Informationen weitergegeben!«), klang sie plötzlich untröstlich: »Wir haben wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann, Paul. In drei Monaten haben wir nur jede Menge Zeit und Lady Margrets Geld verschwendet und darüber hinaus viel zu viele Menschen mit in die Sache hineingezogen.«
»Es ist Lord Tilneys Geld«, korrigierte sie Lady Tilney. »Du würdest staunen, wenn du wüsstest, wofür er sein Geld sonst so alles verschwendet. Pferderennen und Tänzerinnen sind da noch das Harmloseste – das bisschen, das ich für unsere Sache abzweige, bemerkt er gar nicht. Und wenn doch, dann dürfte er Gentleman genug sein, kein Wort darüber zu verlieren.«
»Und ich persönlich fände es sehr schade, wenn man mich nicht in diese Sache mit hineingezogen hätte«, versicherte Dr. Harrison und schmunzelte. »Ich hatte gerade angefangen, mein Leben ein bisschen langweilig zu finden. Schließlich hat man nicht alle Tage mit Zeitreisenden zu tun, die aus der Zukunft kommen und alles besser wissen. Und unter uns: Der Führungsstil der Herren de Villiers und Pinkerton-Smythe zwingt einen ja geradezu zur geheimen Rebellion.«
»Allerdings«, sagte Lady Tilney. »Dieser selbstgefällige Jonathan hat seiner Frau gedroht, sie im Haus einzuschließen, sollte sie weiter mit den Suffragetten sympathisieren.« Sie ahmte eine mürrische Männerstimme nach: »Was kommt als Nächstes? Das Wahlrecht für Hunde?«
»Tja, deswegen haben Sie ihm ja auch mit einer Ohrfeige gedroht«, sagte Dr. Harrison. »Das war übrigens endlich mal eine Teeparty, auf der ich mich nicht gelangweilt habe.«
»Aber so war es doch gar nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht für das garantieren könne, was meine rechte Hand als Nächstes tue, wenn er weiterhin derartig unqualifizierte Äußerungen von sich gebe.«
»Wenn er weiterhin derartigen Schwachsinn von sich geben würde, war der genaue Wortlaut«, korrigierte Dr. Harrison sie. »Ich weiß das so genau, weil es mich ungeheuer beeindruckt hat.«
Lady Tilney lachte und reichte dem Arzt ihren Arm. »Ich bringe Sie zur Tür, Dr. Harrison.«
Paul versuchte, die Augen zu öffnen und sich aufzurichten, um dem Arzt zu danken. Es gelang ihm weder das eine noch das andere. »Mfsch…nke«, nuschelte er mit letzter Kraft.
»Was zur Hölle war in dem Zeug drin, das Sie ihm gegeben haben?«, rief Lucy Dr. Harrison hinterher.
Er drehte sich in der Tür um. »Nur ein paar Tropfen Morphiumtinktur. Ganz harmlos!«
Lucys empörten Aufschrei hörte Paul nicht mehr.
Aus den Annalen der Wächter30. März 1916Parole des Tages: »Potius sero quam numquam.« (Livius)Da London unseren Geheimdienstquellen zufolge in den nächsten Tagen wieder Luftangriffe deutscher Marinegeschwader zu erwarten hat, haben wir beschlossen, ab sofort nach Sicherheitsprotokoll Stufe eins zu verfahren. Der Chronograf wird auf unbestimmte Zeit im Dokumentenraum platziert und Lady Tilney, mein Bruder Jonathan und ich werden gemeinsam von dort elapsieren, um die dafür täglich aufzuwendende Zeit auf drei Stunden zu beschränken. Reisen ins19. Jahrhundert dürften in diesem Raum keine Probleme bereiten; zu nächtlicher Zeit hat sich dort selten jemand aufgehalten und in den Annalen ist nie die Rede von einem Besuch aus der Zukunft, weshalb davon auszugehen ist, dass unsere Anwesenheitniemals bemerkt wurde.Wie zu erwarten war, sträubte sich Lady Tilney dagegen, von ihren üblichen Gewohnheiten abzuweichen, und konnte nach eigenen Aussagen »keinerlei Logik in unserer Argumentation finden«, aber zu guter Letzt musste sie sich der Entscheidung unseres Großmeisters beugen. Kriegszeiten erfordern nun einmalbesondere Maßnahmen.Das Elapsieren heute Nachmittag ins Jahr 1851 verlief dann überraschend friedlich, vielleicht, weil meine fürsorgliche Gattin uns ihren unvergleichlichen Teekuchen mitgegeben hatte und wir Themen wie das Wahlrecht für Frauen in Erinnerung an hitzige Debatten bei anderen Gelegenheiten mieden. Lady Tilney bedauerte zwar, dass wir nicht zur Weltausstellung in den Hyde Park gehen konnten, aber da wir ihr Bedauern diesbezüglich durchaus teilten, artete das Gespräch nicht in Streit aus. Mit dem Vorschlag allerdings, uns die Zeit ab morgen mit Pokern zu vertreiben, zeigte sie sich dann doch wieder von ihrer exzentrischen Seite.Das Wetter heute: leichter Nieselregen bei frühlingshaften 16 Grad Celsius.Bericht: Timothy de Villiers, Innerer Kreis
1.
Die Spitze des Schwertes war genau auf mein Herz gerichtet und die Augen meines Mörders waren wie schwarze Löcher, die alles zu verschlingen drohten, das ihnen zu nahe kam. Ich wusste, dass ich nicht entkommen konnte. Schwerfällig stolperte ich ein paar Schritte rückwärts.
Der Mann folgte mir. »Ich werde vom Antlitz der Erde tilgen, was nicht von Gott gewollt ist! Dein Blut wird die Erde tränken!«
Mir lagen mindestens zwei schlagfertige Erwiderungen auf diese pathetisch geröchelten Worte auf der Zunge (Erde tränken – HALLO? Der Boden hier war gefliest!), aber vor lauter Panik brachte ich nichts davon über die Lippen. Der Mann sah sowieso nicht so aus, als würde er meinen Humor in dieser Situation zu schätzen wissen. Oder als wüsste er Humor überhaupt zu schätzen.
Ich taumelte noch einen Schritt zurück und stieß mit dem Rücken gegen eine Wand. Mein Gegner lachte laut auf. Na gut, vielleicht hatte er doch Humor, nur einen etwas anderen als ich.
»Jetzt stirbst du, Dämon!«, rief er und versenkte das Schwert ohne weitere Umschweife in meiner Brust.
Mit einem Schrei fuhr ich hoch. Ich war nass geschwitzt und mein Herz schmerzte, als wäre es tatsächlich von einer Klinge durchbohrt worden. Was für ein mieser Traum. Allerdings – wunderte mich das wirklich?
Die Erlebnisse des gestrigen Tages (und der Tage davor) schrien nicht gerade danach, sich gemütlich unter der Decke zusammenzukuscheln und den Schlaf der Gerechten zu schlafen. Es war vielmehr so, dass sich unerwünschte Gedanken durch meinen Kopf schlängelten wie wild wuchernde fleischfressende Pflanzen. Gideon hat mir nur was vorgespielt. Er liebt mich nicht.
»Wahrscheinlich muss er ohnehin kaum etwas tun, damit die Mädchenherzen ihm zufliegen«, hörte ich den Grafen von Saint Germain mit seiner sanften, tiefen Stimme sagen, immer und immer wieder. Und: »Nichts ist leichter zu berechnen als die Reaktion einer verliebten Frau.«
Tja, und wie reagiert eine verliebte Frau, wenn sie erfahren hat, dass sie angelogen und manipuliert wurde? Richtig: Sie telefoniert stundenlang mit ihrer besten Freundin, um dann schlaflos im Dunkeln zu sitzen und sich zu fragen, warum zum Teufel sie auf diesen Typ hereingefallen ist, während sie sich gleichzeitig vor Sehnsucht die Augen aus dem Kopf heult… – in der Tat leicht zu berechnen.
Die Leuchtziffern auf dem Wecker neben meinem Bett zeigten 3:10 Uhr an, was bedeutete, dass ich wohl doch eingenickt sein musste und sogar mehr als zwei Stunden geschlafen hatte. Und jemand – meine Mum? – musste hereingekommen sein und mich zugedeckt haben, denn ich erinnerte mich nur noch daran, wie ich mit hochgezogenen Knien auf dem Bett gekauert und meinem Herzen beim viel zu schnellen Schlagen gelauscht hatte.
Seltsam eigentlich, dass ein gebrochenes Herz überhaupt noch schlagen konnte.
»Es fühlt sich an, als ob es nur aus roten, scharfkantigen Splittern besteht, die mich von innen aufschlitzen und verbluten lassen!«, hatte ich Leslie den Zustand meines Herzens zu beschreiben versucht (okay, das klingt mindestens so pathetisch wie das von dem Röcheltypen aus meinem Traum, aber manchmal ist die Wahrheit eben irgendwie… kitschig). Und Leslie hatte mitleidig gesagt: »Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als Max mit mir Schluss gemacht hat, dachte ich auch zuerst, ich müsste vor Kummer sterben. Und zwar an multiplem Organversagen. Weil an all diesen Redensarten was Wahres dran ist: Liebe geht an die Nieren, schlägt auf den Magen, bricht das Herz, schnürt die Brust zu und… äh… läuft einem als Laus über die Leber… Aber erstens geht das vorbei, zweitens ist die Sache nicht so hoffnungslos, wie sie dir erscheint, und drittens ist dein Herz nicht aus Glas.«
»Stein, nicht Glas«, korrigierte ich sie schluchzend. »Mein Herz ist ein Edelstein, den Gideon in tausend Stücke zerbrochen hat, genau wie in Tante Maddys Vision.«
»Hört sich zwar irgendwie cool an, aber – nein! In Wirklichkeit sind Herzen aus ganz anderem Material gemacht. Das kannst du mir wirklich glauben.« Leslie räusperte sich und ihr Tonfall wurde ganz feierlich, so als ob sie mir gerade das größte Geheimnis der Weltgeschichte offenbarte: »Es handelt sich um ein viel zäheres, unzerbrechliches und immer wieder neu formbares Material. Nach einer geheimen Rezeptur hergestellt.«
Nochmaliges Räuspern, um die Spannung zu steigern. Ich hielt unwillkürlich die Luft an. »Wie Marzipan!«, verkündete Leslie.
»Marzipan?« Für einen kurzen Moment hörte ich auf zu schluchzen und musste grinsen.
»Ja, Marzipan!«, wiederholte Leslie todernst. »Das gute mit dem hohen Mandelanteil.«
Beinahe hätte ich gekichert. Aber dann fiel mir wieder ein, dass ich ja das unglücklichste Mädchen auf der ganzen Welt war, und ich sagte schniefend: »Wenn das so ist, dann hat Gideon ein Stück von meinem Herzen abgebissen! Und die ganze Schokolade drum herum hat er auch abgeknabbert. Du hättest sehen sollen, wie er geguckt hat, als…« Bevor ich wieder von vorne anfangen konnte, seufzte Leslie vernehmlich.
»Gwenny, ich sag’s wirklich nur ungern: Aber dein Gejammer nützt keinem was. Du musst damit aufhören!«
»Ich mache es nicht mit Absicht«, versicherte ich ihr. »Es jammert in einem fort aus mir heraus. In der einen Minute noch war ich das glücklichste Mädchen der Welt und dann sagt er mir, dass…«
»Okay, Gideon hat sich wie ein Mistkerl verhalten«, fiel Leslie mir rasch ins Wort. »Wenn man auch nicht versteht, warum. Ich meine, hallo? Wieso sollten verliebte Mädchen leichter zu lenken sein? Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Verliebte Mädchen sind wie tickende Zeitbomben. Man kann nie wissen, was sie als Nächstes tun. Wenn Gideon und sein Chauvi-Freund, der Graf, sich da mal nicht kolossal vertan haben.«
»Ich dachte wirklich, er liebt mich. Dass er das alles nur gespielt hat, ist so…« Gemein? Grausam? Kein Wort schien meine Gefühle ausreichend beschreiben zu können.
»Ach, Süße! Unter anderen Umständen dürftest du dich von mir aus noch wochenlang im Unglück suhlen. Aber das kannst du dir im Augenblick einfach nicht leisten. Du brauchst deine Energie für andere Dinge. Zum Überleben zum Beispiel.« Leslie klang ungewöhnlich streng. »Also reiß dich jetzt gefälligst mal zusammen!«
»Das hat Xemerius auch schon gesagt. Bevor er abgehauen ist und mich allein gelassen hat.«
»Das kleine unsichtbare Monster hat recht! Wir müssen jetzt einen klaren Kopf behalten und alle Fakten zusammentragen. Puh, was ist das denn? Warte mal, ich muss das Fenster aufmachen, Bertie hat einen seiner entsetzlichen Betäubungs-Furze losgelassen… böser Hund! Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, wir müssen herausfinden, was dein Großvater in eurem Haus versteckt hat.« Leslies Stimmlage wurde ein bisschen höher. »Raphael hat sich als ziemlich nützlich erwiesen, würde ich mal sagen. Vielleicht ist er ja gar nicht so dämlich, wie man so denkt.«
»Wie du so denkst, meinst du wohl.« Raphael war Gideons kleiner Bruder, der seit Neustem auf unsere Schule ging. Er hatte entdeckt, dass es sich bei dem Rätsel, das mein Großvater mir hinterlassen hatte, um geografische Koordinaten gehandelt hatte. Und die hatten direkt zu unserem Haus geführt. »Mich würde brennend interessieren, wie viel Raphael von den Geheimnissen der Wächter und Gideons Zeitreisen so mitbekommt.«
»Möglicherweise mehr, als man so vermuten sollte«, sagte Leslie. »Jedenfalls hat er mir meine Story nicht abgenommen, von wegen, dass Mystery-Spiele in London gerade der neueste Schrei wären. Aber er war klug genug, keine Fragen zu stellen.« Hier machte sie eine kleine Pause. »Er hat ziemlich schöne Augen.«
»Allerdings.« Die Augen waren wirklich schön, was mich daran erinnerte, dass Gideon genau die gleichen hatte. Grün und von dichten dunklen Wimpern umrahmt.
»Nicht, dass mich das irgendwie beeindrucken würde, es ist nur eine Feststellung…«
»Ich habe mich in dich verliebt.« Ganz ernst hatte Gideon das gesagt und mir dabei direkt in die Augen gesehen. Und ich hatte zurückgestarrt und ihm jedes Wort geglaubt! Meine Tränen begannen wieder zu fließen und ich konnte kaum noch hören, was Leslie sagte.
».…aber ich hoffe, es ist ein langer Brief oder eine Art Tagebuch, in dem dein Großvater dir alles erklärt, was dir die anderen verschweigen, und noch ein bisschen mehr. Dann müssten wir nicht länger im Dunkeln tappen und können endlich einen richtigen Plan machen…«
Solche Augen sollten verboten werden. Oder man müsste ein Gesetz erlassen, nach dem Jungs mit so schönen Augen nur noch mit Sonnenbrillen herumlaufen dürften. Außer, sie hätten zum Ausgleich riesige Segelohren oder so was…
»Gwenny? Heulst du etwa schon wieder?« Jetzt hörte sich Leslie genauso an wie Mrs Counter, unsere Erdkundelehrerin, wenn man ihr sagte, dass man leider die Hausaufgaben vergessen habe. »Süße, das ist nicht gut! Du musst damit aufhören, dir den Drama-Dolch immer und immer wieder in der Brust herumzudrehen! Wir brauchen…«
».…einen kühlen Kopf! Du hast ja recht.« Obwohl es mich Überwindung kostete, versuchte ich, die Erinnerung an Gideons Augen aus meinem Kopf zu verdrängen und ein wenig Zuversicht in meine Stimme zu legen. Das war ich Leslie einfach schuldig. Schließlich war sie diejenige, die mich ohne jedes Wenn und Aber seit Tagen unterstützte. Bevor sie auflegte, musste ich ihr daher unbedingt noch sagen, wie froh ich war, dass ich sie hatte. (Auch wenn ich dabei wieder ein bisschen zu weinen begann, aber dieses Mal vor Rührung.)
»Und ich erst!«, versicherte mir Leslie. »Wie langweilig wäre mein Leben ohne dich.« Als sie auflegte, war es kurz vor Mitternacht und ich hatte mich tatsächlich für ein paar Minuten etwas besser gefühlt, aber jetzt, um zehn nach drei, hätte ich sie liebend gern wieder angerufen und das Ganze noch mal durchgekaut.
Von Natur aus neigte ich gar nicht so sehr zum Jammern, es war nur das erste Mal in meinem Leben, dass ich Liebeskummer hatte. So richtigen Liebeskummer, meine ich. Die Sorte, die wirklich wehtut. Alle anderen Dinge rückten dabei weit in den Hintergrund. Selbst das Überleben wurde zur Nebensache. Ganz ehrlich: Der Gedanke ans Sterben war für den Augenblick gar nicht mal so unangenehm. Schließlich wäre ich nicht die Erste, die an gebrochenem Herzen starb, da befand ich mich in bester Gesellschaft: die kleine Meerjungfrau, Julia, Pocahontas, die Kameliendame, Madame Butterfly – und jetzt eben auch ich, Gwendolyn Shepherd. Das Gute war, die Nummer mit dem (Drama-)Dolch würde ich mir sparen können, denn so elend, wie ich mich fühlte, war ich längst mit der Schwindsucht infiziert, da starb es sich doch gleich viel malerischer. Bleich und schön wie Schneewittchen würde ich auf meinem Bett liegen, das Haar auf dem Kissen ausgebreitet. Gideon würde neben mir knien und bitterlich bereuen, was er getan hatte, wenn ich meine letzten Worte hauchte…
Aber vorher musste ich noch dringend zur Toilette.
Pfefferminztee mit reichlich Zucker und Zitrone war in unserer Familie eine Art Allheilmittel gegen Kummer und ich hatte eine ganze Kanne davon getrunken. Meiner Mutter war nämlich sofort aufgefallen, dass es mir nicht gut ging, als ich zur Tür reinkam. Das war auch kein Kunststück, denn vom vielen Weinen sah ich aus wie ein Albinokaninchen. Sie hätte mir ganz bestimmt nicht abgenommen, dass ich während der Fahrt vom Hauptquartier der Wächter nach Hause in der Limousine Zwiebeln hatte schneiden müssen, wie es Xemerius als Ausrede vorgeschlagen hatte.
»Haben diese verdammten Wächter dir etwas getan? Was ist passiert?«, hatte sie gefragt und dabei das Kunststück fertiggebracht, gleichzeitig mitleidig und ungeheuer wütend auszusehen. »Ich werde Falk umbringen, wenn…«
»Niemand hat mir etwas getan, Mum«, hatte ich mich beeilt, ihr zu versichern. »Und es ist nichts passiert.«
»Als ob sie dir das glauben würde! Warum hast du nicht das mit den Zwiebeln gesagt? Nie hörst du auf mich.« Xemerius hatte mit seinen Klauen auf den Boden gestampft. Er war ein kleiner steinerner Wasserspeierdämon mit großen Ohren, Fledermausflügeln, einem langen geschuppten Drachenschwanz und zwei kleinen Hörnern auf einem katzenähnlichen Kopf. Leider war er nur halb so süß, wie er aussah, und leider konnte niemand außer mir seine unverschämten Bemerkungen hören und ihm entsprechend Paroli bieten. Dass ich Wasserspeierdämonen und andere Geister sehen und seit meiner frühen Kindheit mit ihnen sprechen konnte, war übrigens nur eine der bizarren Eigenschaften, mit denen ich leben musste. Die andere war noch bizarrer und ich wusste selber erst seit knapp zwei Wochen davon, nämlich, dass ich zu einem – geheimen! – Kreis von zwölf Zeitreisenden gehörte und täglich für ein paar Stunden irgendwohin in die Vergangenheit springen musste. Eigentlich hätte der Fluch, Pardon, die Gabe, in der Zeit reisen zu können, meine Cousine Charlotte ereilen sollen, die dafür viel besser geeignet gewesen wäre, aber tatsächlich hatte sich herausgestellt, dass ich die Dumme war. Was mir von vorneherein hätte klar sein sollen, denn ich zog immer den Schwarzen Peter, also im übertragenen Sinne. Beim Weihnachtswichteln war ich diejenige, die den Zettel mit dem Namen der Lehrerin erwischte (und was bitte schenkt man seiner Lehrerin?), wenn ich Karten für ein Konzert hatte, wurde ich ganz bestimmt krank (wahlweise auch gerne in den Ferien), und wenn ich besonders gut aussehen wollte, bekam ich einen Pickel auf der Stirn, so groß wie ein drittes Auge. Zeitreisen mögen sich zwar im ersten Moment nicht mit Pickeln vergleichen lassen und sich vielleicht sogar nach etwas Beneidenswertem und Lustigem anhören, aber das sind sie nicht. Sie sind vielmehr lästig, nervenaufreibend und gefährlich. Und nicht zu vergessen: Hätte ich diese blöde Gabe nicht geerbt, hätte ich niemals Gideon kennengelernt, was hieße, dass mein Herz – ob aus Marzipan oder nicht – noch ganz wäre. Der Mistkerl war nämlich auch einer der zwölf Zeitreisenden. Einer der wenigen, die noch lebten. Die anderen konnte man nur noch in der Vergangenheit treffen.
»Du hast geweint«, hatte meine Mutter nüchtern festgestellt.
»Siehst du«, hatte Xemerius gerufen. »Jetzt wird sie dich ausquetschen wie eine Zitrone und keine Sekunde mehr aus den Augen lassen und aus der Schatzsuche wird heute Nacht nichts mehr.«
Ich hatte ihm eine Grimasse geschnitten, um anzudeuten, dass mir heute Nacht ganz bestimmt nicht mehr nach Schatzsuche zumute war. Na ja, wie man das eben so macht mit unsichtbaren Freunden, wenn man nicht möchte, dass andere einen für verrückt halten, weil man mit der Luft spricht.
»Sag, du hast dein Pfefferspray ausprobiert und es dir dabei aus Versehen in die Augen gesprüht«, hatte die Luft gekräht.
Aber ich war zum Lügen viel zu erschöpft gewesen. Ich hatte meine Mum mit verweinten Augen angeschaut und es einfach mit der Wahrheit versucht. Und mit Mut zur Lücke. »Es ist nur… mir geht’s nicht gut, weil… – so ein Mädchending, weißt du?«
»Ach, Schätzchen…«
»Wenn ich mit Leslie telefoniere, geht es mir gleich besser.«
Zu meiner und Xemerius’ großer Verblüffung hatte Mum sich mit dieser Erklärung begnügt. Sie hatte mir Tee gekocht, die Kanne zusammen mit meiner gepunkteten Lieblingstasse auf den Nachttisch gestellt, mir über den Kopf gestreichelt und mich ansonsten in Ruhe gelassen. Sogar die üblichen Zeitansagen (»Gwen! Es ist nach zehn, du telefonierst schon seit vierzig Minuten! Ihr seht euch doch morgen in der Schule!«) waren ausgeblieben. Manchmal war sie wirklich die beste Mutter der Welt.
Mit einem Seufzer schwang ich meine Beine über den Bettrand und taperte Richtung Badezimmer. Ein kalter Lufthauch streifte mich.
»Xemerius? Bist du da?«, fragte ich halblaut und tastete nach dem Lichtschalter.
»Kommt drauf an.« Xemerius baumelte kopfüber von der Flurlampe und blinzelte ins Licht. »Nur wenn du dich nicht wieder in einen Zimmerbrunnen verwandelst!« Seine Stimme wurde hoch und weinerlich, als er mich – leider ziemlich treffend – nachahmte. »Und dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, und dann hab ich gesagt, ja oder nein, und darauf hat er gesagt, ja, aber bitte hör auf zu weinen…« Er seufzte theatralisch. »Mädchen sind wirklich die anstrengendste Sorte Mensch, die es gibt. Gleich nach pensionierten Finanzbeamten, Verkäuferinnen in Strumpfgeschäften und Vorsitzenden von Kleingärtenvereinen.«
»Ich kann für nichts garantieren.« Ich flüsterte, damit der Rest meiner Familie nicht wach wurde. »Am besten sprechen wir nicht über du-weißt-schon-wen, weil sonst… na ja… der Zimmerbrunnen wieder anspringen könnte.«
»Ich konnte seinen Namen sowieso schon nicht mehr hören. Machen wir jetzt endlich mal was Sinnvolles? Wie einen Schatz suchen zum Beispiel?«
Schlafen wäre vielleicht etwas Sinnvolles gewesen, aber ich war leider wieder hellwach. »Von mir aus können wir anfangen zu suchen. Aber vorher gehe ich noch schnell den Tee wegbringen.«
»Häh?«
Ich zeigte auf die Badezimmertür.
»Ach so«, sagte Xemerius. »Ich warte so lange hier.«
Im Badezimmerspiegel sah ich viel besser aus als erwartet. Von Schwindsucht leider keine Spur. Lediglich die Augenlider waren ein bisschen geschwollen, so als hätte ich etwas zu viel rosafarbenen Lidschatten aufgetragen.
»Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, Xemerius?«, fragte ich, als ich zurück in den Flur kam. »Nicht zufällig bei…?«
»Bei wem?« Xemerius setzte eine empörte Miene auf. »Fragst du mich etwa nach dem, dessen Name nicht genannt werden darf?«
»Hm ja.« Ich hätte nur zu gern gewusst, was Gideon am Abend gemacht hatte. Wie ging es wohl der Wunde an seinem Arm? Und hatte er vielleicht mit jemandem über mich gesprochen? So etwas wie: »Das ist alles ein großes Missverständnis. Natürlich liebe ich Gwendolyn. Ich habe ihr niemals etwas vorgespielt.«
»Nee, nee, darauf falle ich nicht herein.« Xemerius breitete seine Flügel aus und flatterte auf den Fußboden. Wie er so vor mir saß, reichte er mir bis knapp übers Knie. »Aber ich war auch gar nicht weg. Ich habe mich hier im Haus gründlich umgesehen. Wenn einer diesen Schatz finden kann, dann ich. Schon, weil sonst niemand von euch in der Lage ist, durch Wände zu gehen. Oder die Kommodenschubladen deiner Großmutter zu durchwühlen, ohne dabei erwischt zu werden.«
»Es muss ja auch irgendwelche Vorteile haben, unsichtbar zu sein«, sagte ich und verzichtete dabei auf den Hinweis, dass Xemerius überhaupt nichts durchwühlen konnte, weil er mit seinen Geisterkrallen nicht mal eine Schublade aufziehen konnte. Kein Geist, den ich bisher kennengelernt hatte, war in der Lage, Gegenstände zu bewegen. Die meisten bekamen nicht mal einen kalten Luftzug auf die Reihe. »Aber du weißt schon, dass wir keinen Schatz suchen, sondern nur einen Hinweis meines Großvaters, der uns irgendwie weiterhelfen soll?«
»Das Haus ist wirklich voll schatztauglichen Krams. Nicht zu reden von all den möglichen Verstecken«, fuhr Xemerius ungerührt fort. »Die Wände im ersten Stock sind zum Teil doppelt gebaut, dazwischen befinden sich Gänge, die definitiv nicht für Leute mit dicken Hinterteilen gedacht sind, so eng, wie die sind.«
»Wirklich?« Diese Gänge hatte ich bisher noch nicht entdeckt. »Und wie kommt man da rein?«
»In den meisten Zimmern sind die Türen einfach übertapeziert worden, aber es befindet sich immer noch ein Eingang im Wandschrank deiner Großtante und ein weiterer hinter dem klobigen Büfett im Esszimmer. Und in der Bibliothek, klassisch hinter einem Drehregal versteckt. Von der Bibliothek gibt es übrigens auch eine Verbindung zum Treppenhaus von Mr Bernhards Wohnung und eine weitere hinauf in den zweiten Stock.«
»Was erklären würde, warum Mr Bernhard immer einfach so aus dem Nichts auftaucht«, murmelte ich.
»Das ist noch nicht alles: Im großen Kaminschacht an der Wand zu Hausnummer 83 gibt es eine Leiter, auf der man bis aufs Dach klettern kann. Von der Küche aus gelangt man nicht mehr in den Schacht, da ist der Kamin zugemauert, aber im Wandschrank am Ende des Flurs im ersten Stock gibt es eine Klappe, groß genug für den Weihnachtsmann. Oder euren unheimlichen Butler.«
»Oder den Schornsteinfeger.«
»Und erst der Keller!« Xemerius tat, als hätte er meinen Einwurf nicht gehört. »Ob eure Nachbarn wissen, dass es eine Geheimtür zu ihrem Haus gibt? Und dass unter ihrem Keller noch ein Keller existiert? Man darf allerdings keine Angst vor Spinnen haben, wenn man dort nach etwas sucht.«
»Dann suchen wir am besten erst woanders«, sagte ich schnell und vergaß dabei ganz zu flüstern.
»Wenn wir wüssten, wonach wir suchen, wäre es natürlich einfacher.« Xemerius kratzte sich mit einer Hinterpfote am Kinn. »So könnte es im Grunde alles sein: das ausgestopfte Krokodil in den Abseiten, die Flasche Scotch hinter den Büchern in der Bibliothek, das Bündel mit Briefen im Geheimfach des Sekretärs deiner Großtante, die Kiste, die in einem Hohlraum im Mauerwerk steht…«
»Eine Kiste im Mauerwerk?«, unterbrach ich ihn. Und was waren Abseiten?
Xemerius nickte. »Oh, ich glaube, du hast deinen Bruder geweckt.«
Ich fuhr herum. Mein zwölfjähriger Bruder Nick stand in der Tür seines Zimmers und fuhr sich mit beiden Händen durch die verstrubbelten roten Haare. »Mit wem redest du, Gwenny?«
»Es ist mitten in der Nacht«, flüsterte ich. »Geh wieder schlafen, Nick.«
Nick schaute mich unschlüssig an und ich sah förmlich, wie er von Sekunde zu Sekunde wacher wurde. »Was ist mit einer Kiste im Mauerwerk?«
»Ich… wollte danach suchen, aber ich glaube, es ist besser, ich warte damit, bis es hell ist.«
»Unsinn!«, sagte Xemerius. »Ich sehe im Dunkeln wie… sagen wir mal eine Eule. Außerdem kannst du schlecht das Haus durchsuchen, wenn alle wach sind. Es sei denn, du willst noch mehr Gesellschaft.«
»Ich habe eine Taschenlampe«, sagte Nick. »Was ist denn in der Kiste?«
»Ich weiß es nicht genau.« Ich überlegte kurz. »Möglicherweise etwas von Grandpa.«
»Oh«, sagte Nick interessiert. »Und wo ist die Kiste in etwa versteckt?«
Ich sah Xemerius fragend an.
»Ich habe sie seitlich in dem Geheimgang hinter dem fetten, backenbärtigen Mann auf dem Pferd gesehen«, sagte Xemerius. »Aber wer versteckt schon Geheimnisse… äh… Schätze in einer langweiligen Truhe? Das Krokodil finde ich viel verheißungsvoller. Wer weiß, mit was es ausgestopft ist? Ich bin dafür, dass wir es aufschlitzen.«
Da das Krokodil und ich schon einmal Bekanntschaft geschlossen hatten, war ich dagegen. »Wir schauen zuerst in dieser Kiste nach. Hohlraum klingt schon mal nicht schlecht.«
»Laaaaangweilig!«, krakeelte Xemerius. »Wahrscheinlich hat da nur einer deiner Vorfahren den Pfeifentabak vor seiner Alten versteckt… oder…« Offensichtlich war ihm ein Gedanke gekommen, der ihn aufmunterte, denn nun grinste er plötzlich. ».…oder die zerstückelten Einzelteile eines ungezogenen Dienstmädchens!«
»Die Kiste ist in dem Geheimgang hinter dem Bild von Urururgroßonkel Hugh«, erklärte ich Nick. »Aber…«
»Ich hole schnell meine Taschenlampe!« Mein Bruder hatte sich schon umgedreht.
Ich seufzte.
»Was seufzt du denn schon wieder?« Xemerius verdrehte seine Augen. »Kann doch nicht schaden, wenn er mitkommt.« Er breitete seine Flügel aus. »Ich drehe mal schnell meine Runde und schaue, ob der Rest der Familie auch tief und fest schläft. Wir wollen ja nicht von deiner spitznasigen Tante erwischt werden, wenn wir die Diamanten finden.«
»Welche Diamanten?«
»Denk doch mal positiv!« Xemerius flatterte schon davon. »Was hättest du denn lieber? Diamanten oder die verwesten Überreste des ungezogenen Dienstmädchens? Alles eine Frage der Einstellung. Wir treffen uns vor dem dicken Onkel mit dem Gaul.«
»Sprichst du mit einem Geist?« Nick war wieder hinter mir aufgetaucht, schaltete das Flurlicht aus und knipste stattdessen seine Taschenlampe an.
Ich nickte. Nick hatte nie infrage gestellt, dass ich tatsächlich Geister sehen konnte, im Gegenteil. Schon als Vierjähriger (da war ich acht) hatte er mich vehement verteidigt, wenn jemand mir nicht glauben wollte. Tante Glenda zum Beispiel. Wir bekamen jedes Mal Streit, wenn sie mit uns zu Harrods ging und ich dort mit dem netten uniformierten Türsteher Mr Grizzle sprach. Da Mr Grizzle schon fünfzig Jahre tot war, konnte natürlich niemand so recht Verständnis dafür aufbringen, wenn ich stehen blieb und anfing, über die Windsors zu reden (Mr Grizzle war ein glühender Verehrer der Queen) und den viel zu feuchten Juni (das Wetter war Mr Grizzles zweitliebstes Thema). Manche Leute lachten, manche fanden die Fantasie von Kindern »göttlich« (was sie meist damit unterstrichen, mir durch die Haare zu wuscheln), manche schüttelten einfach den Kopf, aber niemand regte sich so sehr darüber auf wie Tante Glenda. Peinlich berührt pflegte sie mich weiterzuzerren, sie schimpfte, wenn ich die Füße in den Boden stemmte, sie sagte, ich solle mir ein Beispiel an Charlotte nehmen (die übrigens auch damals schon so perfekt war, dass ihr noch nicht mal ein Haarspängchen verrutschte), und – was am Gemeinsten war – sie drohte mit Nachtischentzug. Aber obwohl sie ihre Drohungen auch wahr machte (und ich Desserts in allen Variationen liebte, sogar Pflaumenkompott), brachte ich es einfach nicht übers Herz, an Mr Grizzle vorbeizugehen. Jedes Mal versuchte Nick, mir zu helfen, indem er Tante Glenda anflehte, mich loszulassen, der arme Mr Grizzle habe doch sonst keinen, mit dem er plaudern könne, und jedes Mal setzte Tante Glenda ihn ganz geschickt außer Gefecht, indem sie zuckersüß sagte: »Ach, kleiner Nick, wann wirst du endlich verstehen, dass deine Schwester sich nur wichtigmachen will? Es gibt keine Geister! Oder siehst du hier etwa einen?«
Nick hatte dann immer traurig den Kopf schütteln müssen und Tante Glenda konnte triumphierend lächeln. An dem Tag, an dem sie beschloss, uns niemals wieder mit zu Harrods zu nehmen, hatte Nick überraschend seine Taktik geändert. Winzig und pausbackig, wie er war (ach, er war ja so niedlich als kleiner Junge und er lispelte ganz entzückend!), baute er sich vor Tante Glenda auf und rief: »Weißt du, was Mr Grizzle gerade zu mir gesagt hat, Tante Glenda? Er hat gesagt, du bist eine boshafte, frubierte Hexe!« Natürlich hätte Mr Grizzle so etwas niemals gesagt (dazu war er viel zu höflich und Tante Glenda eine viel zu gute Kundin), aber meine Mum hatte am Abend vorher etwas Ähnliches von sich gegeben. Tante Glenda hatte die Lippen fest zusammengepresst und war mit Charlotte an der Hand einfach davon stolziert. Zu Hause hatte es dann eine ziemlich hässliche Auseinandersetzung mit meiner Mutter gegeben (Mum war sauer, dass wir den Heimweg ganz allein hatten finden müssen, und Tante Glenda hatte glasklar geschlossen, dass die frubierte Hexe aus dem Mund ihrer Schwester gekommen war) und das Ende vom Lied war, dass wir nicht mehr mit Tante Glenda einkaufen gehen durften. Das Wort »frubiert« allerdings benutzen wir bis heute gern.
Als ich älter wurde, hörte ich auf, allen Menschen davon zu erzählen, dass ich Dinge sehen konnte, die sie nicht sahen. Das ist das Klügste, was man tun kann, wenn man nicht für verrückt gehalten werden will. Nur vor meinen Geschwistern und vor Leslie musste ich mich nie verstellen, sie glaubten mir nämlich. Bei Mum und Großtante Maddy war ich mir da nicht ganz sicher, aber wenigstens machten sie sich niemals über mich lustig. Weil Tante Maddy in unregelmäßigen Abständen seltsame Visionen überkamen, wusste sie wahrscheinlich genau, wie man sich fühlte, wenn einem niemand glaubte.
»Ist er nett?«, wisperte Nick. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe tanzte über die Stufen.
»Wer?«
»Na, der Geist.«
»Geht so«, murmelte ich wahrheitsgemäß.
»Und wie sieht er aus?«
»Ziemlich niedlich. Aber er denkt, dass er gefährlich ist.« Während wir auf Zehenspitzen hinunter zum zweiten Stockwerk schlichen, das von Tante Glenda und Charlotte bewohnt wurde, versuchte ich, Xemerius zu beschreiben, so gut ich konnte.
»Cool«, flüsterte Nick. »Ein unsichtbares Haustier! Du bist echt zu beneiden!«
»Haustier! Sag das bloß niemals, wenn Xemerius dabei ist.« Halb hoffte ich, meine Cousine durch die Schlafzimmertür hindurch schnarchen zu hören, aber natürlich schnarchte Charlotte nicht. Perfekte Menschen machen im Schlaf keine unschönen Geräusche. Frubierend.
Ein halbes Stockwerk tiefer gähnte mein kleiner Bruder und mich überkam sofort ein schlechtes Gewissen. »Hör mal, Nick, es ist halb vier Uhr morgens und du hast nachher Schule. Mum wird mich umbringen, wenn sie rausfindet, dass ich dich vom Schlafen abhalte.«
»Ich bin kein bisschen müde! Und du bist gemein, wenn du ohne mich weitermachst! Was hat Großvater denn versteckt?«
»Ich habe keine Ahnung – vielleicht ein Buch, in dem er mir alles erklärt. Oder wenigstens einen Brief. Grandpa war Großmeister der Wächter. Er wusste ganz genau über mich und diesen Zeitreisekram Bescheid und er wusste auch, dass es nicht Charlotte war, die das Gen geerbt hatte. Weil ich ihn nämlich höchstpersönlich in der Vergangenheit getroffen und es ihm erzählt habe.«
»Du hast es gut«, flüsterte Nick und setzte fast beschämt hinzu: »Ehrlich gesagt kann ich mich kaum noch an ihn erinnern. Ich weiß nur noch, dass er immer gut gelaunt war und kein bisschen streng, das genaue Gegenteil von Lady Arista. Außerdem hat er immer nach Karamell und etwas komischem Würzigen gerochen.«
»Das war sein Pfeifentabak. – Vorsicht!« Ich konnte Nick gerade noch zurückhalten. Wir hatten mittlerweile den zweiten Stock passiert, aber auf dem Weg in den ersten Stock gab es ein paar garstige Stufen, die gewaltig knarzten. Jahrelanges nächtliches In-die-Küche-Schleichen musste schließlich irgendeinen Lerneffekt haben. Wir umgingen die Stellen und gelangten schließlich zu Urururgroßonkel Hughs Gemälde.
»Okay. Dann wollen wir mal!«
Nick leuchtete unserem Vorfahren mit der Taschenlampe ins Gesicht. »Es ist gemein, dass er sein Pferd Fat Annie genannt hat! Das Tier ist gertenschlank, während er selber aussieht wie ein Mastschwein mit Bart!«
»Ja, das finde ich auch.« Ich tastete hinter dem Rahmen nach dem Riegel, der den Mechanismus der Geheimtür in Gang setzte. Wie immer klemmte er ein bisschen.
»Alle schlafen sie wie satte Babys.« Xemerius landete schnaufend neben uns auf den Stufen. »Das heißt alle bis auf Mr Bernhard. Der leidet offensichtlich unter Schlafstörungen. Aber keine Sorge, er wird uns nicht in die Quere kommen: Er hat sich in der Küche mit kalten Geflügelwürstchen eingedeckt und sieht sich einen Film mit Clint Eastwood an.«
»Sehr gut.« Mit dem üblichen Quietschen schwenkte das Bild nach vorn und gab den Eingang zu ein paar Stufen zwischen den Mauern frei, die nach nur anderthalb Metern vor einer weiteren Tür endeten. Diese Tür führte in das Badezimmer im ersten Stock und sie war von der Rückseite durch einen bodentiefen Spiegel getarnt. Früher waren wir zum Spaß oft dort durchgelaufen (der Nervenkitzel lag darin, dass man nie wissen konnte, ob nicht gerade jemand das Badezimmer benutzte), aber wofür dieser Geheimgang wirklich gut war, hatte sich uns noch nicht erschlossen. Vielleicht hatte einem unserer Vorfahren einfach die Vorstellung gefallen, jederzeit vom stillen Örtchen verschwinden zu können.
»Und wo befindet sich die Kiste, Xemerius?«, fragte ich.
»Linksch. Zwischen den Mauern.« Ich konnte es im Halbdunkeln nicht genau erkennen, aber es hörte sich an, als würde er sich etwas zwischen den Zähnen herauspulen.
»Xemerius ist aber ein ziemlicher Zungenbrecher«, sagte Nick. »Ich würde ihn Xemi nennen. Oder Merry. Darf ich die Kiste holen?«
»Sie steht links«, sagte ich.
»Schelber Zschungenbrecher«, sagte Xemerius. »Xschemi oder Merry – dasch hättescht du wohl gern! Ich entschtamme einer langen Ahnenreihe mächtiger Dämonen und unschere Namen…«
»Sag mal, hast du was im Mund?«
Xemerius spuckte und schmatzte. »Jetzt nicht mehr. Hab diese Taube gefressen, die auf dem Dach schlief. Blöde Federn.«
»Du kannst nichts essen!«
»Hat von nichts ’ne Ahnung, aber gibt überall ihren Senf dazu«, sagte Xemerius beleidigt. »Und gönnt mir nicht mal ein Täubchen.«
»Du kannst keine Taube essen«, wiederholte ich. »Du bist ein Geist.«
»Ich bin ein Dämon! Ich kann alles fressen, was ich will! Einmal habe ich sogar einen ganzen Pfarrer gefressen. Mit Soutane und gestärktem Kragen. Warum guckst du so ungläubig?«
»Pass lieber auf, dass niemand kommt.«
»Hey! Glaubst du mir etwa nicht?«
Nick war bereits die Stufen hinabgeklettert und leuchtete mit seiner Taschenlampe die Mauer ab. »Ich sehe nichts.«
»Die Kiste steht ja auch hinter den Steinen. In einem Hohlraum, du Hohlkopf«, sagte Xemerius. »Und ich lüge nicht! Wenn ich sage, dass ich eine Taube gefressen habe, dann habe ich eine Taube gefressen.«
»Sie steht in einem Hohlraum hinter den Steinen«, informierte ich Nick.
»Von denen sieht aber keiner so aus, als wäre er lose.« Mein kleiner Bruder kniete sich auf den Boden und drückte probeweise die Hände dagegen.
»Halloho, ich spreche mit dir!«, sagte Xemerius. »Ignorierst du mich etwa, Heulsuse?« Als ich nicht antwortete, rief er: »Na gut, es war eine Geistertaube! Aber das zählt genauso.«
»Geistertaube – dass ich nicht lache. Selbst wenn es Geistertauben gäbe – und ich habe noch nie eine gesehen –, dann könntest du sie nicht fressen: Geister können einander nicht töten.«
»Die sitzen alle bombenfest, diese Steine«, erklärte Nick.
Xemerius schnaubte ärgerlich. »Erstens: Auch Tauben können hin und wieder beschließen, als Geist auf der Erde zu bleiben, weiß der Himmel, warum. Vielleicht haben sie noch eine Rechnung mit einer Katze offen. Und erklär mir doch bitte zweitens mal, wie du eine Geistertaube von den anderen unterscheiden kannst! Und drittens: Mit ihrem Geisterleben ist es vorbei, wenn ich sie fresse. Denn ich bin kein gewöhnlicher Geist, sondern – ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe – ein Dämon. Mag sein, dass ich in eurer Welt nicht viel ausrichten kann, aber in der Geisterwelt bin ich eine ziemlich große Nummer. Wann wirst du das endlich kapieren?«
Nick stellte sich wieder hin und trat ein paar Mal gegen die Wand. »Nee, da ist nichts zu machen.«
»Schschscht! Hör auf damit, das ist zu laut.« Ich zog meinen Kopf aus dem Gang und sah Xemerius vorwurfsvoll an. »Na toll, du große Nummer. Und nun?«
»Was denn? Ich habe kein Wort von losen Steinen gesagt.«
»Und wie sollen wir da jetzt rankommen?«
Die Antwort »Mit Hammer und Meißel« war durchaus einleuchtend. Nur dass es nicht Xemerius war, der sie gab, sondern Mr Bernhard. Ich erstarrte vor Schreck. Da stand er, nur einen Meter über mir. Im Halbdunkel konnte ich seine goldgefasste Eulenbrille funkeln sehen. Und seine Zähne. Konnte es sein, dass er lächelte?
»Ach, du Scheiße!« Xemerius spuckte vor Aufregung einen Schluck Wasser auf den Treppenläufer. »Der muss die Würstchen ja inhaliert haben. Oder der Film war Mist. Auf Clint Eastwood ist einfach kein Verlass mehr.«
Leider war ich unfähig, etwas anderes herauszubringen als: »Ww-was?«
»Hammer und Meißel wären die richtige Wahl«, wiederholte Mr Bernhard seelenruhig. »Aber ich schlage vor, dass Sie dieses Unternehmen auf später verschieben. Schon um die Nachtruhe der anderen Bewohner nicht zu stören, wenn Sie die Truhe aus ihrem Versteck holen. Ah, da ist ja auch Master Nick.« Er schaute ins Licht von Nicks Taschenlampe, ohne zu blinzeln. »Barfuß! Sie werden sich erkälten.« Er selber trug Pantoffeln und einen eleganten Bademantel mit aufgesticktem Monogramm. W. B. (Walter? Willy? Wigand? Für mich war Mr Bernhard immer ein Mann ohne Vornamen gewesen.)
»Woher wissen Sie denn, dass wir eine Kiste suchen?«, fragte Nick. Sein Tonfall war recht forsch, aber an seinen weit aufgerissenen Augen konnte ich erkennen, dass er genauso erschrocken und verdutzt war wie ich.
Mr Bernhard rückte die Brille gerade. »Nun, vermutlich, weil ich diese – tss – Kiste höchstpersönlich dort eingemauert habe. Es handelt sich um eine Truhe mit kostbaren Intarsienschnitzereien, eine Antiquität aus dem frühen 18. Jahrhundert, die Ihrem Großvater gehört hat.«
»Und was ist drin?«, fragte ich, endlich wieder fähig zu sprechen.
Mr Bernhard sah mich tadelnd an. »Es stand mir selbstverständlich nicht zu, danach zu fragen. Ich habe die Truhe hier lediglich im Auftrag Ihres Großvaters versteckt.«
»Das kann er mir nicht weismachen«, sagte Xemerius mürrisch. »Wo er doch sonst überall seine neugierige Nase hineinsteckt. Und sich anschleicht, wenn er einen vorher mit Geflügelwürstchen in Sicherheit gewiegt hat. Aber das ist allein deine Schuld, ungläubiger Zimmerbrunnen! Wenn du mir nicht unterstellt hättest zu lügen, hätte er uns nicht überraschen können, der senile Bettflüchter.«
»Ich helfe Ihnen selbstverständlich gern, die Truhe dort wieder herauszuholen«, fuhr Mr Bernhard fort. »Bevorzugt aber heute Abend, wenn Ihre Großmutter und Ihre Tante zum Treffen der Rotary-Club-Damen unterwegs sind. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir alle zu Bett gehen, schließlich müssen Sie nachher noch zur Schule.«
»Ja, klar, und in der Zwischenzeit haut er das Ding selber aus der Wand«, sagte Xemerius. »Dann reißt er sich die Diamanten unter den Nagel und legt uns ein paar alte Walnüsse in die Kiste. Kennt man doch.«
»Blödsinn«, murmelte ich. Wenn Mr Bernhard darauf aus gewesen wäre, hätte er es längst tun können, denn außer ihm wusste ja niemand von der Kiste. Was zur Hölle konnte darin sein, dass Grandpa sie im eigenen Haus hatte einmauern lassen?
»Warum wollen Sie uns helfen?«, fragte Nick, wobei er den Fragen, die ich auf der Zunge hatte, auf recht plumpe Art und Weise zuvorkam.
»Weil ich gut mit Hammer und Meißel umgehen kann«, sagte Mr Bernhard. Noch leiser setzte er hinzu: »Und weil Ihr Großvater bedauerlicherweise nicht hier sein kann, um Miss Gwendolyn zur Seite zu stehen.«
Plötzlich war mein Hals wieder wie zugeschnürt und ich musste mit den Tränen kämpfen. »Danke«, murmelte ich.
»Freuen Sie sich nicht zu früh. Der Schlüssel zur Truhe ist… verloren gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringen werde, das wertvolle Stück mit einem Brecheisen zu misshandeln.« Mr Bernhard seufzte.
»Das heißt, Sie werden unserer Mum und Lady Arista nichts davon sagen?«, fragte Nick.
»Nicht, wenn Sie jetzt sofort ins Bett gehen.« Wieder sah ich im Halbdunkeln seine Zähne schimmern, bevor er sich umdrehte und die Treppe wieder hinaufschritt. »Gute Nacht. Versuchen Sie, noch ein bisschen zu schlafen.«
»Gute Nacht, Mr Bernhard«, murmelten Nick und ich.
»Alter Halunke«, sagte Xemerius. »Glaub bloß nicht, dass ich dich aus den Augen lassen werde!«
Der Kreis des Blutes Vollendung findet,Der Stein der Weisen die Ewigkeit bindet.Im Kleid der Jugend wächst neue Kraft,Bringt dem, der den Zauber trägt, unsterbliche Macht.Doch achte, wenn der zwölfte Stern geht auf,Das Schicksal des Irdischen nimmt seinen Lauf.Die Jugend schmilzt, die Eiche ist geweihtDem Untergang in Erdenzeit.Nur wenn der zwölfte Stern erbleicht,Der Adler auf ewig sein Ziel erreicht.Drum wisse, ein Stern verglüht vor Liebe gequält,Wenn sein Niedergang ist frei gewählt.Aus den Geheimschriften des Grafen von Saint Germain
2.
»Also?« Unsere Klassenkameradin Cynthia hatte sich mit in die Seiten gestemmten Ellenbogen vor uns aufgebaut und versperrte den Weg hinauf in den ersten Stock. Die Schüler, die sich rechts und links an uns vorbeischieben mussten, beschwerten sich über den Stau. Cynthia ließ das vollkommen kalt. Sie zwirbelte die hässliche Krawatte, die zur Schuluniform von Saint Lennox gehörte, zwischen ihren Fingern und hatte eine strenge Miene aufgesetzt. »Wie kann man sich eure Kostüme vorstellen?« Ihr Geburtstag stand am Wochenende an und sie hatte uns zu ihrer alljährlichen Kostümparty eingeladen.
Leslie schüttelte genervt den Kopf. »Weißt du, dass du immer verschrobener wirst, Cyn? Ich meine, du warst früher schon seltsam, aber in letzter Zeit wird es wirklich auffällig. Man fragt doch seine Gäste nicht, was sie zur Party anziehen werden!«
»Genau! Nicht, dass du am Ende allein feiern musst.« Ich versuchte, mich seitlich an Cynthia vorbeizuschummeln. Aber ihre Hand fuhr blitzschnell vor und schnappte nach meinem Arm.
»Ich denke mir jedes Mal die interessantesten Mottos aus und dann gibt es diese Spielverderber, die sich nicht daran halten«, sagte sie. »Ich erinnere nur an Karneval der Tiere. An die Leute, die mit einer Feder im Haar aufkreuzten und behaupteten, sie stellten ein Huhn dar! Ja, da kannst du ruhig schuldbewusst gucken, Gwenny. Ich weiß noch genau, wessen Idee das war.«
»Es hat ja nicht jeder eine Mum, deren Hobby es ist, Elefantenmasken aus Pappmaschee zu basteln«, sagte Leslie, während ich nur schlecht gelaunt »wir müssen weiter« murmelte. Ich verkniff mir hinzuzufügen, wie scheißegal mir Cynthias Party im Moment war. Vermutlich sah man mir das ohnehin an.
Der Griff um meinen Arm wurde nur noch fester. »Und wisst ihr noch bei Barbies Beachparty?« Cynthia lief offensichtlich in Erinnerung an diese Party ein Schauer über den Rücken – zu Recht, nebenbei bemerkt – und sie holte tief Luft. »Dieses Mal möchte ich auf Nummer sicher gehen. Es grünt so grün ist ein wunderbares Motto und ich lasse es mir von niemandem kaputtmachen. Damit wir uns richtig verstehen: Grüner Nagellack oder ein grünes Halstuch reichen da nicht aus.«
»Würdest du zur Seite gehen, wenn ich dir ein blaues Auge schlüge?«, knurrte ich. »Bis zur Party ist es bestimmt grün.«
Cynthia tat, als hörte sie mich nicht. »Ich zum Beispiel werde als viktorianisches Blumenmädchen Eliza Doolittle gehen. Sarah hat ein geniales Paprikaschoten-Kostüm – wobei ich noch nicht genau weiß, was sie macht, wenn sie mal aufs Klo muss. Gordon kommt als Gänseblümchenwiese, von Kopf bis Fuß in Kunstrasen.«
»Cyn…« Leider ließ sie sich nicht beiseiteschieben.
»Und Charlotte lässt sich eigens ein Kostüm bei einer Schneiderin anfertigen. Aber ihre Verkleidung ist noch ein Geheimnis. Nicht wahr, Charlotte?«
Meine Cousine Charlotte, eingekeilt zwischen Fünftklässlern, versuchte stehen zu bleiben, wurde aber unbarmherzig von der Schülermeute die Treppe nach oben geschoben. »Na ja, besonders schwer zu erraten ist es eigentlich nicht. Ich sage nur: Tüll in sieben verschiedenen Grüntönen. Und wie es aussieht, erscheine ich in Begleitung von König Oberon.« Den letzten Satz musste sie über ihre Schulter rufen. Dabei schaute sie mich an und lächelte merkwürdig. Das hatte sie schon am Frühstückstisch getan. Ich war kurz davor gewesen, eine Tomate nach ihr zu werfen.
»Brave Charlotte«, sagte Cynthia zufrieden. »Kommt in Grün und in männlicher Begleitung. Das sind mir die liebsten Gäste.«
Charlottes männliche Begleitung war doch nicht etwa… – nein, ausgeschlossen. Gideon würde sich niemals spitze Ohren ankleben. Oder doch? Ich sah Charlotte hinterher, die sich selbst im Gedrängel wie eine Königin bewegte. Sie hatte ihre glänzenden roten Haare in einer Art Retro-Style-Flechtfrisur gebändigt und die Mädchen aus den unteren Klassenstufen starrten sie alle mit dieser Mischung aus Abscheu und Bewunderung an, die nur von echtem Neid hervorgerufen wird. Wahrscheinlich würde es morgen auf dem Schulhof von niedlichen Flechtfrisuren nur so wimmeln.
»Also: Als was und mit wem werdet ihr kommen?«, fragte Cynthia.
»Als Marsmenschen, oh beste Gastgeberin aller Zeiten«, antwortete Leslie mit einem resignierten Seufzer. »Und wen wir mitbringen, ist noch eine Überraschung.«
»Oh. Okay.« Cynthia ließ meinen Arm los. »Marsmenschen. Nicht schön, aber originell. Wehe, ihr überlegt es euch anders.« Ohne sich zu verabschieden, steuerte sie auf das nächste Opfer zu. »Katie! Hallo! Stehen bleiben! Es geht um meine Party!«
»Marsmenschen?«, wiederholte ich, während ich routinemäßig meinen Blick zu der Nische schweifen ließ, in der James, der schuleigene Geist, für gewöhnlich lehnte. Heute Morgen war die Nische leer.
»Irgendwie mussten wir sie ja loswerden«, sagte Leslie. »Party! Tsss, wer kann sich schon mit so was beschäftigen?«
»Höre ich da was von Party? Ich bin dabei.« Gideons Bruder Raphael war hinter uns aufgetaucht und schob sich wie selbstverständlich zwischen uns, wobei er sich bei mir einhakte und Leslie den Arm um die Taille legte. Seine Krawatte war äußerst merkwürdig gebunden. Genau genommen hatte er einfach einen Doppelknoten hineingemacht. »Und ich dachte schon, ihr Engländer haltet nicht so viel vom Feiern. Wenn man allein an diese Sperrstunden in den Pubs denkt.«
Leslie machte sich energisch los. »Leider muss ich dich enttäuschen. Cynthias alljährliche Kostümparty hat mit Partymachen nichts zu tun. Es sei denn, du magst Partys, bei denen die Eltern das Buffet bewachen, damit niemand etwas Alkoholisches in die Getränke oder über den Nachtisch kippt.«
»Na ja, aber dafür spielen sie auch immer gaaaanz lustige Spiele mit uns«, verteidigte ich Cynthias Eltern. »Und meistens sind sie auch die Einzigen, die tanzen.« Ich betrachtete Raphael von der Seite und sah schnell wieder weg, weil sein Profil so sehr dem seines Bruders ähnelte. »Ehrlich gesagt wundert es mich, dass Cyn dich noch nicht eingeladen hat.«
»Doch, hat sie.« Raphael seufzte. »Ich habe gesagt, dass ich leider schon eine Verabredung hätte. Ich hasse Motto-Partys mit Kostümzwang. Aber wenn ich gewusst hätte, dass ihr beiden auch kommt…«
Ich wollte gerade anbieten, seine Krawatte richtig zu binden (die Schulordnung war, was das anging, ziemlich streng), da legte er seinen Arm erneut um Leslies Taille und sagte fröhlich: »Hast du Gwendolyn erzählt, dass wir den Schatz aus eurem Mystery-Spiel lokalisiert haben? Hat sie ihn schon gefunden?«
»Ja«, erwiderte Leslie knapp. Mir fiel auf, dass sie sich dieses Mal nicht losmachte.
»Und wie geht das Spiel jetzt weiter, Mignonne?«
»Eigentlich ist es kein…«, begann ich, aber Leslie fiel mir ins Wort.
»Es tut mir leid, Raphael, aber du kannst nicht mehr mitspielen«, sagte sie kühl.
»Wie bitte? Also, das finde ich nicht gerade fair!«
Ich fand es auch nicht fair. Schließlich spielten wir überhaupt kein Spiel, aus dem wir den armen Raphael ausschließen konnten. »Leslie meint nur, dass…«
Leslie unterbrach mich erneut. »Tja, das Leben ist nun mal nicht fair«, sagte sie, wenn möglich noch kühler. »Bedank dich dafür bei deinem Bruder. Wie du ganz bestimmt weißt, stehen wir in diesem Spiel auf unterschiedlichen Seiten. Und wir können nicht riskieren, dass du irgendwelche Informationen an Gideon weitergibst. Der, nebenbei bemerkt, ein riesengroßes A… kein besonders netter Mensch ist.«
»Leslie!« War sie denn von allen guten Geistern verlassen?
»Pardon? Diese Schatzsuche hat etwas mit meinem Bruder und den Zeitreisen zu tun?« Raphael hatte uns alle beide losgelassen und war wie angewurzelt stehen geblieben. »Und darf ich mal fragen, was er euch getan hat?«
»Jetzt tu bloß nicht so überrascht«, sagte Leslie. »Gideon und du, ihr werdet doch wohl über alles reden.« Sie zwinkerte mir zu. Ich konnte nur perplex zurückstarren.
»Nein, das tun wir nicht!«, rief Raphael. »Wir haben ja kaum Zeit füreinander! Gideon ist ständig in geheimen Missionen unterwegs. Und wenn er mal zu Hause ist, brütet er über geheimen Unterlagen oder er starrt geheime Löcher in die Decke. Oder noch schlimmer: Charlotte kreuzt auf und nervt rum.« Er machte ein so unglückliches Gesicht, dass ich ihn am liebsten in den Arm genommen hätte, vor allem, als er leise hinzufügte: »Ich dachte, wir wären Freunde. Gestern Nachmittag hatte ich den Eindruck, wir würden uns wirklich gut verstehen.«
Leslie – oder sollte ich besser sagen »meine Freundin, der Kühlschrank«? – zuckte lediglich mit den Schultern. »Ja, das war nett gestern. Aber mal ehrlich, wir kennen uns kaum. Da kann man doch nicht gleich von Freundschaft reden.«
»Du hast mich also nur ausgenutzt, um diese Koordinaten zu bestimmen«, sagte Raphael und sah Leslie prüfend an, wahrscheinlich in der Hoffnung, sie würde ihm widersprechen.
»Wie gesagt, das Leben ist nicht immer fair.« Für Leslie war die Angelegenheit damit offensichtlich beendet. Sie zog mich weiter. »Gwen, wir müssen uns beeilen«, sagte sie. »Heute verteilt Mrs Counter die Themen für die Referate. Und ich hab nicht vor, über die Ausdehnung des östlichen Gangesdeltas recherchieren zu müssen.«
Ich sah mich nach Raphael um, der einigermaßen verdattert dreinschaute. Er versuchte, die Hände in die Hosentaschen zu stecken, und musste dabei feststellen, dass die Schuluniform gar keine Hosentaschen besaß.
»Ach, Les, sieh doch nur!«, sagte ich.
».und auch nichts mit unaussprechlichen ethnischen Völkergruppen.«
Ich packte sie am Arm, so wie Cynthia vorher mich gepackt hatte. »Was ist los mit dir, Sonnenscheinchen?«, flüsterte ich. »Warum musstest du Raphael so vor den Kopf stoßen? Ist das ein Teil von einem Plan, den ich noch nicht kenne?«
»Ich bin nur vorsichtig.« Leslie sah an mir vorbei auf das Schwarze Brett. »Oh wie schön! Sie bieten eine neue AG an, Schmuckdesign! Apropos Schmuck!« Sie nestelte an ihrer Bluse und zog ein Kettchen heraus. »Sieh mal: Ich trage den Schlüssel, den du mir von deiner Zeitreise mitgebracht hast, als Anhänger. Ist das nicht cool? Ich sage allen, es handele sich um den Schlüssel zu meinem Herzen.«
Ihr Ablenkungsmanöver zog bei mir nicht. »Leslie, Raphael kann doch nichts dafür, dass sein Bruder ein Mistkerl ist. Und ich glaube ihm, dass er von Gideons Geheimnissen keine Ahnung hat. Er ist neu in England und an der Schule und er kennt niemanden…«
»Er wird bestimmt genügend Leute finden, die sich mit Freuden um ihn kümmern werden.« Leslie starrte weiter hartnäckig an mir vorbei. Auf ihrer Nase tanzten die Sommersprossen. »Du wirst sehen: Morgen hat er mich schon längst vergessen und nennt eine andere Mignonne.«
»Ja, aber…« Erst als ich die verräterische Röte in Leslies Gesicht sah, ging mir ein Licht auf. »Oh, ich verstehe! Dein abweisendes Verhalten hat gar nichts mit Gideon zu tun! Du hast nur Schiss, dich in Raphael zu verlieben!«
»Quatsch. Er ist überhaupt nicht mein Typ!«
Aha. Das sagte alles. Schließlich war ich ihre beste Freundin und kannte Leslie seit Ewigkeiten. Wobei sie mit ihrer Antwort nicht mal Cynthia auf die falsche Fährte gelockt hätte.
»Komm schon, Les. Wem willst du hier etwas vormachen?« Ich musste lachen.
Leslie wandte den Blick endlich von den Ankündigungen und sah mich grinsend an. »Und wennschon! Wir können es uns im Augenblick nicht leisten, beide unter hormoneller Gehirnaufweichung zu leiden. Es reicht doch wohl, dass eine von uns nicht mehr zurechnungsfähig ist.«
»Vielen Dank.«
»Ist doch wahr! Weil du nur mit Gideon beschäftigt bist, realisierst du einfach nicht den Ernst der Lage. Du brauchst jemanden, der klar denken kann, und das bin ich. Ich werde mich nicht von diesem Franzosen einwickeln lassen, so viel steht fest.«
»Ach, Les!« Ich fiel ihr spontan um den Hals. Niemand, niemand, niemand auf der Welt hatte so eine wunderbare, verrückte, kluge Freundin wie ich. »Wie schrecklich wäre das, wenn du meinetwegen darauf verzichten müsstest, glücklich verliebt zu sein.«
»Jetzt übertreib doch nicht gleich wieder so.« Leslie prustete mir ins Ohr. »Wenn der Typ nur halbwegs nach seinem Bruder kommt, hätte er mir spätestens nach einer Woche das Herz gebrochen.«
»Na und?«, sagte ich und gab ihr einen Klaps. »Das ist doch aus Marzipan und kann immer wieder neu geformt werden!«
»Mach dich nicht lustig darüber. Die Marzipanherzen sind eine Metapher, auf die ich wirklich stolz bin.«
»Na klar. Eines Tages wirst du in Kalendern auf der ganzen Welt zitiert werden«, sagte ich. »Herzen können gar nicht brechen, weil sie nämlich aus Marzipan sind. Metapher der weisen Leslie Hay.«
»Leider falsch«, sagte eine Stimme neben uns. Sie gehörte unserem Englischlehrer, Mr Whitman, der auch an diesem Morgen für einen Lehrer viel zu gut aussah.
»Was verstehen Sie schon von der Konsistenz weiblicher Herzen?«, hätte ich gern gefragt, aber Mr Whitman gegenüber hielt man sich besser zurück. Genau wie Mrs Counter verteilte er gern Extra-Hausarbeiten zu exotischen Themen und so lässig er aussah, so unerbittlich konnte er auch sein.
»Was bitte schön ist falsch?«, fragte Leslie, jede Vorsicht in den Wind blasend.