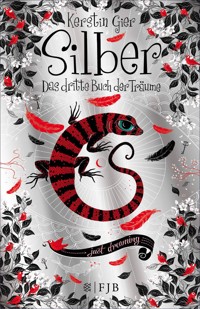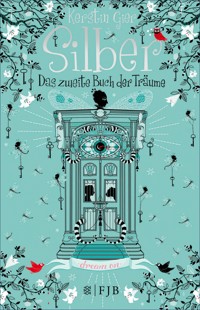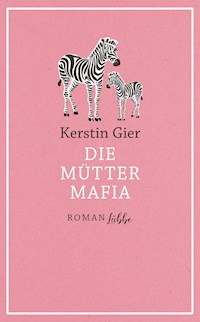9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carolin ist sechsundzwanzig - und ihre große Liebe gerade gestorben. Wirklich gestorben, nicht nur im übertragenen Sinne tot. In ihrer Trauer muss sie sich nun mit ihrem spießigen Exfreund um ein nicht gerade kleines Erbe streiten. Kein Wunder also, dass Caro sich das erste Mal in ihrem Leben betrinkt, zu einer Therapeutin geht und ein kleines Vermögen für Schuhe ausgibt. Und sich von Idioten umzingelt fühlt. Zum Glück ist Carolin in ihren schwärzesten Stunden nicht allein, und ihre besorgte Familie und ein ausgestopfter Foxterrier mit Namen "Nummer zweihundertdreiundvierzig" helfen ihr bei einem Neuanfang ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Danksagung
Über die Autorin
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von Bergisch Gladbach. Sie schreibt mit großem Erfolg Romane. Ihr Erstling MÄNNER UND ANDERE KATASTROPHEN wurde mit Heike Makatsch in der Hauptrolle verfilmt. EIN UNMORALISCHES SONDERANGEBOT wurde 2005 mit der „DeLiA“ für den besten deutschsprachigen Liebesroman ausgezeichnet. FÜR JEDE LÖSUNG EIN PROBLEM wurde ein Bestseller und mit enthusiastischen Kritiken bedacht.
www.kerstingier.com
KERSTIN GIER
In Wahrheit wird viel mehr gelogen
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch bei Lübbe Audio lieferbar.
Originalausgabe
Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelgestaltung: FAVORITBUERO, München unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Irtsya | Mr. Luck; Favoritbuero
Innenillustrationen: Frauke Ditting
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0118-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
Albert Einstein
Dieses Buch ist für Frank, weil er immer dafür sorgt, dass das Leben weitergeht, während ich wieder mal in der Warteschleife hänge.
Du bist wirklich unbezahlbar.
»Haltet euch fern von den Idioten«
Lebensmotto von Lemmy Kilmister,Sänger von Motörhead
»Sind Sie hingefallen?«
Aber nein. Ich liege hier einfach nur so auf dem Bürgersteig rum und schaue mir die Sterne an.
»Haben Sie sich verletzt?« Es war ein junger Mann, der sich über mich beugte. Im Licht der Straßenlaterne sah er ganz gut aus. Und er guckte besorgt und freundlich.
Schade, dass er ein Idiot ist.
Gar nicht so einfach, sich von den Idioten fernzuhalten. Es wimmelte ja nur so von ihnen. Selbst in dieser gottverlassenen Vorstadtsiedlung nachts um halb zwölf.
Von diesen Doofen-Fragen-Stellern hatte ich heute schon einige getroffen. Der erste kam vorbei, als ich die Hecke meiner Schwester schnitt. Er schaute mir eine Weile dabei zu und fragte dann: »Na? Schneiden Sie die Hecke? Jetzt im November?«
Es war dieser schreckliche Nachbar, der meine Schwester und ihren Mann ständig verklagt. Herr Krapfenkopf. Den Namen hatte ich mir gemerkt, weil Mimi und Ronnie ziemlich oft über ihn und Frau Krapfenkopf redeten.
Ich ließ die Heckenschere weiterrattern. »Ich schneide doch nicht die Hecke, Herr Krapfenkopf, ich dirigiere die Berliner Philharmoniker.«
»Wie haben Sie mich genannt?« Das Gesicht des Nachbarn lief rot an. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass »Herr Krapfenkopf« nicht sein richtiger Name sein könnte. Obwohl er ausgezeichnet zu ihm passte. »Das wird ein Nachspiel haben!«, zischte er und stiefelte davon.
Später, im Supermarkt, traf ich Mimis Freundin Constanze. Sie mochte ja nett sein, aber sie gehörte leider auch zu der Sorte Menschen, die einen mit unintelligenten Fragen nerven.
»Ach, hallo, Carolin!«, sagte sie freundlich. »Was machst du denn hier?«
Mal überlegen: Ich gehe gerade durch einen Supermarkt und schiebe einen Einkaufswagen vor mir her. Was mache ich also hier?
»Man hat mich gerufen, um eine Bombe in der Käsetheke zu entschärfen«, sagte ich. »Und was machst du hier?«
»Ach, ich mache nur schnell den Wochenendeinkauf.«
»Tatsächlich? Ist ja ’n Ding.«
Constanze lächelte nachsichtig und warf einen Blick in meinen Einkaufswagen. Sellerie, Pastinaken, Lauch, Crème fraîche und Hähnchenbrust. Für die Suppe, die Ronnie heute Abend kochen wollte. Außerdem vier Flaschen Rotwein und Tampons. Ich wartete darauf, dass Constanze fragte: »Kaufst du Sellerie, Pastinaken, Lauch, Crème fraîche, Hähnchenbrust, Rotwein und Tampons?«, aber das tat sie nicht. Sie zeigte auch nicht auf die Tampons und sagte: »Ah, deshalb die schlechte Laune!« Sie richtete lediglich schöne Grüße an Mimi aus und wünschte mir einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls.
Wir hatten wirklich einen schönen Abend. Gleich nach dem Einkaufen fing ich nämlich mit dem Rotweintrinken an. Bis zum Abendessen hatte ich die erste Flasche geleert. Das heißt, ein Glas trank Ronnie, während er die Suppe kochte. Die zweite Flasche musste ich mit Mimi und Ronnie teilen. Die dritte trank ich ganz allein, als Mimi und Ronnie zu Bett gegangen waren. Ich machte das Licht aus, lehnte mich auf die Fensterbank und schaute beim Trinken hinaus in den Garten. Der Vollmond hing leuchtend hell und gelb über den kahlen Ästen des Apfelbaums. Er sah aus wie ein Zitronenbonbon, das jemand an den Himmel geklebt hatte. Ich versuchte mit der Zungenspitze zu testen, ob er wirklich nach Zitrone schmeckte. Und an dieser Stelle begriff ich, dass ich tatsächlich sehr, sehr betrunken war. Da es das erste Mal in meinem Leben war, dachte ich ernsthaft, frische Luft würde mir helfen, wieder nüchtern zu werden. Weit kam ich nicht. Ich schwankte den Gartenweg hinunter, öffnete das Tor – und plumpste auf den Bürgersteig, weil ich vergessen hatte, dass es hier eine kleine Stufe gab.
Ja, und hier lag ich nun.
Ich kam nicht allein wieder hoch. Nicht etwa, weil ich mir etwas gebrochen hätte. Mir tat auch nichts weh. Ich fühlte mich einfach nur wie ein Stück nasse Seife. Aber seltsamerweise war es lustig, jedenfalls musste ich die ganze Zeit vor mich hinkichern.
Und jetzt war ja auch dieser nette Idiot vorbeigekommen, um mir zu helfen.
»Hörst du mich überhaupt?« Er war schon zum Du übergegangen, obwohl ich noch keinen Ton gesagt hatte. »Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
O Gott. Das fehlte noch. Unter normalen Umständen würde die Sache anfangen, mir peinlich zu werden. »Natürlich höre ich Sie. Ich bin nur betrunken, nicht taub. Ziemlich betrunken. Ich meine, ich habe versucht, am Mond zu lecken. Sieht er nicht aus wie ein Zitronenbonbon?«
Der Mann sah mich eine Weile unschlüssig an. »Ich helfe dir hoch, wenn du versprichst, mir nicht auf die Schuhe zu kotzen.«
»Das ist nur fair«, sagte ich und lachte. Es klang ein bisschen eingerostet, aber es war eindeutig ein Lachen. Ein Hoch auf den Rotwein!
Noch vor ein paar Wochen habe ich gar nicht gewusst, was für eine wunderbare Wirkung Wein auf die Stimmung hat. Ich hatte nie mehr als ein Glas getrunken, und auch das nur, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich den Geschmack von Wein nicht besonders schätzte, egal wie teuer und besonders er auch sein mochte. Duft von reifen Pflaumen, Fruchtaromen, gut eingebundene Tannine, mineralisch im Abgang, blablabla. Mittlerweile war ich davon überzeugt, dass es den kultivierten Weintrinkern in der Mehrzahl gar nicht um den Geschmack ging, sondern auch nur um die Wirkung. Dieses ganze Drumherum war doch nur ein Alibi, um sich kultiviert den Kopf zuzuknallen.
Aber es hatte was.
Und wenn einer Grund hatte, sich den Kopf zuzuknallen, dann ich. Ich war sechsundzwanzig Jahre alt und vor vier Wochen Witwe geworden. Und vor drei Wochen hatte mich der Bruder meines Mannes auf die Herausgabe einer »großen Girandole in vergoldeter Bronze«, einer »vergoldeten Schnupftabaksdose mit Schildplattdeckeleinsatz und figürlich graviertem Perlmuttdekor« und eines 6-Parteien-Mietshauses in Düsseldorf-Carlstadt verklagt.
Unter anderem.
Wenn das kein Grund für ein gepflegtes Besäufnis war, dann wusste ich es aber auch nicht.
Scheiß Gleichgewicht.
»Hätten Sie gewusst, was eine Girandole ist?«
Der nette Idiot antwortete nicht. Er zog mich hoch und stellte mich auf die Beine. In meinem Kopf musste sich alles neu sortieren. Es fühlte sich nicht so an, als würde es gelingen. Ich hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Und in meinem Magen rumorte es, als hätte ich ein Alien verschluckt.
»Weißt du eigentlich, wie viele Gehirnzellen bei so einem Besäufnis absterben?«
»Ich hab genug davon«, sagte ich.
Der Mann sah mich streng an. »Zwei-, dreimal, und du hast dich um den Schulabschluss gesoffen.«
Ich musste wieder lachen. »Ich bin hier nich’ die Dumme. Ich weiß, was eine Girandole is! ’n scheiß Kerzenständer is’ das.« Eine Haarsträhne fiel mir ins Gesicht, und ich strich sie hinter mein Ohr. »Man lernt überhaupt viel, dieser Tage. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass es zu einer Urne auch noch eine Überurne gibt? Ich kann Ihnen eine zeigen, ich habe eine besonders schöne in meinem Zimmer stehen.«
»Wohnst du weit von hier?«
Ah, der junge Mann schien Interesse an einer Besichtigung zu haben. »Na ja, Sie sollten aber nicht zu viel erwarten. Sieht ein bisschen aus wie die Suppenterrine, die meine Eltern von meiner Großtante Elfriede geerbt haben. Ich frage mich, ob es extra Überurnendesigner gibt, oder ob das dieselben Leute sind, die Suppenterrinen entwerfen.«
Der Mann schaute mich nur an. Ich konnte seinen Blick schwer deuten, aber ein bisschen angeekelt sah er schon aus. Ich grinste ihn breit an.
»Sie verstehen mich gar nicht, was? Ich nuschele viel zu sehr, ich weiß, kann mich selber kaum verstehen, macht aber nichts, ist irgendwie lustig, fast so, als ob ich polnisch reden würde, was? Das kann ich nämlich auch. Cholera, ale mi się chce rzygać.«
»Wo wohnst du?«
»Das war nicht die Adresse. Das war Polnisch und heißt: ›Scheiße, mir ist schlecht.‹ Interessiert Sie nicht, was?« Ich zeigte auf Mimis Haustür. »Is’ nich’ weit, aber im Augenblick kommt es mir so vor.«
Das musste man dem Mann lassen: Er war sehr ritterlich. Er packte mit einer Hand meinen Arm, legte die andere um meine Taille und führte mich den Gartenweg hinauf. Ich konzentrierte mich auf meine Füße und sah dabei, dass ich noch meine Pantoffeln anhatte.
»Schlüssel?«
Oh. Mist. Den hatte ich drinnen vergessen. Genau wie meinen Mantel.
»Ich könnte auf der Terrasse schlafen, dann muss ich niemanden wecken«, sagte ich, aber da hatte der Typ schon geklingelt. Zwei Mal.
»Deine Eltern sollen ruhig sehen, dass du betrunken bist«, sagte er. »Dir hätte ja weiß der Himmel was passieren können. Da können die sich ruhig mal ein paar Gedanken drüber machen.«
»Tsssshhh«, machte ich. »Für wie alt halten Sie mich? Für siebzehn?«
»Höchstens«, sagte der Idiot. »Eigentlich sollte man mit siebzehn schon wissen, wie schädlich Alkohol ist.«
Mein Schwager öffnete die Tür. Bei meinem Anblick riss er entsetzt seine Augen auf. Dabei war er es und nicht ich, der nur eine Pyjamahose trug und einen ziemlich haarigen Bauch hatte. Mir entfuhr ein leises »Cholera!«
Hinter ihm kam Mimi, sich den Bademantelgürtel zuknotend, die Treppe hinunter. »Was ist passiert?«
»Nichts! Wir wollten nur eine kleine nächtliche Urnenbesichtigung machen«, sagte ich, aber ich hörte genau, dass es klang wie »Nschwisichtchn«.
Der Mann hielt mich immer noch fest. »Ich möchte mal wissen, wieso man es ihr so leicht macht, an Alkohol zu kommen«, sagte er vorwurfsvoll zu Ronnie. »Was nutzt das Jugendschutzgesetz in den Läden, wenn die Kinder zu Hause freien Zugang zu Papas Weinkeller haben?«
»Wir hatten nur einen Bordeaux zum Abendessen«, murmelte Ronnie. »Einen Achtundneunziger Chateau Ni… – ähm, sagten Sie Jugendschutzgesetz?«
Ich kicherte, hörte aber wieder auf, als ich Mimis blasses Gesicht sah. Auch die anderen guckten ziemlich ernst. Ich war ganz offensichtlich die Einzige, die hier irgendwas komisch fand.
»Sie können sie loslassen. Wir kümmern uns um sie«, sagte Mimi. Ihre Stimme zitterte ein wenig.
»Ich glaube nicht, dass sie alleine stehen kann.« Der Griff um meinen Arm lockerte sich erst, als Ronnie mich mit beiden Händen gepackt hatte. »Sie lag auf dem Bürgersteig! Wer weiß, wie lange schon.«
»Wie gut, dass Sie vorbeikamen.« Mimi biss sich auf die Unterlippe. »Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Ich möchte gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können.« O Gott – hatte sie etwa Tränen in den Augen?
Jegliche durch Alkohol herbeigeführte Erheiterung verflüchtigte sich. Stattdessen meldete sich mein schlechtes Gewissen. Sogar die Katze, die aus dem Wohnzimmer kam, um zu sehen, was los war, machte ein schockiertes Gesicht.
»A, urna! Dziś zamknięte dla zwiedzających!«, murmelte ich peinlich berührt. Offenbar war ich noch nicht betrunken genug.
»Ich sag ja, man kann sie kaum verstehen.«
»Weil das polnisch ist, Sie Idiot.« Mir ist plötzlich furchtbar übel. Gut möglich, dass ich mich übergeben muss. Oder sterben. (Daher der dramatische Präsens.)
In meinen Ohren fängt es an zu rauschen. Wahrscheinlich sterben jetzt alle Gehirnzellen ab, die ich für einen Schulabschluss brauchen könnte. Gut, dass ich schon einen habe. Außerdem ist es sowieso egal, wenn ich jetzt sterbe.
»Halt sie bloß fest, Ronnie!«
Ich höre ihre Stimmen nur ganz undeutlich. Mir geht es gar nicht gut. Es ist auch nicht mehr lustig, jetzt. Kalter Schweiß bricht aus allen Poren. Das Rauschen in den Ohren wird lauter. Und dann höre ich gar nichts mehr.
Ich glaube, ich bin gestorben. Oder eingeschlafen.
»Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heit’ren Stunden nur.«
Poesiealbumsspruch. Keine Ahnung von wem. Verklagen Sie mich doch!
Demnach vergangene Zeit seit dem 21. Oktober: 0,2 heitere Stunden. Positiv: Wenn das so weitergeht, bleibe ich auf ewig jung.
Ich will mein persönliches Drama wirklich nicht schönreden, aber bei allem Unglück hatte es durchaus auch Vorteile. Erstens musste man sich um überhaupt nichts kümmern, und zweitens durfte man sich in jeder Beziehung hängen lassen. Oder sagen wir so: Man kann sich eine Menge herausnehmen, wenn einem gerade der Ehemann gestorben ist. Plötzlich und unerwartet, wie es immer so schön heißt. Als trauernde Witwe kann man abwechselnd ekelhaft und gemein sein oder den ganzen Tag apathisch vor sich hinglotzen, man darf vergessen, sich die Haare zu waschen, und braucht sich nicht zu kämmen und zu schminken. Man darf mitten in den »Tagesthemen« einen Schuh auf Tom Buhrow schleudern (also, auf den Fernseher), und man darf sich um elf Uhr vormittags ins Bett legen, ohne mit irgendwelchen Vorwürfen rechnen zu müssen. Wenn man plötzlich auf die Idee kommt, die Hecke zu schneiden, wird einem sofort ganz begeistert die elektrische Heckenschere in die Hand gedrückt, und wenn man dabei eine Magnolie verstümmelt, die gar nicht zur Hecke gehört, schimpft niemand mit einem. Man kann egoistisch, mäkelig, ungerecht, ja, einfach nur widerwärtig sein – und alle haben Verständnis dafür. Auch wenn man sich so betrinkt, dass man im Stehen einschläft und gar nicht mehr merkt, dass man den Parkettboden vollko… – äh, mit Erbrochenem ruiniert. Meine Schwester und mein Schwager umsorgten mich in den Tagen danach nur umso liebevoller. Und auch meinen Eltern, die zweimal täglich anriefen, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen, kam kein einziges vorwurfsvolles Wort über die Lippen. Sie sagten mir nur immer, wie lieb sie mich hätten und dass ich sehr tapfer sei. Ja, meine Mutter verstieg sich sogar zu so theatralischen Sätzen wie: »Mein Schatz, ich weiß, das sind die schwärzesten Stunden deines Lebens, aber du wirst das alles überwinden, und glaub mir, auch für dich wird irgendwann wieder die Sonne scheinen.« Und das von meiner Mutter: Wenn jemand in einem Fernsehfilm so etwas sagte, dann verdrehte sie nur die Augen und schaltete um.
Der Einzige, der sich offenbar nicht von meinem persönlichen Unglück einschüchtern ließ, war Herr Krapfenkopf. Das konnte aber auch daran liegen, dass er gar nichts davon wusste. Von seinem Anwalt kam ein Brief an Ronnie und Mimi, in dem stand, dass »die Person, die zurzeit illegal bei Ihnen wohnt und arbeitet« ihn als Karpfenkopf beschimpft und mit einer Kettensäge bedroht habe, und dass Herr Krapfenkopf sich daher vorbehalte, Anklage wegen Beleidigung, beabsichtigter Körperverletzung und Schwarzarbeit sowohl gegen mich als auch gegen Ronnie und Mimi einzureichen.
Mimi und Ronnie wollten mir den Brief erst gar nicht zeigen, um mich nicht unnötig aufzuregen, aber ich regte mich nur darüber auf, dass Herr Krapfenkopf anstelle von Krapfenkopf Karpfenkopf verstanden hatte. Was für ein Idiot. Mimi reichte das Schreiben an den Anwalt weiter, den sie für mich organisiert hatten. Nicht wegen Herrn Krapfenkopf, sondern wegen der Briefe, die ich in Sachen Mietshäusern, Schnupftabaksdosen und Girandolen vom Anwalt des Bruder meines Mannes bekommen hatte.
Wie gesagt, als trauernde Witwe darf man sich so ziemlich alles erlauben. Dennoch zwangen Mimi und Ronnie mich nach der Sache mit dem Wein und dem kleinen Intermezzo auf dem Bürgersteig, eine Therapeutin aufzusuchen. Angeblich war sie großartig und hatte Ronnie »in seiner schlimmen Krise« sehr geholfen.
»Ich wusste gar nicht, dass du mal eine schlimme Krise hattest«, sagte ich. Genauso wenig, wie ich einen derart behaarten Bauch bei ihm vermutet hätte.
»Doch. Nach unserer Fehlgeburt«, sagte Ronnie. »Frau Karthaus-Kürten ist wirklich sehr hilfreich gewesen.«
Unsere Fehlgeburt. Das war typisch Ronnie. Er hatte auch immer »Wir sind schwanger« gesagt. Er war ohne Zweifel von allen Idioten, von denen ich umgeben war, der liebenswerteste und weichherzigste. Ich wusste auch, dass er es nur gut mit mir meinte.
Aber trotzdem.
»Ich will da nicht hin. Ich halte nichts von Therapeuten und Leuten mit doofen Doppelnamen und überflüssigem Gelabere über mein inneres Kind und meine zu früh beendete anale Phase. Ich bin auch nicht depressiv, ich bin nur traurig. Ich habe meinen Mann verloren!«
Ronnie hatte sofort Tränen in den Augen, als ich das sagte, und er streichelte meine Hand. »Es wird dir aber guttun, wenn dir jemand Wege aus der Trauer zeigt. Zurück ins Leben. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.«
»Ich glaube, ich muss mich wieder übergeben«, sagte ich.
Ronnie ließ meine Hand los, griff sich die Obstschale vom Couchtisch und hielt sie mir erwartungsvoll unter die Nase, während Äpfel und Bananen auf den Boden plumpsten. Mimi verdrehte die Augen.
»Ich meinte das mehr im metaphorischen Sinne«, sagte ich. »Diese Art Gespräch verursacht einfach Übelkeit bei mir.«
Mimi hob das Obst auf. »Es wird dir guttun, mit jemandem zu reden, der nicht nur deine Trauer versteht, sondern auch deine Wut.«
»Ich bin nicht wütend«, log ich. Ich hatte nur überdurchschnittlich oft das Bedürfnis, jemanden grundlos zu ohrfeigen oder mit Gegenständen um mich zu werfen. Ein schwer zu unterdrückendes Bedürfnis, leider.
»Der Mann, mit dem du verheiratet warst, hat zu seinen Lebzeiten leider vergessen, dir mitzuteilen, dass er nicht nur über sein mageres Dozentengehalt verfügt, sondern auch über nicht unerhebliche Einkünfte durch Mietshäuser und diverse Vermögensanlagen.« Mimis dunkle Augen funkelten. »Und das macht dich nicht wütend?«
Ach so, das meinte sie. Nein, dann war ich wirklich nicht wütend. Ich zuckte mit den Achseln. »Geld ist mir immer schon total egal gewesen. Und Karl eben auch.«
»Das ist das, was du denkst!«
»Ja.«
»Aber da liegst du falsch. Weißt du noch, letztes Jahr Weihnachten? Du wolltest gern nach Deutschland kommen, aber Karl hat gesagt, ihr könnt euch den Flug im Moment nicht leisten. Papa hat euch dann die Flugtickets bezahlt.« Mimi schnaubte. »Und die ganze Zeit über saß dieser Kerl auf einem dicken Vermögen und hat keinem was davon gesagt. Wenn ich nur an die Bruchbude denke, in der ihr in Madrid gehaust habt. Und diese winzige Wohnung in London mit der kaputten Heizung! Bohémien! Dass ich nicht lache. Der war kein Bohémien, der war einfach nur ein Geizkragen.«
»Mimi!«, flüsterte Ronnie, aber wenn meine Schwester einmal loswetterte, konnte man sie so schnell nicht bremsen.
»Er hat dir auch nicht verraten, dass er mit seinem Bruder über ein nicht unbeträchtliches Erbe im Clinch liegt«, fuhr sie unbeirrt fort. »Warum auch? Am Ende hättest du ja denken können, er hätte genug Geld, um dir mal einen neuen Wintermantel zu kaufen.«
»Ich hatte alles, was ich brauchte.«
»Ja, wie überaus praktisch für Karl, dass er für deine bescheidenen Bedürfnisse nicht an sein Vermögen musste. Und Papas Geld hat er auch ohne Wimpernzucken angenommen.«
»Vielleicht solltest du diese Therapeutin aufsuchen«, schlug ich vor. »Du bist offenbar diejenige, die wütend auf Karl ist.«
»Ja«, gab Mimi zu. »Und wie! Aber ich war nicht mit ihm verheiratet. Und mir gegenüber hat er sich ja auch nicht verhalten wie Ebenizer Scrooge.«
Ronnie hatte unseren Wortwechsel mit wachsender Unruhe verfolgt, aber seine vielsagenden Blicke und sein Geflüster hatte Mimi einfach ignoriert. »Mimi, ich weiß nicht, ob das der richtige Moment ist, über Karls äh mögliche äh Schwächen zu sprechen«, sagte er jetzt lauter. »Es geht doch nur darum, dass Carolin sich Hilfe sucht. Und eine Gesprächstherapie ist immerhin ein Anfang.«
Mimi schnaubte noch einmal, sagte aber nichts mehr.
»Bitte, Carolin«, sagte Ronnie. »Wenigstens einen Versuch kannst du ja machen.«
Ich beschloss, die Taktik zu wechseln und sagte: »Ich würde ja da hingehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles so schwierig wegen der Krankenversicherung und dem Wohnsitz und überhaupt – so ohne Überweisung …«
Da breitete sich auf Ronnies und Mimis Gesichtern ein Lächeln aus, und ich wusste, dass ich verloren hatte. Eigentlich hätte ich es mir aber auch denken können. Während ich meine Tage mit misanthropischen Gedanken (»alles Idioten!«), dem sinnlosen Wühlen in Umzugskartons (auf der Suche nach vergoldeten Schnupftabaksdosen) und dem Testen der Wirkung von Wein (gar nicht so übel – jedenfalls, wenn man weiß, wann man aufhören muss) gefristet hatte, war meine Schwester rührig gewesen und hatte sich meiner komplizierten Krankenversicherungslage angenommen. Und während ich meinen allerersten richtigen Rausch ausschlief, hatte Ronnie für mich eine Überweisung von seinem Hausarzt besorgt und einen Termin bei der Therapeutin gemacht. Der gleiche Hausarzt übrigens, der mir, ohne mich jemals persönlich kennen zu lernen, ein Rezept für Beruhigungsmittel und angeblich stimmungsaufhellende Pillen ausgestellt hatte. Das Rezept hatte ich noch nicht eingelöst. Egal, was ich auch schlucken würde – Karl wurde dadurch nicht wieder lebendig. Außerdem hatte ich zuerst die stimmungsaufhellende Wirkung von Wein ausprobieren wollen.
Nun ja. Der Selbstversuch hatte zugegebenermaßen ein wenig unglücklich geendet. Besoffen auf dem Bürgersteig herumzuliegen war ein Tiefpunkt, den ich so nicht eingeplant hatte. Ich sah daher ein, dass ich auf Außenstehende wie jemand wirken musste, der eine Therapie benötigt. Aber ich wollte trotzdem keine. Schon gar nicht bei einer Person, die Kerstin K. Karthaus-Kürten hieß.
»Ich hasse sie jetzt schon«, sagte ich zu Mimi, als ich die vielen Ks auf dem Edelstahlschild an der Praxistür eingraviert sah.
»Das macht nichts«, sagte Mimi nur und schob mich hinein. Nur um sicherzugehen, dass ich nicht auf den allerletzten Metern noch einmal umschwenkte, hatte sie mich bis vor die Tür gebracht. »Ich bin im Laden, wenn du mich brauchst. Und lass dein Handy eingeschaltet.«
Frau Karthaus-Kürten bot mir nicht an, mich auf die Couch zu legen. Wir saßen uns vielmehr an ihrem Schreibtisch gegenüber, wie bei einem Bewerbungsgespräch. Auf dem Schreibtisch standen gerahmte Bilder von einem Mann, einem kleinen Jungen, einem zotteligen Hund und von ihr selbst. Ich musste mich ein bisschen verrenken, um die Bilder zu betrachten, denn sie standen mit der Rückseite zu mir.
»Niedlich«, sagte ich, obwohl der kleine Junge einen Erbsenkopf und Schweinsäugelchen hatte.
Frau Karthaus-Kürten strich sich durch ihre Haare und lächelte stolz. »Das ist mein Sohn Keanu.«
Herr im Himmel. Ein Keanu mit hellblondem Pottschnitt. Keanu Karthaus-Kürten. Was sollte denn aus diesem armen Jungen einmal werden?
Frau Karthaus-Kürten betrachtete noch ein Weilchen versonnen das Bild, dann sagte sie: »Ihr Schwager sagte mir, dass Ihr Mann überraschend an einem Herzinfarkt verstorben ist. Das ist ein schwerer Schicksalsschlag für Sie. In der Psychotherapie sprechen wir von Traumatisierung. Es ist ganz richtig, dass Sie sich Hilfe gesucht haben.«
Ja, das glaube ich Ihnen gern.
»Sicher weinen Sie viel.«
Ich nickte. Ja, ich weinte viel. Aber vor Frau Karthaus-Kürten würde ich nicht eine einzige Träne vergießen, das stand mal fest. Obwohl sie recht einladend eine Box mit Taschentüchern in meiner Reichweite platziert hatte.
»Darf ich fragen, wie alt Ihr Mann war?«
»Er ist im Oktober dreiundfünfzig geworden. Eine Woche vor seinem Tod.«
»Dreiundfünfzig?« Kerstin K. Karthaus-Kürten zog die Augenbrauen hoch. Durfte sie das überhaupt? Als Therapeut sollte man doch als Erstes lernen, seine Mimik zu kontrollieren. »Und Sie sind …?«
»Ich werde im April siebenundzwanzig.« Aber ich wette, das steht auch in meiner Karteikarte, du doofe Kuh.
»Das macht dann einen Altersunterschied von …« Sie schob die Zunge zwischen die Zähne und strich sich wieder durch die tadellos sitzende Frisur.
»Einen Altersunterschied von sechsundzwanzigeinhalb Jahren«, sagte ich nach ein paar Sekunden. Himmel, die Frau konnte nicht mal simple Rechenaufgaben lösen. Unwahrscheinlich, dass sie unter diesen Umständen mein kompliziertes Seelenleben begreifen würde.
»Und Sie waren wie viele Jahre zusammen?«
»Fünf. Vier davon verheiratet.«
»Hmhm.« Sie machte sich mit Bleistift einige Notizen. Dann sagte sie: »Möchten Sie über Ihren Vater sprechen?«
Natürlich. Das war ja zu erwarten gewesen. Junge Frau, älterer Mann – dazu fällt den Leuten sofort das Wort »Vaterkomplex« ein. Allenfalls noch »Aufenthaltsgenehmigung«.
Nichts gegen Vorurteile. Ich hatte selber massenhaft davon. Zum Beispiel gegenüber Psychotherapeutinnen, die sich in der Minute viermal das Haar nach hinten strichen. Oder gegenüber Leuten, die ihre Kinder Keanu nannten und / oder ihnen achtsilbrige Doppelnamen gaben. Außerdem gegenüber Züchtern von Kampfhunden und Leuten, die ihren Wagen zweimal in der Woche wuschen. Aber man sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass man mit seinen Vorurteilen meilenweit neben der Wahrheit liegen kann. Vor allem, wenn man sich Therapeut nennt.
Ich habe keinen Vaterkomplex, und ich hatte auch nie einen.
Ich habe aus Liebe geheiratet.
Frau Karthaus-Kürten seufzte, wohl, weil ich nichts sagte. Therapeuten dürfen doch nicht seufzen! Was würde sie als Nächstes tun – die Augen verdrehen? Sie war ganz sicher eine Anfängerin. Oder einfach nur schlecht. Deshalb hatten Mimi und Ronnie auch so kurzfristig einen Termin bei ihr bekommen können. »Vielleicht überlegen wir noch einmal gemeinsam, warum Sie hier sind, Frau Schütz.«
»Also sicher nicht wegen meines Vaters«, sagte ich und hatte plötzlich das Bedürfnis, ihn zu verteidigen. »Ich denke, ich spreche im Namen all meiner Geschwister, wenn ich sage, dass er nicht die Sorte Vater ist, wegen der man Komplexe bekommt. Er ist ein lieber, freundlicher, ein bisschen verschusselter Ministerialrat im Ruhestand, und überhaupt bin ich dafür, dass wir meine Kindheit überspringen, denn die gibt, was meine derzeitige Situation betrifft, gar nichts her. So psychotherapeutisch gesehen, meine ich.«
Frau Karthaus-Kürten spielte mit ihrem Bleistift. »Vielleicht möchten Sie mir erzählen, warum Sie sich in Ihren Mann verliebt haben?« Ich merkte genau, wie sie dabei versuchte, nicht neugierig zu klingen, sondern ganz professionell distanziert.
Das geht dich gar nichts an. Aber ich konnte schlecht die ganze Zeit hier sitzen, schweigen wie ein bockiges Kind und darüber nachdenken, wie Frau Karthaus-Kürtens zweiter Vorname wohl lauten mochte. (Kriemhild? Kunigunde? Es musste ja etwas noch Fürchterlicheres sein als Kerstin, sonst hätte sie es nicht nötig, es abzukürzen.) Hinter ihr an der Wand hing eine Uhr, und der Minutenzeiger hatte sich bis jetzt kaum vorwärtsbewegt. Also sagte ich sachlich: »Ziemlich viele Studentinnen waren in Karl verliebt. Er hat Kunstgeschichte unterrichtet, und seine Seminare waren immer überfüllt. Er war einfach sehr … charismatisch. Unkonventionell, klug und witzig. Und außerdem wirklich gut aussehend. Aber das war nicht der Grund, warum ich mich in ihn verliebt habe.«
»Nein?«
»Nein.«
Sie wartete eine Weile, ob ich möglicherweise von allein weitersprach, dann fragte sie: »Und warum haben Sie sich in ihn verliebt?«
»Weil er der erste Mann war, der keine Angst vor mir hatte.«
»Sie glauben, die Männer hatten Angst vor Ihnen?« Sie machte sich eine Notiz und nickte dabei.
»Viele Männer haben Angst vor klugen Frauen«, sagte ich.
»Oh. Das ist interessant.« Sie sah ein wenig spöttisch aus, als sie die Augenbrauen hochzog. »Möchten Sie das vielleicht ein bisschen genauer ausführen?«
Ich setzte mich gerader und hob das Kinn. »Ich habe einen IQ von 158. Mein Abitur habe ich mit sechzehn gemacht, mit neunzehn hatte ich einen Abschluss in Geophysik und Meteorologie. Die Männer, die ich damals kennen lernte, fanden das irgendwie … einschüchternd.« Und unerotisch. Männer behaupten zwar immer, dass ihnen Intelligenz bei einer Frau wichtig ist, aber damit meinen sie nicht, dass die Frau intelligenter sein soll als sie selber. Jedenfalls nicht so, dass sie es merken.
Frau Karthaus-Kürten musterte mich misstrauisch. Offenbar sah ich in ihren Augen nicht aus wie jemand mit einem IQ von 158. Ich überlegte, ob ich ihr noch das mit den Instrumenten und den fünf Fremdsprachen erzählen sollte. Aber damit hätte ich sie wieder nur mit der Nase auf meine Kindheit und damit möglicherweise doch noch auf das ein oder andere kleine Kindheitstrauma gestoßen. Wie jedermann weiß, bekommen alle normalen hochbegabten Kinder Violinenunterricht und dürfen Chinesisch lernen. Ich spielte ersatzweise Mandoline und Cembalo, weil das Cembalo als Erbstück von Großtante Elfriede bereits unser Wohnzimmer zierte und die Mandolinenlehrerin mit meiner Mama zur Wirbelsäulengymnastik ging. Praktischerweise war die Mandolinenlehrerin gebürtige Polin, und der Cembalolehrer, den meine Mutter auftrieb, war aus Korea. So lernte ich gleichzeitig Polnisch und Koreanisch, damit mein armes, unterfordertes Gehirn sich nicht langweilte. Nicht, dass ich es in meinem Erwachsenenleben jemals gebraucht hätte. Aber es beeindruckte die Leute, wenn sie hörten, dass ich es konnte.
Frau Karthaus-Kürten räusperte sich. Ich entschied, dass sie beeindruckt genug zu sein hatte.
»Und nach Geophysik und Meterologie haben Sie dann Kunstgeschichte studiert und sich in Ihren Professor verliebt?«
»Es heißt Meteorologie«, sagte ich. »Und nein, danach habe ich mit Jura angefangen. Dabei habe ich Leo kennen gelernt, meinen ersten richtigen Freund.«
»Und Leo hatte keine Angst vor Ihrer Intelligenz?« Da war doch wieder dieser leise Hauch von Spott in ihrer Stimme.
»Nein, aber nur, weil er nichts davon wusste.« Um den unangenehmen Teil der Geschichte hinter mich zu bringen, wartete ich nicht auf ihre nächste Frage, sondern fuhr fort: »Wir waren ein paar Monate zusammen, als er mir seinen Vater vorstellte. Und das war Karl.«
»Aber doch nicht der Karl, den Sie später geheiratet haben?« Damit hatte Frau Karthaus-Kürten sich endgültig verraten: Sie war ein Idiot.
»Nein, das war nur irgendein Karl, von dem ich Ihnen erzähle, weil wir hier ja irgendwie die Zeit rumkriegen müssen«, sagte ich. »Wissen Sie, was Karls Lebensmotto war? Halt dich fern von den Idioten. Er sagte, das sei alles, was man im Leben beachten müsse, um glücklich zu sein. Vielleicht hatte er Recht, und ich bin nur so unglücklich, weil es mir nicht gelingt, mich von den Idioten fernzuhalten, seit er tot ist.«
Frau Karthaus-Kürten sah auf ihre Notizen. »Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr Ehemann war also der Vater Ihres ersten Freundes?«
Meine Güte. »Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ich habe mit Leo Schluss gemacht und bin mit Karl nach Madrid gezogen. Er hatte dort gerade eine Stelle angeboten bekommen. Ein Jahr später haben wir geheiratet.«
Frau Karthaus-Kürten nickte eine ganze Weile vor sich hin. Ein bisschen wie ein Wackeldackel. Sie war schrecklich neugierig, das merkte ich. Zweimal setzte sie an, mich zu fragen, was sie wirklich interessierte, aber beide Male brachte sie ihren Satz nicht zu Ende. »Wie hat denn seine … ich meine … der eigene Sohn … und Ihre … ich meine, das persönliche Umfeld …? Hat denn niemand … waren nicht alle …?«
Oh doch! Sie waren weiß Gott alle schockiert gewesen! Meine Familie, seine Familie, seine Freunde – es hatte ein furchtbarer Aufruhr geherrscht. Am schlimmsten hatte es natürlich den armen Leo getroffen. Er hatte ohnehin immer ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem Vater gehabt. Ich tat aber so, als verstünde ich nicht, was Frau Karthaus-Kürten wirklich wissen wollte und sagte: »Karl hat neben seiner Dozententätigkeit als Kunstsachverständiger für Museen, Galerien und Auktionshäuser gearbeitet. Wir haben zwei Jahre in Madrid gelebt, danach sind wir nach Zürich gezogen. Und von dort nach London. Wo Karl gestorben ist.« Ich machte eine kleine Pause und sah auf die Wanduhr. »Vor genau vier Wochen, drei Tagen, dreiundzwanzig Stunden und vierzehn Minuten. Oder auch siebenundzwanzigmillionenzweiundsechzigtausendundvierzig Sekunden.«
Frau Karthaus-Kürten sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und nickte dann, als ob sie es selber im Kopf nachgerechnet hätte. Natürlich konnte sie mich nicht täuschen, sie hatte ja schon die Differenz zwischen 53 und 26 nicht ausrechnen können. Dann aber überraschte sie mich. »Erzählen Sie mir von Ihrem letzten gemeinsamen Tag.«
Der letzte gemeinsame Tag … die letzte Berührung, der letzte Kuss, der letzte Blick, die letzten Worte … Die Tränen kamen aus meinen Augen geschossen, ehe ich etwas dagegen unternehmen konnte.
Frau Karthaus-Kürten reichte mir die Box mit den Taschentüchern.
»Lebe jeden Tag, als ob es der letzte wäre.«
Kalenderweisheit, vermutlich von den Hoopi-Indianern geklaut oder einer anderen Kultur, in der es keine Kreditkarten gibt, die man überziehen kann, um noch mal so richtig einen drauf zu machen – am letzten Tag.
»Ist noch Kaffee da?«, fragte Karl.
Ich zeigte mit dem Kinn auf die Thermoskanne,
ohne den Blick von der Zeitung zu lösen. Im Observer stand ein Artikel über eine Studie, die das Kommunikationsverhalten von Paaren untersucht und dabei festgestellt hatte, dass Eheleute im Durchschnitt täglich keine vierhundert Worte miteinander sprächen. Dreihundertfünfzig davon, sagte die Studie, gingen auf das Konto der Frau. Das Wort, das am häufigsten gebraucht wurde, war »Tee«, ehrlich, kein Witz, gleich gefolgt von »und« und »zu«. So wie in »Mach die Tür zu« oder »Hörst du mir überhaupt zu?«
Und was den Tee anging – nun, wir befanden uns in England. »Die Vorliebe der Engländer für Tee versteht man erst, wenn man ihren Kaffee probiert hat«, sagte Karl immer. Er und ich hatten bei der Studie nicht mitgemacht, aber ich war ziemlich sicher, dass wir mehr als vierhundert Worte miteinander tauschten. Und dass er mehr redete als ich. Trotzdem beschloss ich, spaßeshalber mal mitzuzählen. Ich hatte ein heimliches Faible fürs Zählen, ich zählte alles Mögliche, Hunde, Schulkinder in Uniform, Türklopfer, Doppeldeckerbusse – oder eben auch Wörter.
Um acht Uhr hatten wir gefrühstückt, den »Observer« ausgelesen und schon siebzig Worte miteinander gesprochen.
»Ist noch Kaffee da?« hat ja allein schon vier Wörter. Und Karl hatte es schon zweimal gefragt. (Es war italienischer Kaffee.)
»Die Heizung ist immer noch eiskalt«, das waren acht Wörter, und ich sagte sie mit einem vorwurfsvollen Zähneklappern. »Von wegen, es lag nur am Ventil.«
»Ich weiß, der Hausmeister ist ein inkompetenter Blödschwätzer«, noch mal acht. »Ich rufe ihn heute Abend wieder an. Es ist manchmal durchaus ärgerlich, perfektes Englisch zu sprechen, aber kein einziges griffiges Schimpfwort zu kennen.«
»Inkompetenter Blödschwätzer ist doch schon mal gut«, sagte ich.
»Das versteht der doch gar nicht.«
»Dann Motherfucker«, schlug ich vor.
»Der Kerl ist doppelt so groß und dreimal so breit wie ich. Ich werde mich hüten.«
Ich klapperte wortlos mit den Zähnen. Als wir hier vor acht Wochen eingezogen waren, hatten sommerliche Temperaturen geherrscht, aber mittlerweile war es Herbst geworden. Mit dem angeblich typischen Londoner Wetter draußen konnte ich mich arrangieren, aber drinnen hatte ich es gern warm und gemütlich. Leider konnte davon hier keine Rede sein: Wenn man die Heizung im Wohnzimmer aufdrehte, wurde der Heizkörper in der Küche eiskalt und umgekehrt. Und der im Badezimmer wurde gar nicht erst warm.
»Weißt du was? Ich werde einfach Hausmeister zu ihm sagen. Das Wort ist die schlimmste Beleidigung, die mir gerade einfällt.«
Ich kicherte. »Ja genau. Sie … Sie … Sie Hausmeister, Sie!«
Karl stand auf, um sich die Zähne zu putzen. Das musste er nicht extra ankündigen, das wusste ich auch so. Um halb neun sprachen wir dann noch mal zehn Wörter miteinander.
»Ich muss los. Bis nachher«, sagte Karl und gab mir einen Kuss.
Und ich sagte: »Nimm die Mülltüte mit runter.« Im Nachhinein bereue ich diesen Satz sehr, denn es war das letzte Mal, dass ich Karl lebend sah. Als ich ihm die Mülltüte in die Hand drückte, war es das letzte Mal, das ich ihn lebend berührte. Allerdings waren es nicht die letzten Worte, die wir miteinander tauschten. Gegen Mittag rief er mich auf dem Handy an und wollte das Passwort für unser Yahoo-Postfach wissen. Ich befand mich zu der Zeit in der Oxford Street, wo ich mir bei Marks und Spencer Angoraunterwäsche und dicke Socken kaufen wollte. Und vielleicht einen Wollschal und so fingerlose Handschuhe, damit ich beim Schreiben nicht fror. Ich schrieb nämlich gerade wieder einmal eine Abschlussarbeit. Meine dritte.
»De we e te jot de es em a pe«, sagte ich. Das galt als ein Wort.
»Ist das Polnisch?« Karl beherrschte viele Sprachen, aber Polnisch konnte er nicht. Nur um ihn zu ärgern, schrieb ich deshalb manchmal polnische Sätze in den Kalender. Zuletzt am 14. Oktober: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, hatte ich geschrieben, und Karl hatte es durchgestrichen und daruntergekrickelt: Auf keinen Fall werde ich an meinem Geburtstag mit dem Wurstverkäufer zum Urologen gehen!!!!
»Großes D, kleines W, kleines E, großes T, kleines Jot, kleines D, kleines S…«
»Lieber Himmel, Carolin«, unterbrach Karl mich. »Wie soll man sich denn das merken, wenn man nicht hochbegabt ist?«
»Das ist doch ganz einfach«, sagte ich.
»Butterblume ist einfach«, sagte Karl. »Sinnfrei aneinandergereihte Groß- und Kleinbuchstaben sind einfach nur …« Sein letztes Wort ging im Motorenlärm eines Busses unter, der an mir vorbeifuhr. Ich zählte es trotzdem mit. »… E, T, Jot … Groß oder klein? Und was soll dieser Singsang?«
Ich seufzte. Ich hatte tatsächlich ein bisschen gesungen. »Also gut!« Ich sah mich kurz um, dann senkte ich meine Stimme und sagte verschwörerisch: »Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat.«
»Wie bitte?«
»Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat!« Diesmal sang ich es, ungeachtet der befremdeten Blicke, die mir die Leute zuwarfen. »Kölle Alaaf, Alaaaf, Kölle Alaaf! Alaaf immer groß.«
»Carolin, muss ich mir Sorgen machen? Ist das ein akuter Anfall von Heimweh?«
»Es ist der Code! Die Anfangsbuchstaben von diesem Refrain.«
»Aha. Nicht dumm. Total bekloppt, aber nicht dumm.«
»Hast du’s?«
»Wie war das? Wenn das Trömmelchen geht? Großes W, kleines D, großes T…? Herrgott, wer kennt denn dieses bekloppte Lied?«