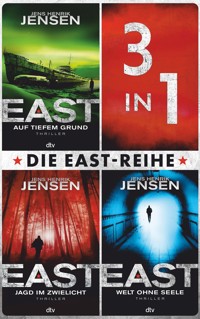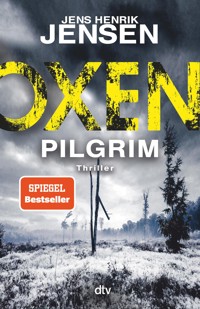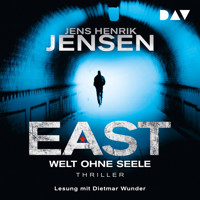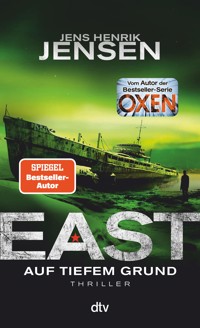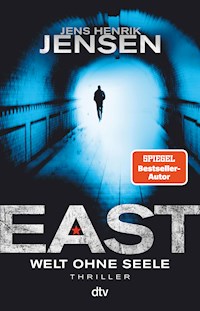9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nina-Portland-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die junge Frau und das Meer – Nina Portlands erster Fall Chaotisch, clever und absolut unbeirrbar: Kapitänstochter Nina Portland bringt frischen Wind in die skandinavische Krimiszene Der Auftakt von Jens Henrik Jensens Nina-Portland-Trilogie Verlassen treibt ein Küstenschiff auf hoher See. An Deck ist es ganz still. Und dieser süßliche Geruch über den Planken … Im Hafen von Esbjerg scheint sich ein düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord Blutspuren und Reste von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist der Seemann Vitali Romaniuk. Hat der Russe seine Kameraden kaltblütig mit einer Axt ermordet? Aus Mangel an Beweisen wird er freigesprochen. Der Fall des »Axtschiffs« wandert zu den Akten. Nur die junge Ermittlerin Nina Portland gibt sich damit nicht zufrieden. Das Lächeln des Seemanns lässt ihr keine Ruhe. Als sie ihm viel später zufällig begegnet, setzt sie sich auf seine Spur. Und findet heraus, dass das, was damals nachts auf der MS Ursula geschah, erst der Anfang war. »Internationales Ränkespiel, Drama, Mord – und eine großartige Liebeserklärung an Esbjerg.« JydskeVestkysten »Ich habe eine große Schwäche für Nina Portland. Sie stammt aus einer Familie von Seefahrern und das Leben an der schroffen Nordsee hat sie geprägt. Vielleicht rührt daher ihre besondere Willensstärke, ihr hartnäckiges und unbeugsames Wesen – denn das ist es, was diese Serie antreibt.« Jens Henrik Jensen Alle Bände der SØG-Reihe: Band 1: Dunkel liegt die See Band 2: Schwarzer Himmel Band 3: Land ohne Sicht Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien OXEN und EAST erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit Nina Portland in ihrem ersten Fall ermittelte – einem rätselhaften Verbrechen auf hoher See. Fünf Seeleute wurden brutal mit einer Axt erschlagen und ihr Mörder nie gefunden. Der Fall der MS Ursula, von der Boulevardpresse »Axtschiff« getauft, liegt seitdem als Cold Case auf Eis. Nina aber kann nicht aufgeben. Rasch wird der ungelöste Fall für sie zur Obsession.
Als sie den damals Hauptverdächtigen, einen Russen namens Romaniuk, zufällig in Estland wiedersieht, setzt sie sich auf seine Spur. Und ruft, ohne es zu wissen, Mächte auf den Plan, für die das Leben eines Menschen nur eine abstrakte Größe ist.
Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv erschienen:
OXEN – Das erste Opfer
OXEN – Der dunkle Mann
OXEN – Gefrorene Flammen
OXEN – Lupus
OXEN – Noctis
OXEN – Pilgrim
SØG – Dunkel liegt die See
SØG – Schwarzer Himmel
SØG – Land ohne Licht
EAST – Welt ohne Seele
EAST – Auf tiefem Grund
EAST – Jagd im Zwielicht
Jens Henrik Jensen
SØG
Dunkel liegt die See
Nina-Portland-TrilogieBand 1
Thriller
Aus dem Dänischenvon Christel Hildebrandt
ERSTERTEIL
1
Dieses Lächeln … Dieses verfluchte Lächeln brannte ihr auf der Haut. Sie hatte das Foto in den Hosenbund geschoben, auf die nackte Haut, damit es so trocken wie möglich blieb.
Ihre Beine fühlten sich fremd und eiskalt an. Als sie endlich einen Unterschlupf fand, war die abgewetzte Jeans vollkommen durchnässt, aber sie fror nicht. Obwohl die alte Lammfelljacke außen klitschnass war, hielt sie warm. Sie hatte sie im letzten Moment doch noch eingepackt, weil sie ahnte, dass es in Estland Mitte Oktober verdammt kalt sein könnte.
Der Regen prasselte auf das Dach und erzeugte einen metallischen Ton, der die Luft nahezu vibrieren ließ. Sie saß auf einer Planke am Boden eines ausrangierten Schiffscontainers, umgeben von einer so massiven Dunkelheit, dass es keinen Unterschied machte, wenn sie die Augen schloss. Sie lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und wartete. In regelmäßigen Abständen drückte sie den Knopf, der die Ziffern auf ihrer Armbanduhr aufleuchten ließ – noch eine halbe Stunde.
Das Lächeln … Dieses verfluchte Lächeln löste ein nervöses Flattern in der Gegend ihres Zwerchfells aus.
Sie zündete sich eine Zigarette an, die dritte innerhalb kurzer Zeit. Die Flamme des Feuerzeugs verscheuchte die Dunkelheit, doch es war nichts zu sehen außer vier nackten Metallwänden und dem dichten Nebel des Zigarettenrauchs, der sich über ihr zu einer wogenden Decke zusammenfand, als sie den Rauch durch die Lippen ausstieß. Erst jetzt entdeckte sie, dass ihr Hosenbein einen Riss bekommen hatte, als sie über den Zaun geklettert war.
Sie hatte sich gründlich umgesehen, bevor sie zur Tat schritt. Links vom Hafen lag die Konzerthalle wie eine niedergetretene Betonpyramide mit breiten Stufen, die übers Dach und auf der anderen Seite wieder hinunter bis zu der kleinen Kaianlage mit dem Hubschrauberlandeplatz führten. Das Gebäude wirkte heruntergekommen, aber schön war es wahrscheinlich nie gewesen. Vom Dach des Gebäudes aus hatte sie sorgfältig die Umgebung studiert, bevor das matte Herbstlicht in die Dämmerung überging. Der Hafen war Tallinns pulsierendes Herz, mit einem gewaltigen Aufkommen an Passagieren und Fracht. Das große Hauptterminal A und daneben das etwas kleinere Terminal B, flankiert vom Terminal C, der Hafenverwaltung und dem pastellblauen Zollgebäude, umringten den großen Parkplatz, auf dem ein Schwarm Reisebusse Gäste ausspuckte oder aufnahm, während große Lastwagen nach jeder neuen Schiffsankunft mit dröhnenden Motoren vom Gelände donnerten.
Sie war dort unten inmitten einer Horde finnischer und schwedischer Reisender herumgelaufen und hatte sich ihre Umgebung in allen Details eingeprägt. Das hier war wirklich das Gegenstück zum Amoklauf der Dänen in den deutschen Grenzläden. Die Finnen kostete es nur ein paar Stunden Fährzeit von Helsinki, während es für die Schweden von Stockholm und Kapellskär fast eine Tagesreise bedeutete, doch alle schienen offenbar nur ein Ziel zu haben – Alkohol.
Bewaffnet mit den unvermeidlichen Marktrollern zog sich der Strom, schwer beladen mit Bier aus dem großen Einkaufszentrum des Hafens, Sadamarket, hinunter zu den Passagierterminals. Im Sadamarket gab es alles, was das Touristenherz an billigen Kopien von Markenwaren begehrte, außerdem Souvenirs und vor allem ein gut sortiertes Spirituosenlager.
Beim Terminal D, der wie eine Enklave mit eigenem Anleger ein Stück entfernt lag, hatte sie schließlich einen Hafenarbeiter dazu bringen können, sich das Foto anzusehen. Er meinte, der Overall des Mannes ähnele denen der Tallink-Reederei. Deshalb richtete sie nun ihre Aufmerksamkeit auf das Hauptterminal.
Sie drückte die Glut auf dem Metallboden aus und wurde wieder von der Dunkelheit verschluckt.
Das Lächeln … Dieses verfluchte Lächeln auf dem Foto war ihr bis ins Mark gedrungen. Zum Umkehren war es zu spät. Und sie wollte auch gar nicht umkehren. Dieses Flattern in der Magengegend, wo das Zwerchfell saß, war eigentlich gar nicht unangenehm, es fühlte sich eher an wie ein prickelndes Gefühl unerlöster Spannung.
Es war unmöglich, an die Männer heranzukommen, die sie eigentlich befragen wollte, denn der Hafen war durch hohe Zäune hermetisch abgeriegelt. An der Zollstation auf der rechten Seite des Terminals, wo die Lastwagen kontrolliert wurden, saßen hellwache Zöllner an den Schlagbäumen. Ebenso auf der linken Seite, wo die Personenwagen hineinfuhren – zu Fuß konnten Fahrgäste gar nicht auf das Gelände gelangen. Sie gingen vom obersten Stockwerk des Terminals über die lange überdachte Brücke direkt an Bord, genau wie auf einem Flughafen.
Es hatte nur eine Möglichkeit gegeben: Im Schutz der Dunkelheit war sie über das offene Geländestück zwischen Konzertsaal und Hafen geschlichen, hatte den Zaun überwunden und, während sie sich dicht am Wasser hielt, weit außerhalb der Lichtkegel gewaltiger Scheinwerfer, nach einem Schutz vor dem Regen Ausschau gehalten. Drei kaputte Container, die man neben einem Haufen Eisenschrott abgestellt hatte, waren ihre Rettung gewesen. Die Riegel der ersten beiden waren festgerostet, doch es gelang ihr, die Luke des dritten aufzutreten. Und jetzt saß sie hier – und wartete.
Eine Kakophonie großer Lastwagenmotoren drang nach einer Weile durch den Geräuschteppich des Regens. Sie erhob sich mit steifen Beinen, schob die Luke vorsichtig einen Spalt weit auf und schaute sich wachsam um, bevor sie hinaustrat.
Das gesamte Hafengelände um die Anleger lag im Flutlicht der Scheinwerfer, die an einer Reihe hoher Masten hingen. Der heftige Regen, der ihr geradewegs ins Gesicht peitschte, schlug Silberfunken aus dem harten Licht. Sie wischte sich die Augen mit dem feuchten Ärmel ab, und für einen kurzen Moment verschwanden die Lichtreflexe, sodass sie deutlich die schwarzen Silhouetten emsiger Arbeiter erkennen konnte, die wie flackernde Schatten hin- und herliefen. Die Männer räumten den Kai frei, während eine Herde Trucks mit orangefarbenen Blinklichtern Kühlcontainer an ihren Platz bugsierte.
Hinten zwischen einer Reihe hoher Kräne glitt ein wahres Lichtermeer langsam näher. Das war die Tallink-Fähre Meloodia, die wie ein überladener Weihnachtsbaum von Helsinki heranstampfte, pünktlich auf die Minute.
Sie wollte warten, bis die erste Hektik vorüber war und sich der Autostrom vom Fährdeck herunter in Bewegung setzte. Sie wollte sich vorsichtig nähern und sich auf Englisch erkundigen, zögernd und entschuldigend wie eine schiffbrüchige Frau, die die Hilfe eines starken Seemanns brauchte.
Der Regen troff aus ihrem Haar, lief ihr in den hochgeschlagenen Kragen und das Rückgrat hinunter. Sie schauderte. Vielleicht war das nicht nur die Kälte. Sie blickte sich wachsam über die Schulter um und ärgerte sich, dass sie dieses merkwürdige Schuldbewusstsein verspürte. Sie befand sich auf verbotenem Terrain. Wenn sie erwischt wurde, konnte das Konsequenzen haben, die sie schon längst nicht mehr überblickte.
Sie hockte sich neben den Container. Jetzt musste sie nur noch dem Schauspiel folgen und handeln, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war.
Unerträglich langsam glitt die Fähre an den Kai heran, und auch als sie bereits vollkommen unbeweglich an ihrem Platz lag, verging noch eine ganze Zeit, bevor sich die Klappe wie das Maul eines Wals öffnete und eine Zahnreihe aus grellen Autoscheinwerfern entblößte.
Sie ließ den ersten Schwung langer Überlandtrucks aus dem Bug herausrollen. Auf die Entfernung war es unmöglich, die Hafenarbeiter von der Schiffsmannschaft zu unterscheiden. Noch einmal rieb sie mit dem Ärmel über ihr nasses Gesicht und versuchte krampfhaft, etwas zu erkennen. Es schien, als sei inzwischen etwas mehr Ruhe unter den dahinhuschenden Schatten am Bug eingekehrt. Drei der Männer standen jetzt zusammen, suchten offenbar gegenseitig etwas Windschutz, während sie die Fahrzeuge betrachteten. Ein Feuerzeug flammte auf und erhellte eines der Gesichter. Sie machte sich bereit.
Es war wie Anlaufnehmen. Als müsste sie in der Zeit zurückgehen zu einem Punkt, der ihr ganzes Leben verändert hatte.
Sie hatte eine Rechnung offen mit dem Jahr 1993. Seit elf Jahren suchte das Lächeln des Seemanns sie heim. Jetzt war sie ihm zufällig auf die Spur gekommen. Und diese Chance würde sie sich nicht entgehen lassen.
Sie lief los, im langen Spurt hinüber zur Breitseite des Terminalgebäudes. Sie presste sich gegen die Mauer, während sie ihren Atem wieder unter Kontrolle brachte. Dann schlich sie weiter zur Ecke und trat ins Licht hinaus, als wäre sie gerade aus der Tür ein paar Meter hinter ihr gekommen. Sie ging, wie es jeder in dem strömenden Regen tun würde – mit hastigen Schritten, beide Hände in den Jackentaschen, die Schultern hochgezogen. Sie trat direkt auf die drei Männer an der Rampe zu. Alle trugen Overalls in den Farben der Tallink-Reederei. Sie war eine Frau in Not, rief sie sich in Erinnerung, wurde langsamer und machte zögerliche Schritte.
»Hello! Excuse me, I’m sorry … Can you help me, please?«
Die drei Männer drehten sich verwundert nach ihr um. Sie zog den Reißverschluss auf, holte das Foto hervor und hielt die Jacke darüber, um es gegen den Regen zu schützen. Mit unsicherer Stimme sprach sie weiter: »Ich suche nach diesem Mann. Kennen Sie ihn?«
Sie deutete auf das Foto, und der älteste der drei Männer trat ganz nah an sie heran und schob fast seinen Kopf unter ihre Jacke, während er die Aufnahme betrachtete. Sie beobachtete seinen Gesichtsausdruck, doch der verriet nichts. Der Mann sah sie misstrauisch an, dann schaute er zu seinen Kollegen und schüttelte bedauernd den Kopf.
Das Gleiche tat Nummer zwei, ein kleiner Mann mittleren Alters. Er stellte mit einem »No, sorry« fest, dass er ihr nicht helfen konnte. Sie trat einen Schritt auf den letzten zu, einen jungen, breitschultrigen Kerl, und schlug ihre Jacke auf. Er schob den Kopf ganz hinein, und erst jetzt spürte sie das leichte Ziehen, das besagte, dass ihre Brustwarzen sich verfroren am Stoff der engen Bluse rieben. Sie war zu konzentriert, um verlegen zu werden, und jetzt richtete der Typ seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Foto. Er kannte den Mann auf dem Bild, den Mann mit dem Lächeln. Da war sie ganz sicher. Es war etwas Aufgesetztes an seiner gleichgültigen Miene und in seinem Tonfall, als er sie ansah und in fließendem Englisch sagte:
»Nein, den kenne ich nicht. Ist er Seemann? Wie heißt er?«
»Ja, ich denke schon, dass er immer noch Seemann ist. Er heißt Vitali, Vitali Romaniuk.«
»Warum suchen Sie nach ihm?«
»Er ist ein guter Freund von mir, den ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe.«
»Nein, tut mir leid … Romaniuk … das sagt mir überhaupt nichts«, erklärte der junge Mann, wobei sein Blick verstohlen über ihr Gesicht hinwegglitt und wieder einen kurzen Moment auf ihren Brüsten verweilte.
»Okay, trotzdem vielen Dank.«
Sie schob das Foto wieder zurück unter die Jacke und schaute sich um. Dann lief sie zwischen zwei Lastwagen hinüber auf die andere Seite der Rampe, wo sie zwei weitere Männer im Overall der Reederei entdeckt hatte.
Das Ergebnis war das Gleiche – Misstrauen, Kopfschütteln und ein bedauerndes Achselzucken. Zögernd ging sie die Rampe hinauf, obwohl einer der Männer hinter ihr herrief und warnend gestikulierte. Ein paar Meter vor dem Autodeck, wo die Dünste konzentrierter Dieselabgase schwer unter dem grellen Licht hingen, blieb sie stehen und tippte einem jüngeren Mann, der in ein Walkie-Talkie sprach, auf die Schulter.
Ziemlich ungehalten musterte er das Foto, das sie ihm reichte. Sie bemerkte gerade noch, wie er leicht nickte und den Mund öffnen wollte, als sie aus dem Augenwinkel heraus weiter hinten an Deck eine dunkle Gestalt ausmachte. Es war, als streiften sich ihre Blicke eine Sekunde lang, vielleicht lächelte er sogar? Trug er nicht einen dünnen, schwarzen Schnurrbart? War er es? Dann wandte der Mann sein Gesicht ab und verschwand mit einem Satz durch eine Türöffnung.
Ohne zu überlegen, riss sie dem Walkie-Talkie-Mann das Foto aus der Hand und rannte das Deck hinunter. Auf halbem Weg entdeckte sie eine Metalltür, die weit offen stand. Sie bremste so plötzlich ab, dass sie auf einem Ölfleck ausrutschte, die Füße glitten ihr weg, und sie landete hart auf einem Ellbogen, war aber gleich wieder auf den Beinen. Sie lief hinein und hastete eine Metallstiege hinauf. Die Abgase brannten ihr in den Augen, ihr Atem ging stoßweise, und ihr Herz hämmerte. Sie bemerkte es kaum, registrierte nur ein leichtes Schwindelgefühl, als sie das nächste Deck erreichte und einen Moment stehen blieb, um zu horchen.
Waren da nicht schwere Stiefel auf Metall zu hören? Doch … Sie lief die Stiege weiter hinauf, hörte über ihrem Kopf eine Tür ins Schloss fallen, riss sie kurze Zeit später auf und schaute sich um – keine Menschenseele war zu sehen.
Vorsichtig betrat sie den schmalen, abgenutzten Streifen Teppichboden. Links, geradeaus und rechts von ihr verzweigten sich die Gänge, gesäumt von einer Reihe kleiner Kajüten, jede mit einem weißen Schild an der Tür. Sie lauschte aufmerksam. Abgesehen vom Lärm der Motoren war kein Geräusch zu hören. Wo zum Teufel war er abgeblieben? War er es überhaupt gewesen? Oder hatte sie Gespenster gesehen?
Da war nichts zu machen. Der Mann war tief im Bauch des Wals verschwunden. Am Ende des Ganges rechts von ihr ging eine Tür auf, und ein dickbäuchiger Mann in Uniformjacke mit Streifen auf den Schultern kam herangewatschelt. Er entdeckte sie und rief sie mit wütender Bassstimme an. Sie hätte warten und ihm erklären können, worum es sich drehte, aber wieder handelte sie reflexartig. Vielleicht brachte dieses idiotische Unbehagen, etwas Ungesetzliches getan zu haben, sie dazu, jedenfalls sprang sie die Stiege mit ein paar großen Schritten wieder hinunter, während sie noch die schweren Schritte des Mannes und seine immer lauter werdenden Rufe über sich hören konnte.
Sie musste weg, raus aus dem Bug dieses ungastlichen Schiffes, zurück in den strömenden Regen.
Vanalinn, der alte Stadtteil, lag in einem weichen, goldenen Licht hinter der Stadtmauer zu ihrer Rechten, als sie die Mere Puistee hinuntertrabte. Der Regen strömte unablässig weiter, und jetzt war sie so durchgefroren und nass, dass sie kaum die Kontraste zwischen den beiden Welten wahrnahm, die sich auf beiden Seiten des Boulevards auftaten. Die erleuchtete grüne Spitze der Olavskirche, die grünen Türme und Schießscharten in den Steinquadern im Gegensatz zu den grellen Scheinwerfern und Lichtern des Hafens.
Es war nur knapp ein Kilometer bis zum Hotel, und sie beeilte sich, überquerte den Boulevard direkt vor einer heranschaukelnden Straßenbahn und ging im Schutz der Bäume auf der linken Seite weiter. Abrupt blieb sie vor einem blinkenden Neonschild stehen, das die Form einer Flasche hatte. Ein Schnapsladen, Tag und Nacht geöffnet, wie all die anderen auch. Anscheinend war Schnaps das Big Business in Tallinn, und mit der Aussicht auf ein langes, heißes Duschbad – aber ohne Minibar im Hotelzimmer – war der Entschluss schnell gefasst.
Nur wenige Minuten später eilte sie weiter in Richtung Hotel, zwei Halbliterflaschen Bier in den Jackentaschen. Es waren nicht viele Menschen auf der Straße zu sehen, trotzdem war der Verkehr die große Narva Maantee hinunter ziemlich hektisch. An neuen Autofabrikaten fehlte es nicht in diesem wirtschaftlich aufstrebenden kleinen Staat. Sie steuerte geradewegs eine rote Markise weiter hinten auf dem Bürgersteig an. Dort musste sie durch die Einfahrt, und hinter den Höfen lag ihr Hotel auf einem offenen Gelände, das Reval Hotel Central, neu und modern und dennoch mit einem Preisniveau, das dem dänischen Staat genehm war.
»Frau Portland, Zimmer 207, nicht wahr?«
Die zierliche Frau hinter dem Empfangstresen schaute fragend vom Computerbildschirm auf und lächelte.
»Ja …«
»Da ist eine Nachricht für Sie, Frau Portland.«
Die Frau überreichte ihr das gelbe, zusammengefaltete Stück Papier und lächelte wieder.
»Danke schön.« Sie las die kurze Nachricht und seufzte erleichtert. Das Seminar am nächsten Tag war um zwei Stunden verschoben worden, weil der Referent, Kriminalkommissar Aro, verhindert war. Dann gab es also doch noch gute Nachrichten. Statt um neun Uhr musste sie erst um elf Uhr erscheinen.
Tropfend und zitternd eilte sie durch das Foyer. Sie wollte möglichst vermeiden, in diesem nassen und durchgefrorenen Zustand auf einen ihrer Kollegen zu stoßen, was sicher Anlass für neugierige Kommentare gegeben hätte. Sie nahm den Fahrstuhl hinauf in den dritten Stock, schloss ihr Zimmer auf, lief ins Bad und öffnete gleich den Warmwasserhahn der Dusche.
Zurück im Zimmer, hob sie ihren Koffer aufs Bett, suchte die Kulturtasche und war in Sekundenschnelle aus den nassen Sachen heraus, die sie auf dem Weg ins Badezimmer auf dem Boden zurückließ. Das Foto legte sie zum Trocknen auf die Heizung.
Sie blieb unter der heißen Dusche, bis ihre Haut rot war und brannte. Ihr Ellbogen tat noch vom Fall auf dem Autodeck weh. Sie roch den schwachen Lavendelduft des Shampoos und spürte das Gefühl der Entspannung, das sich in ihrem Körper ausbreitete, als jeder einzelne Muskel durchgewärmt war.
Sie blieb noch ein paar Minuten stehen, bevor sie das Wasser abstellte, aus der Duschkabine heraustrat, ein Handtuch um ihr halblanges, kastanienbraunes Haar wickelte und das andere über dem Toilettensitz ausbreitete, um sich daraufzusetzen.
Dampfend von der Wärme zündete sie sich eine Zigarette an, öffnete mit dem Feuerzeug eine der beiden Flaschen und goss das Bier in das hoteleigene Zahnputzglas. Sie wusste ein gutes Bier zu schätzen, deshalb nahm sie sich die Zeit, seine dunkle, karamelartige Farbe zu studieren und die Kohlensäureperlen, die vom Grund hochstiegen. Sie ließ den ersten Schluck in der Mundhöhle kreisen. Es schmeckte himmlisch. Das war ein Saaremaa, von einer lokalen Brauerei, zehn Prozent stark, was offenbar in dieser Gegend nichts Besonderes war. Sie nahm noch einen Mundvoll, schnippte die Asche ins Waschbecken, lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück und seufzte zufrieden. Es war schon paradox, dass man bis nach Estland fahren musste, um Zeit zu finden, sich selbst ein wenig zu verwöhnen.
Sie stellte das leere Glas ab und erhob sich gerade so weit von ihrem Sitz, dass sie die Zigarettenkippe ins Toilettenbecken schnipsen konnte.
Das klare Gel fühlte sich angenehm an den Fingern an, und sie verrieb eine dünne Schicht auf Schenkeln und Schienbeinen.
Ein paar Strophen von ›Rule Britannia‹ summend, rasierte sie sorgfältig ihre Beine, bis sie überall schön glatt waren, dann erhob sie sich widerwillig, um sie unter der Dusche abzuspülen. Anschließend wischte sie den Spiegel ab und entfernte mit einem Wattebausch die Reste der Wimperntusche von ihren blauen Augen. Sie setzte sich wieder auf den Klodeckel und ging zur ›Marseillaise‹ über, während sie langsam den ganzen Körper mit der teuren Feuchtigkeitscreme einrieb, die normalerweise bei ihr zu Hause ein stiefmütterliches Dasein ganz oben im Badezimmerregal fristete und die sie spontan in die Kulturtasche geworfen hatte, bevor sie das Haus verließ.
Sie machte den Kneiftest mit Daumen und Zeigefinger, doch, ja, der Bauch war immer noch so fest und flach, wie sie es erwarten konnte, auch wenn sie die Lage vor ein paar Jahren sicher kritischer beurteilt hätte. Ihre Brüste waren durch die Wärme weich und schwer, und sie dachte dankbar an Jonas, der als Baby so rücksichtsvoll gewesen war, sie nicht zu Topflappen auszulutschen. Er hatte sie schlicht und einfach nicht haben wollen. Er wollte lieber die Nuckelflasche, und die salomonische Lösung hatte beiden einen ruhigeren Nachtschlaf beschert.
Sie streckte das rechte Bein aus und spannte die Muskeln an. Hart und deutlich traten sie hervor. Die vielen Stunden Training waren nicht vergeblich gewesen. Es gehörte ganz einfach zu ihrem Job, fit zu bleiben, in letzter Konsequenz konnte das den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, wenn das Schicksal es eines Tages so wollte. Und besonders in ihrem Alter war es wichtig, den Körper nicht zu vernachlässigen. Bei Weitem nicht alle ihrer Kollegen und Kolleginnen fühlten sich gleichermaßen verpflichtet dazu, und es machte sie manchmal richtig wütend, sich ihre dummen Ausreden anhören zu müssen. Ihr eigenes Laster waren die Zigaretten. Nun ja, jetzt wollte sie es damit erst einmal gut sein lassen …
Auf dem Weg aus dem Bad kickte sie ihre Kleidung geschickt mit dem rechten Fuß vom Boden hoch, fing sie in der Luft und legte sie über die Heizung. Sie zog die Tagesdecke ab, drapierte sie über einen Stuhl und holte den Pyjama aus dem Schrank. Er war aus schwarzer Seide. Ein altes Geburtstagsgeschenk, das sie so gut wie nie benutzt hatte. Normalerweise schlief sie in dem verwaschenen T-Shirt, das gerade zuoberst auf dem Stapel lag. Der Pyjama war genauso instinktiv im Koffer gelandet wie die Feuchtigkeitscreme. Sie zog ihn an, setzte sich im Schneidersitz aufs Bett und goss sich ein zweites Glas ein.
Langsam ließ sie sich nach hinten sinken, blieb ausgestreckt auf dem Rücken liegen und genoss den Duft und das Gefühl von frisch gewaschener, gestärkter Bettwäsche und glatter Seide.
Sie stand erst wieder auf, als sie diese schwere Schläfrigkeit spürte, die auf das Gefühl von Wärme im Körper folgt. Sie nahm das Foto von der Heizung. Es war warm und etwas zerknickt. Dann setzte sie sich im Bett zurecht, dieses Mal mit zwei Kissen im Rücken.
Das Foto war an einem der Anleger im Hafen gemacht worden, eine Fähre war im Hintergrund zu sehen. Es zeigte eine Alltagssituation – und doch wieder nicht. Am linken Rand fuhr ein Lastwagen auf die Rampe zu, in der Mitte standen zwei Männer in Polizeiuniform und redeten mit zwei Leuten von der Fähre. Im Vordergrund rechts stand ein dritter in dem blauen Overall der Reederei. Er hatte offensichtlich den Fotografen entdeckt, denn er sah direkt in die Kamera – und lächelte.
Es war ein ungewöhnlich markantes Gesicht, mit hohen Wangenknochen und einem schmalen Schnurrbart. War es der Mann, den sie vor ein paar Stunden an Deck gesehen hatte? Die Zweifel wurden immer stärker – war sie sich jetzt vielleicht auch nicht mehr sicher, dass der junge Typ, der ihr auf die Brust gestarrt hatte, ihn kannte? Doch … Und der Mann mit dem Walkie-Talkie hatte auch leicht genickt.
Gott mochte wissen, zum wievielten Mal sie die Gesichtszüge des Mannes auf dem Foto musterte. Es war auf jeden Fall Vitali Romaniuk. Daran bestand kein Zweifel.
Das Foto hatte sie heimlich mitgehen lassen, als ihre Gruppe zu Besuch beim Polizeichef gewesen war. Er hatte bereitwillig einen Stapel Fotos herumgehen lassen, damit die skandinavischen Gäste sehen konnten, wie effektiv die Tallinner Polizeikräfte bei den regelmäßigen Schmuggelkontrollen im Hafengelände zuschlugen. Zusammen mit dem Zoll hatte die Polizei einen Absperrgürtel um das Terminalgelände gelegt und penibel jeglichen Ausgangsverkehr kontrolliert.
Sie hatte genau wie die anderen höflich interessiert die Bilder durchgesehen und … peng, da knallte ihr dieses unverschämte Lächeln direkt ins Gesicht.
Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, wartete sie, bis sich eine Gelegenheit fand, das Foto in ihrer Tasche unter dem Tisch verschwinden zu lassen. Und jetzt saß sie nach einem nassen Hafenabenteuer entspannt auf ihrem Bett und betrachtete das Bild des lächelnden Mannes – eines lächelnden Mannes, der in Notwehr zwei Seeleute mit einer Axt erschlagen hatte, wenn man seinen eigenen Ausführungen glauben wollte. Oder eines lächelnden fünffachen Mörders, wenn man der Anklage glauben wollte, die davon ausging, dass er die gesamte Besatzung aus dem Weg geräumt und ihre Leichen über Bord geworfen hatte.
Objektiv gesehen war es übrigens eine ziemliche Übertreibung, den Ausdruck des Mannes ein Lächeln zu nennen, doch die Presse hatte es getan.
Es gab viele Arten zu lächeln: fröhlich, bescheiden, schüchtern, überwältigend, falsch, echt, glücklich, verschmitzt, verführerisch und eine ganze Menge mehr. Diskutierte nicht die ganze Welt darüber, wie das Lächeln der Mona Lisa zu interpretieren war? Normalerweise bedeutete ihr ein Lächeln überhaupt nichts. Sie hatte keine romantischen Vorstellungen. Wie sollte eine Beamtin der Kriminalpolizei auch so etwas haben – und dann noch bezogen auf ein Lächeln?
Aber mit Vitali Romaniuk war es etwas anderes, mit diesem lächelnden Mörder, dem russischen Seemann vom Axtschiff, das vor mehr als elf Jahren in den Hafen von Esbjerg gekommen war. Denn sein Lächeln erreichte die Augen nicht. Es war ein unergründlicher, rätselhafter, verführerischer Ausdruck. Eine undurchschaubare Maske, hinter der sich ein Geheimnis verbarg, das niemand hatte lösen können. Vielleicht eine Schuld – doch niemandem war es gelungen, das zu beweisen. Und deshalb war er schließlich freigekommen.
Sie zündete sich eine Zigarette an. Nur Dummköpfe rauchten im Bett, und einige von ihnen starben daran, aber in diesem Augenblick brauchte sie eine. Nachdenklich blies sie einige Ringe zur Decke und folgte ihnen mit dem Blick, bis sie sich auflösten. Manche Jahre, vielleicht die meisten, waren wie Rauchringe. Sie verschwanden. Hinterließen keinerlei Spuren. Aber nicht das Jahr 1993 … Es kam ihr vor, als könnte sie gerade dieses Jahr wie einen Film aus der Erinnerung wieder ins Gedächtnis rufen. Und indem sie die Szenen und die Texte wieder abrief, kamen auch die Musik und die Stimmungen zurück, spürte sie alles wieder unter der Haut vibrieren, von heißer Aufregung bis hin zu Wut, Verwirrung und Enttäuschung.
1993 hatte zwei Hauptdarsteller – abgesehen von ihr selbst. Der eine war der russische Seemann. Der andere wurde ihre große, kurze Liebe, der englische Geologe, der offshore in der Nordsee arbeitete. Wie ein Wink des Schicksals waren beide Männer an Land gegangen und fast gleichzeitig in ihr Leben getreten. Sie leerte das Glas mit einem Zug. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie ins Badezimmer gehen und sich die Zähne putzen sollte, aber sie hatte keine Lust. Sie schloss die Augen wieder und sah, wie sie 1993 ihren ersten Arbeitstag bei der Esbjerger Polizei antrat. Es war Frühling, grün und mild, als sie am ersten Montag im Mai dort begann.
Zu der Zeit mussten alle jungen Beamten ihre gesamte Ausbildung in Kopenhagen absolvieren. Aber sie hatte keine Sekunde daran gezweifelt, dass sie sich anschließend nach Westjütland bewerben würde, in ihre alte Heimat Esbjerg. Es gab zu viele Menschen in Kopenhagen, zu viel Verkehr, Hektik und zu viele Hipster. Der Himmel hing zu niedrig, es gab keine breiten Strände, keine Steilküsten und keinen Westwind, der frische Luft hereinbrachte.
Die Arbeit in Esbjerg war spannend, die Kollegen waren nett, sie nahm alte Freundschaften wieder auf, die bis in die Schulzeit zurückreichten, und die freien Tage, von denen sie die meisten bei Onkel und Tante auf Fanø verbrachte, vergingen wie im Flug. Wiedersehensfreude und ein Gefühl von Leichtigkeit prägten diesen Sommer. Bis zu jenem Dienstag, dem 19. August. Bis zu der Nacht, in der sie geweckt und zum Hafen gerufen wurde, wo sie als frischgebackene Kriminalassistentin, noch vollkommen unwissend, was sie da erwartete, direkt in einen der makabersten und geheimnisvollsten Fälle der dänischen Kriminalgeschichte hineingezogen wurde.
Wieder betrachtete sie das Bild. Der große, schlanke Vitali Romaniuk … Mein Gott, er wirkte in seinen Bewegungen so fein und edel … Hatte er tatsächlich zwei seiner Seemannskollegen überwältigt und ihnen mit einer Axt den Schädel eingeschlagen? Die beiden Seeleute, die laut seiner Aussage zuerst den Kapitän umgebracht und dann noch zwei weitere Seemänner ermordet hatten, bevor sie sich daranmachten, den armen Romaniuk zu jagen, der in reiner Notwehr gezwungen war, »ihre Köpfe zu spalten«, wie er es so malerisch beschrieben hatte. Oder hatte dieser Mann ganz allein die gesamte fünfköpfige Besatzung erschlagen, um die 60000 DM zu stehlen, die man bei ihm fand, nachdem man ihn aus der Nordsee gefischt hatte?
Sie weigerte sich zu glauben, dass da draußen auf hoher See nicht noch etwas anderes passiert war. Etwas, das die ganze Sache auf logische Art und Weise erklären konnte. Romaniuk war ein gerissener Halunke, aber er war kein Killer. Fünf Morde für lächerliche 60000 DM, und dann Hals über Kopf raus aufs offene Meer, in einer Rettungsinsel? Nein und nochmals nein … Weder seine eigene Erklärung noch die Theorie der Polizei waren hieb- und stichfest. Sie hatte das so oft gesagt, dass es keiner mehr von ihr hören wollte.
Hatten sie bei ihren Ermittlungen etwas übersehen? War irgendwo ein Detail versteckt, eine Spur, die weiterführen konnte?
Nein … Das musste sie den Kollegen zugestehen. Sie hatten dieses verdammte Schiff auf den Kopf gestellt, es in seine einzelnen Atome zerlegt – ohne etwas zu finden. Es war und blieb ein Rätsel …
Man hatte Romaniuk schließlich an die Deutschen ausgeliefert, weil der ermordete Kapitän ein Deutscher gewesen war. Die Sache hatte sich über drei ganze Jahre hingezogen. Zum Schluss konnte Vitali Romaniuk als freier Mann heimreisen. Die Beweislage hatte nicht ausgereicht. Sogar das Geld durfte er behalten, als er den Gerichtssaal mit einem breiten Siegerlächeln verließ.
Und jetzt lag sie hier in schwarzer Seide, rauchte im Bett und bildete sich ein, sie wäre Sherlock Holmes. Dabei konnte sie nichts anderes tun, als mit den Augen zu klimpern und honigsüß zu fragen: »Lieber Seemann, bitte erzähl mir doch die Wahrheit, ich habe so lang darauf gewartet. Wärst du so nett?«
Und doch konnte sie nicht anders. Wenn sie jetzt aufgab und diesem kleinen Stück Dreck den Rücken zudrehte, würde sie auch dem Jahr 1993 den Rücken zudrehen …
Ihr Kopf glitt langsam auf die Schulter. Sie wusste nicht, wie lange sie so gedöst hatte, als sie plötzlich mit einem Ruck aufwachte. Verdammt, warum hatte sie nicht daran gedacht, bevor sie zum Hafen ging? Sie rief jeden Abend zu Hause an, und sie vergaß es nie, ganz gleich, wo sie auch war. Die einzigen mildernden Umstände: Dass es Jonas garantiert wie Gott in Frankreich ging, bei Tante Astrid und Onkel Jørgen auf Fanø.
Sie glitt unter die Bettdecke und merkte, wie sie schnell wieder in den Schlaf fiel.
2
»Coffee, please …« Sie konnte es kaum abwarten. Sie brauchte jetzt wirklich einen Kaffee – auf der Stelle.
Es war gerade erst eine Viertelstunde her, seit sie das Seminar verlassen hatte. Sie schwänzte wie ein Schulmädchen, aber das war ihr egal.
»Das tut mir wirklich leid, Frau Portland … Ja, gute Besserung. Ich hoffe, wir sehen uns morgen.« Der Kollege von der Tallinner Polizei, ihre Kontaktperson und der Organisator der verschiedenen Veranstaltungen, hatte verständnisvoll gelächelt, als sie während des Vormittagsprogramms erklärte, dass sie wegen ihrer stechenden Kopfschmerzen leider gezwungen sei, ins Hotel zu gehen und sich ins Bett zu legen.
Es war nicht direkt gelogen, das mit den Kopfschmerzen. Obwohl sie müde und entspannt gewesen war, als sie einschlief, hatte die Nacht sich zu einem unglaublichen Marathon entwickelt. Die ganze Zeit über hatte sie versucht, vor einem unheimlichen Lächeln davonzulaufen, das sie überallhin verfolgte. Sie hatte die verrücktesten Szenen geträumt, die sich in surrealistischen, nackten Räumen mit grellen Farben an den Wänden abspielten.
Man brauchte nicht das kleine Schamanenexamen, um das zu verstehen. Der russische Seemann war eindeutig Dreh- und Angelpunkt. Sie konnte sich an keine einzelnen Worte aus dem Traumchaos mehr erinnern, aber anfänglich hatten alle Leute, denen sie begegnet war, ganz normal ausgesehen. Erst als sie mit ihr sprachen, nahmen ihre Gesichter die Züge des Seemanns an, und dieses Lächeln, das vielleicht gar kein Lächeln war, bekam unglaubliche Dimensionen. Im Traum fürchtete sie sich vor allen diesen Figuren, bis sie ihre Faust geradewegs in das verzerrte Gesicht einer alten Frau schmetterte. Da zerplatzte es wie eine Seifenblase – und sie wachte auf.
Sie hatte sich zerschlagen und unendlich müde gefühlt und einige Sekunden gebraucht, um sich darüber klar zu werden, wo sie sich befand – in einem Hotelzimmer in Tallinn.
Von dem Vortrag des Kriminalkommissars hatte sie nicht besonders viel mitbekommen. Ihre Gedanken gingen in die verschiedensten Richtungen, und es war sinnlos, das aufhalten zu wollen, was sie selbst in Gang gesetzt hatte.
Der Kaffee wurde in letzter Sekunde serviert. Sie riss ihn der Kellnerin beinahe aus den Händen, trank gierig einen großen Schluck, verbrannte sich die Zunge und zündete sich schnell eine Zigarette an.
Sie hatte die Lösung gefunden, gerade als der gute Kriminalkommissar anfing, sich über die Statistik der letzten Jahre und die guten Ergebnisse auszulassen, die sie in Tallinn erreicht hatten. Statistiken waren Teufelszeug. Nichts konnte einem die letzten Kräfte so effektiv rauben wie endlose Zahlenkolonnen.
Der Plan war in Ordnung, einfach und geradlinig. Das Problem war nur, dass sie nicht mal eben zur Reederei gehen und fragen konnte. Auf jeden Fall würde es Aufsehen erregen und Neugier wecken, wenn eine Ausländerin dumme Fragen stellte. Sie erschauderte jetzt noch bei dem Gedanken, was alles hätte geschehen können, wenn sie im Hafen festgehalten worden wäre.
Nachdem sie fast eine Stunde durch die Altstadt gelaufen war, wollte sie schon aufgegeben, ein Taxi anhalten und den Fahrer um Hilfe bitten. Sie hatte gerade den kleinen Stadtplan in der Hotelbroschüre zurate gezogen, als sie abrupt auf dem Bürgersteig stehen blieb. Ein Stück die Straße hinunter explodierte eine Farborgie dessen, was sie die ganze Zeit gesucht hatte – Blumen.
Offenbar hatten sich sämtliche Blumenhändler der Stadt verabredet, ihre Stände am Ende der Viru-Fußgängerstraße direkt vor dem östlichen Stadttor zu platzieren. Auf der rechten Straßenseite waren sie Seite an Seite unter dem gemeinsamen Dach eines flachen Geschäftsgebäudes aufgebaut. Acht, neun zum Verwechseln ähnliche Blumenstände, offenbar auch mit haargenau dem gleichen Angebot.
Sie entschied sich für den hintersten Stand. Dort gab es keine Kunden, eine Frau mittleren Alters und ein junges Mädchen standen hinter dem Tresen und unterhielten sich, fast vollkommen verdeckt von einer Blumenwand. Nina war kaum am Tresen angekommen, als die Frau sie bereits ansprach, etwas sagte, wovon sie kein Wort verstand.
»Flowers?« Ihre Frage musste einfach schwachsinnig erscheinen, stand sie doch in einer Miniaturausgabe eines Botanischen Gartens. Und sie hatte keine Ahnung, ob sie mit Englisch überhaupt weiterkam.
Die Frau nickte eifrig und lächelte übers ganze Gesicht.
»Do you speak English?«
»Moment«, antwortete die Frau und tippte dem Mädchen auf die Schulter. Das drehte sich um und fragte in formvollendetem Englisch:
»Hello, can I help you, please?«
Sie erzählte schnell ihre Geschichte: Sie wollte einem alten Bekannten einen Blumenstrauß zukommen lassen. Er hieß Vitali Romaniuk. Leider hatte sie seine Adresse nicht, war sich aber ziemlich sicher, dass er immer noch bei der Reederei Tallink arbeitete. Ob es vielleicht möglich wäre, dass sie ihr halfen? Beispielsweise im Büro der Reederei nach seiner Adresse fragten?
Das Mädchen erzählte die Geschichte schnell der Frau, die bei näherem Augenschein wohl ihre Mutter war.
»Natürlich können wir helfen. Tallinks Hauptsitz liegt gleich um die Ecke an der Pärnu Maantee«, erklärte das Mädchen mit einem Kopfnicken in die Richtung. »Meine kleine Schwester kommt nach der Schule hierher. Sie kann das mit dem Blumenstrauß herausfinden, kein Problem. An welche Blumen haben Sie gedacht?«
Während Nina ein paar rote und weiße Blumen aussuchte, fragte sie: »Kann ich dann heute Nachmittag wieder vorbeischauen und nachfragen, ob deine Schwester es herausgefunden hat?«
»Ja, gerne doch.«
»Nur sicherheitshalber …«
Sie bezahlte, legte hundert estnische Kronen für die Schwester dazu und erkundigte sich bei dieser Gelegenheit gleich nach der nächsten Apotheke.
Die Wirkung von zwei Kopfschmerztabletten setzte schnell ein. Es war erst Viertel vor zwölf, als sie die Vorhänge in ihrem Zimmer zuzog und sich aufs Bett legte. So konnte sie sich einen ausgiebigen Mittagsschlaf erlauben.
Sie hatte beschlossen, dem lächelnden Seemann am Abend einen Besuch abzustatten, vielleicht so gegen zehn. Nicht, dass dieser Zeitpunkt besonders erfolgversprechend war – womöglich arbeitete der Mann die ganze Nacht durch –, sie brauchte nur selbst etwas Zeit, um das Ganze zu durchdenken. Vorausgesetzt, dass Vitali Romaniuk tatsächlich bei Tallink arbeitete und dass es der kleinen Schwester des Mädchens vom Blumenstand gelungen war, die Adresse zu besorgen. Wenn nicht, musste sie von vorn anfangen und einen neuen Plan schmieden.
Die vielen Wenns und Abers waren aus dem Weg geräumt, als sie sich am Abend an dem kleinen Schreibtisch in ihrem Zimmer zurechtsetzte und die Haube von dem indischen Hähnchencurry abnahm, das sie bestellt hatte. Sie hatte sich das Essen aufs Zimmer bringen lassen, um nicht zu riskieren, auf einen ihrer Kollegen zu stoßen, die sich vermutlich mit einem Bier an der Bar aufwärmten, bevor sie gemeinsam zum Essen gingen.
Sie hasste es, in fester Gruppe unterwegs zu sein. Erwachsene Menschen in einer langen Kolonne im Gänsemarsch auf dem Bürgersteig, das hatte zu viel von kurzen Hosen und Pfadfindermentalität, und dann gab es immer einen Leithammel, immer war es ein Mann, der den Zeitpunkt gekommen sah, als Truppenführer aufzutreten und den Weg zu weisen, das Restaurant und den Tisch auszusuchen, um dann mit altväterlichen Bemerkungen zu kommen wie: »Na, ist das nicht nett?«, sich später die Rechnung bringen zu lassen und mit entschlossener Miene festzustellen, dass der Betrag ja umgelegt werden könnte und pro Nase soundso viel ausmachte, und »vergesst das Trinkgeld nicht«.
Mit den Reisespesen der dänischen Polizei kam man nicht besonders weit, und bereits am ersten Abend hatte sie beschlossen, dass sie keine Lust hatte, für die teuren Weine der Herren zu bezahlen, während sie selbst nur Bier trank, oder deren Cognac zum Kaffee zu finanzieren.
In ihrer Gruppe war es der Schwede Sture Magnusson, der sich dazu berufen fühlte, die vierzehn Polizeibeamten anzuführen, die sich fünf Tage lang in das Thema »Schmuggel« vertiefen und studieren sollten, wie ihre estnischen Kollegen sich zu diesem Thema verhielten. Sie waren drei Dänen, vier Schweden, vier Finnen und drei Norweger. Abgesehen von ihr war nur noch eine Frau dabei, eine Schwedin. Allein die extreme Aufmerksamkeit und die Bemühungen, die aus dieser deutlichen Minderheitsposition resultierten, waren zum Kotzen.
Um Sture Magnusson zu durchschauen, hatte sie nur wenige Minuten gebraucht, denn unglücklicherweise hatte sie am ersten Abend ihren Platz ausgerechnet neben dieser muskulösen Bestie gehabt. Er meinte einen Charme und eine Weltgewandtheit zu besitzen, die ihn, kombiniert mit ein wenig kollegialer Frechheit, für Frauen auf dem ganzen Globus unwiderstehlich machten. Dass er darüber hinaus auch noch von der Säpo kam, der schwedischen Sicherheitspolizei, machte ihn natürlich in jeder Hinsicht den anderen überlegen.
Als er begann, vor der Gruppe mit der doch wirklich absolut fantastischen Polizeiarbeit in Verbindung mit den Ermittlungen zum Mord an der Außenministerin Anna Lindh zu prahlen, verlor Nina die Geduld.
»Ja, das war wirklich ein Geniestreich, einen armen Kerl sofort festzunehmen und sein ganzes Leben vor den Medien auszubreiten. Zieht euer Chef das Geld für den Schadensersatz von eurem Monatslohn ab?«
»Nanu, meine kleine Portland, so spöttisch? Du hast sicher langjährige Erfahrung mit berühmten Mordsachen bei euch in Dänemark – oder genauer gesagt in Esbjerg, was?« Magnussons versöhnliches Grinsen war falsch, schließlich hatte er den Krieg in ihr Lager getragen, und er schien das anerkennende Nicken, das ihre Salve am Tisch ausgelöst hatte, bewusst zu ignorieren.
»Nun ja, immerhin habt ihr dieses Mal den einsamen Mörder gekriegt, den ihr so gerne habt, nicht wahr?«
Er sollte nicht ungestraft mit seinem »meine kleine Portland« davonkommen.
»Was um alles in der Welt meinst du damit?« Das überhebliche Lächeln war verschwunden, und es war still am Tisch geworden, jetzt, wo das Duell härter ausgetragen wurde.
»Ich meine nur, nachdem ihr Christer Pettersson den Palme-Mord nicht anhängen konntet. Bei Säpos großer Erfahrung kann es einen doch nur wundern, dass ihr immer noch mit leeren Händen dasteht und eine ganze Reihe unglaublicher Fehler gemacht habt.«
Was weder Sture Prahlhans noch die anderen wussten: Alles, was den Palme-Mord betraf, war für sie das reinste Heimspiel. Der Fall war ihr Hobby Nummer zwei, gleich nach der Sache mit dem russischen Seemann. Sie hatte alles gelesen, was sie über den Palme-Mord nur in die Finger kriegen konnte.
Resolut schoss sie aus der Hüfte. Zählte die Ermittlungsfehler Punkt für Punkt unter dem verblüfften Blick des Schweden auf. Die Polizeispur. Die sechs verschwundenen Minuten. Die Baseball-Liga bei der uniformierten Polizei. Die Chile-Südafrika-CIA-Spur. Sie hätte noch lange so weitermachen können. Zum Glück gelang es ihr schließlich, sich zu bremsen.
Der Mann von der Säpo hatte erstarrt mit seinem Weinglas in der Hand dagesessen und einige Zeit gebraucht, um sich zu berappeln.
»Beeindruckend, das muss ich schon sagen … Aber Palme ist ein ganz anderer Fall, verdammt kompliziert … Und es gibt da natürlich Dinge, die ich nicht ausplaudern darf, das verstehst du wohl … Aber mein Gott, lass uns jetzt nicht weiter in der Vergangenheit herumbohren, sondern diesen herrlichen Abend genießen – Skål!«
»Skål – auf die Säpo«, hatte sie gesagt.
Sie hatte bemerkt, dass sich ein Ausdruck der Erleichterung bei einigen ihrer Kollegen zeigte.
Bei dem Gedanken an den ersten Abend in der Gruppe musste sie unwillkürlich lächeln. Sie öffnete ihre Bierflasche und machte sich über das indische Currygericht her, während CNN von dem kleinen Hotelfernseher an der Wand herabflimmerte.
Nach ihrem einsamen Mahl breitete sie den neuen Stadtplan auf dem Bett aus. Das Blumenmädchen hatte ihr die Adresse des russischen Seemanns aufgeschrieben, und jetzt suchte sie im Register nach dem Straßennamen. Die Straße hieß Kopli. Da war sie, im Feld K7. Sie ließ ihren Zeigefinger suchend über den Plan gleiten. Kopli begann offenbar am Bahnhof und erstreckte sich parallel zu einem ganzen Bündel von Eisenbahngleisen in nordwestlicher Richtung. Vitali Romaniuk bewohnte Nummer 36, vermutlich fast am Ende der sich lang hinziehenden Straße, vielleicht zwanzig Minuten Fußweg entfernt.
Elf Jahre und zehn kleine, kurze Zentimeter.
Sie begann rastlos in dem kleinen Zimmer auf und ab zu gehen, ins Bad, wieder zurück, wühlte in ihrem Koffer herum, rauchte eine Zigarette, schaute aus dem Fenster auf die verkehrsreiche Narva Maantee hinunter. Mist, es hatte wieder angefangen zu regnen. Nicht so heftig wie am Abend zuvor, aber dafür ausdauernd. Sie setzte sich aufs Bett, stopfte sich die Kissen in den Rücken und zappte die Programme durch. Es war ja erst kurz nach sieben. In einer Stunde – in genau einer Stunde würde sie sich auf den Weg machen. Sie landete bei BBC World mit einem hübschen Mann in einer hübschen Jacke, der ein hübsches Englisch sprach.
Damals, vor elf Jahren, hatte ihr Telefon gegen halb vier Uhr morgens geklingelt. Sie hatte fest geschlafen, doch der Anruf vom Revier brachte sie sofort auf die Beine. Sie sollte sich bereithalten, in wenigen Minuten würde sie von einem Kollegen abgeholt werden. Beide hatten sich so schnell wie möglich am Hafen einzufinden.
Es war noch dunkel gewesen, doch der Mond hatte bleich auf die Stadt geschienen, während sie auf dem Bürgersteig wartete. Sie trug ihre verwaschene Jeansjacke und eine schwarze Jeans, die so neu war, dass sie ihr noch viel zu schwarz und steif erschien. Es war Kristian Arnum, der anhielt und sie einsammelte. Er kam direkt vom Revier, wusste aber nur, dass es um ein Schiff ging, das sie in Empfang nehmen sollten.
Im selben Moment wurden sie über Funk gerufen.
»Dieses deutsche Schiff, davon habt ihr gestern doch auch gehört, oder? Es ist auf dem Weg in den Hafen. Laugesen wartet schon unten. Er wird euch über alles weitere informieren.«
Der Wachhabende an diesem Tag war Dalmose. Er starb zwei Jahre später an einem Herzinfarkt, ein guter Mensch, dessen sanfte Stimme selbst über Funk beruhigend wirkte. Wenn Kriminalhauptkommissar Laugesen seinen Hintern in der nächtlichen Kälte und Dunkelheit Richtung Hafen bewegt hatte, dann war es ernst. Der Mann mit dem messerscharfen Kriminalistenverstand saß am liebsten konzentriert hinter seinem Schreibtisch über jeder Menge Papier. Der oberste Chef, Kriminaldirektor Birkedal, war im Urlaub. Er planschte auf einem Gummitier unten im Gardasee herum, deshalb rotierte Laugesen sicher auf Hochtouren.
Sie hatte die Gerüchte am Tag zuvor gehört – dass Laugesen am Flughafen gewesen sei, um einen Seemann abzuholen, den die Einsatzleitung der Marine mit dem Hubschrauber von der Nordsee hereingeflogen hatte. Die Fischer, die ihn aufgegriffen hatten, waren der Meinung gewesen, er hätte irgendetwas Geheimnisvolles an sich. Mehr wusste sie nicht.
Sie waren sofort zum Hafen hinuntergefahren. Am Doggerkai hielten bereits mehrere Polizeifahrzeuge.
»Portland und Arnum, lasst alles andere sausen. Ihr bleibt den Rest des Tages hier. Ich habe so ein Gefühl, als ob das ein verdammt großes Ding ist, und wenn ich recht habe, werden wir reichlich zu tun kriegen.« Hauptkommissar Laugesen lehnte sich an eine Mauer und spähte übers Wasser, das im Mondschein glitzerte.
»Sie müssten eigentlich bald reinkommen«, seufzte er und schaute auf seine Armbanduhr.
»Wer?«, hatte sie gefragt.
»Äh … ja, ein norwegisches Versorgungsschiff … Aber Alarm geschlagen hat ein Kutter oben im Norden, vor Hirtshals. Er hat gestern Blåvand Radio gerufen, und von dort kam die Meldung über das Hauptquartier der Küstenwache zu uns. Sie sind auf ein verlassenes deutsches Küstenmotorschiff gestoßen, mitten in der Nordsee, bei ruhigem Wetter … In der Nähe trieben zwei Rettungsinseln, solche orangen Dinger mit Dach und Einstieg, sehen ein bisschen aus wie Weltraumkapseln, nicht? Die eine war leer, in der anderen haben sie einen Mann gefunden, mit einem Vorrat an Cola und sechs Dosen Pfirsichen – und auch noch einer ganzen Menge Geld. Er soll aus Osteuropa stammen, wie sie sagen, vielleicht ein Russe … Jetzt sitzt er hier in Gewahrsam. Ich habe ihn gestern Nachmittag vom Flughafen abgeholt, zusammen mit Påske. Sie haben ihn mit dem Hubschrauber hergebracht. Wir wollen ihn heute vernehmen … Jedenfalls, der Kümo ist herrenlos da herumgetrieben. Ein norwegisches Versorgungsschiff, das in der Nähe war, ist längsseits gegangen und hat ein paar Männer an Bord geschickt. Und später sind auch noch Leute von einem anderen Hirtshals-Kutter dazugekommen. Es waren Spuren von Brandstiftung an Bord und wohl auch Blutspuren – aber keine Leichen. Und jetzt sind die Norweger unterwegs hierher. Mit dem Kümo im Schlepptau. Das stinkt nach einer großen, widerlichen Sache …«
Kriminalhauptkommissar Laugesen machte ein sonderbar besorgtes Gesicht, als er seine Pfeife an der Schuhsohle ausklopfte.
Es verging nur eine knappe halbe Stunde, dann konnten sie endlich das Versorgungsschiff sehen. Wie ein dunkler Schatten, nur mit einzelnen Positionslichtern bestückt, glitt es langsam um Fanøs Nordspitze herum, die wie eine flache Hutkrempe im Meer lag. Es erschien ihnen wie eine Ewigkeit, bis die Norweger endlich in Grådyb angekommen waren, sich durch die Hafeneinfahrt manövriert und den deutschen Kümo in den Dokhavn bugsiert hatten.
Die ganze Kette an Polizeifahrzeugen fuhr eilig dorthin. Neben den Kollegen warteten einige Hafenarbeiter der Nachtschicht am Kai, entweder, weil sie beim Anlegen gebraucht wurden, oder weil ihnen die Sensation zu Ohren gekommen war. Um Viertel nach vier machten sie sich an die Arbeit.
Es waren die alten Hasen Larsen und Påske, die zuerst aufs Fallreep und an Bord der MS Ursula kommandiert wurden, die am Vestre Dokkaj festgemacht hatte.
»Seid vorsichtig«, rief Laugesen. »Wo zum Teufel bleibt denn die Spurensicherung? Die sollte doch schon längst da sein.«
Sie selbst brauchte nur ein paar Minuten an Bord, bis ihr klar wurde, dass Laugesen recht hatte: Das stank nach einer dicken, widerlichen Geschichte. Man brauchte kein Kriminaltechniker zu sein, um Blut, Haare und Reste von Menschenhaut zu erkennen, wenn man die Planken im Schein einer Taschenlampe absuchte. Als die Sonne wenig später aufging, waren sich alle klar darüber, dass sie vor einer großen Herausforderung standen.
Ein neuer Zwilling des vorherigen Sprechers tauchte auf dem Bildschirm auf, dieses Mal eine hübsche Frau in einer hübschen Hemdbluse mit einem hübschen Englisch. Nina hörte immer noch nicht zu, zappte stattdessen ein wenig hin und her, landete dann aber doch wieder bei BBC World.
Die Welt war schon merkwürdig. Damals am Kai hatte sie natürlich noch nicht ahnen können, dass der Fall ihr im Laufe der kommenden dreieinhalb Monate, bis sie den Mann an die Deutschen übergeben mussten, einen Berg an Überstunden bescheren würde. Und sie konnte auch nicht ahnen, dass der russische Seemann für sie zu einer Obsession werden sollte, die sie jetzt nach mehr als elf Jahren wieder mit gleicher Wucht gepackt hatte.
»Liebe Mitwirkende, wollen Sie weitermachen?« Wenn es zwei Knöpfe gäbe, einen Ja- und einen Nein-Knopf, die man drücken könnte, jedes Mal, wenn man in seinem Leben an einen Scheideweg kam, dann würde sie aus heutiger Sicht keine Sekunde zögern. Sie hätte an diesem Morgen unten im Hafen auf Nein gedrückt. All die Stunden, all die Spekulationen, was für eine verdammte Menge Energie hatte sie auf Arbeit vergeudet, die nie zu etwas führen würde.
Die Wartezeit im Hotelzimmer wurde ihr unerträglich. Sie schaltete die hübsche BBC-Dame aus. Ungeduld und Nervosität trieben sie in den Mantel und hinaus in den Regen, lange bevor sie eigentlich hatte aufbrechen wollen.
Die Gegend hinter dem Bahnhof wurde von einem lang gestreckten Marktplatz dominiert. Einige Betreiber hatten ihre Buden schon geschlossen, andere waren dabei, einzupacken, während wieder andere die Hoffnung auf ein Schnäppchen vor Ladenschluss noch nicht aufgegeben hatten. Die Beleuchtung variierte von ein paar schwachen Glühbirnen, die an einem nackten Kabel unter einem Sonnenschirm hingen, bis zu einem Meer von Kerzen auf einem Teller mitten in einer reichen Auswahl an Gemüse.
Manche Gassen mit ihren schmalen Häusern lagen fast ganz im Dunkel, in anderen sprangen vereinzelt Schatten hervor und begannen ein Eigenleben. Irgendwo in der Dunkelheit duftete es nach würzigem Fleisch, dann hörte sie das Geräusch klirrender Flaschen. Unter einer löchrigen Markise saßen ein Mann und eine Frau mit ihrem Angebot an Krimskrams, von altem Zaumzeug über abgenutzte Autoreifen bis hin zu Zündkerzen. Ihr eigener Lebensfunke schien schon vor langer Zeit erloschen. Sie hockten alt und runzlig unter Schichten von Decken und dicken Mänteln.
Hier machte man offensichtlich seine Einkäufe, wenn das Geld knapp war und nicht für einen Besuch in den extravaganten Geschäften der Altstadt reichte. Nach dem Untergang der alten Ordnung war hier eine merkwürdige dunkle Welt entstanden, bevölkert von Gestalten, die jeden Tag ums Überleben kämpften, und anderen, die sich eher zufällig hier herumtrieben, so wie sie selbst.
Sie sah auf ihre Uhr. Jetzt war es so weit. Sie ging an den Buden parallel zu der Straße entlang, die Kopli hieß. Zwei Männer mittleren Alters hatten in einem der Aufgänge Schutz vor dem Regen gesucht, und während sie sich wachsam umsahen, wechselte eine Plastiktüte ihren Besitzer. Sie stapfte durch eine Matschpfütze und überquerte die Straße.
Die Hausnummern bestätigten ihr, dass sie das richtige Ende erwischt hatte. Es war nicht mehr weit bis Nummer 36. Die linke Seite der Kopli-Straße war nichts anderes als eine Reihe von Holzlatten und Blechplatten, die das Rangiergelände abschirmten. Sie ging den Fußweg unter den Bäumen auf der anderen Seite entlang. Alle Häuser waren aus Holz gezimmert, ein oder zwei Stockwerke hoch, einzelne sahen gut erhalten aus, aber die meisten schienen ziemlich heruntergekommen zu sein.
Da war Nummer 30 … Sie verlangsamte ihre Schritte. Ein Mann mit seinem Hund an der Leine ging an ihr vorbei. Aus einem Lokschuppen war der ohrenbetäubende Lärm von zwei Zugteilen zu hören, die aneinandergekoppelt wurden, und der Stoß pflanzte sich bis in ihre Fußsohlen fort. Nummer 32, windschief, hinter den Gardinen schwaches Licht, Nummer 34 ohne Licht. Nummer 36 – baufällig. Eine morastige Einfahrt führte in einen Hinterhof mit Schuppen und Ställen. War da ein Lichtschimmer zwischen den Gardinen? Nein … Nummer 36 lag im Dunkeln. Sie ging langsam vorbei. Ein paar Häuser weiter blieb sie unter einem Baum stehen und schaute zurück. Der holprige Bürgersteig war leer. Das Haus, das wahrscheinlich einmal gelb gewesen war, lag mit eingeschlagenen Kellerfenstern wie tot da. Auch eines der Fenster im ersten Stock war mit Brettern zugenagelt.
Sie ging zurück und drückte vorsichtig die Türklinke herunter. Vielleicht war doch jemand zu Hause? Die Bewohner konnten sich ja in einem Zimmer zum Hinterhof hin aufhalten. Die Haustür war verschlossen. Nein, sie klemmte nur. Sie musste mit der Schulter dagegendrücken, um sie zu öffnen. Der Eingangsflur war kohlrabenschwarz und stank nach feuchtem Holz und abgestandener Luft. Sie hielt ihr Feuerzeug in die Höhe. An der Wand neben der Treppe hing ein Stück Papier an einem Nagel. Darauf standen zwei Namen. Obwohl sie mit kyrillischen Buchstaben geschrieben waren, hatte sie keinen Zweifel – hinter der Zahl 1 stand »Romaniuk«.
Eine nackte Birne hing von der Decke herab, aber sie machte sich erst gar nicht die Mühe, den Lichtschalter zu suchen.
Die untersten ausgetretenen Stufen knackten und knarrten, dass es im ganzen Haus zu hören sein musste. Sie blieb einen Augenblick stehen und überlegte. Dann stieg sie trotz des unheimlichen Gefühls, das jeden Schritt begleitete, die Treppe weiter hinauf.
Sie klopfte an die Tür, zuerst vorsichtig, dann immer heftiger – doch es passierte nichts. Nach einem Moment des Zögerns holte sie ihr Taschenmesser heraus und versuchte, die große Klinge zwischen Tür und Rahmen zu stecken. Im Film war das immer so leicht. Jeder konnte mit einem abgelutschten Pommes frites das beste Schloss öffnen, aber in der realen Welt war es verdammt schwer, und es gab kein Fach in der Polizeischule, das da hieß »Wie ich einen Einbruch begehe«.
Sie setzte sich auf den Treppenabsatz, holte das Zigarettenpäckchen aus der Innentasche und zündete sich eine an. Und jetzt? Sie war entschlossen, hier stundenlang zu warten, wenn es sein musste, und wenn das nichts brachte, würde sie es morgen wieder versuchen – und am nächsten und am übernächsten Tag. Sie würde jeden verdammten Tag herkommen und klopfen, bis sie wieder nach Hause musste. Vorsichtig streifte sie die Asche an der obersten Stufe ab, saß nur da, starrte in die Dunkelheit und horchte auf die Geräusche vom Rangiergelände.
Als die Zigarette von allein ausging, fasste sie einen Entschluss. Im Licht des Feuerzeugs strich sie die Asche in die hohle Hand und schlich die Treppe wieder hinunter.
Der Hinterhof war ein einziger Morast mit abbruchreifen Schuppen, alten Autowracks und anderem Müll, den sie nicht identifizieren konnte, und kaum hatte sie ein paar Schritte getan, landete sie bereits in einer Pfütze aus schlammigem Regenwasser und spürte, wie es ihr in die Schuhe lief. Sie sprang auf einen umgeworfenen Kühlschrank und balancierte weiter über einen Haufen Alteisen und das Dach eines der Autowracks. Von hier aus konnte sie bequem auf das Dach eines Schuppens klettern, der ans Haus gebaut worden war. Im ersten Stock gab es einen kleinen Balkon oder besser gesagt die Reste eines Balkons. Das Geländer fehlte, aber der größte Teil des Fußbodens war noch da, und die Balken und dreckigen Bretter schienen solide genug, um sie zu tragen. Vorsichtig kroch sie auf die Plattform und richtete sich langsam auf.
Es war eine Sache, sich unbefugt auf dem Hafengelände aufzuhalten. Vielleicht hätte sie sich da noch herausreden können. Und wenn es ihr gelungen wäre, die Tür zu öffnen, hätte sie behaupten können, sie sei nur angelehnt gewesen. Aber gerade war sie im Begriff, einen Einbruch zu begehen. Das konnte sie Kopf und Kragen kosten, wenn man sie erwischte.
Dänische Kriminalbeamtin bei Einbruch in Estland gefasst – klang das nicht hinreißend?
Es schien, als sei die Balkontür verschlossen, und sie traute sich nicht, mit aller Kraft daran zu ziehen, denn wenn sie plötzlich nachgab, würde sie mehrere Meter tief fallen und rückwärts im Dreck landen. Stattdessen stieß sie mit dem Ellbogen durch eine der Glasscheiben, tastete an der Türinnenseite entlang und fand einen einfachen Riegel. Ein Teil der Türschwelle gab mit nach, als sie endlich die Tür aufbekommen hatte und das Revier des Seemanns betreten konnte.
Sie stand in einer kleinen Küche mit Linoleumfußboden. Es roch auch hier feucht, doch gemischt mit Nikotin und dem süßlichen Gestank von Abfällen. Im Schein ihres Feuerzeugs erkannte sie einen Berg schmutzigen Geschirrs auf der Küchenanrichte und Plastiktüten mit Abfall, die sich in einer Ecke stapelten. Sie trat in den Flur, der von alten Zeitungen und Schuhen übersät war, und weiter in ein Wohnzimmer. Auch dort war es nicht ordentlicher. Mitten im Raum stand ein riesiger Pappkarton, und rundherum lagen Plastik und Styropor verstreut, während der funkelnagelneue Sony-Fernseher seinen Platz auf einer Kommode neben einem Fenster bekommen hatte. Ein gekachelter Couchtisch war vollgestellt mit Bierflaschen und Gläsern, und irgendjemand hatte wohl den Aschenbecher auf den Boden gefeuert, wo er zwischen Asche und Zigarettenstummeln lag.
Vitali Romaniuk hatte damals vor elf Jahren auf der MS Ursula die gleichen Probleme gehabt, Ordnung zu schaffen, aber es war ihm zumindest gelungen, die Leichen über Bord zu werfen. Das hätte er doch auch mit dem schmutzigen Geschirr machen können …
Rasch ging sie durch alle Räume, um sich einen Überblick zu verschaffen. Da gab es ein kleineres Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad, das ekliger war als das Klo in einem dänischen Eisenbahnzug. Im Schlafzimmer standen Schrank und Kommode weit offen. Darin war Männerkleidung, und auch wenn dieser russische Seemann anscheinend das verlotterte Leben eines Junggesellen führte, war er offenbar nicht ganz so unordentlich, wie es zunächst den Anschein hatte. Es sah eher so aus, als hätte er es eilig gehabt, wegzukommen.
Beruhigt von dieser Feststellung zog sie die Vorhänge zu und machte Licht. Sie erwartete nicht, die Antwort darauf zu finden, warum der Mann Hals über Kopf abgehauen war. Im Grunde erwartete sie nichts anderes als eine gewisse Anzahl von Details, ungefähr wie an einem Tatort, die ihr ein wenig Einsicht in sein Leben geben konnten, nur ein wenig ihre Neugier befriedigen, jetzt, da sie endlich am Ende des Weges angekommen war.
Sie begann die Wohnung sorgsam zu durchsuchen. Ging dabei methodisch vor und arbeitete sich von der Küche aus systematisch durch die Zimmer. Weder in der Küche noch in dem kleinen Raum war etwas Interessantes zu finden.
Eine gewissenhaftere Untersuchung des Schlafzimmers bestärkte ihren Verdacht, dass Vitali Romaniuk es eilig gehabt hatte. Es sah so aus, als hätte er im wahrsten Sinne des Wortes seine Kleider von den Bügeln gerissen, wobei einige zu Boden gefallen waren. Sie stellte sich auf einen Stuhl und schaute von oben auf den Schrank. Der war von einer dicken Staubschicht bedeckt, ausgenommen ein Rechteck, dessen Größe genau der eines Koffers entsprach. In einer Schublade im Nachttisch fand sie ein Päckchen Kondome auf zwei Pornoheften, also war der gute Seemann in seiner Freizeit jedenfalls kein Mönch gewesen.
Im Wohnzimmer, zwischen den Bierflaschen, lag der Garantieschein für den neuen Fernseher. Er war vor drei Tagen gekauft worden, also einen Tag, bevor sie Romaniuk auf der Fähre gesehen hatte. Wenn er es überhaupt gewesen war: Konnte ihn ihr Anblick so in Panik versetzt haben, dass er einfach abgehauen war? Und wenn ja – warum?
Auf einem Regal fand sie ein Fotoalbum, das genauso unorganisiert war wie die alltägliche Umgebung des Mannes. Es enthielt Familienfotos, Bilder aus seiner Jugend mit seinen Schulkameraden, Fotos aus seiner Militärzeit, anscheinend bei der Marine, gestellte Aufnahmen von ihm und verschiedenen Besatzungsmitgliedern aus seiner Zeit als Seemann. Alles ganz normale Fotos – in keiner Weise verdächtig, einfach nur langweilige, fantasielose Bilder. Eine Regalschublade quoll von Papieren nur so über, die meisten sahen offiziell aus, einige davon waren auf Russisch, und mehrfach tauchten die Worte »Tallinn«, »Estland« und »Tallink« auf. Sie sahen aus wie Papiere von Behörden und Arbeitgebern, genau wie die Dokumente, die sie selbst zu Hause hatte, nur dass ihre abgeheftet waren.
Erst in der untersten Schublade entdeckte sie etwas Interessantes. Ein kleines Notizbuch mit Plastikeinband, das in einem Umschlag lag. Einige Blätter waren herausgerissen worden. Auf den ersten Seiten stand etwas gekritzelt, das aussah wie Rechenaufgaben, danach kam eine Seite mit zwei Namen, darunter je eine Nummer. Vielleicht Telefonnummern? Die Namen waren in kyrillischer Schrift geschrieben und ergaben für sie erst einmal keinen Sinn. Sie riss eine weitere Seite heraus, schrieb sorgfältig die Schriftzeichen und die Nummern ab und steckte den Zettel in die Tasche.
Noch ein letztes Mal sah sie sich in allen Zimmern um. Mehr war wohl kaum herauszukriegen. Morgen würde sie Vitali Romaniuk eine weitere Chance geben, diesmal die Wohnungstür nehmen und höflich anklopfen – aber sie hatte das deutliche Gefühl, dass er in nächster Zeit nicht an die Tür kommen und sie öffnen würde.
3
Der junge Mann an der Rezeption lächelte ihr freundlich zu und begrüßte sie mit: »Guten Morgen, Frau Portland.«
Überrascht erwiderte sie sein Lächeln. Ob das Personal wohl seinen ganzen Ehrgeiz daransetzte, sich die Namen aller Gäste zu merken?
Sie war früh aufgestanden, so früh, dass sie ihr kleines Unternehmen vorbereiten und sogar noch in Ruhe frühstücken konnte, bevor Sture Magnusson und die anderen herunterkamen und sich vermutlich darüber unterhalten würden, wie angenehm und nett der gestrige Abend doch gewesen war, während sie ja leider im Bett liegen und sich gesundschlafen musste.
Sie legte den kleinen Zettel auf den Tresen vor dem jungen Mann.
»Ob Sie so nett sein könnten und mir sagen, was da steht?« Sie zeigte auf die Namen aus dem Notizbuch des Seemanns.
»Aber natürlich. Das ist Russisch, es sind die Namen von Frauen … Die erste heißt Jelena Mastykina, die andere Larisa Tarasowa. Die Nummern sind Telefonnummern, hier aus dem Tallinner Netz.«
»Und könnten Sie mir auch noch den Gefallen tun und die Auskunft anrufen, wenn es so etwas gibt, und nach den beiden Adressen fragen?«
»Aber selbstverständlich.«
Der junge Mann setzte sich ans Telefon, sprach einen kurzen Moment, während er sich etwas notierte, dann kam er zurück.
»Da haben wir’s. Die erste Nummer ist nicht mehr in Gebrauch, da gibt es also keine Adresse. Zu dem anderen Namen, Larisa Tarasowa, habe ich eine Adresse bekommen: Liivamäe 10. Ich habe sie hier aufgeschrieben, bitte schön.«
»Vielen Dank für Ihre Hilfe.«