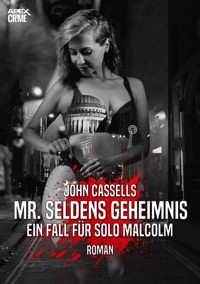6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv Solo Malcolm hat nichts gegen Kontakte mit der Unterwelt - sofern ihm diese Kontakte nützlich sind. Diesmal erhofft er sich einen wertvollen Tipp für einen neuen Auftrag. Als Solo zu den Treffpunkt im Londoner Hafenviertel kommt, ist Lew Eckler bereits da. Doch der Gangster wird ihm nichts mehr verraten - er ist nämlich tot... Der Roman SOLO IM KESSELTREIBEN um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1969. Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JOHN CASSELLS
SOLO IM KESSELTREIBEN
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
SOLO IM KESSELTREIBEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Impressum
Copyright © by William Duncan Murdoch/Signum-Verlag.
Published by arrangement with the Estate of William Duncan Murdoch.
Original-Titel: Murder On The Duchess.
Übersetzung: Mechtild Sandberg.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
Privatdetektiv Solo Malcolm hat nichts gegen Kontakte mit der Unterwelt - sofern ihm diese Kontakte nützlich sind. Diesmal erhofft er sich einen wertvollen Tipp für einen neuen Auftrag.
Als Solo zu den Treffpunkt im Londoner Hafenviertel kommt, ist Lew Eckler bereits da. Doch der Gangster wird ihm nichts mehr verraten - er ist nämlich tot...
Der Roman Solo im Kesseltreiben um den Privatdetektiv Solo Malcolm aus der Feder des schottischen Schriftstellers John Cassells (ein Pseudonym des Bestseller-Autors William Murdoch Duncan - * 18. November 1909; † 19. April 1975) erschien erstmals im Jahr 1961; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1969.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
SOLO IM KESSELTREIBEN
Erstes Kapitel
Nach dem Mädchen hätte sich jeder Mann umgedreht. Sie war groß und schlank und feingliedrig, und das honigfarbene Haar hing ihr lose auf die Schultern herab. Sie hatte klare, ebenmäßige Züge und einen Mund, der vielleicht eine Spur zu groß war - aber mir persönlich gefällt das. Ich fand, zu diesem Gesicht gehörten blaue Augen, doch im Moment war sie zu weit weg, als dass ich die Farbe ihrer Augen hätte erkennen können.
Sie stand an der Tür zu meinem Büro am Adrian Walk. Die langen, weißen Finger umschlossen fest die Klinke. Sie trug einen grünen Plastikregenmantel, auf dem Wassertropfen glänzten. Etwa dreißig Sekunden lang stand sie so da und musterte mich wortlos.
Ich stand auf. Ich sah, wie sich der Ausdruck ihrer Augen veränderte, als ich mich aufrichtete, doch noch immer hüllte sie sich in Schweigen.
»Guten Tag«, sagte ich. »Mein Name ist Malcolm - Solo Malcolm. Was kann ich für Sie tun?«
Langsamen Schrittes trat sie ein und schloss behutsam die Tür hinter sich. Dann lehnte sie sich mit dem Rücken gegen die Füllung der Tür. Unbewegt blieb sie so stehen, während ich um meinen Schreibtisch herumging.
»Mein Name ist Joyce Locke«, erklärte sie schließlich.
Ich ließ mich auf dem Schreibtischrand nieder. Das alte Möbel ächzte unterdrückt.
Sie runzelte die Stirn.
»Sind Sie dafür nicht ein bisschen schwer?«, meinte sie.
»Kann sein. Der Schreibtisch ist daran gewöhnt. Er hält’s aus. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Verraten Sie mir lieber, was Sie zu mir führt.«
Sie löste sich von der Tür und kam langsam auf müh zu. Ja, ihre Augen waren blau - tiefblau wie Kornblumen. Sie sah mich an und lächelte ein klein wenig; doch ihre Hände waren ineinander gekrampft, als koste es sie Anstrengung, ihre Gelassenheit zu bewahren. Sie trat zu dem Stuhl, der für meine Besucher bereitsteht.
»Kann ich mich setzen?«
»Bitte. Dazu ist der Stuhl ja da.«
Sie setzte sich.
»Danke.«
Sie öffnete ihre Handtasche und nahm eine Packung Zigaretten heraus. Dann nahm sie eine Zigarette aus der Packung und wartete darauf, dass ich ihr Feuer geben würde.
Ich reagierte nicht. Ich blieb ruhig sitzen und sah zu, wie sie in ihrer Tasche nach Streichhölzern suchte. Schließlich steckte sie die Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Dann strich sie sich glättend über den Wollrock, den sie trug und blickte zu mir auf.
»Nun, mein Fräulein?«, fragte ich.
»Frau«, verbesserte sie und blickte auf den Ring an ihrem Finger.
Es war ein schmaler Reif aus Weißgold. Er sah neu aus. Verständlich, dachte ich. Sie war ja noch so jung, höchstens fünfundzwanzig.
»Mrs. Locke«, sagte sie, und es klang ein wenig schüchtern, als müsste sie sich selbst erst an den Klang des Namens gewöhnen. »Mrs. Allan Locke.«
Ich war ein wenig verwundert. Die meisten verheirateten Frauen nämlich, die James Solo Malcolm in seinem Büro aufzusuchen pflegen, kommen nur, weil sie die Fesseln der ehelichen Gemeinschaft möglichst rasch abzustreifen wünschen. Von mir bekommen sie alle die gleiche Antwort. Für dieses Spiel bin ich nicht zu haben.
Sie saß schweigend da und rauchte, während sie mich aufmerksam ansah.
»Ich brauche Hilfe«, bemerkte sie schließlich.
»Seit wann sind Sie verheiratet?«, fragte ich.
»Seit zehn Tagen.«
»Und da brauchen Sie jetzt schon Hilfe? Anscheinend ein kurzes Glück.«
Sie lächelte schwach. »Sie missverstehen mich.«
»Keine Scheidung?«
»Nein. Ich liebe meinen Mann.«
»Das hört man selten in meinem Beruf. Ich hoffe, Sie entschuldigen mein Erstaunen.«
Sie wirkte leicht verblüfft.
»Ist das Ihr Ernst?«
»Gewiss. Die meisten meiner Klientinnen gestehen mir früher oder später schamhaft, dass ihnen ihr Ehemann zuwider ist.«
Sie starrte auf die Zigarette in ihrer Hand.
»Sie sind ein Zyniker«, bemerkte sie.
»Ja, vielleicht. Mein Beruf hat mich dazu gemacht. Deshalb versuche ich auch immer gleich reinen Tisch zu machen, ehe gutaussehende junge Damen versuchen, mich zu etwas zu überreden, dem ich nicht zustimmen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf diese Weise am leichtesten mit den Dingen fertig wird. Man macht ihnen seinen Standpunkt klar, noch ehe sie anfangen, ihr Herz auszuschütten. Wenn man sie nämlich erst zu Wort kommen lässt, ist es meist nicht so einfach, sie wieder zum Schweigen zu bringen.«
»Sie glauben also nicht an Scheidung?«, meinte sie nachdenklich.
»Ganz recht. Wie man sich bettet, so liegt man. Das ist meine Devise. Deshalb will ich mit solchen Sachen nichts zu tun haben. Ich verdiene mir mein Geld lieber auf andere Art.« Ich zog meine Pfeife aus der Tasche und begann, sie zu stopfen. »Und jetzt wissen Sie Bescheid. Für Scheidungssachen bin ich nicht zuständig. Wenn Sie ein anderes Problem haben, bin ich gern bereit, es mir anzuhören.«
Ich stand auf, ging um meinen Schreibtisch herum und ließ mich in dem Sessel dahinter nieder.
Sie wandte keinen Blick von mir.
»Sie müssen gut hundertachtzig Pfund schwer sein und sind bestimmt eins sechsundachtzig groß«, stellte sie fest.
»Falls Sie sich für meine Maße und Gewichte interessieren«, versetzte ich, »bin ich gern bereit, Ihnen genaue Angaben zu machen. Allerdings sehe ich nicht ein, inwiefern das von Bedeutung sein sollte.«
Ihr Körper zitterte leicht. Es war ein seltsames Zittern. Ich sah, wie ihre Lippen bebten und ihre Hände sich noch mehr ineinander krampften. Sie saß da und blickte mich an. Nach einigen Sekunden beruhigte sie sich wieder. Doch ich wusste jetzt, dass sie Angst hatte. Sie beugte sich vor und drückte die halbgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus.
»Es ist von großer Bedeutung«, sagte sie leise. »Ich meine, Ihre Körperkraft und Ihre Größe. Ich brauche jemanden wie Sie. Jemanden, der mich schützen kann - und ihn.«
Ich antwortete nichts.
Sie sah mir in die Augen.
»Haben Sie jemals in Ihrem Leben Angst gehabt?«
»Natürlich. Oft sogar.«
Wieder zog sie zitternd die Schultern zusammen. Ich blickte auf ihre Hände und sah, dass das Nagelbett ihres linken Zeigefingers rot und entzündet war. Noch während ich darauf niederblickte, begann sie ganz automatisch, ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, an der Nagelhaut zu zupfen.
»Ich brauche Hilfe, Mr. Malcolm«, flüsterte sie. »Ich brauche unbedingt jemanden, der mir helfen kann. Ich kann Ihnen gar nicht erklären, wie verzweifelt meine Lage ist.«
»Versuchen Sie es trotzdem einmal.«
»Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll«, sagte sie müde. »Ich meine - ich weiß natürlich, was ich Ihnen sagen will und worum ich Sie bitten möchte, aber ich - ich habe Angst, etwas Verkehrtes zu sagen und Sie...«
»Mrs. Locke, versuchen wir doch zuerst einmal, einige grundlegende Fragen zu klären. Der Rest ergibt sich dann vielleicht ganz von selbst. Sie brauchen meine Hilfe. Sie stecken also offensichtlich in irgendwelchen Schwierigkeiten. Gut. Erste Frage: Haben Sie gegen das Gesetz verstoßen?«
Sie blickte verblüfft auf. »Nein, nein. Es ist nichts dergleichen.«
»Gut. Das ist immerhin etwas. Zweite Frage: Wollen Sie von mir verlangen, gegen das Gesetz zu verstoßen?«
»Nein, nein. Keinesfalls.«
»Fein, damit wäre auch dieser Punkt zur Zufriedenheit geklärt. Ich bin ein gesetzestreuer Bürger, wissen Sie. Und außerdem habe ich einen Ruf zu verlieren. Da ich das nicht riskieren möchte, bin ich vorsichtig. Ich habe ein paar gute Freunde hier in der Stadt, die mir die Stange halten, ganz gleich, was geschieht. Ich habe aber auch eine ganze Reihe von Feinden, denen es ein Vergnügen wäre, mich anzuschwärzen und, wenn möglich, zu ruinieren. Sie sehen, dass ich vorsichtig sein muss. So - und jetzt erzählen Sie mir einmal, worum es geht.«
Sie begann wieder, an dem entzündeten Fingernagel zu zupfen.
»Tun Sie das lieber nicht«, sagte ich. »Sie haben so hübsche Hände!«
Sie erstarrte. »Ich - ich bin wahrscheinlich nervös. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich...« Sie blickte auf ihre Hände nieder. Ein wenig Blut quoll aus der Wunde an ihrem Finger. »Tut mir leid. Ich werde versuchen, mich zusammenzunehmen. Die Sache ist so wichtig. Viel wichtiger, als Sie sich vorstellen können.« Ihre Stimme schwankte. »Ich werde Ihnen alles soweit wie möglich erklären. Aber Sie müssen mir eines versprechen.«
»Ja?«
Sie schüttelte ungeduldig den Kopf.
»Sind Sie bereit, mir das zu versprechen, worum ich Sie bitten werde?«
»Ich kaufe nicht die Katze im Sach, Mrs. Locke.«
»Oh.« Sie dachte einen Augenblick nach. »Ich wollte Sie nur bitten mir zu versprechen, dass Sie absolutes Stillschweigen bewahren werden, falls Sie sich nicht entschließen können, mir zu helfen. Kann ich mich darauf verlassen?«
»Ach so. Ja, das geht ohne Schwierigkeiten. Sie möchten die Angelegenheit vertraulich behandelt sehen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das kann ich Ihnen versprechen - vorausgesetzt, Sie machen mich nicht zum Mitwisser einer verbrecherischen Handlung. Reicht Ihnen diese Zusicherung? Mehr kann ich nicht tun.«
Sie schloss die Augen, als könne sie so besser nachdenken.
»Also gut, Mr. Malcolm«, sagte sie dann. »Ich will es riskieren.«
Sie hob ihre Handtasche vom Boden auf und öffnete sie. Aus einem Seitenetui nahm sie ein Bündel Geldscheine, das mit einem Gummiband zusammengehalten war. Sie streifte das Gummiband ab und warf Fünf-Pfund-Noten auf den Schreibtisch, als teilte sie ein Kartenspiel aus.
Einen Moment lang sah ich ihr schweigend zu. Auf dem Schreibtisch häuften sich die Geldscheine.
»Schon gut, schon gut«, bemerkte ich schließlich. »Sie haben mich hinreichend beeindruckt.«
»Interesse, Mr. Malcolm?«
»Für Geld interessiere ich mich immer. Doch was soll diese Vorstellung bedeuten?«
»Damit wollte ich Ihnen nur beweisen, dass es mir ernst ist. Ich wollte Ihnen zeigen, wie wichtig die Sache ist. Ich glaube, Ihnen ist nicht klar, wie sehr...« Sie zuckte die Achseln. »Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Zählen Sie das Geld.«
Ich begann die Scheine einzusammeln. Sie knisterten in meinen Fingern. Sechsundzwanzig Fünf-Pfund-Noten. Ich schichtete sie säuberlich aufeinander.
»Einhundertdreißig Pfund«, verkündete ich.
Sie warf die restlichen Scheine auf den Schreibtisch.
»Das sind insgesamt fünfhundert Pfund. Soviel bin ich bereit zu zahlen, Mr. Malcolm.« Sie beugte sich über den Schreibtisch zu mir. »Sie können das Geld gleich haben, wenn Sie wollen. Sie können aber auch...«
»Wofür?«
Sie dachte einen Moment nach.
»Für etwa zwei Wochen Arbeit. Keinesfalls mehr. Sie brauchen nur da zu sein, sonst nichts.«
»Sie wollen sich also meinen Schutz teuer erkaufen?«
»Ja, so kann man es nennen.«
»Das klingt sehr verlockend«, stellte ich fest, »aber ich habe ein Gewissen.«
»Was soll das heißen?«
»Sie geben mir einen Auftrag, Mrs. Locke. Jeder Auftrag wird nach Tarif bezahlt. Mehr kann ich nicht nehmen.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich habe Geld genug, Mr. Malcolm. Ich könnte Ihnen ebenso gut tausend Pfund bezahlen.« Sie zögerte kurz. »Ich will offen mit Ihnen sein. Ich dachte, Sie würden anfangen zu feilschen, und dementsprechend habe ich mich vorbereitet. Hier habe ich weitere fünfhundert Pfund.« Sie hielt die Handtasche schräg, so dass ich hineinsehen konnte.
Ein zweites Bündel Geldscheine lachte mir entgegen. Doch das war nicht alles, was die Tasche enthielt.
Auf dem Grund der Handtasche blitzte eine Pistole.
Zweites Kapitel
»Für Schusswaffen habe ich nicht viel übrig, Mrs. Locke«, bemerkte ich.
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich auch nicht. Ich habe Todesangst vor den Dingern. Ich habe nie in meinem Leben eine Waffe abgefeuert. Aber ich brauche sie. Ich würde sie nicht benutzen, aber ich brauche sie.«
»Wieso?«
»Ich brauche sie einfach. Das gehört zu meiner Geschichte.«
»Schusswaffen sind oft tödlich«, versetzte ich. »Ich würde Ihnen raten, das Ding lieber nicht mit sich herumzutragen. Eine Waffe kann einem auch nicht helfen, wenn man in der Klemme sitzt. Sie macht die Dinge höchstens noch schlimmer.«
Sie nahm die Waffe heraus. Es war eine kleine schwarze Pistole. Sie hielt sie ungeschickt in der Hand und starrte darauf nieder.
»Walther hat sie mir gegeben. Er ist ein Bekannter von mir. Er meinte, es wäre besser, wenn ich eine Waffe bei mir hätte - nur für den Fall...«
»Ist sie geladen?«
»Ja.«
»Stecken Sie sie weg. Und sobald Sie mein Büro verlassen haben, lassen Sie sie verschwinden.«
Sie ließ die Pistole wieder in ihre Handtasche fallen. Einen Moment saß sie da und blickte mich fragend an.
»Nun, was meinen Sie?«, fragte sie dann.
»Erzählen Sie mir den Rest der Geschichte.«
Ihr Gesicht leuchtete auf.
»Dann wollen Sie mir also helfen?«
»Zunächst will ich mir die Sähe erst einmal anhören.« Ich steckte meine Pfeife an und lehnte mich zurück. »Erzählen Sie mir alles, was ich wissen muss. Lassen Sie nichts aus.«
»Gut.« Sie sh wieg einen Moment, um sich zu sammeln. »Es ist eigentlich gar keine sonderlich verwickelte Geschichte. Ich meine, es ist alles ganz klar und...«
»...und trotzdem brauen Sie eine Waffe?«
»Ja. Wenn man mit diesen Leuten zu tun hat, braucht man irgendetwas, um sich zu schützen. Walther hatte recht. Wenn Allan ein Mensch wie Sie wäre, dann lägen die Dinge vielleicht anders. Aber er ist nicht so...« Sie stellte ihre Handtasche wieder auf den Boden. »Also, lassen Sie mich anfangen. Zunächst wollen Sie sicherlich erst einmal näheres über mich persönlich wissen. Erinnern Sie sich an Lawson Demeter?«
»Sie meinen den Professor, der vor ungefähr einem Jahr in Polen getötet wurde?«
»Ja. Er war mein Vater. Ich bin Joyce Demeter.«
Ich erinnerte mich recht gut an diesen Demeter. Die Zeitungen hatten damals eingehend über die Sache berichtet. Er war Professor an irgendeiner amerikanischen Universität gewesen und hatte vor ungefähr einem Jahr an einer Tagung in Warschau teilgenommen. Die Konferenz hatte etwa zwei Wochen gedauert, und Demeter war nach Abschluss noch einige Zeit in Polen geblieben, um persönliche Freunde aufzusuchen. Und dann war er plötzlich spurlos verschwunden.
Die Zeitungen waren voll davon gewesen. Amerikanischer Wissenschaftler in Warschau verschwunden. Verdacht des Menschenraubs liegt nahe, hatte es geheißen. Und die Boulevardblätter berichteten gar: Demeter von den Kommunisten entführt. Wissenschaftler gewaltsam an der Heimkehr in den Westen gehindert.
Eine Periode aufgeregter Proteste, diplomatischer Interventionen und Verhandlungen war gefolgt, doch viel war dabei nicht herausgekommen. Demeter blieb verschwunden. Die polnische Polizei war eingeschaltet worden, die amerikanische Botschaft hatte getan, was in ihrer Macht stand, doch alle Anstrengungen waren ergebnislos geblieben. Man hatte keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib des amerikanischen Professors. Andere Sensationsmeldungen verdrängten das rätselhafte Verschwinden Lawson Demeters aus den Schlagzeilen, bis schließlich sechs oder sieben Monate später gemeldet wurde, dass man die Leiche des Professors auf dem Grund eines Baggersees nahe Warschau gefunden hatte.
Natürlich erschienen prompt auch wieder die Schlagzeilen, die die Kommunisten verdammten und den Menschenraub anprangerten, doch die Ärzte, die die Autopsie Vornahmen - und einer von ihnen war ein Mitglied der amerikanischen Botschaft in Warschau kamen einstimmig zu dem Ergebnis, dass Lawson Demeter ertrunken war und dass nichts auf einen gewaltsamen Tod hinwies.
Den Zeitungen und Boulevardblättern passte das gar nicht in den Kram. Verschwundene amerikanische Wissenschaftler und rote Mörder heben die Auflage. Doch schließlich wies jemand mit einem überdurchschnittlichen Schuss gesunden Menschenverstands darauf hin, dass Demeter ja kein Atomphysiker gewesen sei, sondern Professor der Botanik, ein Gelehrter, der sich für Politik etwa in dem gleichen Maß interessierte wie ich mich für Frauenvereine. Die Zeitungen mussten sich also wohl oder übel damit abfinden, dass er das Opfer eines Unglücksfalls geworden war. Nach einer Weile verstummten die erregten Stimmen, und es wuchs Gras über die Geschichte.
Das war der Fall Demeter, soweit ich mich an ihn erinnerte. Jetzt blickte ich die Tochter Demeters an.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie Amerikanerin sind.«
»Meine Mutter war Engländerin. Ich bin auch in England zur Schule gegangen.«
»Okay. Und vor ungefähr einer Woche oder zehn Tagen haben Sie also geheiratet?«
Sie steckte sich eine neue Zigarette an.
»Mr. Malcolm, ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Mein Vater und ich hingen sehr aneinander. Meine Mutter starb 1950. Wahrscheinlich kamen wir uns deshalb so nahe. Mein Vater heiratete nicht wieder. Er verbrachte seinen Urlaub stets hier in England, damit wir möglichst viel Zusammensein konnten. Als er im letzten Jahr nach Polen reiste, hätte ich ihn begleiten sollen.«
»Warum taten Sie es nicht?«
»Weil ich damals gerade mit einer Virusinfektion im Bett lag. Ich war nicht ernstlich krank, sonst wäre mein Vater gar nicht gefahren, aber ich musste für ein paar Tage ins Krankenhaus zur Beobachtung. Mein Vater machte sich ziemliche Sorgen und wollte seine Reise nach Warschau eigentlich absagen. Doch das ließ ich nicht zu. Schließlich fuhr er dann doch.«
»Bitter.«
»Ja. Ich weiß. Sie können sich wohl vorstellen, wie mir zumute war, als ich von seinem Verschwinden erfuhr.« Wieder verschränkte sie ihre Finger so verkrampft, dass sie sich weiß färbten. »Ich beschloss, nach Polen zu fahren und selbst Erkundigungen einzuziehen.«
»Das wird nicht leicht gewesen sein.«
»Oh, doch, es war ganz einfach. Die Polen hatten nichts zu verbergen, und man behandelte mich sehr zuvorkommend. Zwar kann ich nicht behaupten, dass man mir tatkräftige Hilfe leistete, doch man machte mir wenigstens keine Schwierigkeiten. Jedenfalls blieb ich drei Monate in Polen. Und damals lernte ich Allan kennen.«
»Ihren Mann? Wie kam der denn dahin?«
»Er ist dort geboren«, erwiderte sie. »Seine Mutter war Polin. Sein Vater, ein Engländer, leitete vor dem Krieg eine chemische Fabrik in Warschau. Bei Kriegsausbruch verschwand er - vielleicht wurde er getötet. Allan war damals noch ein kleiner Junge. Er ist in Warschau aufgewachsen und studierte dort an der Universität, als ich ihm begegnete.«
»Und Sie heirateten ihn?«
»Ja. Wir wurden in einem kleinen Dorf ungefähr hundertfünfzig Kilometer von Warschau entfernt getraut. Und danach begannen plötzlich die Schwierigkeiten. Man sagte uns, dass wir keine Genehmigung erhalten würden, Polen zu verlassen.«
»Offiziell?«
»Nein, amtlich war das nicht. Im Gegenteil, es war höchst inoffiziell. Ich habe ja schon erwähnt, dass Allan studierte. Sie wissen wahrscheinlich, wie Studenten sind. Während er die Universität besuchte, nahm er natürlich auch aktiv am politischen Leben teil. Er war Sekretär einer Parteigruppe. Er hatte sich immer schon für die Politik interessiert - bis er mich kennenlernte.«
»Da flaute das Interesse ab?«
»Ja«, antwortete sie. »Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil die Geschichte ziemlich verwickelt ist, und wenn man die Beteiligten nicht persönlich kennt, wird die Sache doppelt so langatmig. Es steht jedenfalls fest, dass man ihn davor warnte, mich zu heiraten. Außerdem riet man ihm, das Land nicht zu verlassen.«
Die Zigarette zwischen ihren Fingern war niedergebrannt. Ungeraucht drückte sie sie im Aschenbecher aus.
»Das ist nahezu alles. Er hat mich geheiratet, und ich reiste sofort ab. Zwei Tage später kam er mir nach Paris nach.«
»Bis dahin waren Sie also auf keinerlei echte Schwierigkeiten gestoßen?«
Sie sah mir in die Augen.
»Es war nicht so einfach, wie es sich anhört. Allan erklärte mir ganz offen, dass wir mit Schwierigkeiten rechnen müssten, und dass es sich nicht um eine Bagatelle handeln würde. Doch er machte mir nicht klar, wie ernst die Sache tatsächlich ist. Darüber klärte mich erst Walther auf.«
»Wer ist dieser Walther?«
»Walther Knezev. Er ist ein Freund von Allan. Er wohnt hier in London. Er holte uns ab, als wir hier ankamen. Er brachte uns in einem kleinen Zimmer in einer Wohnung in Chelsea unter; dort haben wir uns aufgehalten, seit wir hier eingetroffen sind.« Sie lehnte sich zurück und runzelte einen Moment nachdenklich die Stirn, als versuche sie, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. »Walther spricht wesentlich besser Englisch als Allan. Wir haben immer noch Schwierigkeiten, wenn wir uns unterhalten, weil ich kein Polnisch kann und wir meistens französisch miteinander sprechen. Das macht alles sehr umständlich, verstehen Sie?«
»Nein, eigentlich nicht. So, wie ich die Sache sehe, lernten Sie Locke in Polen kennen, heirateten ihn und verließen mit ihm zusammen das Land. Es kann nicht ganz so schwierig gewesen sein, wie man sich das vorstellt, wenn man, wie ich, Informationen über diese Länder nur durch Zeitungen und Fernsehen erhält.«
»Sicher«, bestätigte sie, »dieser Teil der Geschichte war relativ einfach. Doch dafür sind unsere Sorgen jetzt umso größer. Der Vorsitzende der Partei ist ein Mann namens Tynowski. Dominik Tynowski. Tynowski war kein Student. Er ist nicht mehr jung. Er machte den Krieg mit und diente in der russischen Armee. Gegenwärtig muss er ungefähr Mitte Vierzig sein. Walther meint, er kann sogar älter sein. Auf jeden Fall rief Tynowski Allan an, ehe wir heirateten. Er riet Allan, mich nicht zu heiraten. Er erklärte ihm, das würde ihm von der Partei übelgenommen werden. Außerdem verbot er Allan, mit mir gemeinsam das Land zu verlassen und erklärte, wenn Allan das Verbot missachten sollte, würde er selbst die Sache in die Hand nehmen. Allan fürchtet diesen Tynowski.«
Ich klopfte meine Pfeife aus.
»Warum?«
»Ich - ich weiß selbst nicht genau. Sicherlich hat er Angst vor Repressalien - vor Gewalttätigkeit; vielleicht auch vor Schlimmerem.«
»Sie meinen Mord?«
»Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht«, rief sie heftig. »Ja, ich glaube schon, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Ich habe Allan hundertmal gefragt, aber er weigert sich, darüber zu sprechen. Ich glaube, er möchte mir keine Angst einjagen.«
»Und dieser Walther?«
»Walther Knezev? Den habe ich auch gefragt. Auch er wollte mir nicht viel darüber sagen. Doch schließlich gab er zu, dass wir beide in Gefahr sind, dass allerdings die Gefahr für Allan wesentlich größer ist als für mich. Er meinte, sie würden nicht versuchen, mich zu töten. Doch ganz gewiss würde man den Versuch machen, Allan zu beseitigen, um ihn am Entkommen zu hindern.«
»Aber er ist ihnen doch entkommen!«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nicht ganz. Wir wollen nach Kanada auswandern. Ich habe Verwandte in Toronto, und Allan hat Freunde in Montreal. Wenn wir das schaffen, dann sind wir in Sicherheit. Allan ist sicher, dass seine Freunde ihm helfen werden, wenn wir erst einmal drüben sind. Und später gehen wir dann vielleicht in die Staaten. Aber ich habe Angst, dass etwas geschieht, noch ehe wir Kanada erreichen.«
»Weiter«, sagte ich.
»Das ist der Auftrag, den zu übernehmen ich Sie bitten möchte, Mr. Malcolm. Ich möchte, dass ständig jemand bei uns ist, bis wir abfahren. Und ich möchte, dass uns jemand auf der Fahrt begleitet und uns überwacht, bis, wir Montreal erreichen. Ich suche einen Mann, der stark und furchtlos genug ist, um mit allem fertig zu werden, was unter Umständen auf uns zukommen wird.«
»Jemanden wie mich, also?«
»Richtig. Einen besseren Kandidaten könnte ich mir nicht vorstellen. Ich will ganz offen mit Ihnen sein. Die Sache ist gefährlich. Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß, und ich bin bereit, Ihnen tausend Pfund zu zahlen, wenn Sie den Auftrag übernehmen.«
»Vorhin sagten Sie fünfhundert.«
»Eintausend«, beharrte sie. »Ich kann es mir leisten. Ich möchte mein Leben nicht verlieren - und ich will Allan am Leben erhalten.«
Sie zupfte wieder nervös an der Nagelhaut des entzündeten Zeigefingers. Abrupt stand sie auf und kam um den Schreibtisch herum auf mich zu.
»Mr. Malcolm, ich brauche Hilfe. Allan braucht Hilfe.« Sie schob mir das Banknotenbündel zu. »Da liegen fünfhundert Pfund. Den Rest bekommen Sie, wenn Sie aus Montreal zurückkehren. Ist das ein akzeptabler Vorschlag?«
Ich rieb mir die Nase. Die Sache schien zu gut, um wahr zu sein. Die junge Frau hatte Angst, daran bestand kein Zweifel. Und wenn jemand Angst hat, ist er zu allem fähig. Auf der anderen Seite muss man natürlich vorsichtig sein. Nicht einmal tausend Pfund dürfen einen dazu verleiten, die Grundsätze der Vorsicht außer Acht zu lassen.
»Die Sache hört sich gut an«, meinte ich nachdenklich. »Aber ich brauche zusätzliche Informationen.«
»Was meinen Sie damit? Sie haben doch nicht etwa Angst?«
»Ich habe höchstens Angst, dass ich meine Lizenz verlieren könnte.«
Sie kehrte zu ihrem Stuhl zurück und sank darauf nieder.
»Das geschieht bestimmt nicht.«
»Nein, nicht wenn ich es verhindern kann. Deshalb muss ich aber gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zunächst möchte ich mit Ihrem Mann sprechen. Und dann möchte ich mir auch diesen Walther einmal ansehen.«
»Ich kann Sie mit Allan bekannt machen, Mr. Malcolm. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sich ein Zusammentreffen mit Walther arrangieren lässt. Ich weiß nicht, wo er wohnt.«
»Weiß es ihr Mann?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Es ist schwierig, Walther ausfindig zu machen. Er lebt sehr zurückgezogen. Doch Allan wird ihn schon finden können. Jedenfalls hoffe ich das.«
»So, so, dieser Knezev lebt sehr zurückgezogen? Solche Leute sind mir schon verschiedentlich untergekommen. Er lebt doch wohl nicht zufällig deshalb so zurückgezogen, weil er das Gesetz fürchten muss?«
Sie errötete. »Nein, das glaube ich nicht. Der Gedanke war mir gar nicht gekommen.«
»Was dachten Sie denn?«
»Dass er in Gefahr ist«, erwiderte sie leise. »Genauso in Gefahr wie Allan. Nur: Walther läuft nicht davon. Er sieht der Gefahr ins Auge. Er ist eine Kämpfernatur.«
»Und Sie und Ihr Mann haben die Flucht gewählt?«
»Ja. Ich schäme mich dessen nicht. Warum sollte ich auch? Allan hat für Politik nicht viel übrig. Er ist kein Fanatiker. Weshalb sollte er jetzt für etwas bezahlen müssen, was er vor vier oder fünf Jahren getan hat, als er ein unreifer junger Mann war?«
Ich zuckte die Achseln.
»Das ist Ansichtssache. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Politik etwas für Großmäuler und Ehrgeizlinge ist, die auf leichte Art Geld verdienen wollen. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt lieber mit ehrlicher, harter Arbeit.«
»Dazu haben Sie jetzt Gelegenheit.«
»Stimmt.«
Ich stand auf und nahm das Geld vom Schreibtisch. Dann zog ich meine Brieftasche heraus und steckte die Scheine hinein. Sie hatten nicht alle Platz. Ein kleines Bündel musste ich in meiner Hosentasche verstauen.
»Ich übernehme den Auftrag, Mrs. Locke«, verkündete ich dann. »Von jetzt an stehen Sie unter meinem Schutz.«
Über ihr Gesicht huschte ein Ausdruck großer Erleichterung. Sie atmete tief auf.
»Ich danke Ihnen, Mr. Malcolm.«
Jeder nennt mich Solo. Tun Sie es auch.«
Langsam wanderte ich zum Fenster und blickte schweigend auf die Straße hinunter. Es begann dunkel zu werden. Fünf Uhr, an einem Nachmittag Mitte Oktober.