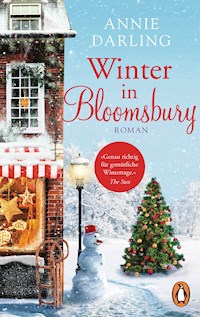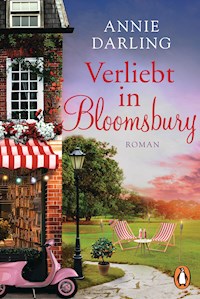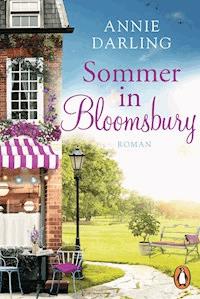
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Bloomsbury-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer Fakedating und Friends-to-Lovers Romance sucht, wird diese RomCom lieben
Verity Love ist Single und glücklich damit: Sie liebt ihre schnuckelige Dachwohnung, ihre verfressene, eigenwillige Katze und ihren Job in einer kleinen Londoner Buchhandlung, die nur Liebesromane mit Happy End verkauft. Wenn bloß die ständigen Verkupplungsversuche ihrer Kolleginnen nicht wären! Fremde Menschen mag Verity nämlich überhaupt nicht, deshalb beschäftigt sie sich viel lieber im Hinterzimmer mit dem Papierkram, statt Kunden zu bedienen. Kurzerhand erfindet sie Peter – ihren umwerfend attraktiven und wahnsinnig charmanten Freund. Doch als sie in einer heiklen Situation einen gutaussehenden Fremden als Peter ausgeben muss, wird ihr Leben plötzlich ganz schön kompliziert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Annie Darling
Sommer in Bloomsbury
Roman
Aus dem Englischen von Andrea Brandl
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »True Love at the Lonely Hearts Bookshop« bei HarperCollins, London.
Das Buch enthält etliche Zitate aus Jane Austens Stolz und Vorurteil. Diese stammen aus der Übersetzung von Andrea Ott, erschienen im Manesse Verlag.
Das Zitat aus Charlotte Brontës Jane Eyre stammt ebenfalls aus der Übersetzung von Andrea Ott, erschienen im Manesse Verlag.
Das Zitat aus William Shakespeares König Heinrich V. stammt aus: Shakespeares sämtliche Werke, Magnus Verlag.
Alle Zitate wurden der neuen Rechtschreibung angeglichen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.1. Auflage 2018Copyright © 2017 by Annie DarlingCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 byPenguin Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCovergestaltung: FavoritbüroCovermotive: Nata-Lia; WDG Photo; AN NGUYEN (2); Zerbor; BK foto; Kondor32; Graphical_Bank; oksana 2010; Richard Peterson; schab; Gluiki; Ihnatovich Maryia; mikolajn; gowithstock; SantaGig; 1000 Words; Africa Studio; peerapong suankaew/ShutterstockRedaktion: Lisa WolfSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-20584-3V002www.penguin-verlag.de
Meinem geliebten Mr. Mackenzie gewidmet. Er lässt ausrichten, dass er zutiefst entsetzt über die Ähnlichkeiten zwischen ihm und Strumpet ist und bereits eine Klage erwägt.
Kapitel 1
Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau.
Peter Hardy, der Ozeanograf, war der beste feste Freund, den man sich vorstellen kann.
Er sah gut aus: blond und braun gebrannt von den zahllosen Stunden an den exotischsten Stränden der Welt, mit Augen so tiefblau wie das Meer – ohne dabei so übertrieben attraktiv zu sein, dass er auf andere einschüchternd gewirkt hätte.
Abgesehen davon war er ein schlauer Kopf. Schließlich war eine Karriere als Meereskundler ohne Einserzeugnis und mehrere Uni-Abschlüsse wohl kaum möglich. Zudem besaß er einen fantastischen Sinn für Humor – ein klein wenig trocken, dazu ein bisschen albern, und er beherrschte es wie kein anderer, wahnsinnig witzige Katzen-Videos auf YouTube aufzustöbern.
Und damit war die Liste seiner Qualitäten bei Weitem noch nicht zu Ende: Jeden Mittwochabend und Sonntagmorgen rief er seine Mutter an, er war immer superpünktlich und schickte, sollte er sich doch einmal verspäten, was jedoch nie vorkam, sofort eine Nachricht mit einer Entschuldigung. Darüber hinaus war er ein aufmerksamer, rücksichtsvoller und leidenschaftlicher Liebhaber, ohne dabei auf allzu abseitigen Schweinkram zu stehen. Peter Hardy würde seine Freundin niemals anbetteln, in rosa Latex zu schlüpfen oder ihn mit einer nassen Socke ins Gesicht zu schlagen.
Peter Hardy war schlicht und ergreifend ein super Fang, er wusste ganz genau, worauf es einer Frau in einer Beziehung wirklich ankam. Verity Love, die als Pfarrerstochter eigentlich als leuchtendes Beispiel vorangehen sollte, würde ihn bei nächster Gelegenheit abschießen müssen.
Was du heute kannst besorgen …, dachte sie, umklammerte ihr Glas viel zu sauren Pinot Noir und rang sich ein dünnes Lächeln ab, während ihre Freundinnen immer noch in den höchsten Tönen von Peter Hardy und seinen Beziehungsqualitäten schwärmten.
»Er klingt absolut toll. Süß, aber trotzdem wie ein richtiger Mann«, säuselte Posy. »Also, wann lernen wir ihn endlich kennen?«
»Ach, du weißt doch, wie es immer ist. Er hat so viel um die Ohren. Eigentlich ist er so gut wie nie hier. Allmählich wird das echt zum Problem …«
»Wir verstehen schon. Du willst ihn ganz für dich haben.« Nina nickte. »Wir kennen das alle, aber ehrlich, Very, das geht jetzt schon seit Monaten so. Du kannst uns deinen heißen Ozeanografen nicht ewig vorenthalten.«
»So lange schon?« Aber Nina hatte recht. Es war Mitte Juni, und Peter war dankbarerweise Mitte November auf der Bildfläche erschienen, gerade noch rechtzeitig, um Verity zu ersparen, als Single bei all den Weihnachtsfeiern auftauchen zu müssen. Zu den meisten war sie gar nicht erst gegangen, aber wer konnte es ihr auch verdenken, wenn sie es nach drei Jahren Dürreperiode mit ihrem Ozeanografen-Gott erst mal wieder so richtig krachen ließ. »Du liebe Zeit, ein halbes Jahr! Wahnsinn!«
»Tu nicht so unschuldig! Ihr seid doch garantiert noch in der Phase, in der ihr es wie die Karnickel treibt, noch dazu, wo ihr euch so selten seht.« Nina strich sich ihr – neuerdings platinblond gefärbtes – Haar hinter die Ohren und stieß einen leisen Seufzer aus. »O Gott, wie ich diese Anfangszeit vermisse, in der man am liebsten gar nicht mehr aus der Kiste rauswill … bevor man anfängt sich darüber zu streiten, wer den Müll rausbringt oder wieso er es ums Verrecken nicht hinkriegt, den Klodeckel runterzuklappen.«
Verity nahm noch einen Schluck Wein zur Stärkung. Sie saßen in ihrem Lieblingspub in Bloomsbury, direkt um die Ecke der Buchhandlung, in der sie alle drei arbeiteten – ehemals Bookends, heute Happy Ends, seit Posy den Laden vor ein paar Monaten geerbt und in ein »Paradies für alles, was das romantische Herz begehrt« verwandelt hatte.
Sie machten ziemlich oft nach Feierabend noch einen Abstecher ins Midnight Bell, ein winziges Pub mit Arts-and-Crafts-Vertäfelungen aus den 1930ern an den Wänden und im Art-déco-Stil gefliesten Toiletten. Hier bekam man bis acht Uhr abends für einen Zehner eine Flasche Wein und zwei Tüten Chips – wen kümmerte es da, dass der Chlorgestank aus dem Schwimmbad in einem der angrenzenden Häuser herüberwehte und sie ihre Handtaschen nicht auf den Boden stellen konnten, weil Tess, der zum Pub gehörende Hund, sie bloß hemmungslos beschlabbern würde? Tess roch selbst aus zwanzig Metern Entfernung eine Tüte Bombay-Mix oder einen Apfel in den Tiefen einer Tasche.
»Na ja, ehrlich gesagt bin ich gerade am Überlegen, ob das mit mir und Peter eine Zukunft hat.« Verity trank ihr Glas aus und zwang sich, Posy und Nina anzusehen, die sie beide mit einer Mischung aus Verblüffung und Entsetzen anstarrten.
»Nein!«
»Du hast doch gesagt, er sei perfekt!«
»Habe ich nicht«, protestierte Verity. »Ihr habt das gesagt. Ich habe nur bestätigt, dass er ein netter Kerl ist.«
»Aber er ist perfekt«, erklärte Posy im Brustton der Überzeugung. Auch wenn sie frisch verheiratet war, hatte es manchmal den Anschein, als würde sie tiefere Gefühle für Peter Hardy hegen als Verity selbst. Andererseits machte die Tatsache, dass Posy dem unverschämtesten Kerl von ganz London das Jawort gegeben hatte, ihre Schwäche für Peter Hardy etwas nachvollziehbarer. »Aber warum? Jeder halbwegs vernünftige Mensch würde doch alles tun, um einen Mann wie ihn zu halten, oder etwa nicht?«
»Weil er mich niemals so sehr lieben wird wie … äh, wie das Meer, und die See kann eine grausame Geliebte sein.« Verity war ziemlich sicher, dass das Zitat aus Moby Dick stammte. Oder vielleicht auch aus Titanic. Jedenfalls aus irgendwas mit viel Wasser. »Er ist ständig weg, und wie sollte das funktionieren, wenn es etwas Ernstes wäre oder wir vielleicht sogar Kinder hätten? Wie könnte ich sicher sein, dass er nicht von einem Hai gefressen wird oder sein Taucheranzug einen Riss bekommt?«
»Ich wusste gar nicht, dass Ozeanografen in haiverseuchten Gewässern zu tun haben«, wandte Nina stirnrunzelnd ein. »Gibt es für so was keine Sicherheitsvorschriften?«
»Sie müssen bei Arbeitsantritt eine Verzichterklärung unterschreiben«, sagte Verity und stand auf. Genug jetzt. Das Ganze dauerte schon viel zu lange. Leider entpuppten sich ihre Beine als nicht ganz so unerschütterlich wie ihr Vorsatz, sodass sie einen Moment lang schwankend neben dem Tisch stand.
»Aber wir haben doch noch nicht mal die erste Flasche ausgetrunken!« Nina schwenkte die Weinflasche, in der noch ein winziger Rest schwappte. »Außerdem ist es gerade mal halb acht. Schwächelst du etwa?«
»Vielleicht weil du pausenlos an Peter Hardy, den Ozeanografen, denken musst?«, fügte Posy mit einem verschmitzten Grinsen hinzu.
Kopfschüttelnd schnappte Verity ihre Handtasche. »Ich verstehe überhaupt nicht, wieso du ihn immer so nennst. Als wäre sein Beruf ein Teil seines Nachnamens. Aber egal. Tut mir leid, dass ich kneife, aber ich habe ja gleich gesagt, dass ich nur auf einen Sprung mitkomme. Ihr wisst, dass ich nicht gern direkt von der Arbeit zu einer Verabredung gehe.«
»O mein Gott, du triffst dich gleich mit Peter Hardy, stimmt’s? Um mit ihm Schluss zu machen?« Nina sah aus wie eine jüngere Schwester von Marilyn Monroe mit Piercings und Tattoos, allerdings hatte sie Verity einmal gestanden, dass sie als Teenager nicht besonders hübsch gewesen sei (»Ich hatte eine Zahnspange wegen meiner Hasenzähne und war flach wie ein Brett.«), diesen Mangel jedoch durch ihre Lebhaftigkeit zu kompensieren versucht hätte. Und selbst heute noch, obwohl sie sich längst in eine atemberaubende Pin-up-Schönheit im Fifties-Stil verwandelt hatte, hatte sie für jede Situation eine übertriebene Grimasse parat – gerade riss sie ihre großen blauen Augen auf, zog die Nase kraus und ließ den Mund weit offen stehen.
»Ich habe mich noch nicht entschieden.« Verity zwängte sich aus ihrer Ecke, wobei sie um ein Haar über Tess gestolpert wäre, den stämmigen Bullterrier, der angetrabt gekommen war, um zu sehen, ob nicht vielleicht doch ein paar Chips zu Boden gefallen waren.
»Aber du kannst ihn doch nicht abservieren, bevor wir ihn kennengelernt haben«, jammerte Posy. »Können wir nicht mitkommen? Nur um kurz Hallo zu sagen …«
»Du brauchst nicht Hallo zu sagen. Du bist verheiratet«, erklärte Verity.
Posy zuckte zusammen. »O Gott. Stimmt ja. Das vergesse ich ständig.« Sie hielt kurz inne, sammelte sich aber sofort wieder. »Egal. Wir sind hier nicht im neunzehnten Jahrhundert, sondern in einem Zeitalter, in dem verheiratete Frauen sehr wohl mit Männern reden dürfen, die nicht ihre Ehemänner sind.« Sie schüttelte den Kopf und schnaubte. »Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich einen Ehemann habe. Iiihh! Sebastian Thorndyke ist mein Mann. Wie zum Teufel konnte das passieren?«
Ganz einfach: In einer ziemlich verrückten Zeit, in der Posy die Buchhandlung neu eröffnet hatte und in der viele höchst merkwürdige und ungewöhnliche Dinge passiert waren, die Verity nach wie vor nicht recht einzuordnen wusste, war Posy dem Charme von Sebastian, ihrem erklärten Erzfeind, verfallen und hatte ihm vor wenigen Wochen auf dem Rathaus von Camden das Jawort gegeben. Es war kaum genug Zeit geblieben, um Konfetti auf das vermeintlich überglückliche Paar regnen zu lassen, als es auch schon über die Straße und in den Bahnhof St. Pancras gestürzt war, um mit dem Eurostar nach Paris zu rasen und dort die Eheschließung zu feiern, noch bevor die Tinte auf dem Trauschein trocken war. Eigentlich war es kein Wunder, dass Posy ein bisschen durch den Wind war, statt mit einem seligen Lächeln durch die Gegend zu laufen.
Verity machte sich die Tatsache, dass ihre Freundin nicht wusste, wo ihr der Kopf stand, schamlos zunutze. »Du solltest vielleicht lieber nach Hause zu Sebastian gehen. Ich meine, rein theoretisch seid ihr doch immer noch in den Flitterwochen, oder?«
»Geh nicht. Ich finde, du solltest keine dieser Frauen werden, die all ihre Freunde in den Wind schießen, nur weil sie einen Ring am Finger haben.« Nina schmollte. Als Posy sich zu ihr umwandte, nutzte Verity die Gelegenheit, zur Tür zu hasten, während ihr Ninas Stimme quer durch den Pub folgte. »Wieso ist Peter Hardy, der Ozeanograf, eigentlich nicht auf Facebook? Ist doch komisch, oder?«
Das war es tatsächlich, aber Verity hatte es ihnen bereits erklärt, und ihre Schwester Merry hatte ihr Rückendeckung gegeben – als Ozeanograf stand Peter im Dienste mehrerer Regierungen und hatte Zugang zu vertraulichen Informationen über den Klimawandel, daher war es ihm nicht gestattet, sich in den sozialen Medien zu betätigen.
Oder so etwas in der Art.
Es hatte geregnet, während sie im Pub gewesen waren. Verity stieg der herrliche Geruch von nassem, heißem Asphalt in die Nase, als sie über das rutschige Kopfsteinpflaster auf der Rochester Street ging, vorbei an den Läden, die sie in- und auswendig kannte: das schwedische Deli, den altmodischen Süßigkeitenladen, die Boutiquen. Kurz überlegte sie, ob sie in die Wohnung über dem Happy Ends gehen sollte, wo Posy sie und Nina mietfrei wohnen ließ, aber noch fühlte sie sich nicht recht zu Hause dort. Außerdem war es Freitagabend, und Veritys Freitagabend-Rituale waren in Stein gemeißelt.
Sie bog um die Ecke in die Theobalds Road, hastete an den Läden, Büros und der Immobilienagentur mit den leuchtend bunten Eames-Stühlen vorbei, dann ging sie nach links in die hell erleuchtete Southampton Row, wo reges Treiben herrschte – Leute befanden sich auf dem Weg zu ihren Verabredungen oder standen plaudernd und lachend vor irgendwelchen Pubs. Sie lief eine schmale Straße entlang, vorbei an einem noch altmodischeren Pub als dem Midnight Bell, und blieb vor einem kleinen italienischen Restaurant stehen. Über der Tür hing ein rotes Schild, und die Fenster waren beschlagen. Stimmengewirr, Gelächter und das Klirren von Gläsern schlugen ihr entgegen, und der köstliche Duft nach Knoblauch und Kräutern stieg ihr in die Nase, als sie die Tür öffnete.
Verity hatte das Il Fornello an einem Freitagabend vor einigen Jahren entdeckt, als sie die Straße entlanggeschlendert war, weil sie nicht nach Hause gewollt hatte – damals noch ein Doppelzimmer, das sie mit ihrer Schwester Merry in einem Haus in Islington teilte, das der Tochter eines Gemeindemitglieds ihres Vaters gehörte. Die Familie bestand aus fünf Kindern, einem spanischen Kindermädchen, zwei Bichon Frisés, mehreren Meerschweinchen und einem Goldfisch. Häufig waren die Gerüche und die Geräuschkulisse schier unerträglich. Erschwerend kam hinzu, dass Verity sich gerade von Adam, ihrem damaligen Freund, getrennt hatte. Die Trennung war alles andere als freundschaftlich verlaufen, und sich in einem so lauten, von Gerüchen erfüllten Haushalt, in dem sie noch nicht einmal ein eigenes Zimmer hatte, ihrem Liebeskummer und Weltschmerz hinzugeben, war ziemlich schwierig gewesen.
Deshalb war sie durch die Straßen gewandert, mit blutendem Herzen und schmerzenden Füßen, und hatte sich, obwohl ihr schon die Vorstellung, allein zu Abend zu essen, den kalten Schweiß auf die Stirn getrieben hatte, von Luigi, dem Besitzer, ins Il Fornello locken lassen. Und so wie damals trat er auch heute auf sie zu, um sie zu begrüßen.
»Ah! Miss Very! Sie sind heute Abend spät dran. Wir dachten schon, Sie würden nicht mehr kommen. Ihr üblicher Tisch?«
»Ich musste unterwegs noch etwas erledigen.« Als sie zu ihrem angestammten Platz ging (ganz hinten in der Ecke, sodass bloß kein kontaktfreudiger Single auf die Idee kam, ihr ein Gespräch aufs Auge zu drücken), warf sie einen Blick über die Schulter, nur um Posy und Nina am Fenster stehen und sich die Nasen platt drücken zu sehen.
Das durfte doch wohl nicht wahr sein!
War es aber.
Ihre Neugier im Hinblick auf Peter Hardy, den Ozeanografen, hatte offensichtlich über ihre Vernunft gesiegt, deshalb hatten sie sich an ihre Fersen geheftet. Und jetzt würden sie zweifellos ins Restaurant platzen, sobald sie Verity auf ihrem Stammplatz zwischen den rustikalen Tischen und Bänken entdeckten. Veritys Herzschlag verlangsamte sich, ebenso wie die Zeit, die schließlich nahezu völlig stillzustehen schien. Verity stieß zitternd den Atem aus. Sie würde das hinkriegen. Keine Frage. Knallhart und rotzfrech. Das Problem war nur, dass Verity alles war, bloß nicht knallhart und rotzfrech.
Sie hatte genau zwei Alternativen: Sich der Situation stellen oder die Kurve kratzen, und Verity entschied sich ausnahmslos für Letzteres, wenn sie unter Druck geriet. Sie könnte die Treppe hinauflaufen, sich in der Damentoilette einschließen und sich rundweg weigern, wieder herauszukommen.
Der Haken dabei: Das war kein Plan, sondern purer Schwachsinn. Sie war eine erwachsene, vernünftige Frau und würde sich der Situation stellen und sich irgendeine Ausrede einfallen lassen müssen; zum Beispiel, dass Peter Hardy, der Ozeanograf, sie längst abserviert und sie vorhin versucht hatte, es ihnen zu erzählen … er sei in letzter Zeit ziemlich distanziert gewesen … und dann die große Entfernung zwischen ihnen und so weiter und so fort. Dies wäre die perfekte Gelegenheit, ihn final in den Orbit zu schießen … aber leider war sich Verity ihrer Unzulänglichkeiten nur allzu bewusst, und dazu gehörte auch ihr mangelndes Improvisationstalent.
Denk nach! Lieber Gott, mach, dass mir etwas einfällt!
Hektisch sah sie sich um, während Luigi immer noch neben ihr stand. »Alles in Ordnung, Miss Very? Sie sind ja ganz rot im Gesicht. Aber es ist heute Abend auch wirklich schwül, nicht? Ich hoffe nur, Sie brüten nichts aus.«
Das war’s, dachte Verity resigniert. In diesem Moment sah sie ihn.
Er saß an einem Zweiertisch im hinteren Teil des Raums. Der andere Stuhl war frei, so als würde er nur darauf warten, dass sie hinüberging und sich zu ihm setzte. Was sie auch tat, in der Hoffnung, dass seine Begleitung nicht in dieser Sekunde von der Toilette zurückkehrte.
Der Mann blickte stirnrunzelnd von seinem Handy auf. Jung genug war er. Dreißig vielleicht. Er hatte keine Tattoos am Hals, trug keine abgerissenen Klamotten, sondern ein einfaches weißes Hemd und einen Pulli darüber, der fast dieselbe Farbe hatte wie seine blaugrünen Augen, aus denen er sie überrascht ansah. Der reicht aus, dachte sie. Für den Notfall reicht er aus.
»Hallo?«, sagte er mit eisiger Stimme. Eine Frage, keine Aussage. Nach dem Motto: Wer zum Teufel bist du, und wieso setzt du dich einfach an meinen Tisch?
Verity riskierte einen Blick durch den Raum und stellte fest, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigten: Posy und Nina waren eingetreten und hielten nach ihr Ausschau. In diesem Augenblick entdeckte Posy sie und stieß Nina an, die prompt herüberwinkte. Verity wandte sich wieder dem Typen zu. O Gott. Er sah alles andere als erfreut aus.
»Bitte entschuldige. Bist du allein hier?«
Er blickte auf sein Handy und runzelte erneut die Stirn. Na ja, eigentlich hatte sie sich bisher noch gar nicht geglättet; vielmehr vertieften sich die Furchen sogar noch. »Sieht ganz so aus.« Nun verschwanden die Falten, und ein flüchtiges Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ich weiß, es herrscht ziemlich viel Betrieb, aber ich würde trotzdem lieber alleine essen, wenn es …«
»Very! Hör auf, so zu tun, als hättest du uns nicht gesehen!«
Verity schloss die Augen, angetrieben von einer unsinnigen, aber inbrünstigen Hoffnung: Solange sie Posy und Nina nicht sah, konnten auch sie sie nicht sehen. Leider grätschte ihr die Realität wieder mal dazwischen. »Bitte«, stieß sie kläglich hervor. »Ich flehe dich an. Bitte spiel einfach mit, bitte.«
»Wobei mitspielen?«, fragte er, aber es war zu spät. Verity spürte Hände, die sich schwer auf ihre Schultern legten, dann stieg ihr der schwere Rosenduft von Ninas Parfum in die Nase.
»Very! Willst du uns denn nicht vorstellen?«
Kapitel 2
Ich habe jedenfalls nicht wie manch anderer die Begabung, leichthin mit Leuten zu plaudern, die ich noch nie gesehen habe.
Förmlich gelähmt angesichts dieser unbeschreiblichen Demütigung saß Verity mit geschlossenen Augen am Tisch – eine gefühlte Ewigkeit lang, obwohl es in Wahrheit vielleicht nur ein paar Sekunden waren, bis sie einen leichten Luftzug spürte, dann streifte etwas Kaschmirartiges ihre Wange, und eine Stimme sagte: »Ich bin Johnny.«
Widerstrebend schlug sie die Augen auf. Der Typ – Johnny – war aufgestanden, um Posy und Nina die Hand zu schütteln. Nina musterte ihn verwirrt.
»Johnny? Du bist also nicht Peter Hardy, der Ozeanograf?« Ihre Stimme klang schrill, atemlos, dabei aber höchst fasziniert.
Verity würde sie umbringen. Nachdem sie ihr den Kopf gewaschen hatte, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Für Situationen wie diese gab es ganz klare Regeln: Man stellte keine Freundin bloß, die ihren Freund betrog. Und erst recht verpetzte man sie nicht auch noch bei dem Mann, mit dem sie ihn betrügen wollte. So etwas gehörte sich einfach nicht. Das verstieß gegen die grundlegendsten Gesetze.
Johnny blickte Verity an, die erneut die Augen schließen musste, weil seine Miene alles andere als ermutigend war.
»Nein, das ist nicht Peter«, brachte sie mühsam hervor, was wegen des Kloßes in ihrer Kehle und ihrer Zunge, die sich wie ein zäher Klumpen in ihrem Mund anfühlte, alles andere als einfach war. »Ich habe nie gesagt, dass ich mich mit Peter treffen will, das war eine reine Vermutung von euch.« Zumindest hatte sie das Schlimmste jetzt hinter sich und konnte ganz normal weiterlügen: Sie konnte behaupten, Johnny sei der Sohn eines Gemeindemitglieds ihres Vaters (dankbarerweise war den Leuten ein reicher Kindersegen beschert), und sie hätten sich verabredet, weil er ein wenig spirituellen Zuspruch bräuchte … auch wenn so etwas eher in den Zuständigkeitsbereich ihres Vaters fiel. »Jedenfalls ist Johnny …«
»Ich weiß ja, dass das zwischen uns noch ziemlich frisch ist, aber mir war nicht bewusst, dass du dich auch noch mit anderen triffst. Also, wer ist dieser Peter Hardy, der Ozeanograf? Muss ich mir wegen ihm Sorgen machen?«
Verity spürte die Hitze, die sich über ihrem Brustkorb, ihrem Hals und ihren Wangen ausbreitete, bis hinauf zu den Ohrläppchen, die sich anfühlten, als hätte sie jemand in kochendes Wasser getaucht. Sie war in ihre eigene Falle getappt, und es wurde mit jeder Sekunde schlimmer … sie steuerte geradewegs auf eine Katastrophe zu.
»Very, Süße, du böses, böses Mädchen!«, rief Posy verzückt. »Du hast mir gar nicht erzählt, dass du zwei Jungs gleichzeitig datest. Und das als Pfarrerstochter!«
Das war der Standardspruch, den Verity sich selbst beim kleinsten Vergehen anhören durfte – wenn sie fluchte, über Leute aus Reality-Shows im Fernsehen lästerte oder, wie es gerade aussah, mit zwei Männern gleichzeitig zusammen war.
»Ach, na ja, es ist … meine Güte … ich weiß auch nicht …« Vollständige Sätze wären eine prima Sache. Sogar regelrecht grandios. Wieder spürte sie die Hände auf ihren Schultern und Ninas Kinn, das sie auf Veritys Kopf abstützte.
»Bitte, denk jetzt nichts Schlechtes über sie«, sagte sie zu Johnny, während Verity sich bereits auf Ninas Wortschwall gefasst machte – gleich würde sie dem sichtlich unbeeindruckten Fremden erzählen, dass Peter Hardy, der Ozeanograf, Verity viel zu häufig alleine ließ, weil er sich pausenlos auf irgendwelchen Meeren herumtrieb, deshalb könnte man es ihr doch kaum verdenken, wenn sie sich anderweitig umsähe, oder? Derlei Theorien hatte Nina schon häufiger vom Stapel gelassen, vorzugsweise wenn der Laden voller Kunden war. »Aber ich will dir etwas über diese Frau hier erzählen. Einmal hat sie sogar das Auto ihrer Vermieterin ausgeliehen und ist damit durch ein heftiges Gewitter gerast, nur um mich von einem Campingplatz in Derbyshire abzuholen, wo mich mein Blödmann von Exfreund sitzen gelassen hat. Verity Love ist der großherzigste Mensch, den ich kenne.«
Der Mann, Johnny, stand immer noch neben dem Tisch. Er war schlank und so groß, dass Verity den Kopf in den Nacken legen musste, um den nachdenklichen Ausdruck in seinen Augen erkennen zu können, als würde er sich ernsthaft fragen, ob sie mehr sein könnte als bloß eine unverschämte, schmutzige Lügnerin.
»Na ja, wir waren ja noch nicht an dem Punkt, an dem man klärt, ob es noch andere gibt. Eigentlich hatten wir ja noch nicht mal ein richtiges Date.« Immerhin waren zwei vollständige Sätze aus Veritys Mund gekommen, ohne dass sie dafür hatte lügen müssen. Na ja, fast. Und es sah ganz gut aus, denn Johnny setzte sich wieder hin und lächelte – diesmal nicht verkniffen, sondern durchaus amüsiert, als wäre das Szenario eine willkommene Ablenkung von dem, was ihn zuvor so verärgert hatte.
»Tja, dann ist das doch die perfekte Gelegenheit, oder? Posy, Nina, hat mich gefreut, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Bestimmt sehen wir uns bald mal wieder.«
Die beiden traten erst den Rückzug an, als Verity sich umdrehte und ihnen einen vielsagenden Blick zuwarf, der signalisieren sollte: »Ich kann mir mindestens zehn verschiedene Methoden vorstellen, euch beide umzubringen und es wie einen Unfall aussehen zu lassen.« Zum Glück machten sich Posy und Nina unter Daumenrecken und lautlosen »Auf geht’s!«- und »Du machst das!«-Ermutigungen schnell auf den Weg zur Tür. Verity drehte sich erst um, als Johnny sich betont räusperte.
»Tut mir wirklich leid. Ich bin in Panik geraten und wusste nicht, was ich machen soll«, gestand Verity und starrte auf ihre Hände, die sie um die Tischkante gekrallt hatte, wobei ihr auffiel, dass auf ihrem Daumen ein schwarzer Tintenfleck prangte.
»Immerhin läuft es für mich noch besser als für Peter Hardy, den Ozeanografen.«
»Es gibt keinen Peter Hardy. Es tut mir aufrichtig leid. Ich denke, ich habe dich lange genug belästigt.«
»Was genau meinst du damit, dass es keinen Peter Hardy gibt?«
Johnnys Ausdrucksweise war sehr präzise – man könnte auch sagen, leicht affektiert –, seine Stimme kultiviert, gleichzeitig schwang eine gewisse Wärme darin mit, so als würde er die ganze Zeit lächeln, was Verity jedoch nicht beurteilen konnte, weil sie immer noch wie gebannt den Tintenfleck auf ihrem Daumen anstarrte.
Endlich hob sie den Kopf. Im Eifer des Gefechts hatte sie lediglich überprüfen können, ob er für ihre Finte halbwegs tauglich war, doch inzwischen konnte auch sie nachvollziehen, wieso Posy und Nina regelrecht um einen Platz in der ersten Reihe gerangelt hatten.
Dieser Johnny war ein gut aussehender Typ, auf diese »Ach ja, und in meiner Freizeit modele ich noch für Burberry«-Weise. Er hatte hohe Wangenknochen, und wenn er nicht lächelte, sahen seine vollen weichen Lippen aus, als würde er ein klein wenig schmollen. Er hatte dichtes, glänzendes dunkelbraunes Haar, das er hinten und an den Seiten kurz, oben dafür etwas länger trug, sodass er es sich lässig aus dem Gesicht streichen konnte, was wiederum seine geradezu lächerlich markanten Wangenknochen und seine Augen – ein bläuliches Grün oder eher ein grünliches Blau – noch betonte. Er war die erwachsene Version der bleichen Kunstgeschichte-Jungs auf dem College in ihrer Heimatstadt, nach denen sie sich als Teenager immer verzehrt hatte. Leider hatten die allenfalls ein gelangweilt-höhnisches Grinsen für sie übrig gehabt, weil sie eine der fünf Töchter des Pfarrers war, die alle als etwas schräg galten, wobei sie eben leider nicht hübsch genug war, als dass sich diese Schrägheit als Pluspunkt hätte auswirken können.
Natürlich war Verity keineswegs hässlich, trotzdem war es ihr nie gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – im Gegensatz zu diesem fremden Kerl, der leicht ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte trommelte und darauf wartete, dass sie endlich etwas sagte.
Tja … Peter Hardy, der Ozeanograf. Wo sollte sie anfangen?
Vielleicht mit der Wahrheit.
»Also, tja, Peter Hardy ist das Produkt eines albernen Geplänkels zwischen mir und meiner Schwester Merry darüber, wie der perfekte Freund sein müsste. Am Ende hatten wir eine komplette Biografie über ihn zusammengestellt, aber natürlich war er reine Fiktion … bis meine Freundinnen angefangen haben … na ja, sie meinen es ja nur gut, aber … sie versuchen eben pausenlos, mich mit irgendwelchen Typen zu verkuppeln oder basteln ein Profil auf Datingseiten für mich oder … o Gott, kennen Sie zufällig diese neue App, HookUpp?«
Er schüttelte sich. »Alle bei mir im Büro unter dreißig drehen komplett durch deswegen.«
»Mir blieb gar nichts anderes übrig, als sie runterzuladen, weil es einfacher war, als ihnen zum hundertsten Mal zu erklären, wieso ich kein Interesse an einer Beziehung habe. Eines Abends musste ich im Pub zur Toilette und habe mein Handy auf dem Tisch liegen lassen. Als ich zurückkam, hatten sie schon Dates mit den allerübelsten Typen ausgemacht, und da habe ich einfach behauptet, ich hätte längst einen Freund. Peter Hardy.«
»Der Ozeanograf.« Wieder nickte Johnny. »Was würdest du gern trinken, Verity Love?«
Aus seinem Mund, mit dieser dunkelgrauen Samtstimme, hörte sich ihr Name auf einmal nicht mehr ganz so schlimm an; er klang plötzlich weniger schnulzig. »Eigentlich heiße ich Verity, aber alle nennen mich Very. Und, Verzeihung, aber ich hätte tatsächlich gern etwas zu trinken.«
Eigentlich hätte sie sich mit einer Ausrede in ihre gewohnte Ecke zurückziehen sollen, doch stattdessen winkten sie Luigi heran, um zwei Gläser Malbec zu bestellen.
Verity war seit drei Jahren Single, nachdem ihre erste, letzte und bislang einzige Beziehung auf dramatische, hässliche und sehr schmerzliche Art und Weise in die Brüche gegangen war. Seit Adam nicht mehr Teil ihres Lebens war, genoss Verity ihr Single-Dasein – nur der Rest der Welt war nicht glücklich damit, dass sie glücklich war.
»Meine Freundinnen meinen es nicht böse, wirklich nicht. Die meisten sind eben in einer festen Beziehung oder wollen unbedingt eine haben, deshalb erwartet jeder von mir, dass ich das auch will. Außerdem sind ihre Ansprüche an die Typen, mit denen sie mich zusammenbringen wollen, nicht gerade hoch.« Verity zuckte innerlich zusammen beim Gedanken an ein Blind Date mit einem Kerl, den Nina bei einer Party kennengelernt hatte. Der Typ hatte sich als »vollzeit-dominant« entpuppt und allen Ernstes gefragt, ob Verity einen Mann suchen würde, der »mit liebevoller, aber strenger Hand herrscht«. Verity war zu perplex für eine Antwort gewesen, doch ihr eisiger Blick hatte Bände gesprochen.
»Ich werde auch ständig von meinen Freunden verkuppelt. Bislang allerdings ohne Erfolg«, sagte Johnny, als ihre Getränke kamen. Er hob sein Glas. »Prost. Und wenn ich sehe, welche Frauen sie für mich aussuchen, kann ich nur davon ausgehen, dass sie keine allzu hohe Meinung von mir haben. Meistens sind es entweder so junge Mädchen, dass ich mir erst mal ihren Ausweis zeigen lassen muss, oder aber verbitterte frisch Geschiedene. Die Letzte wollte sich eigentlich nur an ihrem Ex rächen. Aber wenn ich jammere, werfen mir meine Freunde vor, ich sei wählerisch und solle nicht so ein Theater machen.«
»Genau deshalb habe ich mir die Story von Peter Hardy einfallen lassen. Und das Praktische an ihm ist, dass er wegen seines Jobs ziemlich viel unterwegs ist.« Verity konnte nicht fassen, dass sie einem Wildfremden von ihrem Schein-Freund erzählte. »Wie gesagt, ich bin zu hundert Prozent glücklich darüber, dass ich Single bin, aber meine Freunde wollen es mir einfach nicht glauben.«
Johnny spitzte gedankenverloren die Lippen, was seinen Mund noch hinreißender aussehen ließ. »Vielleicht bist du einfach noch nicht dem Richtigen begegnet.«
»Das will ich auch gar nicht. Ich habe einen anstrengenden Job, tolle Freunde und eine Katze, die mich dringend braucht. Da ist gar kein Platz für jemand anderen.« Verity umfasste ihr Glas ein wenig fester. »Also, wie ist es mit dir? Du hast doch keine Probleme, Frauen kennenzulernen, oder?«
Johnny senkte den Kopf – bestimmt bloß, um sein leicht beschämtes, aber geschmeicheltes Grinsen zu verbergen, dachte Verity. Zweifellos hatte er einen Spiegel zu Hause und wusste sehr wohl, dass er optisch gesehen ein echter Knaller war. »Nein, eher nicht.«
Klar! Logo! Nun, da Verity nicht länger auf dem Altar ihrer eigenen Demütigung gekreuzigt war, schaffte sie es endlich auch, eins und eins zusammenzuzählen. Kein Mann konnte so aussehen und … »Oh, jetzt kapiere ich! Du bist schwul. Alles klar. Und du hast dich vor deinen Freunden bloß noch nicht geoutet, stimmt’s? Also? Na ja, natürlich geht mich das nichts an.«
»Es schmeichelt mir, dass du das glaubst«, sagte Johnny mit einer Stimme, deren anfängliche Samtigkeit der kalten Schärfe eines Stacheldrahtzauns gewichen war. »Und das war noch nicht mal eine Frage, sondern eine ganz klare Aussage. Aber, nein, ich bin nicht schwul.«
Verity presste die Hände auf ihre glühend heißen Wangen. »Entschuldigung. Normalerweise laufe ich nicht herum und oute einfach fremde Leute. Einer meiner besten Uni-Freunde ist schwul. Und zwei Cousins von mir auch. Und ich stehe voll und ganz hinter den LGBT-Rechten. Ich liebe Schwule!«
»Das freut mich zu hören, deshalb bin ich aber trotzdem nicht schwul.«
Jetzt waren Johnnys Augen definitiv blau. Wie das Meer im Winter – eisig und kalt. Ein Mister Darcy, tippte Verity. Darcys traf man nur sehr selten. Vermutlich wusste sie es deshalb so genau, weil sie Stolz und Vorurteil praktisch auswendig kannte, und wann immer Verity neue Leute kennenlernte, ordnete sie ihnen eine Figur aus dem Roman zu – im Lauf der Jahre hatte sie schon viele Jane Bennets und Charles Bingleys kennengelernt, definitiv zu viele Mr. Collins, den einen oder anderen Wickham, aber einem Darcy begegnete man seltener als einem alleinstehenden Mann mit einem hübschen Vermögen, der tatsächlich eine Frau suchte. Und ehrlich gesagt war es nicht gerade ein Zuckerschlecken, einen Darcy kennenzulernen.
Offen gestanden war es sogar fast unerträglich. In diesem Moment läutete Johnnys Handy. Als er danach griff, beschloss Verity, dass es keinen Grund gab, noch länger zu bleiben und zu leiden.
Sie verabschiedete sich und stand eilig auf, während Johnny immer noch am Telefon war und ihr überstürztes Aufbrechen nicht zur Kenntnis nahm. »Schreiben Sie die zwei Gläser Wein bitte auf meine Rechnung«, rief sie Luigi zu, der immer noch sichtlich verblüfft darüber war, dass Verity zum ersten Mal seit drei Jahren ihre freitagabendliche Gewohnheit über Bord geworfen hatte. Und damit nicht genug: Sie war in Gesellschaft eines Mannes gewesen.
Kapitel 3
Das ist tatsächlich ein Abend voller Wunder!
Nachdem ihre Pläne fürs Abendessen durchkreuzt worden waren, ging Verity zurück in Richtung Rochester Street und kaufte sich unterwegs bei der Fischbude eine Portion Kabeljau mit Pommes und Erbsenpüree.
»Kannst du vielleicht gleich deinen Kater mit nach Hause nehmen?«, fragte Liz. »Er hockt schon seit Stunden hier und macht Theater.«
»Tut mir leid«, murmelte Verity. Sie war erst vor einer Woche in die Wohnung über dem Happy Ends gezogen und hatte eigentlich vorgehabt, Strumpet mindestens einen Monat lang eingesperrt zu lassen, damit er sich an die neue Umgebung gewöhnte und nicht nach Islington zurückrannte. Aber kaum hatte Strumpet mitbekommen, dass er keine hundert Meter von einer Fischbude und einem schwedischen Delikatessengeschäft lebte, wo regelmäßig Lachs im Hof geräuchert wurde, nutzte er jede Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen. Der sonst behäbige und faule Kater schlüpfte durch jeden noch so schmalen Türspalt, um sich den Geruch nach Freiheit um die Nase wehen zu lassen … und nach Fisch.
Verity hatte sich gezwungen gesehen, überall in der Straße ein Foto von Strumpet in seiner gesamten Pracht aufzuhängen, mit der Bitte, ihn nicht zu füttern, weil er »auf strengster Diät« sei.
Strumpet schien das allerdings noch nicht mitbekommen zu haben, denn er hatte an der Hintertür der Fischbude Posten bezogen und forderte, auf die Hinterbeine gestützt (Verity konnte nur staunen, dass sie allen Ernstes sein Körpergewicht trugen), nachdrücklich Einlass.
»Was treibst du da?«, fragte sie, doch Strumpet tat, als hätte er sie nicht gehört. Das machte er häufig. Wundersamerweise zeigte er sich gegenüber Veritys Bitten, sie in Ruhe zu lassen und ihr Gesicht nicht als Kissen zu benutzen, meistens stocktaub, andererseits bekam er es sofort mit, wenn jemand mitten während eines Gewitters drei Zimmer weiter ein Stück Käse auswickelte.
Am Ende ließ sich Strumpet lediglich weglocken, weil Verity ein Stück von ihrem Fisch abriss. Sie packte ihn und trug das verdrossen strampelnde Fellbündel die Straße entlang und in die Gasse, in der sich seit über hundert Jahren die Buchhandlung, einstmals Bookends, jetzt Happy Ends, befand.
Rochester Mews hatte sich in den letzten Wochen sichtlich gemausert. Zwar befanden sich auf der einen Seite immer noch einige heruntergekommene, leer stehende Ladengeschäfte, doch das Happy Ends erstrahlte nach der Renovierung in nagelneuem grau-fuchsiafarbenem Glanz. Mittlerweile hatte sich Verity an den Anflug von Stolz in ihrer Brust (auch wenn Strumpet gerade seine Krallen hineingrub) gewöhnt, der sie beim Anblick ihres Arbeitsplatzes und ihres neuen Zuhauses überkam.
Und sie war nicht die Einzige, die sich über den Aufschwung des Happy Ends freute: Seit Posy die Holzbänke auf Vordermann gebracht und die Bäume gestutzt hatte, diente der Platz als Anlaufstelle für eine Gang von Kapuzenshirt-Kids aus der nahe gelegenen Sozialsiedlung, die hier fast jeden Abend abhingen und Gras rauchten.
Nina hatte sie gefragt, ob es ihnen etwas ausmachen würde, sich einen anderen Treffpunkt zu suchen, aber offensichtlich liefen sie überall sonst Gefahr, von ihren Eltern oder einem Lehrer entdeckt zu werden. Sie hatten sich breitschlagen lassen, erst nach Ladenschluss dort abzuhängen, und Nina und Verity hatten beschlossen, sich lieber von ihrer freundlichen Seite zu zeigen und eine Art Beziehung zu ihnen aufzubauen.
»Und? Alles paletti, Very? Siehst echt cool aus heute Abend«, rief der kleinste Kapuzenshirt-Typ. Verity schenkte ihm ein Lächeln, das nett sein, ihn jedoch keineswegs zu weiteren Bemerkungen ermutigen sollte, und hastete zum Laden, die Schlüssel griffbereit in der Hand, um sie notfalls als Waffe einzusetzen.
Den zappelnden Strumpet unter dem Arm schloss Verity die Tür auf und trat ein. Mit einem neuerlichen Anflug von Stolz ließ sie den Blick über die Regale schweifen, die sie im Schweiße ihres Angesichts selbst gestrichen hatte, sog den Geruch nach neuen Büchern und der Happy-Ends-Kerze ein, einer Spezialanfertigung, die Posy selbst erfunden hatte.
Der große Hauptverkaufsraum bot Platz für drei Sofas in unterschiedlichen Stadien des Durchhängens mit einem kleinen Tisch in der Mitte, auf dem das Foto von Lavinia, der verstorbenen ehemaligen Besitzerin, stand, gemeinsam mit ihren Lieblingsbüchern (von Nancy Mitfords Englische Liebschaften bis hin zu Jilly Coopers Reiter) und ihrem Markenzeichen, rosafarbenen Rosen.
Eine ganze Wand war ausschließlich mit Büchern bestückt, an der anderen waren altmodische Vitrinen mit allerlei Romantik-Krimskrams aufgereiht – Kaffeebecher und besagte Kerzen, Modeschmuck, T-Shirts, Grußkarten und Geschenkpapier. Und Tragtaschen. Posy war geradezu besessen von Tragetaschen.
Links vom Hauptverkaufsraum befanden sich mehrere kleinere Räume, in denen fuchsiafarbene Schriftzüge auf den grauen Regalen auf die unterschiedlichen Genres hinwiesen: Klassiker, Historische Romane, Regency, Junge Erwachsene, Gedichte und Theaterstücke und, ja, selbst Erotische Literatur. Ganz hinten, am Ende des letzten Torbogens, führte eine gläserne Doppeltür in die Teestube – zumindest würde dort bald eine Teestube eröffnen; gerade war es noch eine Baustelle und der Fluch in Veritys Leben, wenn auch nicht ganz so sehr wie Strumpet, der sich mit Leibeskräften gegen ihre Umklammerung zur Wehr setzte. Eilig schloss sie die Tür hinter sich und löste dankbar den Griff um die neun Kilo strampelndes blaues Britisch Kurzhaar.
»Du bist eine echte Nervensäge«, sagte sie zu Strumpet, der schnurstracks am Tresen vorbeistiefelte und dann ungeduldig miauend und mit peitschendem Schwanz vor der Tür stehen blieb, die nach oben in die Wohnung führte. »Du kannst miauen, solange du willst. Ich werde mein Abendessen nicht mit dir teilen«, erklärte sie und folgte ihm die Treppe hinauf. »Ich gehe ins Wohnzimmer und mache die Tür zu, damit ich keinen Muckser mehr von dir hören muss. Es war ein langer Tag, und ich brauche meine Ruhe.«
Das Miauen wurde lauter und wütender. Katzen anderer Leute rächten sich mit stummem Protest; Verity wünschte, sie hätte dieses Glück. Aber in Wahrheit hatte sie sich längst mit ihrem Schicksal abgefunden: Sobald sie den Fisch, die Pommes und das Erbsenpüree auf einen Teller gehäuft und sich ein Glas Rotwein eingeschenkt hätte, würde sich Strumpet auf ihrem Schoß häuslich einrichten und sich ihr Essen einverleiben.
Aber in diesem Fall würde er zumindest Ruhe geben.
Ruhe.
Sie blieb einen Moment am oberen Treppenabsatz stehen und holte tief Luft. Ihre Schultern sackten herab, und ihre Glieder erschlafften. Sie schloss die Augen, nahm noch einen tiefen Atemzug, durch die Nase ein, durch den Mund aus, spürte, wie die Strapazen der Woche, vor allem aber der letzten zwei Stunden, von ihr abfielen und einer köstlichen Ruhe und Stille …
»Hey, hey! Ich bin einfach reingekommen. Das macht dir doch nichts, oder?« Die Wohnzimmertür wurde so abrupt aufgerissen, dass sie gegen die Wand knallte. »Oh! Machst du wieder diesen schwachsinnigen Meditations-Kram? Wieso mitten auf der Treppe? Soll ich lieber den Mund halten? Ist schon okay. Du wirst nicht mal merken, dass ich da bin.«
Verity schlug die Augen auf und starrte ihre Schwester an. Wie immer war es, als blicke sie durch einen extrem schmeichelnden Instagram-Filter: Der Herr Pfarrer und seine Frau waren mit fünf Töchtern gesegnet – Con, die Älteste, dann kam Merry, dann Verity und schließlich Immy und Chatty, die beiden Nachzügler. Im Gegensatz zu ihren Schwestern, die den athletischen Körperbau der Familie väterlicherseits geerbt hatten, schlugen Verity und Merry eher ihrer Mutter nach; sie waren kleiner und nach Merrys Worten »schlank«, wohingegen es Verity eher als »klapprig« bezeichnen würde. Ihre Großtante Helen hatte bei jeder sich bietenden Gelegenheit daran erinnert, dass die Frauen der Familie mütterlicherseits in reiferen Jahren massiv an Gewicht zuzulegen pflegten.
Beide Schwestern hatten widerspenstiges Haar, das, je nach Witterungsverhältnissen, irgendwo zwischen glatt und lockig und – im Winter mehr, im Sommer etwas weniger – aschfarben war, weit auseinanderstehende braune Augen und fein geschwungene Brauen, allerdings wirkte Merry zarter und niedlicher, nicht zuletzt weil sich auf Veritys Stirn mittlerweile die ersten Falten eingruben. Tatsache war, dass Merry jedes Tröpfchen Selbstsicherheit und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten aus dem Genpool aufgesogen hatte, sodass für Verity nichts mehr übrig geblieben war, wenngleich sich der Pool rechtzeitig zu Immys und Chattys Geburt wieder gefüllt hatte. Trotzdem hieß das noch lange nicht, dass Verity sich kampflos geschlagen geben würde.
»Ich habe dir wider besseres Wissen einen Schlüssel gegeben … für den Notfall.«
Merry starrte finster zurück. »Dougie hat am Wochenende Spätschicht, und mir war langweilig.«
Und Langeweile war bei den Pfarrerstöchtern ein Ausnahmezustand. Verity schüttelte den Kopf und stieß einen Seufzer aus.
»Lass das gefälligst!« Merry wäre um ein Haar über Strumpet gestolpert, der Verity in die Küche folgte. »Ich kenne niemanden, der derart aggressiv seufzen kann wie du!«, fügte sie hinzu, während Verity ihr Essen auf einen Teller gab und Besteck, ein Glas und die Weinflasche schnappte. »Das ist eine Riesenportion. Gibst du mir etwas davon ab?«
»Nein. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer, mache die Tür zu und will dreißig Minuten lang nicht gestört werden, und zwar auf die Sekunde. Los, Uhrenvergleich!«
Merry sah auf ihre Uhr und nannte die Zeit, wenn auch mürrisch und mit einem Schmollen, das Verity jedoch geflissentlich ignorierte. Sie war immun gegen Schmollmünder. »Und was soll ich machen, während du dein Abendessen verputzt und dich weigerst, mir etwas davon abzugeben, obwohl ich noch nichts gegessen habe?«
»Du kannst von deinen Reserven an innerer Stärke zehren«, gab Verity ohne einen Anflug von Mitgefühl zurück. »Davon hast du ja mehr als genug.«
Mit einem letzten Blick in Merrys verdrossenes und Strumpets empörtes Gesicht schloss sie die Tür hinter sich, stellte ihren Teller auf den Couchtisch und ließ sich aufs Sofa fallen – ein behagliches Exemplar mit einem üppig geblümten Bezug. Sie streckte sich lang aus, und obwohl der Fisch und die Pommes bald kalt sein würden, schloss sie die Augen und blendete sämtliche Geräusche aus, selbst Strumpets verärgertes Miauen auf der anderen Seite der Tür.
Der Tür, die plötzlich ohne Vorwarnung aufgerissen wurde. Sekunden später sprang Strumpet auf Veritys Brust, sodass die Luft abrupt aus ihrer Lunge gepresst wurde, und Merry streckte den Kopf herein.
»Kann ich etwas von dem Käse im Kühlschrank haben?«, winselte sie.
»Ja!«, stieß Verity zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Und nimm den Kater mit.«
Nach gerade einmal zwanzig ruhigen, tiefen Atemzügen kam die nächste Störung. »Entschuldige, aber du hast die Weinflasche mitgenommen. Könnte ich vielleicht auch ein Glas davon kriegen?«
Die Tür schloss sich hinter Merry und Veritys Weinflasche, nur um Sekunden später erneut aufgerissen zu werden. »Bitte entschuldige, aber ich habe ja bloß Käse und Wein und brauche auch noch ein paar Cracker. Hast du welche hier?«
»Sie haben kein Mitleid mit meinen armen Nerven«, zitierte Verity und schwang sich vom Sofa hoch. »Los, komm schon rein. Genau das wolltest du doch die ganze Zeit.«
»Ich habe großen Respekt vor Ihren Nerven. Wir sind alte Bekannte«, erwiderte Merry ebenfalls mit einem Zitat aus Stolz und Vorurteil. »Gibst du mir ein paar von deinen Pommes ab?«
»Bedien dich«, antwortete Verity resigniert. »Außerdem habe ich schlechte Nachrichten.«
»So?« Merry schob sich ein paar lauwarme Pommes in den Mund und wandte sich ihrer Schwester zu.
»Ich musste Peter Hardy eliminieren, sonst hätten Posy und Nina mich erwischt, wie ich ihn betrüge.«
Verity hätte lieber erst in Ruhe über ihre missliche Lage nachgedacht, aber das konnte sie jetzt vergessen, deshalb schilderte sie ihrer Schwester, was vorgefallen war.
»Es ist alles ihre Schuld«, brummte Verity schließlich.
»Aber eigentlich sollte er sowieso nur so lange bleiben, bis die ganzen Weihnachtsfeiern vorbei sind«, wandte Merry ein.
»Sollte ein Schein-Freund nicht fürs ganze Leben bleiben? Nicht nur über die Weihnachtszeit?«, gab Verity schmollend zurück.
»Wie soll das gehen? Hättest du irgendwann Schein-Kinder bekommen? Dir einen Schein-Hund zugelegt?«
»Einen Schein-Hund bestimmt nicht. Strumpet möchte lieber Einzelkind bleiben«, erwiderte Verity, als die Ladentür lautstark ins Schloss fiel. Wenig später ertönten Schritte auf der Treppe, dann stand Nina im Türrahmen.
»O. Mein. Gott!«, trompetete sie statt einer Begrüßung. »Hast du ihn gesehen, Merry? Hast du diesen verboten attraktiven Schnösel gesehen, mit dem deine Schwester sich getroffen hat, obwohl sie eigentlich mit Peter Hardy, dem Ozeanografen, verabredet war?«
»Nein!« Merry winkte ab. »Aber Peter Hardy ist doch seit einer Ewigkeit Geschichte. Dieser andere Typ – Very wollte nicht, dass ihn einer von euch sieht, sondern ihn ganz für sich behalten. Ist er cool?«
»Ja, und schlau noch dazu. Und diese Stimme … wie Benedict Cumberbatch oder Tom Hiddleston. Du weißt schon … eine Stimme, bei der du dir am liebsten sofort das Höschen runterreißt.« Nina zog ihr Handy heraus. »Ich hab sogar ein Foto gemacht, allerdings ist es leicht unscharf.«
»Lass mal sehen!« Merry kletterte über ihre Schwester hinweg, um einen Blick auf das Display zu werfen. »Wie blöd, dass dein Hinterkopf im Weg ist, Very. Du hättest ein Stück zur Seite gehen müssen.«
»Nächstes Mal gern«, murmelte Verity und kaute nachdenklich auf einer mittlerweile eiskalten Pommes herum.
»Los, raus damit, ich will alles wissen«, befahl Nina und ließ sich aufs Sofa fallen, sodass Verity zwischen ihrer Mitbewohnerin und ihrer Schwester eingequetscht war. »Wo hast du ihn kennengelernt? Er hat dich angesprochen, richtig? Du würdest doch nie einen Typen anquatschen. Was hast du getan, als er auf dich zugekommen ist? Ihn mit deinem berühmten ausdruckslosen Killer-Blick angestarrt?«
»Vielleicht sollte ich das auch mal probieren.« Merry stieß Verity an und grinste, als wäre das Ganze rasend komisch. »Zuerst umgarnst du Peter Hardy, den Ozeanografen, und jetzt diesen Kerl. Wie hieß er noch mal?«
»Johnny«, antwortete Nina. »Normalerweise stehe ich ja nicht auf solche Typen, aber bei ihm würde ich glatt eine Ausnahme machen.«
»Ich hab auch so einen«, warf Merry ein. »Eigentlich ist er ein richtiger Schnösel, auch wenn er so tut, als wäre er keiner. Er redet, als wäre er in einem Arbeiterviertel aufgewachsen, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass er auf die St. Paul’s gegangen ist und dem Kadettenkorps angehört hat.«
»Ich war auch mal mit einem Soldaten zusammen«, sagte Nina, während Verity aufstand: Ihre Anwesenheit war nicht länger gefragt – Nina hob bereits zu einer übertriebenen Lobeshymne auf ihren superattraktiven Soldaten-Beau an und schilderte einen Trick mit seinem erigierten Penis und einem halb vollen Bierglas, mit dem er sie bei Laune gehalten hatte, während Merry vor Vergnügen kreischte.
Verity trat an den Kartons und Schachteln im Flur vorbei, die immer noch darauf warteten, endlich ausgepackt zu werden, und ging in ihr Zimmer. Es war früher einmal das von Posy gewesen, allerdings hatten zu ihrer Zeit überall Sachen herumgelegen. So gern Verity Posy mochte, aber Sebastian hatte mit seiner Einschätzung, dass seine inzwischen Angetraute das Chaos in Person war, durchaus ins Schwarze getroffen. Nachdem Posys Habseligkeiten weitgehend verschwunden waren (abgesehen von einem halben Dutzend einzelner Socken, mehreren eselsohrigen Liebesromanen und einem steinharten Bounty-Riegel unter dem Bett) und Veritys Sachen erst noch ausgepackt werden mussten, war das Zimmer zwar leer, aber trotzdem durchaus einladend.
Es hatte ein großes Fenster auf den Innenhof, einen wunderschönen Kamin mit Fliesen im Edwardianischen Stil und Bücherregalen links und rechts, die nur darauf warteten, mit Veritys Romanen und anderen Schätzen bestückt zu werden. Verity hatte ihren ausladenden Lehnsessel mitgebracht, den sie und Merry aus einem Baucontainer in der Essex Road gezerrt hatten und den Verity für ein Heidengeld mit blauem Samt hatte beziehen lassen. Er war ihr Lesesessel. Ihr Heiligtum. Ihre »Ich kuschle mich mit einer Decke ein und vergesse die Welt rings um mich her«-Insel.
Verity nahm die Patchworkdecke, die ihre Urgroßmutter gestrickt hatte, und machte es sich in ihrem Sessel gemütlich. Es war gerade einmal halb zehn und am Himmel immer noch das letzte Licht des Sommertags zu sehen. Wenn sie lauschte, konnte sie das Kichern und Quieken aus dem Wohnzimmer hören, vermischt mit zwei erhobenen Stimmen aus dem Hof unter ihr – offenbar waren irgendwelche Leute gerade in eine hitzige Diskussion verstrickt.
Verity beschloss, einfach nicht hinzuhören. Sie zog die Knie an die Brust und saß da. Es wurde still. Endlich gelang es ihr, Zugang zu ihren eigenen Gedanken zu finden, doch sie beschloss, lieber nicht zu viel nachzudenken, weil ihr sonst bloß dieser attraktive Mann mit den blaugrünen Augen wieder in den Sinn kam, der sie ansah und vielleicht sogar anlachte.
Und Männer wie er verhießen bloß Ärger. Ohne Ausnahme.
Kapitel 4
Und was soll ich da machen? Die Sache scheint mir aussichtslos.
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug, und Verity hatte kaum Zeit, um Atem zu schöpfen, auch ohne imaginären Freund.
In den drei kurzen Wochen, seit Bookends zu Happy Ends geworden war, hatte sich alles von Grund auf verändert: Wo einst gähnende Leere im Laden geherrscht hatte, drängten sich nun die Kunden auf der Suche nach Büchern; teilweise lag es daran, dass um die Jahreszeit das Geschäft grundsätzlich anzog, teilweise verdankten sie den Aufschwung der Tatsache, dass die Wiedereröffnung im Guardian, dem Bookseller und zahllosen Bücher-Blogs Erwähnung gefunden hatte; und Posy hatte sogar BBC News South East ein Interview gegeben.
Das triumphierende Ping der Registrierkasse war Musik in Veritys Ohren, und die einst qualvolle allabendliche Abrechnung erwies sich nun als Quell der Freude und des Staunens. Nur eine winzige Kleinigkeit störte Verity: das endlose Geplapper der Kundinnen, die stets auf der Suche nach neuem romantischem Futter waren, und ihre entzückten Schreie – »Arbeiten Sie etwa hier?« –, wann immer Verity sich in den Verkaufsbereich verirrte … eine durchaus legitime Frage, schließlich trug sie das graue T-Shirt mit dem fuchsiafarbenen Happy-Ends-Logo, so wie Posy es von ihnen verlangte.
»Ich bin nur für die Verwaltung zuständig«, murmelte Verity jedes Mal und wurde stocksteif, aus Angst, jemand könnte sie anfassen. Einmal hatte eine alte Frau sie mit erstaunlicher Kraft am Arm gepackt, über den Tresen gezogen und verlangt, dass sie auf der Stelle E. L. James anrief und ihr Dampf machte, sie solle endlich ein neues Buch vorlegen.
Verity war tatsächlich für die Verwaltung zuständig, auch wenn Lavinia sie vor einem Jahr offiziell zur Leiterin der Buchhandlung befördert hatte, weil sie die Einzige gewesen war, der man das Geld anvertrauen konnte, auch wenn die Umsätze noch so dürftig gewesen waren. Normalerweise saß Verity im Hinterzimmer mit einem »Nur für Mitarbeiter«-Schild an der Tür, erledigte die Bestellungen, registrierte die eingehenden Lieferungen, fragte nach, wenn Sendungen nicht pünktlich eintrafen, und erledigte den Versand der Bestellungen, die über die neu gestaltete Homepage eingingen – die in den letzten Wochen spürbar angezogen hatten und täglich vor der Mittagszeit und vor fünf Uhr nachmittags verpackt werden mussten, um mit der Post verschickt zu werden.
Doch trotz der verschlossenen Tür und der Regale voller Bücher, die eigentlich die Geräusche schlucken sollten, konnte Verity das Bohren und Hämmern aus der Teestube hören, die bald wieder in ihrer einstigen Pracht erstrahlen sollte. Ab und zu tauchten Greg oder Dave, die beiden Bauarbeiter, bei ihr im Büro auf und baten sie um Bargeld für irgendwelchen Krempel aus dem Baumarkt oder beschwerten sich über Mattie, die die Teestube nach der Renovierung betreiben würde.
Normalerweise dauerte es einige Zeit, bis Verity mit Fremden warm wurde, aber Mattie mochte sie schon jetzt, obwohl sie sich erst seit Kurzem kannten; nicht zuletzt weil sie eifrig neue Rezepte ausprobierte und die Angestellten des Happy Ends als Versuchskaninchen für ihre leckeren und nicht enden wollenden Kreationen benutzte – Kuchen, Tarts, Kekse, Brote, Shortbreads, süße Brötchen, Gebäckteilchen und ihre Erfindung, den sogenannten Muffnut, eine Kreuzung aus Muffin und Donut, der, vom schwachsinnigen Namen einmal abgesehen, mit seinem fluffigen Teig und dem Karamellguss so unfassbar köstlich war, dass Verity beinahe in Tränen ausgebrochen wäre, als Nina sich bei der Kostprobe das letzte Exemplar unter den Nagel gerissen hatte.
Aber nicht ihre Fähigkeiten, aus einer Handvoll Zutaten derartige Köstlichkeiten zu erschaffen, hatten ihr Veritys Respekt eingebracht, sondern die Tatsache, dass Mattie keine Frau großer Worte war: Im Gegensatz zu gewissen Personen in Veritys Umfeld, für die Schweigen gleichbedeutend mit einer persönlichen Beleidigung war, ergriff Mattie nur das Wort, wenn sie auch etwas zu sagen hatte. Aus diesem Grund hatte Verity ihr einen Schreibtisch in ihrem Büro angeboten: ein Privileg, in dessen Genuss sonst keiner kam außer Posy, und das auch nur, weil ihr der Laden gehörte und sie Veritys Gehalt zahlte.
Aber nicht einmal Posy konnte Verity überreden, mit Bücher-Fans in Kontakt zu treten, weder persönlich noch telefonisch. »E-Mails schreiben, das kann ich echt gut«, erklärte Verity ihrer Chefin mehrmals am Tag. »In meiner Stellenbeschreibung steht nichts davon, dass ich ans Telefon gehen oder Leute selbst anrufen muss.«
Lavinia hatte ihren Mitarbeitern niemals so etwas wie eine Stellenbeschreibung ausgehändigt, weil sie stets der Überzeugung gewesen war, dass die Menschen instinktiv die Aufgaben übernahmen, die am besten zu ihnen passten. Doch Posys rebellische Miene, die sie aufsetzte, wann immer Verity vor dem läutenden Telefon oder Hilfe suchenden Kunden zurückschreckte, ließ ahnen, dass sie ernsthaft erwog, ihren Mitarbeitern zu sagen, was sie zu tun hatten.
Doch als Emma, die Schwester von Merrys Freund Dougie, unangekündigt im Laden auftauchte und Verity zwang, endlich für ihre Dreißiger-Geburtstags-/Einweihungsparty zu- oder abzusagen, zu der sie ihr bereits im Mai eine Einladung geschickt hatte, gab es kein Entrinnen mehr. Emma behauptete steif und fest, lediglich die Geschäfte ankurbeln zu wollen, aber in Wahrheit war sie wegen Verity gekommen.
»Also, ja oder nein, Very?«, rief Emma über den Tresen hinweg, als sie den neuesten Roman von Mhairi McFarlane und ein »Ich habe ihn geheiratet, lieber Leser!«-Shirt bezahlte – als kleine Inspiration, um ihren Freund Sean dazu zu bewegen, ihr einen Antrag zu machen, meinte sie. »Und du bringst doch deinen Freund mit, Peter Hardy, den Ozeanografen, richtig? Allerdings hat Merry erzählt, du hättest ihn abserviert, weil er ein bocklangweiliger Meeres-Heini sei.«
»Habe ich nicht!«, widersprach Verity empört, während ihr bewusst wurde, dass sie sich ab sofort keine Ausreden mehr würde einfallen lassen müssen, um Peter Hardys Abwesenheit zu erklären. »Wir haben uns getrennt, das ist wahr, aber freundschaftlich.«
»Also setze ich dich als Single auf die Gästeliste.« Emma strahlte. »Schau nicht so trübselig. Es kommen jede Menge Single-Männer zur Party, mit denen ich dich zusammenbringen kann, glaub’s mir.«
»O Gott«, erwiderte Verity angewidert. »Eigentlich solltest du mich inzwischen kennen. Versprich mir, dass du das nicht tun wirst.«
Mit einer triumphierenden Geste zog Emma den Reißverschluss ihrer Handtasche zu. »Hervorragend! Das heißt also, du kommst. Und solltest du dich wider Erwarten mit Peter versöhnen, kannst du ihn selbstverständlich gern mitbringen. Wirklich schade, das Ganze.«
»Tja, so läuft es nun mal im Leben«, erklärte Verity mit einem abgrundtiefen Seufzer und deutete auf ihre Bürotür. »Die Arbeit ruft. Ich muss wieder ran«, sagte sie. »Aber ich freue mich schon wahnsinnig auf die Party«, fügte sie eilig hinzu, als ihr wieder einfiel, dass ihre Eltern ihr Manieren beigebracht hatten.
»Wir wollen’s nicht übertreiben, Very«, gab Emma zurück. »Ich kenne dich seit fünf Jahren und habe noch nie erlebt, dass du dich wahnsinnig auf etwas freust.«
»Na ja, ein bisschen«, sagte Verity.
»Das kannst du auch.« Emmas Augen begannen zu leuchten. »Wir haben eine Karaoke-Anlage gemietet. Und jeder muss mitmachen.«
Damit verschwand sie, und zurück blieb Verity, schockstarr vor Angst. »Wie schade, dass du Peter Hardy, den Ozeanografen, abgeschossen hast«, bemerkte Nina und packte die Bücher der nächsten Kundin ein. »Jetzt musst du ganz allein zu der Party gehen.«
»Peter Hardy, der Ozeanograf, war so oft auf den sieben Weltmeeren unterwegs, dass sie wahrscheinlich sowieso ohne ihn hätte hingehen müssen«, warf Tom mit einem leicht abfälligen Schnauben ein – Verity hatte ihn schon immer im Verdacht gehabt, dass er ihr die Story von ihrem Ozeanografen-Freund nicht abkaufte.
»Ich sehe sowieso nicht ein, wieso ich zu all den Verlobungsfeiern, Geburtstagen und Einweihungspartys gehen muss«, brummte Verity, kreuzte die Arme und starrte zu Boden.
»Wie schrecklich, dass deine Freunde dich gern bei den wichtigsten Ereignissen in ihren Leben dabeihaben wollen«, sagte Posy, die mit einem Tablett voller Teebecher aus der kleinen Küche trat. »Und es tut mir wahnsinnig leid, weil ich darauf bestanden habe, dass du zu der kleinen, intimen Party für meine engsten Freunde und Familie am Abend vor der Trauung und am nächsten Tag zu meiner Hochzeit kommst.«
»So habe ich es nicht gemeint. Ich liebe meine Freunde und versuche, ihnen eine gute Freundin zu sein.« Stirnrunzelnd dachte sie darüber nach, wie sie sich als Freundin schlug: Überschwängliche Umarmungen, wortreiche Ratschläge oder ausgelassene Trinkgelage, bei denen alle Beteiligten kreischten, kicherten und wild durcheinanderschrien, waren nicht ihr Ding, aber in Ruhe zuzuhören und mit jemandem zu reden, gehörte eindeutig zu ihren Stärken. Das konnte sie. Verity war die geborene Zuhörerin, jederzeit mit Rat und Tat zur Stelle, wenn eine Freundin sich getrennt hatte, betrogen oder aus der Wohnung geworfen worden war, und auch wenn sie niemals an Matties Fähigkeiten heranreichen würde (sie war gerade mit einem Teller voll selbst gebackener Käsestangen mit Chili hereingekommen), war sie zumindest stolze Besitzerin eines Brotbackautomaten und hatte schon so manchen Kummer mit ihrem berühmten Bananen-Schoko-Brot gelindert. »Ich tue mich nur mit größeren Menschenmengen schwer, aber das macht mich noch lange nicht zu einem schlechten Menschen, oder?«
»Natürlich nicht«, antwortete Nina. »Aber kannst du Johnny nicht einfach mitbringen?«
»Nein! Dafür ist es noch viel zu früh«, wiegelte Verity eilig ab, als ihr aufging, dass sie es schon wieder tat – sie log, dass sie einen festen Freund hatte. Dabei hatte sie sich geschworen, so etwas nie wieder zu tun. »Außerdem ist er nicht mein neuer Freund. Er ist gar nichts.«
Tom lächelte … na ja, eigentlich war es eher ein Grinsen. »Johnny? Wer ist Johnny? Inzwischen verliere ich den Überblick über Verys zahllose Liebhaber. Ist er auch Ozeanograf?«
Es war einer jener seltenen Augenblicke, wenn kein Kunde an der Kasse stand, niemand an den Regalen entlangschlenderte und Fragen zu irgendwelchen Büchern stellte. Verdammt! Stattdessen standen Nina, Posy und Mattie mit ihren Käsestangen da und musterten Verity neugierig. »Ja, genau, Very, was macht er eigentlich beruflich?«
Die Anspannung wurde unerträglich. »Er arbeitet sehr hart«, antwortete sie ernst. »Genau das, was ihr auch tun solltet, statt herumzustehen und euch das Maul zu zerreißen. Und dasselbe gilt für mich … ich habe massenhaft Bestellungen, die ich verpacken und auf den Weg bringen muss.«
Und wie so oft in der Vergangenheit – normalerweise wenn Posy sie überreden wollte, für zehn Minuten die Kasse zu übernehmen – flüchtete Verity sich in die Sicherheit ihres Büros.
Verity hatte sich immer noch in ihrem Büro verschanzt, als Posy um sechs den Laden abschloss und das Schild an der Tür auf »Geschlossen« drehte. Nina hatte die Kasse gemacht, Tom räumte ein paar verirrte Bücher in die Regale, die Kundinnen auf dem Sofa hatten liegen lassen, und Verity wischte den Fußboden auf.
»Pub?«, schlug Nina vor. »Wer kommt mit?«
Posy und Tom waren sofort dabei, nur Verity schüttelte den Kopf, aber als die anderen schließlich verschwunden waren und sie allein in ihrem Sessel bei vorgezogenen Vorhängen in ihrem Zimmer saß, dämmerte ihr, dass dies auch nicht das Wahre war. Über dem Laden zu wohnen, war in vielerlei Hinsicht eine feine Sache. Miete: null. Öffentliche Verkehrsmittel: zehn Sekunden und eine Treppe hinunter. Lage: im Herzen der Stadt. Zwanzig Minuten vor Ladenschluss noch schnell zu Sainsbury’s auf der Holborn gehen und ein Riesenschnäppchen mit leicht verderblichen Lebensmitteln machen: kein Problem! Gleichzeitig bedeutete es aber auch ein leichtes Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit, weil man nur selten einen Fuß vor die Tür setzte.
Zum Glück war ein Spaziergang Veritys Entspannung ähnlich zuträglich, wie in einem abgedunkelten Raum zu sitzen. Also schlenderte sie durch die Straßen, enge Kopfsteingassen entlang, vorbei an hübsch bepflanzten Plätzen. Es war noch hell genug, um keine Angst haben zu müssen, trotzdem überquerte sie mehrmals die Hauptstraßen, um den Grüppchen auszuweichen, die sich vor den Pubs versammelt hatten – ausgelassene junge Leute in Feierabendstimmung, die Jacken achtlos über irgendwelche Geländer geworfen und mit Drinks und Chipstüten in den Händen.