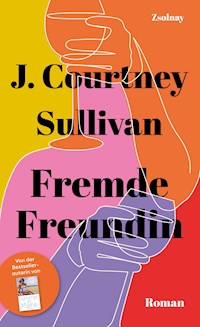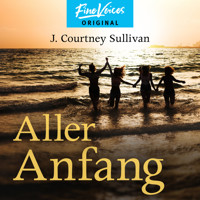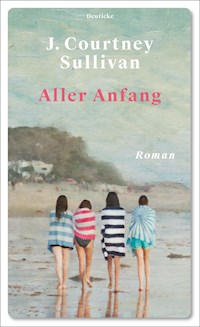Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommer in Maine, vier Frauen und ihre Abgründe: Alice, die oft streng und unnahbar wirkt, würde alles dafür geben, eine einzige tragische Nacht in ihrem Leben ungeschehen zu machen, aber auch Tochter Kathleen, Enkelin Maggie und die scheinbar so perfekte Schwiegertochter Ann Marie, die am liebsten Puppenhäuser bastelt, haben panische Angst davor, dass ihre dunklen Geheimnisse ans Licht kommen könnten. Doch die Wogen gehen hoch zwischen den ungleichen Frauen, und die Fassaden bröckeln … Eine meisterhaft erzählte Familiengeschichte in der Tradition der großen amerikanischen Romanciers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke E-Book
J. Courtney Sullivan
Sommer in Maine
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Henriette Heise
Deuticke
Die Originalausgabe erschien erstmals 2011 unter dem Titel Maine im Verlag Alfred A. Knopf, New York.
Textnachweise: Gedicht von Dana Perkins erschienen in Ogunquit By-The-Sea von John D. Bardwell (Arcadia Publishing, 1994): mit freundlicher Genehmigung von Arcadia Publishing, www.arcadiapublishing.com
Auszug aus To a young poet von Edna St. Vincent Millay, mit freundlicher Genehmigung von The Edna St. Vincent Millay Society
ISBN 978-3-552-06218-4
Copyright © 2011 by J. Courtney Sullivan
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Random House, Inc.
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2013
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Trish
Nur scheut sich eine Mutter selten
Mit dem Kinde streng zu sein,
Denn Liebe, das ist ihr bekannt, sät doch stets Gegenliebe.
Elizabeth Barrett Browning, »Aurora Leigh«
Mach einfach alles, was wir nicht gemacht haben,dann kann gar nichts schiefgehen.
F. Scott Fitzgerald in einem Brief an seine Tochter Frances
Alice
Alice fand, dass es Zeit für eine Pause vom Packen war. Sie zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich in einem der Korbsessel zurück, die von der Meeresluft immer ein wenig feucht waren. Dann blickte sie sich im Zimmer um und sah die vielen Kartons, in denen sie die Familienhabseligkeiten verstaut hatte. Gläser, Salzstreuer und Bilderrahmen – alles sorgfältig verpackt. In jedem Zimmer standen ein paar Kisten, die noch vor der Ankunft der Kinder zum Goodwill Sozialladen mussten. Sie hatten die Sommer von sechs Jahrzehnten hier verbracht, und Alice staunte, wie viel sich über die Jahre hinweg angesammelt hatte. Mit diesem Durcheinander wollte sie niemanden belasten, wenn sie einmal nicht mehr war.
Am Himmel hingen dicke Wolken. Bald würde es regnen. In Cape Neddick in Maine gewitterte es in diesem Mai fast jeden Nachmittag. Ihr war das egal. Sie ging sowieso nicht mehr zum Strand hinunter. Nach dem Mittagessen setzte sie sich normalerweise mit einem Glas Rotwein auf die Veranda, las stundenlang Romane, die ihr ihre Schwiegertochter Ann Marie im Winter geliehen hatte, und sah die Wellen gegen die Felsen schlagen, bis es Zeit war, das Abendessen vorzubereiten. Sie hatte nicht mehr das Bedürfnis, sich einen Badeanzug anzuziehen, ins Wasser zu springen und im Sand ihre Pediküre zu ruinieren. Stattdessen zog sie es vor, die Szenerie aus der Ferne zu beobachten und wie einen Geist durch sich hindurchziehen zu lassen.
Ihr Alltag in Cape Neddick folgte einer bestimmten Routine. Spätestens um sechs Uhr stand sie auf, um die anstehenden Haus- und Gartenarbeiten zu verrichten. Dann machte sie sich einen Tee und legte den Beutel auf ein Schälchen im Kühlschrank, um sich damit vor dem Mittagessen eine zweite Tasse zu brühen. Um Punkt neun Uhr dreißig stieg sie in den Wagen und fuhr zur Zehn-Uhr-Messe in St. Michael.
Die Gegend hatte sich in den vielen Jahren seit ihrem ersten Sommer in Maine sehr verändert. An der Küste waren riesige Häuser aus dem Boden geschossen, und in den Ortschaften gab es an jeder Ecke elegante Restaurants, Souvenir- und Feinkostläden. Die Fischer waren noch da, aber in den siebziger Jahren hatten sich viele auf Tourismus umgestellt und boten jetzt Walbeobachtung, Vergnügungsfahrten mit Frühstücksbuffet und dergleichen an.
Aber manches war beim Alten geblieben. In Rubys Gemischtwarenladen und in der Apotheke gingen noch immer um sechs Uhr die Lichter aus. Alice ließ nach wie vor den Autoschlüssel stecken, und auch das Haus schloss sie nicht ab – das tat hier niemand. Der Strand war noch unberührt, und die großen, den Weg zur Kirche säumenden Pinien, sahen aus, als stünden sie dort seit Jahrhunderten.
Auch die Kirche war eine Konstante. St. Michael war eine altmodische, steinerne Dorfkapelle mit rotsamtenen Kniebänken und Buntglasfenstern, deren Farben in der Morgensonne strahlten. Sie stand auf dem Hügel hinter der Shore Road Küstenstraße, damit die Seefahrer ihr Kirchturmkreuz vom Meer aus sehen konnten.
Alices Platz war in der dritten Reihe links. Sie versuchte, sich die besten Teile von Pfarrer Donnellys Predigten für diejenigen Kinder oder Enkel zu merken, die sie besonders nötig hatten. Leider hörten sie ihr meistens gar nicht zu. Alice folgte den Predigten aufmerksam, sang die vertrauten Kirchenlieder mit und sprach Gebete, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Sie schloss die Augen und bat Gott um Dinge, um die sie ihn schon als Kind gebeten hatte: Er möge ihr helfen, ein guter Mensch zu sein und ein besserer zu werden. Meistens glaubte sie, dass Er sie hörte.
Montags, mittwochs und freitags kam die Legion Mariens von St. Michael nach der Messe im Gemeinderaum der Kirche zusammen, um den Rosenkranz für erkrankte Gemeindemitglieder, die Hungrigen und Bedürftigen der Welt und für die Heiligkeit des Lebens in all seinen Phasen zu beten. Sie sprachen das Ave Maria, tranken Koffeinfreien und plauderten. Mary Fallon erinnerte daran, wer in der Folgewoche an der Reihe war, für Gebäck zu sorgen und wer Pfarrer Donnelly bei seinen wöchentlichen Hausbesuchen bei gebrechlichen Gemeindemitgliedern begleiten würde, wo er für eine baldige Genesung betete, die doch nie eintrat. Obwohl es ihr naheging, Männer und Frauen ihres Alters sterben zu sehen, schätzte Alice die Nachmittage mit dem Priester. Er brachte seinen Schützlingen so viel Trost. Pfarrer Donnelly war ein junger Mann, erst vierunddreißig, mit dunklem Haar und einem warmen Lächeln, das sie an Schlagersänger aus den Fünfzigern erinnerte. Der Beruf, den er gewählt hatte, gehörte vergangenen Zeiten an, und seine besondere Art der rücksichtsvollen Anteilnahme hatte sie einem jungen Menschen von heute gar nicht mehr zugetraut.
Wenn sie ihn beim Gebet für ein Gemeindemitglied beobachtete, spürte Alice seine tiefe Hingabe. Heutzutage nahmen sich die meisten Priester keine Zeit für Hausbesuche. Wenn sie fertig waren, lud Pfarrer Donnelly Alice zum Mittagessen ein. Das machte er, das wusste sie genau, mit keiner der anderen Damen der Legion. Er hatte so viel für sie getan. Ab und zu half er ihr sogar im Haus, wechselte die Glühbirne auf der Veranda oder beseitigte nach einem Sturm abgefallene Äste. Vielleicht war diese besondere Aufmerksamkeit eine Folge ihrer kleinen Abmachung, aber was kümmerte sie das.
Pfarrer Donnelly und die sieben Mitglieder der Legion Mariens (von denen tatsächlich fünf Mary hießen) waren zu dieser Jahreszeit die einzigen Personen, mit denen Alice regelmäßig verkehrte. Sie war der einsame Sommerzugang der Legion, die Austauschschülerin, wie sie sich scherzhaft nannte. Die Einheimischen waren Fremden gegenüber misstrauisch. Aber nachdem St. Agnes zwei Jahre zuvor von der Erzdiözese geschlossen worden war, hatten sie sich einverstanden erklärt, Alice für die Sommermonate aufzunehmen.
St. Agnes war ihre Gemeinde in Canton gewesen. Hier waren ihre Kinder getauft und ihr Mann Daniel beerdigt worden. Hier war sie sechs Jahrzehnte lang jeden Tag zur Messe gegangen. Hier hatte sie, als die Kinder noch klein waren, die Sonntagsschule und später die hiesige Legion Mariens geleitet. Gemeinsam mit Abigail Curley, einer jungen Mutter von vier Kindern, die eine fast durchsichtige Haut hatte und eine sanfte, kindliche Stimme, hatte sie die Kampagne zur Rettung der Kirche ins Leben gerufen. Sie hatten fünfhundert Unterschriften gesammelt und mehrere Dutzend Briefe geschrieben. Sogar an den Kardinal.
Bei der letzten Messe hatte Alice leise in ihr Taschentuch geweint. Schließungen wie diese waren an der Tagesordnung, man hörte davon überall. Aber dass es sie treffen könnte, damit hatten sie nicht gerechnet. Abigail Curley und andere Gemeindemitglieder hatten sich geweigert, das Gebäude zu verlassen. Zweieinhalb Jahre später war die Kirche immer noch Tag und Nacht besetzt. Sie blieben, obwohl der Priester längst gegangen war, obwohl es weder Licht noch Heizung gab. Alice versuchte es mit einer Gemeinde in Milton, aber es verband sie nichts mit dem Ort und seinen Menschen. Ihre Sommergemeinde war nun ihre wichtigste Verbindung zum Glauben und zu ihrer Vergangenheit. Die Mitglieder der Legion schienen das zu wissen.
Die Gruppe bestand zum größten Teil aus Witwen, die sich gehen ließen. Sie trugen Jogginganzüge mit klobigen, weißen Turnschuhen und ihre Frisuren waren durchweg katastrophal. Alice war die einzige, die ihre Figur gehalten hatte. Nur die verflixten Falten deuteten auf die erschreckende Tatsache hin, dass sie dreiundachtzig Jahre alt war. Wie die anderen war auch sie allein. Vielleicht war ihnen die Morgenandacht deshalb so wichtig, weil sie Zeugen dafür brauchten, dass sie noch nicht gestorben waren. Sonst könnte es passieren, dass eine von ihnen am Küchentisch einen Hirnschlag erlitt und es keiner bemerkte.
Ihr Mann Daniel hatte das Grundstück kurz nach Kriegsende 1945 in einer dummen Wette mit seinem ehemaligen Schiffskameraden Ned Barell gewonnen. Ned war ein Trinker, selbst nach den Maßstäben der Marinesoldaten. Er kam aus einem Fischerdorf in Maine, verbrachte nun aber seine Zeit damit, in den edelsten Bars und Casinos Bostons seinen Lohn durchzubringen. Bei irgendeinem Basketballspiel wettete er mit Daniel um fünfzig Dollar. Alice war empört. Sie waren im zweiten Ehejahr, und sie war mit Kathleen schwanger. Aber Daniel beteuerte, dass es eine sichere Sache sei und er die Wette sonst auch nie eingegangen wäre. Dann gewann er.
Aber Ned hatte das Geld nicht.
»Was für eine Überraschung«, sagte Alice, als Daniel es ihr abends erzählte.
Daniel grinste sie nur groß an: »Aber du errätst nie, was er mir stattdessen gegeben hat.«
»Ein Auto?«, schlug Alice mit sarkastischem Unterton vor. Ihr zwölf Jahre alter Ford Coupé soff regelmäßig ab. Mittlerweile hatten sie sich an die Kraftstoffrationierung gewöhnt und gingen sowieso zu Fuß oder nahmen die Straßenbahn. Aber jetzt war der Krieg vorbei, und es stand ihnen ein harter neuenglischer Winter bevor. Alice hatte nicht vor, eine jener Mütter zu werden, die ihr brüllendes Neugeborenes zu beruhigen versuchten, während die anderen Fahrgäste ihr vorwurfsvolle Blicke zuwarfen.
»Besser«, sagte Daniel.
»Besser als ein Auto?«, fragte Alice.
»Ein Grundstück«, sagte Daniel verschmitzt, »ein ordentliches Stück Land in Maine, direkt am Wasser.«
So einfach konnte sie das nicht glauben: »Daniel Kelleher, wenn das ein Witz sein soll…«
»Das würde ich mir nie erlauben, verehrte Dame«, sagte er, indem er auf sie zuging und ein Ohr an ihren Bauch legte.
»Hörst du, Gummibärchen?«, sprach er zu ihrem Gürtel.
»Daniel!«, rief sie und versuchte, ihn von sich zu drücken. Sie mochte es nicht, wenn er mit dem Baby sprach, als wäre es schon Teil seines Lebens.
Daniel ignorierte sie.
»Heute in einem Jahr bauen wir Sandburgen, du und ich. Papa hat einen ganzen Strand für dich.« Er richtete sich wieder auf. »Neds Großvater hat seinen Enkeln Land vererbt, aber Ned ist sein Anteil egal. Es gehört uns!«
»Für eine Fünfzigdollarwette?«, fragte Alice.
»Also sagen wir mal so: Es war die letzte in einer langen Reihe von Fünfzigdollarwetten, die er vielleicht nicht alle ganz abbezahlt hat.«
»Daniel!« Trotz der guten Nachricht war sie ein bisschen sauer.
»Liebling, mach dir doch keine Sorgen. Du bist mit einem Glückspilz verheiratet«, sagte er mit einem Augenzwinkern.
Alice glaubte nicht an Glück. Und wenn es das gab, blieb es ihr fern. In zwei Ehejahren hatte sie drei Fehlgeburten gehabt. Bevor Alice und ihre Geschwister zur Welt kamen, hatte ihre Mutter zwei Babys verloren. Das wusste Alice, obwohl sie nicht danach zu fragen gewagt hatte. Ihre Mutter hatte dazu nie mehr gesagt, als dass Gott sie wohl prüfen wolle, indem er ihr das Liebste nahm. Alice fragte sich, ob die Kinder in ihrem Fall nicht deshalb wieder verschwanden, weil sie wussten, dass sie nicht willkommen waren. Oder, um genau zu sein, weil sie wussten, dass Alice keine Mutter war.
Sie kannte den Ablauf: Erst blieben die dunklen Flecken in der Unterwäsche aus, dann folgten ein paar Wochen Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerz, dann sah sie Blut in der weißen Toilettenschüssel. Und wieder war eine Seele dahingegangen.
Im Aufzug des Bürogebäudes, in dem sie arbeitete, hatte sie ein Gespräch zwischen zwei Mädchen mitgehört. Die eine hatte der anderen zugeflüstert, dass ihr ein Arzt in New York ein Diaphragma angepasst habe.
»Das ist eine Befreiung, sag ich dir!«, meinte sie. »Harry passt nämlich überhaupt nicht auf.«
»Wenn die Männer die Kinder rauspressen müssten, würden sie schon aufpassen«, sagte die Freundin. »Stell dir vor: Ronald beim Hecheln und Pressen.« Sie schloss den Mund und blies die Wangen auf, bis beide in verhaltenes Gelächter ausbrachen.
Alice hätte so gerne mit ihnen darüber gesprochen und mehr erfahren. Aber sie kannte die beiden nicht, und außerdem fand sie es vulgär, dass sie über derartige Dinge sprachen. Sie wusste nicht, wen sie fragen sollte, also fuhr sie eines Morgens vor der Arbeit zu einer entfernt gelegenen Gemeinde. Man sprach von der Anonymität der Beichte, dabei sah man den Priester ja, bevor er in den Beichtstuhl stieg, und auch er konnte einen sehen. Dieser war ein alter Mann mit schlohweißem Haar. Auf einem Schild las sie: PFARRER DELPONTE. Vermutlich Italiener, dachte Alice. Italienerinnen waren leicht zu haben, das war allgemein bekannt. Hoffentlich würde er sie nicht für eine halten. Sie war schließlich verheiratet.
Sie kniete im Halbdunkel des Beichtstuhls nieder, schloss die Augen und bekreuzigte sich.
»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, amen«, begann sie mit den wohlvertrauten Worten.
Als sie ihm von den Fehlgeburten berichtete, errötete sie tief.
»Ich frage mich, ob ich vielleicht noch nicht so weit bin«, sagte sie. »Ich frage mich, ob ich es nicht vielleicht etwas hinauszögern sollte. Vor ein paar Jahren ist meine Schwester gestorben, und ich bin noch nicht wieder ganz ich selbst. Ich fürchte mich davor, Mutter zu werden. Ich glaube, ich bin nicht bereit, einem neuen Menschen in meinem Leben genug Liebe zu geben, zumindest jetzt noch nicht.«
Sie hatte nicht zu Ende gesprochen, da fragte er: »Wie alt sind Sie?«
»Vierundzwanzig.«
Alice hätte schwören können, dass sie durch das Gitter einen erstaunten Ausdruck auf seinem Gesicht gesehen hatte.
»Natürlich sind Sie alt genug, meine Tochter«, sagte er mit sanfter Stimme. »Unser Weg ist von Gott vorgezeichnet. Wir müssen an diesen Weg glauben und dürfen nichts tun, das uns von ihm abbringen könnte.«
Hatte er sie auch richtig verstanden? Vielleicht hatte sie sich undeutlich ausgedrückt.
»Ich habe von gewissen Mitteln und Wegen gehört, mit denen man es verzögern kann«, fing sie nach Worten suchend an. »Ich weiß, dass die Kirche das nicht gutheißt –«
»Die Kirche verbietet es«, sagte er, und das war sein letztes Wort.
Nachdem sie auf dem Parkplatz kurz geweint hatte, ging sie zur Arbeit. Daniel erfuhr nie davon.
Die jetzige Schwangerschaft dauerte schon sechs Monate an. Alice hatte panische Angst. Sie schlich umher und traute sich kaum, tief einzuatmen. Abends brauchte sie einen kleinen Whiskey, um einschlafen zu können. Sie rauchte doppelt so viel wie sonst und musste nachmittags um den Block gehen – dreimal schon hatte ihr Chef sie ermahnt, weil sie während der Arbeitszeit vom Schreibtisch verschwand. Mister Kristal war richtig gemein gewesen. Vermutlich hatte er ihren Zustand erraten und wusste aus Erfahrung, dass sie sowieso bald kündigen würde.
Am Samstag, nachdem Daniel das Grundstück gewonnen hatte, fuhren sie nach Cape Neddick. Alice wusste nicht, was sie erwartete. Sie war nur einmal als junges Mädchen auf einen Tagesausflug mit ihren Geschwistern in Maine gewesen. Zu sechst hatten sie sich in den Pontiac ihres Vaters gequetscht und waren mit offenen Fenstern über den Highway gedonnert. Mittags hielten sie an einer Fischbude und fuhren dann nach Osten, bis sie ein ruhiges Stück Strand entdeckten. Die Jungs ließen Steine springen, während Alice und Mary im Sand saßen und plauderten. Alice zeichnete die Dünen in ihr Tagebuch. Sie wussten nicht genau, wo sie waren, und blieben nicht lange. Eine Übernachtung konnten sie sich nicht leisten, nicht einmal in einem der billigen Motels am Autobahnrand.
Seitdem waren nur wenige Jahre vergangen, aber Alice kam es vor, als sei es in einem anderen Leben gewesen.
Daniel lenkte den Wagen durch das Zentrum von Ogunquit, vorbei an einem Motel, einem Tanzlokal, der Drogerie Perkins und dem Leavitt Lichtspielhaus, wo um zwei Uhr eine Vorstellung von Urlaub in Hollywood beginnen sollte. Sie fuhren immer geradeaus und kamen am steinernen Gebäude der Bibliothek, der Baptistenkirche und einer Reihe vornehmer Hotels vorbei, bis sie die Landspitze erreichten, wo Hummerfallen an Fischerhütten lehnten und Fischerboote auf dem Wasser schaukelten. Die Landzunge war auf drei Seiten vom Meer umgeben: Zu ihrer Linken und geradeaus sahen sie die felsige Atlantikküste, und rechts lag eine kleine Bucht mit einer Fußgängerbrücke, die zur anderen Seite hinüberführte. In einen Stein am Fuß der Brücke waren die Worte PERKINS BUCHT gemeißelt.
Alice zog die Augenbrauen hoch. »Heißen denn hier alle Perkins?«
»So ungefähr«, sagte Daniel und war sichtlich stolz, seine Ortskenntnisse unter Beweis stellen zu können. »Ned meint, dass den Perkins der halbe Landstrich gehört. Die sind auch Fischer, wie Neds Familie. Ned war zu Schulzeiten mit einer der Perkinscousinen zusammen.«
»Die Glückliche«, sagte Alice.
»Na, na«, sagte Daniel. »Ned hat mir sogar einen Reim aus der Gegend beigebracht. Bist du bereit?«
Bevor Alice protestieren konnte, sagte er ihn auch schon mit singender Stimme und in seiner besten James-Cagney-Imitation auf:
Ein Perkins hat den Supermarkt
Ein Perkins hat die Bank
Ein Perkins füllt Benzin in jeden Autotank.
Ein Perkins hat die Zeitschriften
Ein anderer den Gin,
Egal, was du gerade brauchst, zu Perkins musst du hin.
Ein Perkins greift ins Portemonnaie
Uns allen alle Tag
Und wenn ich sterb, so denke ich,
Lieg ich in ’nem Perkinssarg.
Alice verdrehte die Augen. »Danke, Schatz. Ich hab’s begriffen.«
Sie wendeten und bogen auf die Shore Road ein. Daniel fuhr langsam und sah zu beiden Seiten aus dem Fenster. Linker Hand blitzte das Meer hinter einem Pinienwald. Hier und dort standen inmitten grüner Wiesen Schindelhäuser mit der amerikanischen Flagge im Vorgarten. Auf den Weiden grasten Kühe.
»An dieser Straße muss es irgendwo sein«, sagte Daniel.
Die neue Landkarte lag aufgefaltet auf Alices Schoß. Daniel war davon ausgegangen, dass seine Frau sie lesen konnte, aber Alice erinnerten die Flächen und Linien nur an das Gewirr aus Venen und Muskeln in ihrem alten Biologielehrbuch. Sie wartete darauf, dass er sie anfuhr und so etwas sagte wie: »Jetzt reicht’s. Gibt mal her!« Aber das war nicht seine Art. Er lachte nur und sagte: »Sieht aus, als hätte ich mir eine Tagträumerin als Kopilotin ausgesucht. Na, dann müssen wir eben unserer Nase folgen.«
In diesem Augenblick sah Alice die kleine Gruppe von Männern und Frauen, die in Malerkitteln vor ihren Staffeleien auf einem Hügel saßen.
»Es gibt hier eine Künstlerkolonie«, sagte Daniel. »Ned hat erzählt, dass die Hütten der Hummerfischer eine nach der anderen von Künstlern übernommen werden. Ich dachte, das würde dir gefallen. Die bieten Sommerkurse an. Vielleicht ist was für dich dabei.«
Alice nickte nur, aber sie war plötzlich angespannt. Sie wehrte sich gegen düstere Gedanken, spürte aber schon, wie ihre Stimmung umschlug. Sie starrte aus dem Fenster.
Zu ihrer Rechten stand ein schlichtes Holzhaus mit einem Schild: RUBYS GEMISCHTWAREN. Zur Linken sah sie ein kleines grünes Gebäude, das man für ein Wohnhaus hätte halten können, hätte das Holzschild über der Veranda es nicht als Apotheke ausgewiesen.
Briarwood Road war nicht ausgeschildert. Ned hatte gesagt, sie sollten der Straße entlang der Küste folgen, bis sie nach etwa drei Kilometern auf eine Gabelung stießen. Da sollten sie links auf eine unbefestigte Straße einbiegen. Dann ginge es geradeaus bis ans Meer.
»Er hat gesagt, es sieht aus, als würde man direkt in den Wald fahren«, sagte Daniel.
Alice stöhnte und bereitete sich geistig auf ein undurchdringliches Dickicht vor, das Ned einfach als sein Eigentum erklärt hatte.
Sie mussten mehrfach wenden, weil sie den Eingang zweimal verpassten. Beim dritten Versuch bogen sie an einer Stelle ab, die man kaum als Weggabelung erkennen konnte. Alice war sprachlos. Was da vor ihnen lag, war wie aus einem Märchenbuch: Ein sandiger Weg schlängelte sich durch einen Tunnel aus üppigen Pinien, und als sie an seinem Ende ankamen, glitzerte vor ihnen das Meer in der Sonne. Es hob sich dunkelblau gegen einen kleinen Sandstrand ab, der die felsige Küste unterbrach.
»Willkommen zuhause«, sagte Daniel.
»Das gehört uns?«, fragte Alice.
»Tja, ein Hektar davon«, sagte er. »Und zwar der allerbeste – das ganze Uferstück.«
Alice war begeistert. Keiner ihrer Freunde und Bekannten zuhause hatte ein Haus am Strand. Sie stellte sich schon vor, was ihre beste Freundin Rita für ein Gesicht machte würde, wenn die das Grundstück sah.
Alice drückte Daniel einen Kuss auf den Mund.
Er grinste: »Es gefällt dir also.«
»Ich weiß schon, welche Vorhänge wir nehmen.«
»Wunderbar. Dann ist das Wichtigste ja erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Haus, in das wir sie hängen können.«
Auf dem Rückweg hielt er an der Weggabelung an, ritzte ein Kleeblatt und die Buchstaben A.H. in die weiche Borke einer Birke und sagte: »Jetzt verpassen wir die Abzweigung nie wieder.«
»A.H.?«, fragte sie. »Was soll das denn sein?«
Wie ein Lehrer zeigte er langsam auf einen Buchstaben nach dem anderen: »Alices. Haus.«
Daniel und seine Brüder bauten das Sommerhaus eigenhändig, sie setzten jeden Balken selbst. Die fünf Räume im Erdgeschoss waren durchgehend miteinander verbunden: Durch die enge, steinerne Küche betrat man das Wohnzimmer. Hier standen das schwarze Klavier von J. & C. Fischer aus New York, außerdem ein gusseiserner Holzofen in der Ecke und ein Esstisch, an dem problemlos zehn Personen Platz hatten, obwohl sie sich oft zu sechzehnt daran drängten. Von diesem Raum kam man in ein kleines Schlafzimmer, das die richtige Größe für ein Paar hatte und an ein sonnengelbes Bad angeschlossen war. Das Bad führte in ein weiteres Schlafzimmer, so groß wie alle anderen Räume zusammen, in dem zwei Einzelbetten und vier Stockbetten standen. Über allem lag der Dachboden, der einzige Ort im Haus, in dem man ungestört war. An die Küchentür war ein Windfang angebaut, und vom Wohnzimmer ging eine Veranda ab. Außerdem gab es eine Außendusche voller Spinnweben, von der aus man beim Haare waschen die Sterne beobachten konnte. Das war alles. Ihr kleines Stück vom Paradies. Hier verbrachten die Kellehers fortan jeden Sommer.
In den fünfziger Jahren wurden immer mehr Grundstücke um Ogunquit und Cape Neddick von reichen Auswärtigen gekauft. Aber an der Briarwood Road baute niemand, und sie empfanden das Waldstück mit den herrlichen Bäumen, die den Weg zum Strandhaus säumten, als ihr Eigentum.
Jeden Juni verließen sie Massachusetts und blieben in Maine, solange es ging. Wenn Daniels Chef bei der Versicherungsgesellschaft ihm nicht freigab, fragte Alice Rita, ob sie mitkommen wolle. Dann machten die beiden, jede mit einem Baby im Arm, die Antiquitätenläden in Kennebunkport unsicher und schlürften am Strand vor dem Haus Cocktails. An Regentagen gingen sie ins Kino oder fuhren an der Küste entlang. Eines Sommers bespielte Tallulah Bankhead vier Wochen lang das Theater von Ogunquit, und Alice und Rita besuchten zwei Vorstellungen, obwohl das Stück eigentlich nicht besonders gut war. Die Leute des Städtchens waren eine seltsame Mischung aus einheimischen Fischersleuten, Touristen, Schauspielern und Künstlern. Wohin man auch blickte, malte jemand das Meer, einen Sonnenuntergang oder geschickt arrangierte Hummerfallen. Alice vermied die Künstler. Im Ort hatte einer von ihnen, übrigens ziemlich gutaussehend, sie eines Morgens gefragt, ob er sie porträtieren dürfe. Sie hatte gelächelt, war aber weitergegangen, als hätte sie ihn nicht verstanden.
An manchen Wochenenden bekamen sie Besuch von Alices oder Daniels Familie. Dann aß und trank man zusammen, sang zu Alices Klavierspiel irische Volkslieder und ging spät ins Bett. Wenn sie morgens von der Kirche zurückkam, legten sich Alice und ihre Schwägerinnen in einer Reihe in den Sand und ließen sich stundenlang die Sonne auf die nackten Beine brennen. Alice hatte dann ein Buch dabei, denn diese Frauen waren keine besonders gute Gesellschaft: Sie lehnten Klatsch aus moralischen Gründen ab und beneideten Alice offensichtlich um ihre Figur. Alice sehnte ihre Schwester Mary herbei, und manchmal vergaß sie fast, was geschehen war, und wartete darauf, dass Mary um die Hausecke bog.
Am späten Nachmittag gingen die Frauen in die Küche, schälten Maiskolben und kochten Kartoffeln. Im Hintergrund lief eine Dean-Martin-Platte. Die Männer standen währenddessen in die Kohlen pustend um den Grill, als brauchte man acht Mann, um ein Feuer anzufachen.
Dann kamen immer mehr Kinder dazu – die drei von Alice und Daniel und ihre zweiundvierzig Nichten und Neffen. Jahrelang wurde das Sommerhaus von einer Armee von Kindern belagert, und Alice gab es bald auf, die Zimmer in präsentablem Zustand halten zu wollen. Bis zum vierten Juli war auch das letzte Kind knallrot und sommersprossig, und ihr braunes Haar, besonders das der Mädchen, gebleicht, weil sie es nach dem Vorbild ihrer Mütter morgens mit Zitronensaft beträufelten. Fußsohlen, die am Tag der Ankunft weich und glatt gewesen waren, wurden durch wochenlanges Barfußlaufen über Stege und Dünen rauh und hart. Daniel meinte, dass sie am Ende des Sommers allesamt über Scherben gehen könnten.
Umgeben von glücklichen Menschen, die dankbar waren, hier sein zu dürfen, konnte Alice in Cape Neddick vergessen. Die Kinder rannten mit ihren Cousins in Rudeln durch die Gegend und brauchten nichts. Abends beobachtete sie, wie sich der Himmel über dem Meer rot färbte. Es brachte ihr in Erinnerung, dass Gott nicht nur Schmerz, sondern auch Schönheit geschaffen hatte. Im Sommer in Maine war sie ein anderer Mensch.
Zuhause in Massachusetts wurde sie von Erinnerungen heimgesucht. Wenn sie mit den Kindern allein war, hatte sie manchmal das Gefühl, alles würde ihr entgleiten. Eine düstere Stimmung überfiel sie unerwartet, und sie litt unter starken Kopfschmerzen, die sie oft ganze Nachmittage lang ans Bett fesselten. Ihr Alltag hier war von Natur aus langweilig, und Langeweile vertrug sie nicht. Wie sehr sie sich auch bemühte, sie konnte sich nicht an den Herd stellen, über die Wäscheberge beugen oder den Küchenboden schrubben, als gäbe es nichts Schöneres. Ihr war etwas Anderes vorbestimmt. Das Sommerhaus in Maine war das einzige, das sie von den anderen unterschied, das einzige nicht Gewöhnliche an ihr.
Mit zwölf oder dreizehn verkündete die Große, schon immer eine Miesmacherin, dass sie die Urlaube in Maine hasste. Die Luft sei mückenverpestet und das Wasser eiskalt, fand Kathleen. Es gab keinen Fernseher, und es war sterbenslangweilig. Vom jährlichen Ankunftstag zu Beginn des Sommers bis zum unvermeidbaren Morgen, an dem sie das Auto beluden, um nach Massachusetts zurückzukehren, jammerte Kathleen von da an: »Können wir jetzt zurückfahren? Wann fahren wir endlich zurück?«
»Seltsam«, hatte Daniel einmal gesagt.
»Ach, wieso denn?«, sagte Alice. »Sie muss gemerkt haben, wie glücklich ich hier bin und automatisch beschlossen haben, dass sie Maine nicht ausstehen kann.«
Viel später – die Zeit schien schneller zu vergehen, je älter sie wurde – kamen die Enkel. Daniel ging in Rente. Die Kinder kamen nach Maine, wann sie wollten und keiner machte sich die Mühe, vorher Bescheid zu sagen. Sie brachten einfach eine Extraladung Hotdogs und Heineken mit, dazu Kekse oder Heidelbeerkuchen von Rubys Gemischtwaren. Daniel und Alice waren die einzige Konstante. Ständig drängten mehr Familienmitglieder ins Haus und schliefen, wo gerade Platz war: Auf dem Holzboden im Wohnzimmer lagen zugedeckt die Kleinen, die jungen Leute machten es sich auf Luftmatratzen auf dem Dachboden gemütlich, und der Laufstall ihres Enkels Ryan wurde in die enge Küche gezwängt.
Frühmorgens, wenn noch alles schlief, kochte Alice eine Kanne Kaffee, schob Brötchen in den Backofen, briet ein Dutzend Eier mit Schinken und stellte für die sandigen Kinderfüße einen Wassereimer vor den Eingang. Später half sie vielleicht noch Kathleen oder Ann Marie, die Kinder mit Sonnencreme einzureiben. Aus Erfahrung wussten sie, dass für irische Haut etwas anderes als Lichtschutzfaktor fünfzig nicht in Frage kam. Und selbst dann gab es üble Sonnenbrände mit krebsroter Haut und schmerzhaften Brandblasen, die den Rest des Tages mit verschiedenen Cremes behandelt werden mussten. Die Enkel kamen, wie schon die Kinder, nach Daniel: Eine halbe Stunde in der Sonne reichte, und die kleinen, rosigen Gesichter waren von Sommersprossen übersät.
Ein paar Jahre vor Daniels Tod hatte ihr Sohn Patrick eine Überraschung für sie. Er wolle ein Haus nur für sie bauen, und zwar ein richtiges, modernes Haus mit Luxusausstattung und der neuesten Haustechnik, mit Meerblick, aber ohne schreiende Kinder. Es sollte gleich neben dem alten Sommerhaus stehen, aber um Meilen besser sein. Sie hätten dort einen großen Fernsehschirm, der an ein irgendwie in die Wände eingebautes Lautsprechersystem angeschlossen wäre. Im alten Haus gab es nur ein kleines Radio, mit dem man die Baseballspiele der Boston Red Sox nur verfolgen konnte, wenn man es aufs Fensterbrett stellte und die Antenne im richtigen Winkel ausrichtete.
»Wäre das nicht wundervoll?«, sagte Alice zu ihrem Mann, als Pat ihnen seine Pläne eröffnet hatte. »Ein Unterschlupf nur für uns zwei. Keine Viecher im Dachgebälk, kein Schimmelgeruch im Bad. Und kein undichter alter Kühlschrank.«
»Aber genau das macht doch ein Sommerhaus aus«, sagte Daniel. »Wenn wir alleine in einem perfekten Haus sitzen wollen, können wir gleich in Canton bleiben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr uns loswerden wollt.«
Alice sagte, das sei vollkommener Unsinn, obwohl sie eigentlich dasselbe dachte. Die Pläne klangen extravagant und widersprachen ihrer Vorstellung von einem Familienferienhaus. Aber Patrick hatte schon alles ausgetüftelt und er hatte so glücklich ausgesehen, als er ihnen davon erzählte. Außerdem, meinte er, würde ein zweites Haus auf dem Grundstück den Marktwert steigern.
»Wie bei Monopoly«, hatte er gesagt, und Alice hatte gelacht. Aber hinter Daniels verkrampftem Lächeln sah sie, dass er den Kommentar als herablassend empfand.
Als das Haus stand, ließ Patrick das Anwesen neu schätzen und erklärte, dass es jetzt über zwei Millionen Dollar wert sei. Alice wurde schwindelig. Zwei Millionen Dollar für ein Grundstück, das ihnen ein halbes Jahrhundert zuvor einfach in den Schoß gefallen war!
»Siehst du? Unser Junge ist ein schlaues Bürschchen«, sagte sie zu Daniel.
Aber Daniel schüttelte den Kopf und sagte: »Es ist nicht gut, so über Geld zu reden. Unser Zuhause ist unverkäuflich.«
Sie blickte in seine traurigen Augen und lächelte. Auch sie wollte dies alles festhalten, genau wie er.
Alice legte ihm eine Hand auf die Wange. »Niemand hat etwas anderes behauptet.«
Von ihren drei Kindern hatte es Patrick, der Jüngste, mit Abstand am Weitesten gebracht. Er hatte die Boston College High School besucht und war in seinem letzten Schuljahr dort mit Sherry Burke, der Tochter des Bürgermeisters von Cambridge, zusammen gewesen. Sherry war ein nettes Mädchen, und ihre Familie hatte Patrick in die Welt der guten Dinge einführt. Alice glaubte, dass es die Jahre mit Sherry gewesen waren, die in Patrick den Wunsch geweckt hatten, das große Geld zu machen. (Heute sah sie Sherry, die jetzt Senatorin war, manchmal im Fernsehen.) Nach der Schule ging Pat zur Notre-Dame-Universität und machte den sechstbesten Abschluss. Er lernte Ann Marie kennen, die am Schwestercollege Saint Mary studierte. Die beiden heirateten in dem Sommer, in dem sie zweiundzwanzig wurden. Sie führten eine gute Ehe und hatten drei zauberhafte Kinder: Fiona, Patty und den entzückenden Daniel Junior, Alices Liebling. Pat war an der Börse, und Ann Marie kümmerte sich um den Haushalt. Sie wohnten vor den Toren Bostons in einem riesigen Haus in Newton mit Swimmingpool und der passenden dunkelblauen Mercedeslimousine in der Garage.
Alices Töchter nannten sie Familie Makellos. Und verglichen mit ihnen waren sie das ja auch. Alice sagte oft, dass Ann Marie ihr eine bessere Tochter sei, als eine von ihnen es je sein könnte. Ihre Schwiegertochter nahm sie auf Wochenendausflüge mit, und sie gingen gemeinsam zu einem teuren Friseur in der Stadt. Sie trafen sich regelmäßig zum Mittagessen und tauschten Rezepte, dicke Bücher und Modezeitschriften aus. Alices Töchter hingegen schafften es meist nicht einmal, sie wöchentlich anzurufen und einigermaßen auf dem Laufenden zu halten. Clare machte das gelegentlich durch hübsche Geschenke wieder gut, aber Kathleen gab sich überhaupt keine Mühe.
Clare war das mittlere Kind und zwei Jahre älter als Patrick. Als die Kinder noch klein waren, hatte Alice sich um sie am meisten gesorgt. Ihre Mähne war rot wie Herbstlaub, sie hatte ein unvorteilhaft rundes Gesicht und jede Menge Sommersprossen. (Die hatte sie von Daniel.) Sie war jungenhaft und hatte mehr Köpfchen, als gut für sie war. Ihren Highschool-Abschluss hatte Clare mit nonnenhaftem Ernst verfolgt: Sie hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, sich am offenen Fenster in die Schulbücher vertieft und Alice Zigaretten stibitzt, wenn sie sich unbeobachtet fühlte. Sie hatte nie mehr als einen oder zwei Freunde gehabt, und auch diese Freundschaften hatten nie länger als ein paar Monate gehalten. Daniel hatte die Idee für nicht gerade mütterlich gehalten, aber Alice befürchtete, dass irgendetwas an Clares Verhalten die Leute abstieß.
Nach ihrem Abschluss vom Boston College nahm Clare einen Job in der IT-Branche an. Bis heute wusste Alice nicht genau, was sie da gemacht hatte. Clare hatte sich ganz ihrer Arbeit verschrieben und, soweit Alice wusste, nie einen Freund gehabt. Mit Ende dreißig traf sie Joe, natürlich über die Arbeit. Seine Familie besaß ein Devotionaliengeschäft im Süden Bostons. Sie verkauften Bibeln, Gebetsbücher, Kreuze und zur Erstkommunion Nachbildungen des Prager Jesulein. Als Joes Vater sich zur Ruhe setzte, ging das Geschäft auf Joe über. Seitdem verkaufte Clare die Waren irgendwie übers Internet.
Sie verdienten gut und wohnten in einem alten viktorianischen Bau im Bostoner Jamaica Plain, einem Bezirk, den sie für seine kulturelle Vielfalt und die öffentlichen Parks zu lieben vorgaben. (Klingt wie eine nette Beschreibung für ein Armenviertel, dachte Alice, als sie das hörte. Dabei wusste sie, dass das Haus nicht billig gewesen war.) Die Nachbarn auf beiden Seiten waren Schwarze.
Alice konnte sich nicht daran erinnern, einen Schwarzen gesehen zu haben, bevor sie mit neunzehn einen Job in der Bostoner Innenstadt bekam. Heute konnte sie die Straße im Vorort Dorchester, auf der sie aufgewachsen war, nicht entlangfahren ohne die Autotüren zu verriegeln, die Luft anzuhalten und innerlich zehn Ave Maria zu sprechen. Wo ihre Brüder früher vor dem Abendessen Basketball gespielt hatten, standen jetzt Gangs und Prostituierte. Aber das durfte man ja nicht sagen. Wenn man es doch tat, wurde man von Clare und Joe der Bigotterie bezichtigt.
Die beiden waren wie füreinander geschaffen. Beide waren ganz versessen auf dieses neumodische liberale Tamtam, und sie waren so verliebt, dass Joe Clares höchstens als unscheinbar zu bezeichnendes Äußeres gar nicht aufzufallen schien und ihr seine eigentlich peinliche Körpergröße offenbar ganz egal war. Ihr Sohn Ryan war siebzehn und machte seinen Schulabschluss an der Boston Arts Academy. Er war ein talentierter Sänger und würde noch groß rauskommen. Manchmal war er ganz schön frech, aber so hatte man ihn eben erzogen. Alice hatte ihnen ja von einem Einzelkind abgeraten. Als Ryan noch klein war, wollte er immer, dass Alice für ihn Klavier spielte. Er sang dann dazu Tomorrow aus dem Musical Annie und erreichte die Höhen mindestens so gut wie die Mädchen am Broadway. Alice und Daniel hatten im Lauf der Jahre so viele Schultheaterstücke besucht, dass Daniel sich irgendwann Ohropax besorgt hatte, um im Zuschauerraum ein Nickerchen halten zu können. Alice aber liebte diese Aufführungen. Sie hatte alle Programmhefte aufbewahrt. Aber jetzt hielten Clare und Joe ihr Ryan fern. Bei den vielen Vorsingterminen, Reisen und einem stressigen Alltag blieb für die Oma keine Zeit. Alice hielt das für eine schlechte Ausrede.
Kathleen, die Große, hatte Alices schwarzes Haar und ihre blauen Augen, und als die beiden noch klein waren, war sie die hübschere Schwester gewesen. Aber auch das nur relativ. Sie hatte ein viel zu rundes Gesicht und schon im Jugendalter hatte man an ihren runden Hüften und Brüsten absehen können, dass sie ansetzen würde.
Daniel meinte, dass Alice nie echte Muttergefühle für Kathleen entwickelt habe und sie auch so behandelte. Dafür hatte er sie verzogen und nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie sein Liebling war. So war es, als Kathleen noch klein war, so war es, als er ihr in der Zeit ihrer Scheidung das Sommerhaus zur Verfügung stellte, obwohl er das eigentlich mit Alice hätte absprechen müssen, und so war es auch noch kurz vor seinem Tod, was Alice ihm und Kathleen nie ganz hatte verzeihen können.
Nach der Scheidung ging Kathleen nochmal zur Uni und studierte Sozialpädagogik. Ihre Kinder waren noch klein und brauchten sie. Aber Kathleen war tagsüber kaum zuhause und ging abends zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker, als gäbe es da was umsonst. Später arbeitete sie dann als Vertrauensperson an einer Schule und ging mit lauter ungeeigneten Männern aus.
Aus ihren Kleinen, Maggie und Christopher, war geworden, was bei einer kaputten Familie zu erwarten war. Chris hatte Wutanfälle. Als Jugendlicher hatte er einmal ein Loch in die Badezimmerwand geboxt, als seine Mutter ihm Hausarrest erteilt hatte, weil er sich heimlich aus der Wohnung schlich. Im Gegensatz zu ihrem Bruder war Maggie zu bemüht, das brave Mädchen zu sein. Sie war zu höflich und zu sehr an anderen interessiert. Das machte Alice nervös.
Nach Daniels Tod zog Kathleen mit diesem Gammler Arlo nach Kalifornien. Zu dem Zeitpunkt kannten die beiden sich gerade sechs Monate. Ihr Plan war – um genau zu sein, war es sein Plan – eine Firma zur Herstellung von Düngemittel aus Wurmexkrementen aufzubauen. Es war eine absurde Idee, und Alice schämte sich dessen bis heute. Besonders, weil Kathleen die Umsetzung dieses dummen Plans mit Daniels Erbe finanziert hatte. Aber Kathleen hatte ja auch schon vor Daniels Tod eine Menge Geld von ihm geliehen. Alice wollte gar nicht wissen, wie viel. Früher hatte sie geglaubt, was Daniel gehörte, gehöre ihnen beiden. Aber wenn dem so gewesen wäre, hätte sie wohl ein Stimmrecht in der Frage gehabt, ob sie Geld verschenkten. Das war aber nicht der Fall, wenn es um Kathleen ging. Sobald ihre älteste Tochter einen ihrer dummen, naiven Fehlgriffe tat, stand Daniel bereit, um alles wieder auszubügeln.
Kathleen war schon als Jugendliche bei den gleichaltrigen Jungs beliebt gewesen.
»Warum nimmst du deine Schwester nicht mal auf eine Party mit?«, hatte Alice Kathleen freitagabends oft gebeten. Oder: »Kannst du nicht einen netten Jungen für Clare finden?«
Aber Kathleen hatte nur mit den Schultern gezuckt, als hätte sie Alice gar nicht richtig verstanden.
Bei einer dieser Auseinandersetzungen war Alice so wütend auf ihre selbstsüchtige Tochter geworden, dass sie gebrüllt hatte: »Du solltest dankbar sein, überhaupt eine Schwester zu haben, du armselige Kreatur. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich –«
»Ja was würdest du denn machen?«, hatte Kathleen sie unterbrochen. »Was denn? Würdest du sie in irgendeinen Nachtclub schleppen und sie da sterben lassen?«
Alice war sprachlos gewesen. Wie hatte Daniel ihrer Tochter das erzählen können? Es blieb das einzige Mal, dass sie eines ihrer Kinder schlug.
Normalerweise überließ sie Daniel die körperliche Züchtigung der Kleinen, aus Angst davor, was sie in ihrer Wut und Frustration anrichten könnte. Sie hatten abgemacht, dass er die Kinder mit dem Gürtel schlug, wenn sie es brauchten. Alice hatte damit nie ein Problem gehabt. Ihre Geschwister und sie hatten viel Schlimmeres über sich ergehen lassen.
»Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt«, sagte sie zu den Kindern, wenn sie sich nicht benahmen, und sie sahen Alice dann mit großen, angsterfüllten Augen an.
Wenn Daniel dann kam, zerrte er den jeweiligen kleinen Missetäter mit viel Theatralik in eines der Kinderzimmer und zog die Tür hinter sich zu. Alice hörte ihn mit ernster Stimme sagen: »Das hast du dir selbst zuzuschreiben, das weißt du genau. Also zetere jetzt nicht.«
Danach hörte man nur noch das Knallen des Gürtels auf dem weichen Kinderhintern, gefolgt von dramatischem Geschrei. So ein Verhalten war für ihren Mann ganz untypisch, aber es erleichterte Alice. Manchmal waren die Kinder nämlich richtige Monster, und Daniel hielt sie in Schach, sodass Alice wieder mit ihnen klarkam.
Nach Daniels Tod erzählten die Kinder ihr, dass ihr Vater sie nie geschlagen hatte. Er habe sie nur nach oben gebracht, mit dem Gürtel ein paarmal auf die Matratze gehauen und sie angewiesen, bei jedem Schlag laut zu schreien.
Alice erhob sich von ihrem Sitzplatz auf der Veranda, ging in die Küche und goss sich ein Glas Wein ein. Beim Anblick des über die Arbeitsfläche verteilten Geschirrs und Silbers seufzte sie. Sie hatte gehofft, es sich vor dem Abendessen noch mit einem Buch gemütlich machen zu können, aber der Inhalt der Anrichte verlangte ihre Aufmerksamkeit.
Sie griff nach der großen Rolle Noppenfolie, schnitt ein paar lange Streifen ab und wickelte einen Teller nach dem anderen ein. Mit Zeitungspapier würde es schneller gehen, aber es wäre doch schade, wenn das Porzellan von der Druckertinte grau wurde, wenn sie es auch weggeben würde. Sie hatte kurz überlegt, das Geschirr Clare oder Ann Marie anzubieten, aber dann würden die beiden nur Fragen stellen, und Alice wollte nicht diskutieren.
In letzter Zeit hatten ihre drei Kinder eine Sache gemein: Sie gingen ihr allesamt unglaublich auf die Nerven.
Sie wollten, dass sie das Rauchen aufgab, zitierten Statistiken über die schlimmen Spätfolgen und zeigten mit der Frage auf die verfärbten Zimmerdecken, wie dann erst ihre Lunge aussehen müsse. Im letzten Frühjahr hatte sie eine brennende Zigarette im Aschenbecher auf dem Küchentisch vergessen, als sie mit Ann Marie zum Einkaufen gegangen war. Später trug ihre Schwiegertochter die Einkäufe für sie ins Haus und sah, dass die Zigarette auf den Tisch gefallen war und dort einen hässlichen Brandfleck hinterlassen hatte. Die Kinder waren vollkommen durchgedreht, obwohl ja nichts weiter passiert war.
Sie fanden, sie trinke zu viel. Aber wen interessierte das schon? Himmelherrgott, sie war doch über dreißig Jahre lang ihrem Mann zuliebe trocken geblieben. Zu Thanksgiving hatte Patrick ihr eine Standpauke gehalten, von wegen Alkohol am Steuer, dabei hatte sie nur ein paar Cocktails getrunken. Alice hatte gelacht. Sie hatte sagen wollen, dass sie früher regelmäßig mit mehr als nur ein paar Cocktails intus gefahren sei – erst als junge Frau, dann während der drei Schwangerschaften, später mit den kreischenden Bälgern auf dem Rücksitz des Kombi –, und es immer gut gegangen sei. Vermutlich dachten sie an den Unfall, als sie noch klein waren, aber das war längst Geschichte und außerdem ein absoluter Einzelfall gewesen. Es gab doch genug Schlimmes in der Welt, und Alice fragte sich, warum ihre Kinder sich unbedingt auf hypothetische Katastrophen versteifen mussten, die eventuell irgendwann eintreffen könnten.
Sie meinten, sie achte nicht sorgfältig genug auf ihre Ernährung und kontrolliere ihre Salzaufnahme nicht, wie vom Arzt verlangt. Ann Marie rief immer wieder mit warnenden Geschichten von der Verschlechterung der Diabetes ihrer Mutter an oder zitierte zu dem Thema Artikel aus USA Today, die ihr in die Finger geraten waren. Alice biss sich dann auf die Zunge, damit ihr nicht rausrutschte, dass Ann Maries Mutter zwar früher recht hübsch gewesen sein mochte, jetzt aber aussah wie Churchill im Badeanzug, wohingegen Alice, abgesehen von den Schwangerschaften, nie ein Gramm über vierundfünfzig Kilo gewogen hatte.
Sie meinten, Alice solle ihr Geld besser zusammenhalten, weil sie im Winter im Haus eingesperrt mit einem Manhattan oder einem Glas Cabernet vor dem Fernseher saß und ab und zu etwas bestellte – eine Time Life CD-Sammlung, einen Pürierstab, der die perfekte Suppe innerhalb weniger Minuten versprach, und einmal für die Kinder ihrer Enkelin Patty sogar ein Modell der Holzhütte, in der Lincoln geboren worden war. Aber sie gab nie mehr als 19,99 aus. Um sich besser zu fühlen, ging sie einmal im Monat sonntags nach der Kirche ins Kaufhaus, legte sich ein Seidentuch um und ließ sich am Chanel-Stand Lippenstift und Mascara auftragen. Natürlich kaufte sie nichts. Aber sie merkte sich das Gefühl und den Anblick im Spiegel, dann ging sie zu Marshalls und kaufte ein ähnliches Produkt von einer Billigmarke. Ihrem Adlerauge entging kein Niedrigpreis beim Schlussverkauf, und morgens schnitt sie Gutscheine aus der Zeitung und informierte Ann Marie telefonisch über die besten Angebote.
Trotzdem war es gar nicht so einfach, mit ihrem Geld zu haushalten, schließlich stand ihr nur ihre und Daniels Rente zur Verfügung. Vor ein paar Jahren hatte Patrick sich ihre Steuererklärung angesehen, die Stirn in Falten gelegt und gesagt: »Du gibst mehr aus, als du reinbekommst. Das musst du umdrehen, und zwar pronto.«
Ihr erster Gedanke war gewesen, das Grundstück in Maine zu verkaufen. Das hatte sie selbst überrascht, aber so war es.
An dem großen Neubau hing Alice nicht besonders, dafür umso mehr an dem kleinen Sommerhaus, das voller vertrauter Details war und wo in jeder Kommode und unter jedem Bett Geschichten aus ihrer Vergangenheit schlummerten. Auf dem Rahmen der Küchentür waren unzählige Daten und Initialen verzeichnet, anhand derer sie über die Jahre hinweg das Wachstum ihrer Kinder, Enkel, Nichten und Neffen verfolgt hatten. Hier hatte Clare laufen gelernt und Patrick sich eines Sommers beim waghalsigen Supermanflug vom Verandadach den Arm gebrochen. Hier waren ihre Enkel das erste Mal mit Sand in Berührung gekommen und ihre kleinen Körper ins Meer getaucht worden. Hier hatten Daniel und sie unzählige Spaziergänge gemacht und schweigend Hand in Hand die Sterne betrachtet.
Aber das waren nur Erinnerungen. Dieser Ort hatte keine Zukunft, nicht für Alice. In den letzten Jahren hatten ihre Kinder einen unsinnigen Zeitplan für das Sommerhaus entwickelt: Jeder Familie stand ein Sommermonat zu. Juni für Kathleen und ihre Kinder, Juli für Patrick und seine Familie, August für Clare, Joe und Ryan.
Es machte Alice nervös, ihre Kinder eines nach dem anderen zu sehen. Die fröhliche Spontanität früherer Sommer war vorbei. Seit Daniels Tod hielt nichts die Familie zusammen. Sie hatten sich voneinander entfernt, und irgendwann hatte Alice bemerkt, dass sie plötzlich nicht mehr die Matriarchin und weise, ordnende Herrin war, sondern die alte Dame, um die man sich kümmern musste, bevor man sich den schönen Dingen des Tages zuwenden konnte.
Sie hatte das Gefühl, dass ihre Kinder sich nicht leiden konnten, oder schlimmer noch, dass sie keine Verwendung füreinander hatten. Wofür sollte sie also das Grundstück behalten? Und warum sollte sie jedes Jahr die weite Strecke hierherfahren, wenn sie sich dann doch nur einsam fühlte und etwas vermisste, das längst der Vergangenheit angehörte?
Alice hatte den Eindruck, dass sich heutzutage jeder selbst der Nächste war. Die Art von Familie, in der Daniel und sie groß geworden waren und die sie weiterzuführen versucht hatten, gab es einfach nicht mehr. Ihre Mutter hatte inklusive der zwei verstorbenen Kleinkinder acht Kinder geboren. Bei Daniels Mutter waren es zehn gewesen. Obwohl sie den Krach, das Chaos und die Opfer, die das damals bedeutet hatte, gehasst hatte, sah Alice jetzt, dass es auch schön war, Teil einer großen Familie zu sein. Ihre Kinder und deren Kinder würden das nie verstehen. Deshalb zögerten sie auch nicht, die Sommermonate in Maine aufzuteilen und wenige Kilometer voneinander entfernt zu leben, sich aber nur alle paar Wochen zu sehen. Oder, wie in Kathleens Fall, ohne triftigen Grund ans andere Ende des Landes zu ziehen. Würmer, Herrgott nochmal.
Sie legte die Teller vorsichtig in eine auf dem Boden stehende Kiste. Darin stand schon eine Teekanne, die seit einer halben Ewigkeit zu dem alten Sommerhaus gehörte, ein paar alte Küchenhandtücher lagen darin und eine Kaffeetasse mit der Aufschrift Küss mich, ich bin Ire, die ihrem Bruder Timothy gehört hatte. Alice nahm die Tasse wieder heraus und stellte sie in den Schrank zurück.
Ihre Brüder fehlten ihr. Heute noch mehr als nach ihrem Tod vor einigen Jahren. In letzter Zeit verfolgten Alice auch Erinnerungen an ihre Schwester, und sie fragte sich, was gewesen wäre, wenn Mary nicht gestorben wäre. Im vergangenen Herbst waren es sechzig Jahre seit Marys Tod. Am achtundzwanzigsten November, ihrem Todestag, hatte Alice überlegt, ihr Grab zu besuchen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal da gewesen war. Auch ihre Eltern lagen dort begraben, die drei Namen auf einem Grabstein, auf dem auch die Namen der zwei kleinen Kinder standen, die sie in den Zwanzigern verloren hatten. Aber am Grab würde sie nur auf ein Zeichen ihrer Gegenwart hoffen, dabei wusste sie doch genau, dass sie dort nicht waren.
Alice hatte versucht, es zu vergessen, doch als sie am achtundzwanzigsten November den Boston Globe aufschlug, fand sie im Lokalteil eine ganzseitige Reportage über den Brand, sogar mit Fotos. Es wurde an die berühmtesten Opfer erinnert: Der alte Westernstar Buck Jones, der im Krankenhaus gestorben war, kurz bevor seine Frau ihn dort erreichte, um von ihm Abschied zu nehmen. Die Frau, deren Körper in einer Telefonkabine gefunden worden war, von wo aus sie ihren Vater angerufen und um Hilfe gefleht hatte. Ein Hochzeitspaar, das an jenem Tag in Cambridge geheiratet hatte und zusammen mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft in den Flammen umgekommen war. Und dann war da das Mädchen, das sie Jungfrau Maria nannten und die gestorben war, ohne je zu erfahren, dass ihr Liebster sie am nächsten Tag um ihre Hand hatte bitten wollen.
Alice las den Namen ihrer Schwester, und während sie sich an jene Nacht erinnerte, plagte ihr Gewissen sie, wie schon seit Jahren nicht. Es gab niemanden, mit dem sie darüber hätte reden können. Ihre Kinder würden sie nicht verstehen, und Daniel war lange tot. Doch selbst wenn er noch gelebt hätte, hätte sie es nicht gewagt, sich ihm anzuvertrauen.
Sie zwang sich dazu, an etwas anderes zu denken, aber schon wenige Minuten später brach sie beim Abwasch in Tränen aus. Ihre Brust schnürte sich zusammen, und sie dachte schon, es wäre ein Herzinfarkt.
Alice wünschte, sie könnte zur Kirche gehen, zu ihrer Kirche, die sie durch Freud und Leid begleitet hatte. Dass es diesen Ort nicht mehr gab, machte den Schmerz oft noch unerträglicher. Sie konnte nicht vergessen, dass sie die Gemeinde nicht hatte retten können. Und dennoch überraschte sie die Tatsache von Zeit zu Zeit, dass die Kirche jetzt geschlossen war. Den Pfarrer von St. Agnes hatte man in eine Gemeinde nach Connecticut geschickt, und Alice wusste nicht, wie sie ihn dort erreichen konnte. Sie fühlte sich vollkommen allein.
Da dachte sie an ihren Geistlichen für die Sommermonate, Pfarrer Donnelly. Mit zitternden Fingern wählte sie seine Nummer in Maine, ohne genau zu wissen, was sie sagen würde. Sechs Jahrzehnte lang hatte sie das Geheimnis bewahrt. Ihr war klar, dass Beichte hieß, nichts auszulassen, und dennoch erzählte sie Pfarrer Donnelly nur eine Version der Wahrheit. Danach kannte er nur die Teile der Geschichte, von denen auch Daniel schon gewusst hatte.
Er war sehr freundlich gewesen und hatte gesagt, dass sie sich verzeihen müsse. Das Gleiche hatte ihr auch Daniel gepredigt.
»Bitte«, hatte sie immer wieder gesagt, »erlegen Sie mir doch eine Buße auf. Sagen Sie mir, wie ich das wiedergutmachen kann.«
Nicht einmal dem Pfarrer gegenüber konnte sie ihre wahnsinnige Angst vor der Hölle eingestehen. Aber ihr war klar, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb.
»Wir müssen uns alle darauf konzentrieren, in der uns verbleibenden Zeit Gutes zu tun«, sagte er. »Es ist sinnlos, mit der Vergangenheit zu hadern. Überlegen Sie sich lieber, was Sie in der Gegenwart tun können.«
Früher hätte ein Pfarrer sie beten oder Verzicht üben lassen und sie dann von ihren Sünden losgesprochen. In der Fastenzeit gab es keine Süßigkeiten, kein Parfum, keinen Gin, je nachdem, was einem das Liebste war. Aber heutzutage schienen sie es vorzuziehen, dass man Gutes tat: Ein Haus neu anstreichen, Spenden für Unicef sammeln, ehrenamtlich mit Problemkindern arbeiten. Was auch immer.
Nachdem sie aufgelegt hatte, konnte sie freier atmen. Es war doch eine Erleichterung gewesen, es sich von der Seele zu reden. Dennoch goss sie sich ein Glas Wein ein und legte sich schon um sechs Uhr ins Bett.
Einen Monat darauf, Weihnachten war gerade vorbei, war Pfarrer Donnelly bei Freunden in Boston zu Besuch und kam bei Alice zum Mittagessen vorbei. Er wollte wissen, ob es ihr seit ihrem Gespräch besser ginge, und sie sagte Ja, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Sie hatte seitdem viel an Mary gedacht, und Pfarrer Donnellys Worte hatten sich ihr eingebrannt: Überlegen Sie sich, was Sie in der Gegenwart tun können. Aber sie konnte ihre Schwester nicht wieder lebendig machen, ebenso wenig konnte sie sich von ihren Sünden erlösen.
Sie servierte dem Pfarrer eine Geflügelpastete aus der Tiefkühltruhe, die sie schon ein paar Wochen zuvor zubereitet hatte. Die beiden saßen in der Küche, während vor dem Fenster Schnee auf die Rhododendronbüsche fiel, und das Gespräch wandte sich anderen Themen zu. Irgendwann ging es dann um St. Michael. Alice bemerkte die Sorgenfalten auf Pfarrer Donnellys Stirn. Die Finanzmittel schwanden, das Pfarrhaus verfiel, das Kirchendach war in schlechtem Zustand und im Keller, der bei Regen volllief, hatten sie jetzt auch noch mit Schimmelbefall zu kämpfen.
»Wenn wir Glück haben, bleiben uns dort vielleicht noch zehn Jahre«, sagte er. »Es ist einfach kein Geld für die Sanierung da.«
Alice konnte den Gedanken nicht ertragen, auch diese Kirchengemeinde zu verlieren. Plötzlich wusste sie, was zu tun war. »Meine Familie und ich haben beschlossen, dass das Grundstück in Maine nach meinem Tod an die Gemeinde von St. Michael gehen soll«, sagte sie. »Vielleicht beruhigt Sie das. Im großen Neubau und dem kleinen Sommerhaus ist Platz für zehn oder zwölf Personen. Sie können es aber auch verkaufen. Das Anwesen ist über zwei Millionen Dollar wert.«
Pfarrer Donnelly errötete genau wie Daniel, wenn er als junger Mann in eine peinliche Situation geriet.
»Aber Alice«, sagte er, »ich wollte damit doch nicht sagen –«
»Das weiß ich doch«, sagte sie. »Aber glauben Sie mir: Der Beschluss stand schon vor diesem Gespräch fest.«
»Ich kann mich Ihrer Familie unmöglich auf diese Weise aufdrängen«, gab er zurück.
»Ich habe St. Michael schon besucht, lange bevor Sie geboren wurden und bin seitdem jeden Sommer dort«, sagte sie mit ernstem Gesicht. »Ich habe der Gemeinde viel zu verdanken und es ist nur recht und billig, wenn ich jetzt etwas zurückgebe. Außerdem bedeutet das Grundstück meinen Kindern nichts.«
Noch während sie das sagte, wurde ihr plötzlich klar, dass die Kinder, vor allem Patrick, stinkwütend sein würden, dass sie eine solche Entscheidung ohne sie traf. Aber warum sollte sie das nicht tun? Schließlich war es ihr Grundstück. Hatte sie denn jemand nach ihrer Meinung gefragt, als es um die Einteilung der Sommermonate ging? Clare und Patrick brauchten das Geld nicht. Und Kathleen hatte schon Daniels Ersparnisse verschwendet. Der Gedanke daran erinnerte Alice an den Tag, an dem sie ihren Stolz überwunden hatte und Kathleen gebeten hatte, den todkranken Daniel gemeinsam mit ihr zur Vernunft zu bringen. Dass Kathleen ihre Unterstützung verweigert hatte, würde Alice ihr nie verzeihen. Daniel könnte noch am Leben sein, wenn er damals nicht jene Entscheidung getroffen und Kathleen darin nicht zu ihm gehalten hätte. Aber das konnte Alice jetzt nicht mehr ändern.
»Sie sollten sich das in Ruhe überlegen«, hatte Pfarrer Donnelly gesagt. »Sprechen Sie noch einmal mit Ihrer Familie. So eine Entscheidung darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, Alice.«
Für sie war es so gut wie erledigt.
»Ich habe schon alles mit der Familie besprochen und wir sind uns einig«, sagte sie.
In derselben Woche ging sie zu ihrem Anwalt und änderte ihr Testament. Der Hektar Land und die zwei Häuser würden an St. Michael gehen.
Danach rief sie Pfarrer Donnelly an, um ihm mitzuteilen, dass es amtlich war.
»Oh Alice, vielen, vielen Dank.« Sie hörte die Erleichterung in seiner Stimme. »Bitte richten Sie Ihrer Familie aus, dass wir Ihnen unendlich dankbar sind.«
»Das werde ich«, log sie.
Alice hatte nicht vor, ihren Kindern davon zu erzählen. Sie sollten in Maine weiterhin Erinnerungen sammeln können, als hätte sich nichts geändert und ohne, dass das Gewicht eines baldigen Abschieds auf ihnen lastete. Außerdem wollte sie sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Die Familie hätte noch reichlich Gelegenheit dazu, sie zu verwünschen, wenn sie schon unter der Erde lag.
Maggie
Es war der erste Sonntag im Juni, ein Tag vor ihrer geplanten Abreise nach Maine zusammen mit Gabe. Maggie hatte sich zwei Wochen Urlaub genommen. Normalerweise war sie vor der jährlichen Fahrt so euphorisch und aufgeregt, wie sie es als Kind gewesen war, wenn sie ihrem Vater beim Beladen des Autos zugesehen hatte, bevor es Richtung Cape Neddick losging. Aber diesmal hatte sie Angst.
Schon morgen würden sie am Strand sein. Morgen würde sie es Gabe endlich sagen. Sie stellte sich vor, wie sie seine Hand nahm und ihn zum steinernen Steg hinunterführte. Sie würde gar nicht erst um den heißen Brei herumreden: »Schatz, ich hab Neuigkeiten.«
Dann würde das richtige Leben zu zweit beginnen: Ihr zweiter Jahrestag, dann die Zweiraumwohnung in Manhattans East Village. Oder Gabe würde Panik kriegen und alles würde ganz anders kommen.
Sie weckte ihn mit einer Flut von Küssen, die sie über sein Gesicht, seinen Nacken und seine Brust verteilte, und hoffte, so ihre Nervosität zu verstecken.
»So, dann packen wir mal deinen Kram!«, sagte sie.
Neben dem Bett stand ihr prall gefüllter Louis Vuitton. Tante Ann Marie hatte Maggie den ausrangierten Koffer fürs Auslandsstudium vor zehn Jahren geschenkt. Maggies Mutter war stinksauer gewesen, aber Maggie hatte sich sehr gefreut. Sie hatte ihn am Abend zuvor aus ihrer Wohnung mitgebracht. Heute übernachtete sie noch ein zweites Mal bei Gabe und am nächsten Tag sollte es gegen Mittag losgehen, gleich nachdem Gabe den frühen Fototermin erledigt hatte. Er hatte nichts dagegen, vor der Reise zwei Nächte hintereinander mit ihr zu verbringen – das allein war schon ein gutes Zeichen, schließlich brauchte Gabe gewöhnlich viel Zeit und Raum für sich. Bis vor kurzem war es für sie fast selbstverständlich gewesen, dass sie sich gemeinsame Zeit mit ihm erkämpften musste, aber vielleicht änderte sich das gerade.
Er lachte ins Kissen. »Maggie, es ist mitten in der Nacht. Außerdem fahren wir erst morgen«, sagte er.
Eigentlich war es schon fast zehn Uhr, aber sie sagte dazu nichts und kochte stattdessen Kaffee. Normalerweise wachte er vor ihr auf und bis sie aufstand war das Frühstück schon fertig: Omelette, Bratkartoffeln, Würstchen und Waffeln, alles in einem einzigen Gang, wie bei einem Truckerpaar. In den zwei Jahren ihrer Beziehung hatte sie drei Kilo zugelegt, aber er schien es nicht bemerkt zu haben.
Durch das Küchenfenster sah sie einen Obdachlosen seinen Einkaufswagen über den Bürgersteig schieben. Auf der anderen Straßenseite saßen ein paar Hipster in engen, dunklen Jeans auf einem besprayten Treppenaufgang und teilten sich eine Zigarette. Im Gegensatz zu Gabe konnte sie an dieser Gegend nichts Schönes finden. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie es sein würde, ihr geliebtes, grünes Brooklyn Heights zu verlassen und Abschied zu nehmen von den schönen Backsteinhäusern, dem Blick auf die Manhattan Skyline und die Brooklyn Bridge von der Promenade aus und dem sonntäglichen Markt, auf dem Gabe und sie im Herbst frisches Gemüse, Apfelkuchen und, für die Feuertreppe, Dahlien kauften, die ihre Pflege nie lange überlebten.
Sie konnte sich nur schwer vorstellen, hier zu leben, in einer Gegend, die für junge Nachteulen gemacht war und aus Kneipen und Beton bestand. Besonders mit einem Kind. Aber vielleicht würden sie in eine ruhigere, kinderfreundliche Gegend umziehen. Vielleicht sogar in die Park Slope.
Aber ein Teil von ihr bezweifelte, dass sie ein gemeinsames Leben führen würden. Vielleicht war das alles nur die neueste Episode in ihrer Serie lächerlicher Beziehungen, in der ihre riesigen Hoffnungen schließlich doch immer verpufften.
Obwohl sie es schon seit über zwei Wochen wusste, hatte Maggie niemandem von der Schwangerschaft erzählt. Schon viele Male hatte sie die Panik gepackt und sie hatte zum Telefon gegriffen, um ihre Mutter oder ihre beste Freundin Allegra anzurufen, aber bisher hatte sie diesem Bedürfnis widerstehen können. Gabe sollte es als erster erfahren.
Noch nie hatte sie derartige Höhen und Tiefen erlebt. Sie konnte sich einreden, dass das alles ganz toll und super war und sich ein paar Minuten lang entspannen. Aber kurz darauf flippte sie aus und war der festen Überzeugung, den Fehler ihres Lebens gemacht zu haben.
Sie wusste genau, wie es passiert war. Monatelang hatte sie an nichts anderes denken können als an Babys. Das Gefühl hatte sie plötzlich wie aus dem Nichts überfallen: Sie wollte ein Kind. Plötzlich hatte sie begriffen, was Frauen meinten, wenn sie von der biologischen Uhr faselten. In der U-Bahn und in der Mittagspause blickte sie jedem Kleinkind sehnsüchtig nach, und an bestimmten Tagen im Monat hätte sie die nächstbeste Person im Kinderwagen kidnappen können.