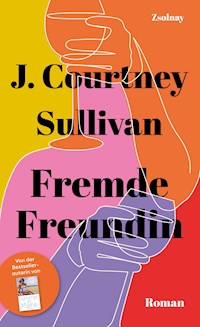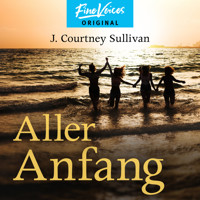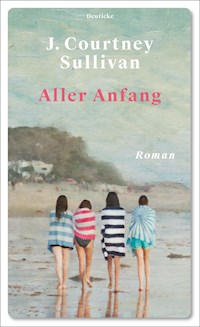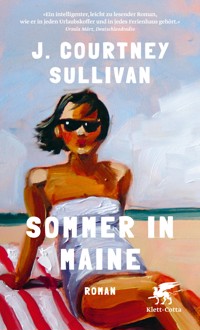Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nora Flynn ist 21, als sie mit ihrer jüngeren Schwester aus Irland nach Amerika auswandert, um ihrem Verlobten zu folgen und Theresa eine Ausbildung zu ermöglichen. Doch Theresa wird schwanger, und Nora trifft eine folgenschwere Entscheidung. Fünfzig Jahre später hat Nora vier erwachsene Kinder: John, Bridget, Brian und Patrick, ihren Ältesten, der Nora beständig Sorgen bereitet und trotzdem ihr Liebling ist. Theresa lebt als Nonne in einem Kloster, als Patricks Tod die Schwestern nach Jahrzehnten des Schweigens wieder zusammenführt – und sie zwingt, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihr Leben für immer verändert hat. Nach „Sommer in Maine“ ein neuer großer Familienroman von J. Courtney Sullivan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nora Flynn ist 21, als sie mit ihrer jüngeren Schwester von einem irischen Dorf nach Boston auswandert, um ihrem Verlobten zu folgen und Theresa eine Ausbildung zu ermöglichen. Doch die macht alle Pläne zunichte. Theresa wird schwanger. Nora trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Fünfzig Jahre später hat Nora vier erwachsene Kinder: John, der Karriere in der Politik gemacht hat; Bridget, die mit ihrer Freundin ein Baby plant; Brian, der nichts so recht auf die Reihe kriegt, und den gutaussehenden Patrick, ihren Ältesten, der Nora beständig Sorgen bereitet und trotzdem ihr Liebling ist.
Theresa lebt als Nonne in einem Kloster, als Patricks Tod die Schwestern nach Jahrzehnten des Schweigens wieder zusammenführt − und sie zwingt, sich mit dem auseinander zu setzen, was ihr Leben für immer verändert hat.
Deuticke E-Book
J. Courtney Sullivan
ALL DIE JAHRE
Roman
Aus dem Englischen von Henriette Heise
Deuticke
Für Jenny Jackson, Brettne Bloom und Ann Napolitano, die den Glauben bewahrten.
Ich existiere an zwei Orten,
Hier und wo du bist.
Margaret Atwood, Corpse Song
Teil Eins
2009
1
Im Auto auf dem Weg zum Krankenhaus erinnerte Nora sich. Als Patrick noch ein kleiner Junge war, war sie oft plötzlich aufgewacht, panisch vor Angst – dass er zu atmen aufgehört hatte oder von einem tödlichen Fieber befallen war. Dass man ihn ihr weggenommen hatte.
Dann musste sie ihn sehen, um sich sicher zu sein. Damals wohnten sie im obersten Stock eines kleinen Wohnhauses auf der Crescent Avenue. Sie nachtwandelte mit über die kalten Dielen schleifendem Nachthemd durch die Küche und an Bridgets Zimmer vorbei, den langen Flur hinunter bis zum Zimmer des Kleinen. Im Hintergrund war Mrs. Sheehans Radio aus der Wohnung unter ihr zu hören.
Die Angst kehrte in dem Sommer wieder, in dem Patrick sechzehn Jahre alt war und sie in das große Haus in Hull zogen. Nora wachte nachts mit pochendem Herzen auf, sah ihn und ihre Schwester vor sich, und Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart überlagerten einander. Sie machte sich Sorgen wegen der Jungs, mit denen er sich herumtrieb, wegen seiner Launen und wegen der Dinge, die er getan hatte und die nicht wieder rückgängig gemacht werden konnten.
Sie begegnete diesen Ängsten auf die ihr vertraute Art. Zu welcher Stunde auch immer: Sie stand auf und stieg die Treppen zu Patricks Zimmer unter dem Dach hinauf, um ihn zu sehen. Das war ihre Vereinbarung mit sich selbst, das Ritual, das Sicherheit garantierte. Solange sie die Augen offen hielt, konnte nichts richtig Schlimmes passieren.
Über die Jahre hatte es immer wieder Zeiten gegeben, in denen sie mehr mit einem der anderen drei Kinder beschäftigt gewesen war. Je älter sie wurden, desto besser konnte Nora sie einschätzen. Das war etwas, das einem keiner vorher sagte: Man musste die eigenen Kinder kennenlernen. John wollte ihr unentwegt gefallen. Bridget war ein hoffnungsloser Wildfang und benahm sich wie ein Junge. Sie hatten sich diese Eigenschaften aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter erhalten. Als Brian, das Nesthäkchen, auszog, machte Nora sich schreckliche Sorgen. Noch mehr Sorgen machte sie sich allerdings, seit er wieder eingezogen war.
Aber es war Patrick, der sie stets am meisten beschäftigte. Er war jetzt fünfzig Jahre alt, und in den letzten Monaten waren die alten Ängste zurückgekehrt. Alles hatte damit angefangen, dass John Dinge aufgewirbelt hatte, von denen sie gedacht hatte, dass sie schon lange vergessen waren. Sie konnte in diesen Nächten, wenn die Angst sie wach hielt, nicht mehr nach Patrick sehen, also knipste Nora die Lampe an und blätterte durch ihre Heiligenbildchen, bis sie die heilige Monika fand, Schutzheilige der Mütter schwieriger Kinder. Sie legte die Karte neben sich auf Charlies Kopfkissen und schlief ein.
Heute Nacht hatte sie endlich einmal nicht an Patrick gedacht, sondern an etwas ganz anderes: die Heizanlage im Keller. Die hatte nach dem Abendessen angefangen, komische Geräusche zu machen. Nora hatte die Temperatureinstellung verändert, aber es hatte sich nichts getan. Wahrscheinlich musste die Heizung gelüftet werden. Als nichts mehr half, sprach sie als letztes Mittel einen Rosenkranz. Das schien zu wirken, und sie legte sich mit einem Grinsen ins Bett, zufrieden mit ihren Fähigkeiten.
Kurze Zeit später weckte sie ein Anruf: Die Stimme eines Fremden erklärte, es habe einen Unfall gegeben und sie solle sofort kommen. Als sie die Notaufnahme erreichte, im rosa Flanellpyjama unter dem Wintermantel, war Patrick schon tot.
Der Rettungswagen hatte ihn ins Carney gebracht.
Nora brauchte eine Dreiviertelstunde für die Strecke von zu Hause in die Gegend, in der sie früher gelebt hatten.
An der Tür warteten schon der Arzt, eine Schwester und ein Priester in Noras Alter auf sie. Als sie den Geistlichen sah, war alles klar. Sie dachte daran, dass sie damals wegen Patrick aus Dorchester weggezogen waren, und dass er, sobald er alt genug war, wieder hierhergezogen war. Hier hatte sein Leben seinen Anfang genommen, und hier war es zu Ende gegangen.
Man führte sie in ein fensterloses Büro. Sie wollte sagen, dass sie da nicht hineingehen würde, doch dann trat sie doch ein und setzte sich. Der Arzt sah schrecklich jung aus für diese Aufgabe, aber in letzter Zeit kamen ihr viele Menschen schrecklich jung vor. Er wollte Nora sagen, dass sie fast eine Stunde lang versucht hatten, ihren Sohn wiederzubeleben. Für ihn sei alles Menschenmögliche getan worden. Er erklärte ruhig und detailliert, dass Patrick getrunken hatte, die Kontrolle über das Auto verloren und am Morrissey Boulevard unter einer Brücke in eine Mauer gefahren war. Sein Oberkörper sei gegen das Lenkrad geschleudert worden. Die Lungen ausgeblutet.
»Es hätte schlimmer sein können«, sagte der Arzt. »Wenn er nicht angeschnallt gewesen wäre, wäre er durch die Frontscheibe geflogen.«
Gab es etwas Schlimmeres als den Tod, fragte sie sich, hielt sich aber an einem Detail fest: Patrick hatte einen Sicherheitsgurt getragen. Er hatte nicht sterben wollen.
Nora hätte den Priester gerne gefragt, ob er es für möglich hielt, dass all ihre Ängste auf diesen Moment hinausgelaufen waren. Oder ob sie das hier hinausgezögert hatten. Sie hatte das Gefühl, dass sie beichten sollte. Ihre Schuld. Ihr war klar, dass sie sie für verrückt erklären würden, wenn sie das laut sagte. Sie saß da, die Lippen fest aufeinandergepresst, und drückte sich die Handtasche wie ein zappeliges kleines Kind an die Brust.
Nachdem Nora die Papiere unterschrieben hatte, sagte die Krankenschwester: »Wenn Sie möchten, können Sie ihn noch einmal sehen.«
Sie führte Nora den Flur entlang, in einen Raum hinein und schloss die Tür.
Patrick lag unter einer weißen Abdeckung auf einer Bahre. In seinem Mund steckte ein Atemschlauch. Jemand hatte ihm die Augen geschlossen.
Aus dem Flur und den umgebenden Zimmern drangen Schritte, Stimmen und das Piepen der Maschinen. Im Schwesternzimmer lachte jemand laut. Aber in diesem Raum herrschten Endgültigkeit und Stille.
Nora versuchte, sich genau an die Worte des Arztes zu erinnern. Wenn es ihr gelang, sich alles zu erklären und das Problem zu verstehen, konnte sie ihn vielleicht doch wieder zurückbekommen.
Unbändige Wut auf John kochte in ihr hoch. Sie erinnerte sich an einen Augenblick im letzten Mai, als er sie gefragt hatte, ob sie sich an die McClains aus Savin Hill erinnerte. Der älteste Sohn sei auf John zugekommen, er suche einen Leiter für seine Wahlkampagne zur Senatswahl.
»Sie waren nicht sehr nett«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass du das machen solltest.«
Was sie meinte war: Tu es nicht! Aber John hatte es trotzdem getan, und das hatte zu dieser schrecklichen Sache bei Maeves Konfirmationsfeier geführt. Seitdem hatten Patrick und John nicht mehr miteinander geredet. Patrick war wie ausgewechselt.
Erst gestern hatte Nora wieder einen Artikel in der Zeitung gesehen und war wie immer, wenn sie Rory McClains Namen las, unruhig geworden.
Auf einem Foto war Rory zu sehen, ganz der Politiker, dieses Gesicht, das ihr so vertraut war, mit dem tiefschwarzen Haar und dem zähnebleckenden Lächeln. Neben ihm stand die Ehefrau, und vor ihnen waren die drei jugendlichen Söhne wie die Orgelpfeifen angeordnet. Ob sie unter den weißen Hemden und den braven Frisuren genauso böse waren wie ihr Vater und ihr Großvater? Heuchelei musste eine vererbbare Eigenschaft sein, wie Zwillingsgeburten oder schwache Knie.
Sie hatte den Artikel nicht lesen wollen. Da sie aber wusste, dass John anrufen würde, um sich sicher zu sein, dass sie ihn gesehen hatte, hatte sie umgeblättert.
Jetzt atmete sie tief ein und sagte sich, dass sie diese Gedanken beiseiteschieben sollte. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit.
Patrick hatte seit zwei Jahren diesen schrecklichen Schnurrbart getragen, trotz ihrer Bitten, ihn abzurasieren. Sie ließ ihre Hand in der Luft über ihm verharren, wie um ihn zu verstecken, dann sah sie ihn an. Sie schaute und schaute. Er war schon immer gutaussehend gewesen, das schönste ihrer Kinder.
Nach einiger Zeit klopfte die Krankenschwester zweimal und trat dann ein.
»Ich fürchte, es ist Zeit«, sagte sie.
Nora nahm eine kleine Plastikbürste aus der Handtasche und glättete die schwarzen Locken. Dann fühlte sie seinen Puls, um ganz sicherzugehen. Es kam ihr vor, als lebe ein ganzer Schwarm Bienen in ihr, aber es gelang ihr schließlich, Patrick gehenzulassen, wie es ihr auch schon bei anderen Gelegenheiten gelungen war, in denen es unmöglich erschienen war. Als er fünf Jahre alt war und Angst vor der Vorschule hatte, steckte sie ihm, als der gelbe Schulbus ins Blickfeld kam, eine Muschel zu. Damit schaffst du das, sagte sie.
Im grell erleuchteten Flur legte der Priester ihr die Hand auf die Schulter.
»Sie sind in besserer Verfassung als die meisten, Mrs. Rafferty«, sagte er. »Sie sind hart im Nehmen, das sieht man gleich. Keine Tränen.«
Nora sagte nichts. Sie hatte noch nie vor anderen weinen können. Außerdem kamen ihre Tränen in einem Moment wie diesem nicht gleich. Weder beim Tod ihrer Mutter, als sie noch ein Kind gewesen war, noch bei dem ihres Mannes vor fünf Jahren hatte sie geweint. Und auch nicht, als ihre Schwester weggegangen war. Das war zwar kein Tod gewesen, aber es hatte sich so angefühlt.
»Woher in Irland stammen Sie?«, fragte er, und als sie ihn nur ausdruckslos anstarrte, fügte er hinzu: »Ihr Akzent.«
»County Clare«, sagte sie.
»Ah, meine Mutter kam aus County Mayo.« Der Priester schwieg einen Augenblick. »Ihr Sohn ist jetzt an einem besseren Ort.«
Warum wurden einem in dieser Situation Geistliche geschickt? Die konnten so etwas grundsätzlich nicht verstehen. Ihre Schwester war genauso. Nora sah sie im schwarzen Habit vor sich – trug man die heutzutage überhaupt noch? Sie würde an diesem Morgen in ihrer friedlichen Abtei auf dem Lande erwachen, frei von jeder Bindung, frei von Herzschmerz, dabei war sie es doch gewesen, die alles ins Rollen gebracht hatte.
Auf dem Heimweg verdrängte Nora die Frage, wie sie es den Kindern sagen sollte, und dachte stattdessen an ihre Schwester. Ihre Wut war so heftig, als ob eine andere Person neben ihr im Auto sitzen würde.
Als die Kinder noch klein waren, hatte Charlie ihnen oft von zu Hause erzählt. Ihre Lieblingsgeschichte war die vom Knocheneinrichter.
»Habe ich euch schon mal erzählt, wer in Miltown Malbay gerufen wurde, wenn sich einer was gebrochen hat?«, fragte er zum Einstieg.
Sie schüttelten euphorisch die Köpfe, obwohl sie die Geschichte schon kannten.
»Der Knocheneinrichter!«, rief er und packte das nächstbeste Kind, das vor Vergnügen in seinen Armen quietschte.
»Zum Arzt ging man erst, wenn man halbtot war«, sagte er. »Wenn man sich was gebrochen hatte, so wie ich mir damals das Fußgelenk, kam der gute Mann zu einem ins Schlafzimmer und rückte einen mit bloßen Händen zurecht.« Charlie machte ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge. »Danach war man so gut wie neu. Ganz ohne Medizin, die war gar nicht nötig.«
Die Kinder wurden grün im Gesicht, wenn er die Geschichte erzählte, aber kaum war er fertig, wollten sie sie von neuem hören.
Wie üblich, wenn Charlie von zu Hause erzählte, ließ er die dunklen Seiten aus: Der Mann hatte das Fußgelenk nicht ganz geradegerichtet, was zu einer leichten Schiefstellung des ganzen Körpers geführt hatte und erst Knieprobleme und später Rückenschmerzen verursachte.
Ihr Lügen funktionierte auf dieselbe Weise: Die Urlüge ging auf ihre Schwester zurück, alle Folgelügen hatte Nora in dem Versuch erdacht, die Welt der ursprünglichen Lüge zu erhalten. Jede dieser Unwahrheiten hatte Patrick mehr in Schieflage gebracht. Das hatte Nora akzeptiert. Es war der Preis für Patricks Sicherheit.
John hatte sich oft darüber beschwert, dass Nora Patrick vorzog, und Bridget sagte, dass sie als kleines Kind gedacht hatte, sein Name sei Meinpatrick. Sie hatte schlicht nie etwas anderes gehört. Eines Tages würden sie es verstehen, hatte Nora gedacht, eines Tages würden sie alles erfahren, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, es ihnen zu sagen. Patrick hatte Fragen gestellt, aber sie hatte es nicht geschafft, zu antworten.
Nora hatte ihnen nicht einmal erzählt, dass sie eine Schwester hatte.
Sie musste wieder an das Kloster denken. Diese Frauen dort, die die Welt hinter sich gelassen und sogar ihren Namen aufgegeben hatten. Nora war schon vor langer Zeit klar geworden, dass die Mauern, hinter denen sich die Nonnen vor der Außenwelt schützten, auch ein Gefängnis waren, in dem man mit seinen Gedanken ganz allein war. Bitteschön, da hatte sie jetzt etwas zum Nachdenken. Mit dieser Last sollte sie erstmal klarkommen. Nora sah keinen Grund, sie allein zu tragen.
Kaum war sie zu Hause, trat sie an die Schublade mit dem Gerümpel und holte ihr altes Adressbuch hervor. Sie nahm zum ersten Mal nach über dreißig Jahren mit der Abtei Kontakt auf. Der jungen Frau am anderen Ende der Leitung stellte sie sich als Nora Rafferty vor und bat sie, Mutter Cecilia Flynn wissen zu lassen, dass ihr Sohn Patrick am Vorabend bei einem Autounfall umgekommen war, allein.
Vor der Tür hörte sie die ersten Pendler vorbeifahren, den Hügel hinunter Richtung Autobahn, die sie in die Stadt führte oder zur Fähre, auf der sie eine Tasse Kaffee trinken würden, während das Schiff sich seinen Weg durch den dunklen Hafen bahnte.
Nora nahm das Notizbuch von der Arbeitsplatte und machte eine Liste. Dann kochte sie eine Kanne Tee, falls sie früher als erwartet Besuch bekäme. Schließlich setzte sie sich hin, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte, legte das Gesicht in die kühlen Hände und weinte.
Teil Zwei
1957–1958
2
Ihr Vater hatte ein Taxi bestellt, das sie nach Ennistymon bringen sollte. Den Rest der Strecke nach Cobh würden sie mit dem Bus zurücklegen.
Um sechs Uhr früh stand er rauchend am Küchenfenster, klopfte mit der Fußspitze auf den Boden und wartete darauf, dass Cedric McGanns schwarzer Ford angezockelt kam.
Nora hatte kein Auge zugetan. Im Haus war Stille eingekehrt, während sie beim Licht der Öllampe noch einmal prüfte, ob sie alles hatten, was sie brauchten. Dreimal hatte sie es überprüft, um sich sicher zu sein. Jetzt standen die Koffer an der Tür, und sie saß am Küchentisch und hoffte, er würde sie zurückhalten. Aber der Vater wich ihrem Blick aus.
»Alles in Ordnung?« Die Frage fiel ihr nicht leicht.
»Alles bestens.«
Das Frühstücksei, das sie ihm eine Stunde zuvor gekocht hatte, war noch immer auf seinem Teller.
In einem der Briefe hatte Charlie von der Cousine seines Vaters in Boston erzählt, die eine super Köchin sei, sowas habe Nora noch nicht erlebt. Damit ihr Vater sich keine Sorgen machte, hatte Nora ihm erzählt, diese Frau sei sehr streng. In Wirklichkeit hatte Charlie berichtet, dass sie die häufig wechselnden Familienmitglieder, die bei ihr unterkamen, kaum wahrnahm. Mädchen wohnten im ersten Stock, Jungs im zweiten, und solange man sich benahm, ließ Mrs. Quinlan einen in Ruhe.
Charlie hatte geschrieben, sie würden nicht lange bei ihr wohnen. Wenn sie erst verheiratet waren, würden sie sich eine eigene Wohnung suchen. Und was wird dann aus Theresa?, hatte sie im nächsten Brief gefragt. Sie kann mit uns kommen, wenn du magst, hatte er geantwortet. Oder sie bleibt bei Mrs. Quinlan. Wir werden nicht weit weg sein.
Nora beobachtete ihren Vater, der noch am Fenster stand. Es war fast wie bei einem Todesfall, die Mischung aus Trauer und Erwartung, die den Raum füllt, wenn jemand verschwunden ist.
In diesem Augenblick stürzte ihre Schwester im Sonntagskleid in die Küche.
Nora wollte sie daran erinnern, vor der langen Reise ihren Haferbrei zu essen.
»Oh«, rief Theresa, schon auf der Schwelle, »mein Hut.«
Sie machte kehrt und war so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht war.
»Nicht so laut«, rief der Vater ihr leise nach. »Du weckst unsere Hoheit.«
Großmutter hatte sich schon am Abend zuvor von ihnen verabschiedet. Sie wolle den Augenblick ihrer Abreise nicht miterleben, hatte sie gesagt. Sie wolle sich daran nicht erinnern müssen.
Als das Taxi vorfuhr, dachte Nora, dass sie einfach nicht gehen würde. Die eigenen Beine konnten einen doch nicht irgendwohin tragen, wenn man nicht wollte? Und doch setzte sie jetzt einen Fuß vor den anderen. Ihr Körper verriet ihren Geist. Sie umarmte ihren Vater lang, ihren Bruder, der im letzten Augenblick mit hängendem Kopf aus seinem Zimmer geschlichen kam, etwas kürzer. Martin war von Anfang an dagegen gewesen und hatte die beiden Schwestern seit ihrer Entscheidung ignoriert, als wolle er sich an ein Leben ohne sie gewöhnen.
Ihr Vater hatte feuchte Augen, und die Tränen drohten, sich jeden Augenblick zu lösen. Er sah müde und alt aus, das Gesicht sonnengegerbt und ledern.
Als Kind hatte Nora schreckliche Angst vor ihm gehabt. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte er wegen jeder Kleinigkeit durchgedreht, wegen einer Tasse verschütteter Milch, als wären die Kinder eine Strafe. Dann waren sie schreiend davongerannt, hatten sich in der hintersten Ecke des Hauses versteckt, hinter schweren Möbeln oder unter dem Bett der Großmutter, während sich ihnen fleischige, bedrohliche Hände näherten.
Ein Kind hatte keine andere Wahl als zu verzeihen. Und er konnte lieb sein, auf seine Art. Er hatte sie zum Angeln mitgenommen und ihnen gezeigt, wie man mit bloßen Händen eine Forelle aus dem Wasser holt. Jeden Sommer fuhr er mit ihnen zum Pferderennen in Miltown, und jeder bekam einen Penny und durfte sich ein Pferd aussuchen.
Theresas Kühnheit gefiel ihm. Er hielt sie nicht zurück. Diese Aufgabe hatte allein Nora übernommen. Sie versuchte, ihrer Schwester Manieren beizubringen, wie es ihre Mutter getan hätte. Aber Theresa und Martin hatten ihre Mutter nicht lange genug gekannt. Die Zeit war zu kurz gewesen, um die beiden Jüngeren so zu formen, wie sie es bei Nora getan hatte.
Bevor sie starb, hatte sie Nora die Verantwortung für die jüngeren Geschwister übertragen. Vielleicht hatte sie Nora damit einen Halt geben wollen, vielleicht hatte die Mutter nur etwas sagen wollen, damit Nora sich weniger verloren fühlte. Aber Nora nahm die Aufgabe sehr ernst, auch wenn die Geschwister sich meistens nicht dafür interessierten, was sie sagte. Sie war nicht so fest und entschlossen wie ihre Mutter. Sie konnte sie nie wirklich von ihrer Autorität überzeugen.
Je älter sie wurde, desto weniger fürchtete Nora ihren Vater. Seit sie Geld nach Hause brachte, war sie ihm ebenbürtig. Beim Frühstück redeten sie über den Hof, und Nora erzählte von den Kolleginnen. Ihr Vater lachte viel und erzählte Geschichten wie die von der Gasthausrauferei in seiner Jugend. Sie bemerkte, dass er gar kein großer Mann war. Im Vergleich zum Durchschnitt war er schmächtig, und mit seinem hellen Haar und den hellen Brauen sah er, wenn er grinste, fast wie ein kleiner Junge aus. Sie lernte, dass er nach einer bestimmten Tageszeit nicht derselbe Mann war, wenn er sich einen Whiskey, einen zweiten und dann noch einen dritten genehmigt hatte. Morgens war ihr ihr Vater am liebsten. Dann konnte sie sich seiner sicher sein.
Bei der Tür drehte er sich um und rief: »Theresa. Wo bleibst du? Beeil dich!«
Nora sah ihre Schwester in der Tür zu dem Zimmer stehen, das sie sich siebzehn Jahre lang geteilt hatten, seit Theresas Geburt. Hinter ihr die strahlend blauen Zimmerwände. Im Morgenlicht rahmten sie Theresa ein wie ein Abbild der Heiligen Jungfrau. Nora und sie hatten die gleichen Gesichtszüge: die gleichen großen, blauen Augen, die gleichen schmalen Lippen und braunen Locken. Aber Nora fand, dass in Theresas Gesicht alles auf angenehmere Art zusammengefunden hatte als bei ihr.
Als Theresa klein war und Angst vor der Dunkelheit hatte, war sie nachts oft zu Nora ins Bett gekrabbelt und hatte sich an sie gekuschelt. Dann hatte Nora gestöhnt und so getan, als wolle sie ihre kleine Schwester loswerden, aber in Wirklichkeit hatten ihr die Wärme und der Trost wohlgetan. Sie kannte Theresas Körper wie ihren eigenen. Besser noch. Nora hatte die kleine Theresa gebadet und die Knoten aus ihrem Haar gebürstet. Wenn sie hingefallen war, war es Nora gewesen, die ihr Jod auf die Schürfwunden tupfte, während Theresa das Haus zusammenschrie.
»Ich kann ihn nicht finden«, sagte Theresa. »Hilf mir. Du weißt, welchen ich meine. Den mit der rosa Seidenblume an der Krempe.«
»Lass ihn da«, sagte Nora. »Es ist schon halb sieben.«
Ihr Vater drückte jeder von ihnen etwas Geld in die Hand. Theresa steckte ihres in die Manteltasche und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Nora bedankte sich und ließ den Schein unbemerkt in einen löchrigen Stiefel gleiten, der an der Tür stand. Irgendwann würde er ihn finden und gut gebrauchen können. Er machte immer nette Gesten, die er sich nicht leisten konnte, gab im Friel’s eine Runde aus, wenn es zu Hause für Zucker und Mehl nicht reichte, oder spendete für die Armen, obwohl sie selbst arm waren. Auch den Luxus eines Taxis konnten sie sich eigentlich nicht leisten, aber mit dem Gepäck gab es keine andere Möglichkeit. Sie war fest entschlossen, ihm das Geld für die Fahrt zurückzuschicken. Das Fahrtgeld und alles, was sie sonst noch zusammenkratzen konnte.
Ihrem Bruder hatte sie aufgetragen, gut auf den Vater aufzupassen, dass er ja nichts Unvernünftiges tun würde. Aber Martin war erst neunzehn. War er selbst vernünftig?
Die Männer trugen die Koffer nach draußen. Nora und Theresa kamen nach.
Neben dem Wagen stand Cedric McGann. Er war der Bruder einer ehemaligen Mitschülerin von Nora, und sie kannte ihn von vielen Tanzabenden. Trotzdem spürte sie, dass ihre Wangen brannten, als er sie grüßte: »Guten Morgen, Nora.«
Eine Woche zuvor hatte sie sich geschworen, nie wieder rot zu werden. Sie errötete bei jedem Anlass und in Situationen, in denen andere Frauen nicht die Spur von verlegen waren. Sie wurde rot, wenn sie zu Jones’s ging und Cyril am Tresen um ein Päckchen Tee bitten musste. Sie wurde rot, wenn Pater Donohue ihr in die Augen sah und ihr eine Hostie auf die Zunge legte.
Charlie hatte gesagt, in Amerika könne man ganz neu anfangen und alles zurücklassen, was einem nicht gefiel. Nora war noch nicht einmal bei der Gartenpforte angekommen, und es war schon klar, dass sie sich selbst nicht hinter sich lassen können würde.
»Hallo, Cedric«, sagte Theresa mit einem frechen Unterton, als hätten die beiden ein Geheimnis, obwohl Nora mit Sicherheit wusste, dass es keines gab.
Doch sie war dankbar dafür, dass Theresa ihn von ihr abgelenkt hatte.
»Wie ist das Spiel gestern ausgegangen?«, wollte ihr Vater wissen.
»Zwölf zu zwei«, sagte Cedric. »Ich hab’ ganz schön was abgekriegt, aber es hat sich gelohnt.«
»Gut gemacht.«
Ihr Vater klang unbeschwert, als ob Cedric nur hier wäre, um die Mädchen zu einem Tanzabend in Lahinch zu fahren und später wieder zurück.
Nora sah sich noch einmal nach den flachen Steinmauern um, die einen Hof von dem anderen trennten und eine kilometerlange gezackte Linie über die Hügel bis dahin zeichneten, wo das Grün in das Blau des Meeres und des Himmels überging. Im Vordergrund standen die Scheunen, in denen die Kühe, der Esel, die Schweine und die Hühner lebten, Tiere, denen Theresa Namen gegeben hatte, obwohl ihr Vater gesagt hatte, sie solle das nicht tun.
Sie schaute das Steinhaus an. Hier waren sie alle geboren worden. Hier war ihre Mutter gestorben. Noras Blick blieb am Schlafzimmerfenster der Großmutter hängen, um zu sehen, ob sie durch die gelben Vorhänge linsen würde, um einen letzten Blick auf ihren Liebling Theresa zu werfen. Jedermanns Liebling. Aber die Vorhänge bewegten sich nicht.
Nora wünschte sich, ein letztes Mal von ihrem Vater in den Arm genommen zu werden, und es wäre ihr egal gewesen, wenn Cedric es gesehen hätte.
Stattdessen sagte er: »Bleib stark, mein Mädchen.«
Sie wusste, dass er das nur sagte, weil sie nicht stark war. Überhaupt nicht.
»Das werde ich«, sagte Nora.
»Und pass auf Theresa auf«, fügte er hinzu. Das hörte sie, seit sie denken konnte, jeden Tag.
»Mach ich.«
Seit sie klein waren, brachte Nora ihren Bruder und ihre Schwester im Sommer jeden Morgen über die Felder zum Meer, wo sie mit den Kindern aus dem Ort baden gingen. Nora konnte sich an viele Momente erinnern, wenn Theresa weit rausgeschwommen war und Nora vor Sorge die Luft wegblieb. Dann wartete sie ängstlich darauf, dass der Kopf ihrer Schwester durch die Wasseroberfläche brach. Genau in dem Moment, in dem Nora panisch aufsprang, tauchte Theresa lachend auf.
Theresa war die Jüngste und kannte keine Angst. Man konnte sie wirklich nicht als schlimm bezeichnen, auch wenn sie es gelegentlich war. Theresa war einfach alles am meisten: am mutigsten, am schönsten, am frechsten und am klügsten. Sogar am frommsten, auf ihre Art. Als Kind hatte sie die Leben der Heiligen auswendig gekannt. Jetzt aber war sie kokett, und all die Aufmerksamkeit, die früher den Märtyrern gegolten hatte, richtete sich nun auf die Jungs von Miltown Malbay.
Während Nora täglich in der Bibelstunde saß, schlich Theresa sich zu einem Spaziergang mit Gareth O’Shaughnessy davon. Andere Mädchen machten das auch, aber nur Theresa war so frech, sich danach von Gareth auf dem Fahrradlenker bis direkt vor die Kirche fahren zu lassen und zu fragen: »Wer hat heute den Rosenkranz gebetet? Sag schnell, bevor Papa kommt und fragt. Der bringt mich um.«
Welches Alter Theresa auch erreichte – Nora war immer schon da gewesen. Aber irgendwie brachte Theresa es immer fertig, mehr aus allem zu holen und es besser zu machen. Nora hatte die Klosterschule als Tagesschülerin besucht, bis ihr Vater es sich nicht mehr hatte leisten können. Nach der zehnten Klasse war für Nora Schluss, und mit fünfzehn fing sie in der Strickwarenfabrik am Stadtrand an. Theresa bekam ein Stipendium und wurde die Jahrgangsbeste. Die Nonnen erkannten ihr Talent zum Unterrichten, nannten es ihre Berufung. Wenn sie es hätten finanzieren können, wäre Theresa längst an der Uni in Limerick gewesen.
Doch so, wie die Dinge lagen, war sie zu Nora in die Fabrik gekommen. Nora hatte jahrelang acht Stunden am Tag mit vom Dampf brennenden Augen an der Bügelmaschine gestanden. Am Ende der Woche war die Haut an den Fingerspitzen verbrannt. Sie hielt diese Art von Arbeit nicht für unter ihrer Würde. Sie war dankbar für den Arbeitsplatz. So viele Leute, die sie kannte, hatten keinen. Aber sie konnte es nicht ertragen, Theresa hier zu sehen, die wie alle anderen sehnsüchtig nach der Uhr schaute und auf die Zehn-Minuten-Pause wartete, in einer langen Reihe von Mädchen an einer Nähmaschine saß und an einem Damenpullover oder einer Strickjacke arbeitete, die sich keine von ihnen je würde leisten können und die mit all den anderen Sachen in der Auslage bei Penneys oder Dunnes landen würden. Der alte Ben Dunne, Präsident des Kaufhauses, besuchte die Fabrik jedes Jahr, um sich zu bedanken. Nora hatte es immer für eine große Ehre gehalten, doch als er eines Tages kam und ihre Schwester anlächelte, durchzuckte sie der Gedanke, dass er keine Ahnung von ihrem Potenzial hatte. Abends blieb Theresa lange auf und las Bücher, die ihr eine ehemalige Lehrerin, eine der Nonnen, geliehen hatte. Nora freute sich darüber, ermahnte ihre Schwester aber dennoch, bald zu schlafen, weil sie sonst am Morgen erschöpft sein würde.
Auf dem Autorücksitz suchte Nora jetzt die Hand ihrer Schwester und drückte sie wortlos, ohne Theresa anzusehen. Sie fuhren die anderthalb Kilometer zur Stadt. Sie hatte diese Strecke immer zu Fuß oder auf dem Fahrrad zurückgelegt, den Straßenstaub in einer Wolke aufgewirbelt, die Rüschen der weißen Socken grau gefärbt.
Als sie an der Rafferty-Farm vorbeifuhren, stellte sie sich vor, dass drinnen gerade Charlies Eltern und sein Bruder beim Frühstück saßen. Sie verspürte in diesem Augenblick puren Hass, obwohl sie das niemals zugegeben hätte: Wegen ihrer Entscheidung musste sie gehen.
Nora hatte ganz bestimmte Vorstellungen von ihrem Lebensweg gehabt: Charlie und sie würden heiraten und auf dem Hof neben dem ihres Vaters leben. Sie würde Vater und Bruder jeden Tag sehen können. Sie hatte gedacht, dass ihre Kinder wie sie aufwachsen würden, dass sie den Namen jeder Wildblume kennen, auf Bäume klettern und zu dritt oder viert auf einem einzigen Fahrrad den Hügel nach Spanish Point runterrasen würden.
Aber mit dem Jammern musste jetzt Schluss sein. Bald würde sie Charlies Frau sein. Obwohl ihr das momentan noch unmöglicher erschien als die Ozeanüberquerung.
Es lag noch nicht lange zurück, dass sie eines Sonntags mit ihrer Schwester auf dem Heimweg von der Kirche einer alten Schulfreundin begegnet war. Aoife trug ein Kleinkind auf der Hüfte und war schon wieder dick.
»Du bist auch bald dran, Nora«, sagte sie. »Hoffentlich ist Charlie ein besserer Vater als mein George. Der feiert seinen Sohn seit der Geburt jeden Tag im Pub.«
Nora wurde schlecht bei dem Gedanken, ihr erstes Kind in Boston zur Welt zu bringen, einem Ort, an dem sie noch nie gewesen war. Eine Stadt, voll von Fremden, zu denen jetzt mehr oder weniger auch Charlie gehörte.
»Bei mir dauert’s mit dem Zweiten auch nicht mehr lange«, sagte Aoife lachend. »Was sie uns alles in der Schule nicht beigebracht haben.«
»Was hat sie damit gemeint?«, fragte Theresa, nachdem sie sich verabschiedet hatten.
»Vergiss es«, sagte Nora. Sie selbst wusste nur, worum es ging, weil ihre beste Freundin Oona ihr die Sache erklärt hatte, nachdem die es von ihrer älteren Cousine erfahren hatte. Eines Tages würde Nora mit Theresa darüber reden. Wenn die Zeit gekommen war.
Es war kurz nach sieben, als sie den Ort erreichten. Das Pub, das Gemeindehaus und Jones’s Kaufladen an der Hauptstraße waren noch geschlossen. Sie würden frühestens in einer Stunde öffnen. Sie hatte den Ort nie so menschenleer erlebt. Die meisten Häuser in der Gegend standen verstreut und waren niedrige, graue Schieferbauten. Die Geschäfte auf der Hauptstraße waren der einzige Farbfleck. Der Fleischer hellgelb, Jones’s hellgrün, die Pubs und Herbergen weiß oder golden, hellblau oder rosa.
Einmal im Monat, am Markttag, füllte sich die Straße mit Bauern, die alles von Kohl bis zu Kühen verkauften und laut einen Preis, einen Ausruf der Enttäuschung oder des Sieges ausstießen, je nachdem. Am Morgen danach stank die ganze Stadt, und die Abflüsse waren mit Mist verstopft. Dann knurrten die Ladenbesitzer, und man hätte denken können, der Ort würde nie wieder zu seinem ursprünglichen Zustand zurückkehren. Aber ein, zwei Tage später sah es aus, als wäre nie etwas passiert.
Im Frühling, wenn der Bischof zur Konfirmation anreiste, wurden über die ganze Länge der Straße orange Wimpel von Fenster zu Fenster gespannt. Wochenlang wurden die Konfirmanden von der Schule befreit, um den Katechismus zu studieren. Der Bischof stellte jedem drei Fragen. Die meisten Kinder standen dann schwitzend und zitternd vor ihm und hofften auf einfache Fragen, bettelten darum, die Antwort zu wissen.
Als Theresa zwölf Jahre alt war und sie an die Reihe kam, stand sie gerade und selbstbewusst vor dem Bischof. Sie erwiderte seinen Blick. Dann fragte er: »Wie viele Sakramente kennt die katholische Kirche?«
»Sieben«, sagte sie und listete sie auf.
»Was geschieht, wenn man im Zustand der Todsünde stirbt?«
Wieder ließ die Antwort nicht lange auf sich warten: »Man kommt in die Hölle«, sagte Theresa. »Aber eine Sündenvergebung ist durch das Bußsakrament auch bei der Todsünde möglich.«
Nora sah, dass der Bischof beeindruckt war.
Als letzte Frage schloss er an: »Was geschieht beim heiligen Messopfer?«
Theresa antwortete: »Brot und Wein werden Leib und Blut, Seele und Göttlichkeit Christi, wenn der Priester die Konsekrationsworte spricht, dieselben Worte, die beim Abendmahl gesprochen wurden. Auf diese Weise wird das Opfer Jesu, das er in Golgatha am Kreuz darbrachte, wieder gegenwärtig, damit wir uns anschließen, es unserem Vater darbringen und seine Barmherzigkeit erleben können.«
»Sehr gut«, sagte der Bischof.
Später hörte Nora ihn zu ihrem Vater sagen: »Sie haben da ein sehr kluges Kind. Sind Ihre anderen auch so aufgeweckt?«
»Um Gottes willen, nein. Wir wissen selber nicht, wie die in unsere Familie gekommen ist.«
Es tat Nora nicht weh, ihn das sagen zu hören. Sie hatte den Großteil ihres Lebens im Schatten ihrer jüngeren Schwester verbracht. Sie hatte nichts dagegen. Nora maßregelte Theresa andauernd. Sie war täglich von ihr genervt. Aber wenn man schüchtern und still war, tat allein die Nähe zu jemandem mit einer so funkelnden Ausstrahlung wie der Theresas gut. In Theresas Gegenwart hatte Nora weniger Angst vor allem und jedem. Ihre Schwester setzte sich für sie ein, wenn sie selbst sich nicht traute.
Sie hatten die Kreuzung in der Ortsmitte erreicht. Würden sie hier rechts abbiegen, kämen sie zur Kirche und zum Friedhof, dahinter Ackerland. Links ging es zur staatlichen Schule, hinter der nur noch Bauernhöfe lagen, über die Felder verstreut bis zur Küste.
Cedric fuhr geradeaus weiter auf die Flag Road. In dieser Richtung lag der heilige Quell Saint Joseph, in den Noras Großmutter Kleidungsstücke getaucht hatte, in der Hoffnung, so ihre einzige Tochter zu retten.
Nora schloss die Augen. Sie wollte es nicht sehen, das dritte Haus auf der linken Seite, dem sie sich nun näherten. Das weiß verputzte Gebäude mit den roten Blumen in den Blumenkästen, in dem ihre beste Freundin Oona Coogan wohnte.
Oder Oona Donnelly, wie sie neuerdings hieß.
Theresa hatte Unmengen von Freunden. Nora hatte Oona und hätte sie gegen nichts und niemanden eingetauscht. Sie hatten jeden Tag miteinander verbracht, erst als Schulmädchen in der Klosterschule, dann in den letzten sechs Jahren in der Fabrik. Oona war eines von neun Geschwistern und wie Nora die Älteste. Sie war jahrelang mit Unterbrechungen mit Conall Davis zusammen gewesen, bis ihr Vater sie vor einigen Monaten ohne Vorwarnung gezwungen hatte, einen alten Bauern mit viel Land zu heiraten.
Oona war ihrem Bräutigam zwei Tage vor der Hochzeit zum ersten Mal begegnet. Am Morgen vor der Hochzeit, während Oonas Mutter umhereilte, Rosenkränze in die Bäume hängte und den Klarissen Eier brachte, um Regen abzuwenden, klagte die Braut im weißen Hochzeitskleid in ihrer Kammer schluchzend der besten Freundin ihr Leid. Nach der Hochzeit erzählte sie Nora, dass der Bauer kaum ein Wort mit ihr sprach. Er beschwerte sich über das, was Oona kochte, über das Geräusch ihrer Schritte und den Klang ihrer Stimme. Sie fürchtete sich vor dem Moment, wenn er von der Arbeit nach Hause kam und Abendessen erwartete. Und davor, was er von ihr erwartete, wenn sie zu Bett gingen.
»Wie soll ich das ertragen, wenn du nicht mehr da bist?«, sagte Oona zu Nora. »Dann bleibt mir niemand.«
Jetzt rief Theresa: »Halt an, Cedric! Stopp!«
Als Nora die Augen öffnete, sah sie Oona am Straßenrand stehen. Sie stieg schnell aus dem Wagen, und die Freundinnen umarmten einander so fest und so lange, dass Nora dachte, jetzt würden sie gewiss den Bus und damit das Schiff verpassen.
Oona hatte ihnen für die Reise einen Kuchen gebacken.
»Ich schreibe dir jeden Tag.«
»Ich dir auch«, gab Nora zurück.
Als sie sich voneinander rissen, drückte Oona ihr noch einen Zettel in die Hand.
»Wenn du dich einsam fühlst.«
Als sie wieder im Taxi saß, betete Nora für die Freundin. Was Oonas Vater getan hatte, war abscheulich. Nora ging davon aus, dass auch die Ehe ihrer Eltern vermittelt gewesen war, aber das war damals so üblich gewesen. Heutzutage sollte das keinem Mädchen mehr passieren.
Andererseits, vielleicht war ihre Situation gar nicht so anders. Charlie war kein schlechter Mann, aber es war keine große Liebesgeschichte. Nora hatte schon früh begriffen, dass der Hof an ihren Bruder gehen würde und man von Theresa und ihr erwartete, dass sie ihren Beitrag leisteten: heiraten und verschwinden. Es gab Dinge, über die man nicht sprach. Das war der Grund, weshalb ihr Vater ihrem Blick ausgewichen war.
Was sollte sie jetzt an das erinnern, was ihr bisher vertraut gewesen war? Alle ihre Erinnerungen waren hier, waren an den Anblick eines bestimmten Geschäftes, Hauses oder einer Straßenecke gebunden. Die Traurigkeit lenkte Noras Gedanken zu ihrer Mutter. Sie spürte ihre Abwesenheit deutlich, ihre jetzt endgültige Abwesenheit.
Nora fing zu weinen an.
»Ach, komm schon«, sagte Theresa. »Wir sind bestimmt bald wieder da.«
Ob ihre Schwester das wirklich glaubte? Sie zeichnete gedanklich ein Bild von Miltown Malbay aus der Vogelperspektive und versuchte, sich jedes Detail ins Gedächtnis zu brennen. Theresa tat im selben Augenblick vermutlich das genaue Gegenteil und sog alles, was den Augenblick ausmachte, in sich auf: den Geruch von Cedric McGanns Rasierwasser, das Brummen des Motors und den Anblick der Häuser, die jetzt ins Blickfeld kamen.
Im Bus nach Cobh stank es nach Hering. Ein Mann in der zweiten Sitzreihe hatte einen als Mittagessen mit, und das roch man auch noch zehn Reihen weiter hinten, wo Nora und Theresa saßen. Vor dem Fenster schien die Sonne auf die gewaltigen Klippen. Nora sah in diesen zwei Stunden mehr von Irland, als sie in einundzwanzig Lebensjahren gesehen hatte.
Sie durchquerten Dörfer, in denen hier und da elektrisches Licht durch ein Küchenfenster schien. Die kleinen Orte wurden einer nach dem anderen ans Netz angeschlossen. Miltown Malbay hätte schon seit einem Jahr Elektrizität haben können, aber die Einwohner mussten die Pläne einstimmig beschließen, und Mrs. Madigan von der Church Street hatte das nicht bezahlen wollen. Seit ihre Schwester in Roscommon elektrisches Licht habe, könne sie putzen, wie sie wolle, das Haus sei trotzdem immer voll Spinnweben.
»Du bist so still«, sagte Theresa. »Denkst du an Charlie?«
Die alte Frau auf der anderen Seite des Ganges blickte von ihrem Strickzeug auf und sah Nora erwartungsvoll an.
»Nein«, flüsterte sie.
»Lügnerin«, gab Theresa zurück.
»Wirklich nicht.«
Sie tauschten Blicke. Dann lachten sie. Sie vermutete, dass Theresa eine Ahnung davon hatte, was sie empfand, obwohl Nora nie mit ihr darüber gesprochen hatte.
Als sie achtzehn Jahre alt war, hatte Charlie Rafferty sie auf dem Heimweg vom Tanz geküsst. Von da an waren sie ein Paar. Sie trafen sich für Strandspaziergänge und bei den Tanzabenden, wo sie immer so taten, als wären sie nicht wegen einander dort. Nora fand ihn ganz nett, mehr nicht. Er war albern. Als sie jünger waren, war er zu Weihnachten mit den Wren-Jungs von Haus zu Haus gerannt. Dann hatten sie mit Masken vor dem Gesicht Weihnachtslieder gesungen, begleitet von seinem Bruder Lawrence auf der Tin Whistle. Sie ließen die Leute erst in Ruhe, wenn sie ihnen etwas gaben. Noras Vater hatte gesagt, er würde seine Kinder den Gürtel spüren lassen, wenn sie sich mit dieser Bande einließen.
Charlie war älter geworden, aber er erzählte immer noch schlechte Witze und heckte Streiche aus. Er lachte zu laut, und Nora schämte sich dafür, als käme das Geräusch aus ihrem Mund. Sie wusste, warum er sich für sie entschieden hatte, obwohl es aufgeschlossenere Mädchen gab, und auch hübschere. Sie hatte sich aus demselben Grund für ihn entschieden.
Nora war keine Romantikerin wie ihre Schwester, deren Kopf voller Träume war. Was Charlie und sie verband, war ihre praktische Ader. Sie hatten dieselbe Vorstellung vom Leben. Sie konnte seine Eigenheiten und sein Benehmen ertragen, wenn sie dafür Vater, Großmutter, Bruder und Schwester und ihre beste Freundin täglich sehen konnte. Ihre Höfe grenzten aneinander. Es war für beide Familien von Vorteil, das Land zusammenzuführen. Im Vergleich zu all dem war der Ehemann nicht so wichtig. Die meisten verheirateten Paare in ihrem Umfeld hatten wenig miteinander zu tun, besonders nicht, wenn erstmal Kinder da waren.
Die Flynns und die Raffertys hatten einander immer zur Seite gestanden. Ihre Freundschaft reichte bis zur Gründung des Ortes zurück und wurde 1888 untermauert, als die Laden- und Pubbesitzer sich gegen den Grundherrn Moroney auflehnten, indem sie sich weigerten, seine Leute zu bedienen. Die Ladenbesitzer kamen ins Gefängnis, unter ihnen Miles und Henry Rafferty, Charlies Urgroßvater und dessen Bruder. Sie betrieben die Fleischerei und wurden am Wochenende auf dem Hof gebraucht. Die beiden saßen für gut zwei Jahre hinter Gittern. Noras Urgroßvater John Flynn schwor, den Hof der beiden bis zu ihrer Rückkehr am Laufen zu halten, und ging am Ende jedes Arbeitstages mit seinen drei Brüdern von seinem eigenen Hof zum anderen hinüber, um dort weiterzumachen.
Viele Jahre später wanderte Henry Rafferty nach Amerika aus. Sobald er sich dort etwas aufgebaut hatte, holte er die Familie nach. Während jetzt die meisten jungen Leute des Ortes nach Liverpool oder London abwanderten, gingen die Raffertys nach Boston. Charlies Schwester Kitty und drei seiner Brüder waren schon seit Jahren dort.
Für Charlie war das nicht in Frage gekommen. Er hielt Amerika für überfüllt, hektisch und verdorben. Kitty war mit einem Protestanten aus Kalifornien durchgebrannt, den sie kaum kannte. Diese Geschichte hatte Charlie und der ganzen Familie viel Schmerz bereitet. Die kommen da an und halten es für einen Traum, hatte er gesagt. Die kommen da an und drehen einfach durch.
Bis vor einem Jahr waren die einzigen Nachkommen der Raffertys, die noch in Irland lebten, Charlie und sein ältester Bruder Peter gewesen, den man nachmittags zuverlässig im Friel’s an der Bar fand. Die Arbeit machte Charlie. Er hatte sich dem Grundbesitz der Familie verschrieben, als sei er dazu geboren. Sein Vater hatte ihm mehr als einmal versichert: »Irgendwann gehört das alles dir.«
Nora wurde neunzehn, dann zwanzig, und Charlie machte ihr unten am Strand einen Antrag, mit Kniefall und allem, was dazugehörte. Eine bedeutungslose Geste, denn sie wussten beide, dass sie erst heiraten konnten, wenn das Land in seinen Besitz übergegangen war. Also wartete Nora. Sie half ihrem Vater, wo sie konnte, aber ihr war klar, dass es nicht mehr lange so weitergehen konnte, mit drei erwachsenen Kindern im Haus.
Den Großteil ihres Gehalts gab sie ihrem Vater, aber es reichte trotzdem hinten und vorne nicht. Sie hielt sich während der Mahlzeiten zurück und ging manchmal heimlich mit knurrendem Magen ins Bett. Einmal im Jahr schlachtete ihr Vater oder ihr Bruder Martin eines der Schweine. Theresa hielt sich dann die Ohren zu, um die Schreie des Tieres nicht hören zu müssen. Zum Abendessen wurde für jeden eine Scheibe Speck abgeschnitten, von Salz befreit und gebraten. Dazu gab es Schwarzbrot und Kohlrüben. Je weiter das Jahr voranschritt, desto dünner wurden die Speckscheiben.
Eines Sonntagmorgens wartete Charlie nach dem Gottesdienst vor der Kirche auf sie. Er sah aus, als sei jemand gestorben. Ihre Großmutter, das wusste sie, war in der Kirche und hoffte, von dem Monsignore beachtet zu werden, der zu Besuch war. Wer sonst? Sein Vater? Ihr Vater?
»Wer?«, fragte sie.
»Vater hat gestern Abend verkündet, dass er nicht mehr weitermachen will«, sagte Charlie langsam und deutlich. »Er möchte den Hof abgeben.«
»Das ist ja wundervoll, Charlie.«
Im Geiste brachte sie mit Oona Vorhänge in der hellen Küche seiner Mutter an und saß bei einer Tasse Tee mit ihr im Garten.
»Peter soll den Hof übernehmen. Er sagt, Peter ist der Älteste, und so hat es auch sein Vater schon gemacht.«
»Aber Peter wird …«
»Das spielt keine Rolle«, unterbrach er. Er sah aus, als würde er in Tränen ausbrechen, wenn Nora weitersprach, also verstummte sie, obwohl ihr tausend Fragen durch den Kopf schwirrten.
Er solle nach Amerika gehen, habe sein Vater gesagt.
Darum ging es also. Charlie war gekommen, um die Sache mit ihr zu beenden.
Aber dann erklärte er ihr seinen Plan: Er wolle zunächst allein nach Boston gehen und dort alles vorbereiten. Wenn er so weit war, würde er Nora nachholen.
»Es wird nicht lange dauern, dann kommen wir mit genug Geld zurück, um uns einen eigenen Hof zu kaufen, größer als die unserer Väter zusammen.«
Sie konnte kaum glauben, dass er die Beziehung weiterführen wollte. Ihr fehlten die Worte.
Nora hatte nie viel über Amerika nachgedacht. Außer vielleicht bei der Sache mit Oonas sprechender Puppe. Die hatte sie, als Nora sieben Jahre alt war, von ihrer Tante in Chicago zu Weihnachten bekommen. Im Ort hatte man so etwas noch nie gesehen. Nora hatte sich in diesem Moment nichts sehnlicher gewünscht, als selbst eine Tante in Amerika zu haben, und hatte Oona sogar vorgeschwindelt, dass es so war.
Ihr erster Impuls war, mit Charlie Schluss zu machen. Sie kannte viele Fälle, in denen eine Beziehung zerbrochen war, weil einer der beiden weggegangen war. Charlie musste fort, also war’s das. Nora hing mehr an ihrer Familie als an ihm. Sie liebte sie mehr, sie verdankte ihnen mehr. Aber Charlie dachte nicht an Trennung. Er war ein Gewohnheitstier. Auch seine Brüder hatten ihre ersten Freundinnen geheiratet, und er würde es ihnen gleichtun.
Abends erzählte sie ihrem Vater davon. Nora hatte erwartet, dass er ihr sagen würde, dass sie unentbehrlich war. Dass er ihr verbieten würde zu gehen.
Stattdessen sagte er: »Dann musst du mit ihm gehen. Ihr seid verlobt.«
Nora dachte an Theresa. Sie konnte nicht zulassen, dass ihre Schwester das Haus führen, in der Fabrik arbeiten und sich den Rest ihres Lebens um Vater und Bruder kümmern würde. Ihr Vater hatte keine Ahnung von Erziehung. Theresa schäkerte zwar gern mit Männern, aber von den Tatsachen des Lebens hatte sie keinen blassen Schimmer. Nora hatte sie, so gut sie konnte, beschützt.
Sie erinnerte sich an die Stunden von Pater Boyle, der in der Klosterschule die ersten Klassen unterrichtete. Er beugte sich gern von hinten über die Mädchen, während diese saßen und lasen, verharrte lange in dieser Position, sah sich nach links und rechts um und brüllte jede an, die es wagte, den Blick vom Blatt zu heben. Alle starrten auf das Papier vor ihnen, aber sie wussten genau, was da geschah. Das Mädchen, das er sich ausgesucht hatte, spürte seinen Atem an ihrem Ohr. Dann legte er ihr ganz leicht die Hand auf die Schulter und bewegte sie immer weiter hinunter, schob sie geräuschlos in ihr Kleid und umfasste ihre Brust. Das Mädchen spürte dann seine kalte, feuchte Haut auf ihrer weichen, warmen. Er verharrte lange, qualvolle Momente so, bevor er die Hand endlich zurückzog und brüllte: »So, Mädels, was haben wir vom Text verstanden?«
Er suchte sich immer das hübscheste Mädchen aus. In Noras Jahrgang war es die arme Oona gewesen. Ihre Freundin hatte mit niemandem darüber gesprochen außer mit Nora. Ihre Mutter würde ihr die Schuld geben, sagte sie. Einen Priester stellte man nicht in Frage. Die Taten eines Priesters waren gottgegeben und allein durch seine Position gerechtfertigt. Nora wusste, dass auch ihr Vater so etwas für unvorstellbar halten würde.
Als Pater Boyles Unterricht Theresa bevorstand, konnte Nora die Vorstellung nicht ertragen, dass er ihr dasselbe antun würde. Also fertigte sie ihrer Schwester ein Mieder aus Stoff und Daune an, ein Polster so dick wie eine Scheibe Brot. Es lag eng um Theresas Brust und war bis zum Kragen geschlossen. Als Pater Boyle den alten Trick an ihr versuchte, musste er feststellen, dass er nicht reinkam. Unter der Oberbekleidung trug sie ein Kettenhemd aus Federn.
»Ohne meine Schwester kann ich nicht nach Boston gehen«, erklärte Nora Charlie vor seiner Abreise.
Sie hielt das für eine Barriere, die er nicht überwinden konnte. Aber er antwortete, dass er dann für zwei Überfahrten sparen würde. Nora solle zuerst kommen, dann würden sie Theresa bald nachholen.
Darauf sagte Nora, sie wolle warten, bis sie die Reise mit der Schwester gemeinsam würde antreten können. Da erkannte sie ihn plötzlich: einen guten Grund, zu gehen. In Amerika könnte Theresa Lehrerin werden und ihrer Berufung folgen. Dort konnte sie eine Frau werden, auf die ihre Mutter stolz gewesen wäre.
Charlies Mutter fand, dass sie noch vor seiner Abreise heiraten sollten. Ein junges Mädchen konnte doch nicht nur aufgrund eines Versprechens den Ozean überqueren. Aber Nora wandte ein, dass die Zeit zu knapp sei. Mrs. Quinlan, eine Cousine von Charlies Vater, wiederum hatte noch nie jemanden aufgenommen, der nicht zur Familie gehörte. Außerdem waren alle Gästezimmer besetzt. Dennoch willigte sie schließlich ein, Nora und Theresa aufzunehmen, allerdings nur unter der Bedingung, dass Nora und Charlie gleich nach ihrer Ankunft heirateten.
Während der Trennung schrieb Charlie ihr Briefe, und sie antwortete. Der Postweg dauerte eine Woche, und so war der Austausch oft zusammenhangslos. Charlie berichtete von der Stadt und seinem neuen Malerjob an der Seite seiner Cousins. Meistens sei es leichte Arbeit im Vergleich zu dem, was sie auf dem Hof zu tun gehabt hatten. Manchmal, wenn Nora einen der dünnen, blauen Umschläge in Händen hielt, stellte sie sich vor, er könne ihr darin mitteilen, dass er jemand anderen gefunden habe, dass sie doch nicht gehen müssen würde.
Es dauerte elf Monate, bis er das Geld zusammenhatte und ihre Übersiedlung organisiert war. Er schrieb, sie solle sich nun bereitmachen. Die Gelegenheit sei günstig, denn eine Verwandte sei gerade ausgezogen, und das Zimmer stünde für Nora und Theresa bereit. Außerdem hatte Charlie mithilfe von Mrs. Quinlan Arbeit für sie beide in einer Schneiderei gefunden.
Charlie versicherte ihr, dass sie nicht ewig bleiben würden. Aber solange sie da waren, würde Boston Nora bestimmt gefallen.
Hier ist alles so anders – daran werde ich mich nie gewöhnen. Du drehst über der Küchenspüle an einem Hahn, und es kommt heißes Wasser raus. Du musst es nicht von der Pumpe ins Haus schleppen und auf den Ofen stellen, bevor du waschen kannst. Und das ist nur eins von hundert kleinen Wundern, die hier für alle ganz normal sind. Du wirst es nicht glauben, Nora. Ich kann es nicht erwarten, dir alles zu zeigen.
Cobh war eine lebhafte, geschäftige Stadt. Auf dem Hügel drängten sich bunte Läden und Häuser, und über allem thronte eine graue Kathedrale.
Sie saßen stundenlang auf einer Bank am Kai und sahen Fischerboote und Schiffe vorbeiziehen. Nora war jetzt schon erschöpft, dabei hatte die eigentliche Reise noch gar nicht begonnen. Sechs Tage Überfahrt, und auf der anderen Seite erwartete sie eine Welt, von der sie keine Vorstellung hatte, und ein Mann, an dessen Gesicht sie sich kaum erinnern konnte. Sie hatte Charlie seit einem Jahr nicht gesehen.
Als es dämmerte, sah sie Theresa einem dunkelhaarigen Mann zulächeln, der mit seinen Freunden an ihnen vorüberging.
»Nehmt ihr Mädels die Fähre heute Abend?«, fragte er.
»Ja«, antwortete Theresa. »Ihr auch?«
»Kommt doch mit ins Commodore zum Abendessen. Dann wird euch die Wartezeit nicht so lang.«
Theresa machte gerade den Mund auf, um zu antworten, da sagte Nora schnell: »Nein, danke.«
»Aber ich habe Hunger«, sagte Theresa und sah ihnen nach.
Nora nahm Oonas Kuchen aus der Tasche und reichte ihn der Schwester.
»Hier.«
Als es endlich so weit war, stellten sie sich vor dem Beiboot an, das sie zum Schiff bringen sollte. Beim Anblick des Schiffes in der Ferne schlug Noras Herz so fest in ihrer Brust, dass sie dachte, es würde ihr das Kleid aufreißen: Riesig groß lag es hell erleuchtet vor dem Dunkel des Ozeans und des Himmels.
Einmal war ein Zirkus nach Miltown Malbay gekommen, und beim Anblick eines Elefanten auf der Flag Road hatten allen die Münder offen gestanden. Damals hatte Nora gedacht, das müsse das Erstaunlichste sein, das sie in ihrem Leben sehen würde. Sie hatte sich geirrt.
3
Ihre Kabine lag unter der Wasseroberfläche, bestand aus zwei schmalen Doppelstockbetten und hatte eine eigene Toilette. Nora hatte von zu Hause eine hellgelbe Decke mitgebracht, die ihre Großmutter gehäkelt hatte. Diese breitete sie als Erstes über eines der unteren Betten aus. Bei diesem Anblick fühlte sie sich schon besser.
Zunächst dachten sie, sie hätten die Kabine vielleicht für sich, aber schon bald traten eine Frau und ein kleiner Junge ein und schleppten einen Koffer mit, der mit Aufklebern in einer Nora unbekannten Sprache übersät war. Vielleicht war es Deutsch. Die beiden rochen, als hätten sie sich seit Tagen nicht gewaschen. Sie sprachen kein Wort.
Theresa sah Nora mit weit aufgerissenen Augen an.
Die Frau öffnete den Koffer und fing an, ihre Kleider über Noras Decke zu verteilen.
Nora schnürte es die Kehle zu. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie sah ihre Schwester an.
»Entschuldigung«, sagte Theresa und zeigte auf Nora. »Das ist ihr Bett.«
Die Frau sah verwirrt aus, und Nora fragte sich, ob sie überhaupt Englisch verstand. Dann wiederholte Theresa ihre Worte und zeigte auf die Decke. Die Frau nahm ihre Sachen und legte sie auf das gegenüberliegende Bett.
»Tut mir leid«, sagte Nora.
Die Frau reagierte nicht.
Die Frau, die nicht sprach, schnarchte lauter als menschenmöglich. Der kleine Junge schlief tief und fest, nur Nora und Theresa taten die ganze erste Nacht kein Auge zu. Theresa warf sich immer wieder über das Geländer des Bettes über Noras, seufzte laut und drohte, der Frau die Meinung zu sagen, aber das änderte natürlich überhaupt nichts.
Nora lag wach und grübelte über das, was ihnen bevorstand. Bisher hatte sie keine Zeit zum Nachdenken gehabt. Sie wusste, dass es sinnlos war. Wenn sie dieses Schiff verließ, würde sie ihr neues Leben akzeptieren müssen. Sie stellte sich vor, das ganze Schiff würde zum Meeresgrund sinken. Dann wären ihre Ängste grundlos gewesen.
Sie fragte sich, wohin die Frau und der Junge auf dem Weg waren und wer auf der anderen Seite auf sie wartete. Hatten sie Ehemann und Vater zurückgelassen, oder waren sie auf dem Weg zu ihm?
Sie dachte an ihre Mutter und fragte sich, was sie Nora jetzt raten würde, wenn sie nicht gestorben wäre. Aber wenn sie nicht gestorben wäre, wäre es nie so weit gekommen. Dann hätte Nora mehr sie selbst sein können, wäre vielleicht wie so viele nach Dublin gegangen, hätte sich zur Krankenschwester ausbilden lassen und wäre einem Mann begegnet, den sie nicht schon ihr ganzes Leben lang kannte.
Am meisten aber dachte sie an Charlie, und je mehr sie sich näherten, desto größer wurde die Angst.
Als die Sonne aufging, sagte Theresa, dass sie durchdrehen würde, wenn sie vor dem Frühstück nicht zu einem Spaziergang an Deck ginge.
»Komm doch mit. Frische Luft wird uns guttun«, sagte sie.
Aber Nora konnte sich nicht bewegen. Der ganze Körper schmerzte.
»Was ist los mit dir?«, fragte Theresa.
Sie konnte es nicht erklären. Charlie hatte gesagt, dass ihr bei Sturm auf dem Schliff schlecht werden könnte, aber was sie erlebte, musste etwas anderes sein. Die See war ruhig.
»In ein paar Stunden ist es bestimmt vorbei«, sagte sie. »Ich brauche nur etwas Schlaf. Geh ruhig ohne mich.«
Aber es wurde nicht besser. Sie stellte sich vor, das Schiff würde in New York anlegen, und sie wäre unfähig auszusteigen. Vielleicht könnte sie dann einfach wieder zurückfahren und hätte immerhin ihre Schwester sicher in ihr neues Leben in Amerika gebracht.
In der Kabine war es den ganzen Morgen über ruhig. Die Frau saß briefeschreibend auf ihrem Bett, und ihr Sohn versuchte, seine Plastiksoldaten strammstehen zu lassen. Jedes Mal, wenn eine heftige Welle das Schiff erfasste, fielen alle um, und er fing wieder ganz von vorne an.
Theresa tauchte erst am späten Nachmittag wieder auf. Sie öffnete die Tür mit so viel Wucht, dass alle erschraken. Sie war in Begleitung von vier Mädchen, die sich jetzt alle in die enge Kabine quetschten, als könnten sie es nun, da sie einander gefunden hatten, nicht ertragen, auch nur eine Minute voneinander getrennt zu sein. Die Frau aus Deutschland sah auf, als Theresa die Mädchen vorstellte und ihre Namen nannte, als handle es sich um eine Person: »AnnaMadeleineHelenAbigail.«
Die Deutsche fing an, in ihrem Koffer zu wühlen, und Nora zog sich die Decke bis ans Kinn.
»Anna hat gehört, dass Jean Simmons in der ersten Klasse ist!«, sagte Theresa und machte dabei ein Gesicht wie ein Kind, dem gerade ein Geburtstagskuchen serviert wird, obwohl Nora nicht dachte, dass Theresa sich besonders für die Schauspielerin interessierte.
»Wir werden sie aufspüren und nicht in Ruhe lassen, bis jede von uns ein Autogramm hat«, sagte eines der Mädchen entschlossen.
Eine großgewachsene Blondine mit Brille setzte sich zu Nora und legte ihr die Hand auf die Stirn, als wären sie alte Bekannte.
»Theresa hat gesagt, dass du krank bist. Hast du Fieber?«, fragte sie. »Vielleicht sollten wir die Krankenschwester rufen.«
»Nein«, sagte Nora. »Es geht mir gut. Ich will einfach noch ein bisschen hier liegen.«
»Das kann ich verstehen. Ist auch wirklich sehr luxuriös hier unten«, sagte das Mädchen lächelnd.
»Abigail wird als Lehrerin in New York arbeiten«, sagte Theresa und zeigte auf die Blondine.
»Neunte Klasse Mathe«, sagte Abigail. »Der Name klingt wie eine idyllische Dorfschule: Saint Hugo of the Hills. Aber meine Cousine hat gesagt, dass es einfach ein großes, hässliches Gebäude in Queens ist. Sie hat die Stelle bisher gehabt, hat jetzt aber etwas Neues gefunden und mich empfohlen. Sie arbeitet seit Ewigkeiten daran, mich nachzuholen.«
»Und die Lehrerausbildung hast du schon absolviert?«, fragte Nora.
»Ja«, erwiderte Abigail. »In Dublin.«
Nora fragte sich, warum das Mädchen ihre Heimat verlassen hatte, wenn sie doch auch in Irland einen guten Lehrerposten hätte finden können.
Jedes der Mädchen hatte ein anderes Ziel. Anna erklärte, sie sei auf dem Weg nach Cleveland, wo ihr Bruder und dessen Frau lebten. Madeleine wollte in New York in einen Zug nach Virginia steigen. Helen wollte nach Philadelphia, um dort bei einer Großtante zu wohnen, die sie noch nie gesehen hatte.
»Zu ihrer Zeit konnte man mit dem Schiff noch direkt dorthin fahren«, erklärte sie.
»Ein Freund von meiner Mutter ist in vierundvierzig Stunden rübergeflogen«, sagte Anna. »Beim Zwischenstopp in Nova Scotia zum Auffüllen des Tanks wurde den Passagieren Frühstück serviert. Dann weiter direkt nach New York. So müsste man in Amerika ankommen.«
Alle vier redeten so viel wie ihre Schwester. Wie kam es, dass Mädchen von diesem Schlag einander so schnell fanden? Theresa schloss in kurzer Zeit neue Freundschaften. Nora fühlte sich unter Fremden nicht wohl. Sie wusste nie, was sie sagen sollte. Auch auf hoher See hatte sich daran nichts geändert.
Sie wünschte, die Mädchen würden ein bisschen bleiben, auf ihrer Bettkante sitzen und Geschichten erzählen. Aber keine Minute später waren sie schon wieder weg.
Die Mädchen kamen zurück, um sie zum Abendessen abzuholen, aber sie sagte, sie könne nichts essen.
Madeleine erzählte von einer bevorstehenden Tanzveranstaltung, die Nora nicht verpassen dürfe.
»Ich glaube, das kann ich nicht«, sagte sie.
»Ich war noch nie woanders als zu Hause tanzen«, sagte Theresa und drehte eine Pirouette. »Bei uns wird während der Fastenzeit nicht getanzt. So rückständig ist es da. In Galway soll es schon seit Jahren auch während der Fastenzeit Tanzabende geben.«
Nora warf ihr einen Blick zu. Theresa redete zu viel. Sie gab an.
»Bei uns daheim ist es auch so«, sagte Abigail. Sie wandte sich zu Nora. »Wir bringen dir einen Teller Suppe. Bist du dir sicher, dass es dir gut geht?«
»Morgen ist es bestimmt vorbei«, sagte Theresa und streichelte Nora den Kopf wie einem geliebten Haustier.
»Sei ein gutes Mädchen, Theresa«, sagte Nora. »Benimm dich.«
»Siehst du? Du bist schon wieder ganz die Alte.«
Nora hörte sie lachen, als sie den Flur entlanggingen. Fünf Mädchen, die bisher abends nicht einmal unbegleitet in die Stadt hatten fahren dürfen und die jetzt den Ozean überquerten auf dem Weg in eine Welt, die sie nie gesehen hatten. Keine von ihnen schien auch nur im Geringsten Angst zu haben.
Sie hatte sich geschworen, sich Oonas Brief so lange wie möglich aufzuheben. Es war viel zu früh. Aber plötzlich hatte sie den Zettel schon herausgeholt und entfaltete ihn. Der Anblick der vertrauten Handschrift versetzte ihr einen Schlag.
Was du nicht alles erlebt haben wirst, wenn wir uns wiedersehen. Was für Abenteuer du bestanden haben wirst. Solltest du dabei mal Angst kriegen, stell dir vor, ich stünde neben dir. Ich bin immer da. Deine Oona
Nora sehnte sich nach Oonas warmer Küche, aber es hätte ihr auch gereicht, ihre Freundin morgens für den langen Spazierweg zur Arbeit abholen zu können. Sie blickte an sich herab, wie sie auf dem Bett zusammengerollt lag, und schämte sich, als könne Oona sie sehen.
Dieser Gedanke reichte, um Nora sofort auf die Beine zu bringen. Es war Zeit für einen kleinen Spaziergang und etwas frische Luft, wie Theresa gesagt hatte.
Sie ging den schmalen Flur hinunter. Ihre Beine hatten noch keine Gelegenheit gehabt, sich an den Rhythmus des Schiffes zu gewöhnen.
An Deck angekommen, sah Nora über den Ozean. Ein erstaunlicher Anblick. Kein Land in Sicht, in keiner Himmelsrichtung.
Es waren nicht viele Menschen zu sehen. Die meisten Passagiere saßen wohl gerade beim Abendessen.
Nach ein paar Minuten reichte es ihr. Genug der Abenteuer.