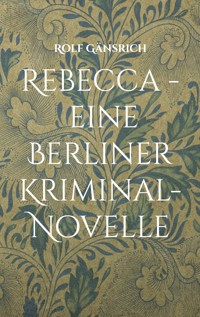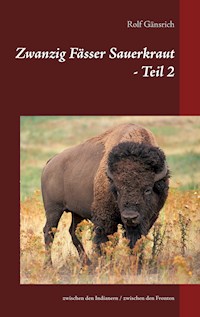Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es sind die Erlebnisse aus der Kindheit, die einen prägen, Begegnungen, Laute und vor allem Gerüche. Für mich sind es die nach Teer, Brackwasser, Mehlstaub und frischem Brot. Die Menschen, um die es hier geht, sind mittlerweile fast alle gegangen, aber die Gefühle von damals sind noch immer tief in mir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Dies ist nun der dritte lange Text, der schon seit Jahren „vor sich hin dampft“ und aus dem ich nun ein Buch „schmieden“ konnte.
„Wie bewerbe ich mich richtig – ein satirischer Ratgeber für den Berufsalltag“ erschien im Februar 2019, „Still gestanden, die Augen links! - mein geheimes NVA-Tagebuch“ erschien am 2.April 2019 und nun dieses Buch hier. Es ist etwa zehn Jahre nach dem letzteren entstanden. Wann und zum Teil wo ich es aufschrieb, hab ich ganz am Ende aufgelistet.
Hier angehängt habe ich außerdem eine lange Version meines Zeitungsartikels aus der Mai-2019-Ausgabe der Monatszeitung „Prenzlberger Ansichten“, den ich dort unter dem Titel „Unternehmergeschichte Prenzlauer Berg – das Bäckereihandwerk“ veröffentlichen konnte und den ich am 29.März und 5.April 2019 geschrieben habe.
Die Menschen, um die es in diesen Kindheitserinnerungen geht, leben zum größten Teil schon lange nicht mehr oder sie sind sehr, sehr hoch betagt.
Danke auf jeden Fall an all diese, daß sie mir ebend jene Erinnerungen verschafft haben.
Rolf Gänsrich am 10.April 2019 – am theoretisch 99.Geburtstag meiner Oma.
Es begann eigentlich schon viel früher, und ich kann mich nur an Hand einiger alter, vergilbter Fotos, so schön mit geriffeltem Rand, daran erinnern.
Wenn im Frühjahr die Elstern im einzigen Baum des Hinterhofs, einer uralten Pappel, vor meinem Wohnzimmerfenster, typisch Prenzlauer Berg, Hinterhof, dritte Etage, nisten, hören sich die Rufe ihrer frisch geschlüpften Jungen genau so an, wie das Gekrächz der Lachmöwen an einem brütend heißen Sommertag über der kleinen Fischerei in „Krakow am See“, mitten im wunderschönen hügeligen Mecklenburg.
Die Fotos aus meiner frühen Kindheit zeigen mich Auge in Auge mit dem Riesenschnauzer in Krakow, ... nein, der Hund war wohl doch noch ein paar Zentimeter größer als ich, sie zeigen mich mutig stehend neben einem weißen Gaul, für Berliner sind alle Pferde „Gäule“, in diesem Fall war es wohl ein Schimmel, neben dem linken Vorderhuf reiche ich fast bis zum Knie des ... Gauls. Dann gibt’s auch Bilder, da „reite“ ich wohl auch, ängstlich festgekrallt in die Mähne des weiß gefleckten Tieres, hinter mir Astrid, etwa zehn Jahre älter als ich und das Kind unserer Verwandtschaft dort, die mich wohl im Gleichgewicht hielt, damit ich, kaum zu sehen zwischen Gaul und Astrid, nicht vom wackligen Pferderücken hinunter rutsche.
Ich entsinne mich weiterhin an die Lederhose, die ein großes, rot umnähtes Herz zwischen den Hosenträgern, vorn als Brusttasche, zierte. ... Wie peinlich! Gibst heute eigentlich noch Kinder im Vorschulalter, die diese Lederhosen tragen? Sie, diese Lederhosen und nicht etwa die Kinder, waren praktisch, sie waren pflegeleicht, sie waren immer voller Sand und man konnte auf ihrem Hosenboden ruhig mal einen Kiesabhang hinunter rutschten, das machte denen gar nichts! Aber sie hatten einen Nachteil! Sie waren nur so kurz, wie heutige Shorts und linderten nicht den Aufprall, wenn man sich mit dem Tretroller auf die Fresse packte oder wenn man über die eigenen, ständig nachwachsenden und viel zu langen und viel zu ungelenken Beine stolperte. Ich jedenfalls hatte als Kind im Sommer ständig aufgeschlagene Knie, egal ob in Krakow, im Garten in Brieselang oder auf dem Hof meiner Eltern. Und ich hatte ständig Holzsplitter in meinen Fingern, die mir Vaddern immer mit einer in einer Kerzenflamme erhitzten Nähnadel, wegen der Desinfektion, aus den Pfoten heraus operieren mußte.
Ich war wohl gerade drei Jahre alt, als ich das erste mal in Krakow war. Daher stammen diese ersten Bilder. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir dort hin gelangten. Ich hatte süße, blonde Locken, einen Dackel blick, so von etwas unten herauf, den ich noch heute kann, und ich sehe, von weitem und mit dem Abstand vieler Jahrzehnte, auf diesen frühen Photos eher wie ein kleines Mädchen aus, mit weißem, mit vielen, kleinen rotblauen Herzchen bedrucktem Shirt an. Shirts gab es damals noch nicht, sie hießen anders, ich glaube „Nicki“, waren aber welche.
Meine Mutter erzählte mir mal eine große Zeitspanne später, dass ich in diesen frühen Jahren, bis ich so etwa zehn, elf war, ein weißes Hemd eine ganze Woche lang tragen konnte, ohne dass es dreckig wurde. Schmutz machte damals wohl einen großen Bogen um mich, außer um die ewig sandige Lederhose.
Und dann gibt’s da noch ein Bild, auf dem ich, waghalsig war ich damals gerade nicht, bis zu den Knöcheln im Wasser des Krakower Sees stehe und mit meiner Patentante Elschen und meinem Patenonkel Gerhard (er war wohl der vierte Gerhard in unserer Familie, mein Vater der fünfte dieses Namens) Ball spiele.
Das Photo daneben zeigt mich mit eben jenem aufblasbaren Ball, der viele, viele Jahre existierte und den ich damals mit einem Arm kaum umfassen konnte, so groß war er, mit Dackel blick, Lederhose und einem hölzernen Segelboot, das so lang war, wie mein Unterarm und, auch noch krampfhaft festgehalten, Buddeleimer und Schaufel.
Aber, wie gesagt, was wir dort machten, mit wem ich da war, wie lange dieser Aufenthalt dauerte, weiß ich nicht mehr zu sagen. Weil Tante Elschen dabei war, nehme ich an, war ich auch mit meiner Ille-Oma da.
Nun ist es aber endlich an der Zeit, dem geneigten Leser, oder auch dem Hörer, falls ich aus diesem Text doch noch eine kleine Radio-Serie mache, was ich nicht von vornherein ausschließen sollte, mal noch ein paar Rundumfakten zu erzählen, die für das Verständnis dieser Sommer, die ich von 1968 bis 1975 regelmäßig in Krakow am See verlebte, notwendig sind.
Ich wurde 1961 in Berlin-Hohenschönhausen geboren, ziemlich genau zwischen dem ersten bemannten Raumflug von Juri Gagarin am 12.April dem Bau der Berliner Mauer am 13.August. Mit mir gemeinsam hatten Geburtstag: Walter Ulbricht, genau der, der DIE Mauer niemals bauen lassen wollte und Peter Alexander. Mir war das in den ersten Schuljahren immer etwas peinlich, genau mit unserem „heiß geliebten“ Staatsratsvorsitzenden diesen Geburtstag zu haben. Die Kinder der Klasse, ja, man wurde jedes Jahr, immer wieder zu meinem Entsetzen, nach vorn an die Tafel zur Lehrerin gerufen, obwohl man ja gar nichts verbrochen hatte, außer dass man Geburtstagsjubilar war, sangen dann nicht irgendwas von „... alles Gute für Dich ..“ sondern sie stimmten, nach Aufforderung durch die Lehrerin, zu Ehren unseres Staatsratsvorsitzenden, für Conny, die da auch noch Geburtstag hatte und mich irgend ein „Kampflied der Arbeiterklasse“ an, ... „Der Kleine Trompeter“, „das Lied von der roten Fahne“, „Die Internationale“ oder gar die Nationalhymne der DDR, so lang man sie noch singen durfte, ... etwa bis 1971 ... „auferstanden aus Ruinen ...“.
Ich beharre darauf, dass ich in Berlin-Hohenschönhausen geboren wurde. Das sind nämlich nicht viele. Hohenschönhausen hatte im „Schloss“, also im Haupthaus des einstigen Gutes, neben der Kirche, deren viel zu große und schwere Glocke schon immer unter einem ebenerdigen Gestell neben dem Kirchturm aufgehängt ist und dicht beim Schulhaus gelegen, eine eigene Entbindungsanstalt bis in die frühen sechziger Jahre hinein. Ursprünglich war es das Gutshaus des Dorfes „Hohen Schoenhusen“, dann die Villa des Erfinders der ersten Batterien, Daimon und ab nach dem Ersten Weltkrieg war es bis mitte der 70er Jahre eine Klinik für Geschlechtskrankheiten.
Entbindungsanstalt nur etwa von 1958 – 1962 … nageln Sie mich jetzt bitte nicht auf diese Zahlen fest. … Vielleicht bin ich ja einfach nur eine Geschlechtskrankheit. …
Dieser Ortsteil, zum Zeitpunkt meiner Geburt zum Stadtbezirk Weißensee gehörig und seit 1920 Teil „Groß-Berlins“, lag damals „am Rande der Stadt“. Man gelangte mit den Straßenbahnlinien 63 (heute M 5) und 64 (dazu existiert heute kein Pedant mehr) aus Richtung Landsberger Allee dort hin. Bis zum S-Bahnhof brauchte man vom Dorfkern aus etwa zwanzig Minuten, oder man fuhr mit der Linie 70 (heute ein Teil der 27 und die ganze 12), eingleisig mit Ausweichpunkten an den Haltestellen, über die Buschallee nach Weißensee zum einkaufen oder zur Würstchenbude Konnopke. Hinter der Kirche endeten die 64 und die 70 und nur die 63 gondelte weiter, eingleisig, an miefenden Rieselfeldern, der Gaststätte „Dogge“ und an winzigen Schrebergärten vorbei nach „Hohenschönhausen – Gartenstadt“. Heute ist da der S-Bf. Gehrenseestr.
Hinter dem Stasi-Knast zur Gartenstraße hin, heute „Gedenkstätte Hohenschönhausen“, lagen Felder, auf denen wir später, mit elf, zwölf Jahren, Mais stahlen und den wir an fast rauchlosen Lagerfeuern vor unseren Höhlen im Naturschutzgebiet „Am Faulen See“ rösteten. „Am Faulen See“ fingen wir auch Wasserflöhe fürs Aquarium, Kaulquappen oder Frösche, wir rannten barfuß über frisch gestoppelte Felder hinter dem Bahnübergang in „Gartenstadt“ und fanden dabei hin und wieder so manchen alten, rostigen und durchlöcherten Wehrmachtsstahlhelm. Wir ballerten mit „Katschies“, kleinen Schleudern, auf Tauben und wir unternahmen mit der Straßenbahn weite Ausflüge in die Stadt – für zwanzig Pfennig innerhalb von zwei Stunden einmal bis zum „Walter-Ulbricht-Stadion“ in der Chausseestraße, Endstation der Linie 63, zum Dönhoffplatz an der Leipziger Straße, Endstation der 64, oder zu „Am Kupfergraben“, Endstation der Linie 70, hin und zurück.
In meinen ersten sieben Lebensjahren wohnten wir in einem alten Haus, einem Gehöft, Berliner Straße 55. Das ist heute Konrad-Wolf-Straße, fast gegenüber vom Berkenbrücker Steig. Wir wohnten in diesem Gehöft in der zweiten Etage, in der Wohnung gegenüber lebte „Tante Lehne“, eine uralte Frau, unter uns ein alter Mann. Man kam in die Wohnung hinein und stand sofort in der Küche. An die schloss sich ein Wohnzimmer und an das ein Schlafzimmer an. Wo das Klo war, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube es war in der ehemaligen Speisekammer neben der Küche, über dem Hausflur und war im Winter entsprechend und im Wortsinne Arsch kalt. In einem weiteren Haus auf diesem Gehöft war wohl noch eine Metallbude, und ich weiß, dass mein Vater dort regelmäßig Holz für unsere Öfen sägte. Da gibt’s auch noch Bilder von. Vaddern energisch an der Säge, icke, blondgelockt mit Dackelblick, sehr unbeholfen, ihm gegenüber an dem Stück Stubben. Es gab auch noch einen Buddelkasten für mich und einige große Bäume. Das Grundstück wurde zur Straße hin begrenzt durch einen undurchsichtigen hohen, windschiefen Lattenzaun, wie man ihn aus der bekannten Anstreich-Geschichte des Tom Sawyer von Mark Twain kennt. Stand man vor dem Gehöft, war auf dem rechten Grundstück neben uns der Dynamo-Radsportverein mit seinen Baracken. Getrennt waren die beiden Gelände durch eine Steinmauer quer zur Straße, an der, auf unserer Seite, einige hohe Büsche wuchsen. „Zopp-Anna“, eine Frau wohl in Omas Alter, wohnte mit auf dem Gelände Radsportvereins. Die Dame war mir immer etwas unheimlich, denn sie machte einen manchmal etwas verwirrten Eindruck. Man munkelte, daß sie im Krieg bei einem Bombenangriff wohl verschüttet gewesen sein soll. Das Areal links neben uns gehörte einem kleinen Pferdefuhrbetrieb. Das ganze Karree ist dort nach unserem Wegzug 1968 in den frühen siebziger Jahren komplett platt gemacht worden, aber diese Buschreihe, die an dieser Mauer zwischen unserem Gehöft und dem Radstall wuchs, steht noch und ich glaube auch noch der dicke Eckbaum rechts neben dem einstigen Eingangstor.
Ille-Oma wohnte genau im Haus gegenüber, Berliner, heute Konrad-Wolf-Straße 72. Dort hatte bis 1962 das untere Ladengeschäft meiner Uroma gehört. Zur Lüderitzstraße hin gab es den Gemüseladen Stenzel, das Eckhaus am Berkenbrücker Steig waren HO-Lebensmittel. Dort wurde die Butter noch aus einem großen Fass von Hand abgewogen und in Pergamentpapier eingeschlagen. Milch gab es gleichfalls in jenen Zeiten „lose“. Unsere Milchkanne durfte ich immer tragen. Dort, wo heute die Altenhofer Straße heraus kommt, gab es damals eine Tankstelle und irgendwie dazwischen gab es noch einen Friseur und einen Laden für Motorrad- und Autoersatzteile. „Bubikopf mit Eckschnitt“ bestellte Muttern, wenn sie mit mir dort zum Frisör ging. Ich mag es bis heute nicht, wenn mir Menschen am Kopf so nahe kommen. Zahnarzt und Frisör sind seit jener Zeit bei mir absolute Vertrauenssache.
Die große Kreuzung am Weißenseer Weg wurde bis ende der 70er Jahre hinein ausschließlich von Hand geregelt. Ich hatte vor diesem großen Polizisten, der auf einem runden, rot-weißen Podest stand, immer gehörig Respekt, wenn meine Mutter und ich dort in eine Straßenbahn der Linie 3 (heute M 13) einstiegen, um „in die Stadt“ nach Weißensee zum Großeinkauf und Currywurst essen zu fahren.
Will sagen, eigentlich bin ich kein richtiges Stadtkind, keene Berlina Großstadtjöhre, weil Hohenschönhausen damals noch Stadtrand war. Also gut, von dort aus, wo wir zuerst lebten, war es zum S-Bf. Landsberger Allee mit der Straßenbahn kürzer, als zu unserem Dorfkern, aber so richtig Großstadt war es halt auch nicht, und ich weiß, dass mir mein Vater zu meinem fünften Geburtstag noch auf diesem Gehöft zwei Hühnchen geschenkt hat, die dann irgendwie nach unserm Umzug am 1.Juni 1968 in die Freienwalder Straße im Familien-Garten in Brieselang und dort wenig später im Kochtopf landeten. Ja, ich hatte eigene Hühner als Haustiere!
Und auch Brieselang war nicht Großstadt. Der Garten gehörte meinem Opa. Kriegsbedingt hatte ich nur noch einen Teil meiner Großeltern. Opa war Vadderns Vater, Ille-Oma und Tick-Tack-Oma waren Mutter und Großmutter meiner Mutter.
Brieselang das waren immer die Wochenenden. In der kleinen Hütte übernachteten vom Samstag zum Sonntag wir, also mein Vater, meine Mutter, mein viereinhalb Jahre jüngerer Bruder und ich, Tante Helga, sie war Vadderns Schwester, samt Tochter, also meine Cousine die heute mein Hausarzt im Prenzlauer Berg ist. Unser Opa schlief in einer Extrakammer neben der Küche. Das Häuschen hatte eine kleine Veranda mit einem winzigen Kühlhaltekeller darunter, der eigentlich mal ein von meinem Opa im Krieg angelegter Bunker gegen Fliegerangriffe war. Opas Frau, Oma Hedwig, starb schon 1962 an einem Hirntumor. An sie hab ich keine Erinnerung mehr. In die Hütte gelangte man durch die Veranda. An diese schloss sich die Küche mit großer „Kochmaschine“ an, dann Opas Kammer und nach rechts der große Raum, in dem wir anderen alle schliefen. Da niemand damit klar kam, kochte Opa auf dem Feuerherd. Es schmeckte fast immer und war anders, als „bei Muttern“, weil Opa halt auch Rhabarbersuppen mit Sago und anderen „exotischen“ Zutaten kochte. Der Garten war ein Nutzgarten. Fast nur Obstbäume, dazwischen Beete mit Kartoffeln, Möhren, Erbsen, Bohnen, Kohlrabi, Porree, Zwiebeln und Wirsing.
Hinterm Haus noch ein Schuppen für Gartengeräte und Fahrräder und auch, ja, auch das hatten wir, das Plumpsklo. Zwei-, bis dreimal pro Jahr wurde der Inhalt des „Eimers“ im hinteren Teil des Gartens, im „Hühnerhocken“ vergraben. Neben der Tür zum Hühnerhocken stand der Busch für’s kleine Geschäft von uns Männern. Dieser Busch blühte im Frühjahr regelmäßig in einem besonders schönen Hauch von Rosa.
Wie das mit den Hühnern in Brieselang genau war, weiß ich nicht mehr. Das Grundstück links neben uns gehörte Frau Förster. Ihr Sohn war in Vadderns Alter. Frau Förster kam eigentlich aus Berlin-Wedding, wurde im Krieg ausgebombt und wohnte in Brieselang seit jener Zeit. Ihr Sohn Herbert, Vadderns Kumpel, heiratete nach Nauen und war mit seiner Frau Renate und seiner Tochter Birgit im Sommer auch immer in Brieselang. Die schon von meinem Opa angelegte Tür zum Nachbargrundstück stand damals immer offen. Tante Försters Hühner nutzten den Hühnerstall auf deren Grundstück und unseren Hühnerhocken. Ich denke, dass dafür Opas Hühner mit von Frau Förster unterhalten wurden und er im Gegenzug an den Wochenenden immer einige frische Eier von ihr bekam oder so.
Ab so 1972 zog „Onkel Herbert“ mit seiner Familie von Nauen nach Brieselang, riss das alte Haus seiner Mutter ab und baute für sie und seine Familie ein neues dort hin. Einige Jahre nach der deutschen Einheit kaufte er das Eckgrundstück links neben seinem für seine Tochter Birgit, drei Jahre jünger, als ich und stellte ihr gleichfalls ein hübsches Häuschen dort hin.
Wir hatten bis 1977 in Brieselang keinen Strom. Erst im Zuge des Hausbaus von „Onkel Herbert“ wurde auch unser Grundstück ans Stromnetz angeschlossen. Bis dahin wurde Wasser mühsam durch eine Handpumpe an die Oberfläche befördert oder zum Gießen aus der Regentonne neben dem Schuppen genutzt. Man funzelte abends mit Kerzen herum und wenn man als Kind dann nochmals vor dem schlafen gehen zum Klo musste, leuchtete man sich den Weg ums Haus herum mit einer Petroleumlampe, denn es wurde im Sommer zeitig dunkel. Die „Sommerzeit“ gab es damals noch nicht.
Also eigentlich alles herrlich primitiv und wunderschön romantisch.
Die Hauptstraße vor dem Haus, die Bredower Allee, war damals noch nicht befestigt. Das geschah erst im Rahmen des Baus des Berliner Autobahn-Rings. Großes Problem in Brieselang: Die Autobahn muss dort über den Havelkanal und über die, selbst schon auf einem hohen Damm den Havelkanal überquerende Hamburger Bahn. Für die Autobahn musste also ein noch höherer, alles überragender Damm aufgeschüttet werden. Deshalb wurde in Brieselang der Nymphensee ausgebaggert und die Zufahrtsstraßen zu dieser gewaltige Baustelle ausgebaut. Davor, in den sechziger und frühen siebziger Jahren fuhr dort dreimal am Tag ein Auto im Schritttempo entlang, heute ist dort fast so ein Verkehr, wie auf einer Berliner Hauptstraße. Ich kann mich noch entsinnen an Federballabende mitten auf der Straße, bei der die einzige Sorge darin bestand, den Feder-Ball nicht in einer die Chaussee flankierenden Kastanien landen zu lassen.
Mit Cousine Petra und Nachbarkind Birgit waren wir gut zu viert und es gab immer wenigstens einen Erwachsenen, der sich um uns kümmern konnte, meine Eltern, Tante Helga, Opa ganz viel, aber auch Onkel Herbert und Tante Renate.
Wir durften im Hühnerhocken Lagerfeuer machen, spielten Gummihopse oder mit Birgit „Mutter, Vater, Kind“, wir gingen mit Opa zum Kanal zum baden, denn der Havel-Kanal war keine hundert Meter entfernt, Onkel Griebert, ein paar Grundstücke weiter, züchtete Ponys, auf denen wir ständig reiten durften, mit meinem Vater und Onkel Herbert zogen wir auch schon mal früh morgens in der Dämmerung mit einigen Ruten zum Angeln an den Kanal und wenn wir es auf einer der beiden der Kinderschaukeln hoch genug schafften, sahen wir gelegentlich auch mal den, auf dem etwa fünfhundert Meter entfernten Bahndamm dahin rasenden „Fliegenden Hamburger“ Dieseltriebwagen oder einfach nur „den Schwarzen“, die Regionalbahn zwischen Nauen und Albrechtshof und deshalb so benannt, weil er noch bis Mitte der 70er mit Dampfloks bespannt war.
Der Samstag war ein mehr oder weniger normaler Schultag mit vier, unter Umständen sogar fünf Stunden Unterricht bei Nullter Stunde (Unterrichtsbeginn dann um 7.10 Uhr, sonst um 8.00 Uhr). Samstags keine Schule ist wohl erst seit der deutschen Einheit so.
Unterrichtsende war Samstags um 11.45 Uhr.
Muttern wartete dann bereits vor dem Schultor, damit ich nicht auf dem Heimweg trödelte. Im Eiltempo ging es nach hause, wo schon mein Vater und mein quengeliger Bruder auf mich lauerten. Dort brauchte ich nicht viel mehr, als meinen Schulranzen ab zu werfen, nebenbei drei Löffel schon halb kalte, weil, es musste ja schnell gehen, Suppe in mich hinein schaufeln und schon standen wir um 12.02 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle.
Mit der 63 bis zum S-Bahnhof, der einige Zeit lang Landsberger Allee und irgendwie auch mal Leninallee hieß. Wir mussten die S-Bahn genau um 12.17 Uhr nach Oranienburg bekommen. Eine S-Bahn später, hieße, in Birkenwerder eine dreiviertel Stunde warten und in Falkenhagen zusätzlich umsteigen. Ich hetzte mit, weil man in Falkenhagen über eine extra Brücke zum anderen Bahnsteig musste und das alles nur wegen einer Station, denn wenn man die S-Bahn um 12.17 Uhr bekam, stieg man zwar gleichfalls in Birkenwerder in den Doppelstock, Taktzeit eine Stunde, um, der fuhr aber nach Falkensee durch, der andere fuhr dagegen nach Potsdam, weshalb man da dann in Falkenhagen nach Finkenkrug umsteigen musste.
In Finkenkrug hieß es dann nochmals den Zug wechseln und zwar in den „Schwarzen“ nach Nauen. Finkenkrug hatte damals noch einen, bereits vor dem Krieg auf S-Bahnniveau angehobenen Mittelbahnsteig. Nach dem „Endsieg“ sollte dereinst die S-Bahn von Spandau aus kommend bis Nauen verlängert werden, Bauvorbereitungsmaßnahmen dafür gab es bereits während des Krieges. Die S-Bahn schaffte es aber ab dem 14.August 1950 von Spandau nur bis Falkensee und nach dem Mauerbau wurde dieser Abschnitt der elektrifizierten S-Bahn eingestellt. Gleichwohl galt bis nach Nauen dennoch der Berliner S-Bahn-Tarif. Die Fahrkarte nach Brieselang kostete ab Landsberger Allee siebzig Pfennige, Preisstufe 4, für Kinder die Hälfte.
Die sonntägliche Rückfahrt nach Berlin war entsprechend. Von uns Kindern wurde im Garten, oft im aufblasbaren Planschbecken, in aller Eile eine dicke Borke Dreck abgekratzt, ich weiß dass dabei dann auch schon mal eine nasse Tapezierbürste zum Einsatz kam, dann hieß es im Laufschritt die gut zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten Weg bis zum Bahnhof zurück zu legen. Die eine Station „im Schwarzen“, lohnte sich hinsetzen nicht, erst ab Finkenkrug, falls man nicht auch auf der Rücktour wieder in Falkenhagen zusätzlich umsteigen musste. Aber von da an hieß es bis Birkenwerder im Oberdeck des Doppelstock sitzen. Mit seinem typischen „klack-klack-klack – bamm-bamm-bamm“ während die Wagen über die Schienenstöße flitzten, zwischen den einzelnen Waggons hatten diese Züge drei Achsen, sind mir diese Fahrten noch in guter Erinnerung.
In Birkenwerder wurde es dann, gerade an den Herbstwochenenden in der S-Bahn oft mehr als kuschelig. Jeder schleppte Spankörbe, Kiepen, Rucksäcke mit frischem Obst und Gemüse. Es roch nach kaltem Rauch, Fisch, weil die Züge der S-Bahn an ihrem Endbahnhof in Oranienburg neben einer Pharmaziebude abgestellt wurden deren Ausdünstungen nach ranzigem Fisch rochen, den Fäkalien der Rieselfelder, altem Männerschweiß, frisch geschlachtetem Kleinvieh, frischen Beeren, Gemüse und vollen Babywindeln. Zwischen Spankörben, Rucksäcken, Kiepen, kleinen und großen Kindern und viel zu vielen Erwachsenen standen einzelne Fahrräder und Kinderwagen. Von Schönfließ bis Blankenburg hatte die S-Bahn kein separates Gleis, sondern sie fuhr mit auf den Fernbahngleisen zwischen D-Zügen aus Rostock und Güterzügen nach Dresden, auf der wichtigsten DDR-Nord-Süd-Bahnachse. Das extra-S-Bahngleis kam erst ab 1982, der Zwischenhalt in Mühlenbeck/Mönchmühle auch. Davor siebzehn Minuten lang kein Halt. Ich liebte meine „lange Strecke“, auf der die alten Züge, meist ein Wagengemisch aus vorn und hinten je einem Viertelzug Bauart Wannseebahn, die beiden Mittelviertel je Bauart Stadtbahn mit ihrem mittigen Frontlicht und den beiden nach oben über das Dach hinweg abstehenden Rücklichtern (die Bauart Wannseebahn hatte dagegen zwei Frontlichter und gleich darunter die Rücklichter), endlich mal zeigen konnten, was noch in ihnen steckte und sie abschnittsweise auch mal „Vollgas“ mit 85 km/h fuhren. Man schaukelte vorbei an Rieselfeldern, Hühnerfarmen, einer Entenzucht, Wäldchen, Feldwegen. In Heinersdorf sah man die Straßenbahn, für mich waren wir somit wieder in Berlin angekommen. Etwas gruselig wurde es dann immer nochmal zwischen Pankow und Schönhauser Allee, wenn man durch das Grenzgebiet fuhr und durch die Zugfenster (noch bis in die achtziger Jahre hinein) in den Westen kieken konnte.
Ab September 1975 hatte dann auch unsere Familie ein Auto, einen Trabant. Davor, so ab 1969 war es, hatte Vaddern schon so ein Moped, einen „Sperber“, mit dem er immer zur Arbeit und auch nach Brieselang vor fuhr. Manchmal nahm er mich darauf auch mit. Etwa auf halber Strecke machten wir vor einem Modell-Bastelladen in Hennigsdorf immer eine Pause.
Ich mochte diese Fahrten als Sozius nicht. Zum einen tat einem nach anderthalb Stunden, so lang brauchten wir etwa nach Brieselang, der Arsch von der harten Sitzbank des Mopeds weh, zum anderen, weil Muttern ja dann nur mit meinem Bruder fuhr und gut zweieinhalb Stunden für die Strecke benötigte, und ich somit eine ganze Stunde lang mit meinem Vater allein war.
So also die Ausgangslage. Eigentlich bin ich gar kein Großstädter.
Das mit Krakow hing wie folgt zusammen.
Ich bin mit einem Zweig wirklich ein Urberliner.
Mein Opa von Vadderns Seite kam in den zwanziger Jahren aus Hamburg nach Berlin als Handwerksgeselle getippelt. Von ihm ist mein Nachname. Und auch die mündliche Überlieferung aus der Familie, immer von Vater zu Sohn weiter gegeben, dass in unsere Familie mal ein großer Fürst gelebt hat, der beim germanischen Stamme der Wandalen eine Rolle spielte.
Ich hielt diese familiäre mündliche Überlieferung immer für Quatsch, bis ich vor einigen Jahren mal im Internet recherchierte. Auch meine Tante, Vadderns Schwester und meine Cousine kannten Opas mysteriöse Geschichte. Nach all dem, was ich durch jahrelange Recherche erfahren habe, kann es als nicht ganz ausgeschlossen gelten, dass einer meiner Vorfahren Wandalenkönig Geiserich war, Geiserich (Genserich, Gaiserich, bedeutet „Speerfürst“; * um 389; † 25. Januar 477 in Karthago) war König der Vandalen von 428 bis 477 und Gründer das vandalischen Königreichs in Afrika. Wenn man bedenkt, dass damit meine Familiengeschichte älter ist, als der Islam, dass das Volk vernichtend geschlagen wurde und es auch noch zwei Lautverschiebungen im germanischen Sprachraum gab, dass Aufzeichnungen nur unvollständig und schlecht geführt, teilweise durch Kriege, Eroberungen und Pestilenz vernichtet wurden, bleibt eigentlich nur noch eine fünfzig/fünfzig-Chance, dass daran etwas Wahres dran ist. Also bin ein Urberliner Wandale? Opa verstarb 1984. Seine Frau, Oma Hedwig, verstorben 1962, kam aus der Altmark, aus Havelberg, dort wo die Havel in die Elbe mündet.
Von dem Zweig mütterlicherseits weiß ich etwas mehr. Die Eltern meiner Uroma, meiner „Tick-Tack-Oma“ lebten schon in Berlin und deren Eltern auch, so dass ich davon ausgehe, dass meine Vorfahren schon vor der Reichsgründung 1871 in Berlin lebten. Frau Beck aus Berlin heiratete nach 1890 einen Herrn Beckmann aus Berlin. Meine Uroma kam als zweites Kind dieser Familie am 18.September 1899 in Berlin als Else Beckmann zur Welt. Ihre Schwester, „Tante Friedchen“ lebte bis zum Mauerbau 1961 an der Ecke Bernauer Straße / Swinemünder Straße, das ist die Ecke, an der dann nach dem 13.August 61 noch die Leute aus den Hausfenstern in die Sprungtücher der Weddinger Feuerwehr sprangen, um noch in „den Westen“ zu flüchten. „Tante Friedchen“ wurde nach dem Mauerbau mit vielen anderen Anwohnern der Bernauer Straße zwangsumgesiedelt. Ich hab kaum noch Erinnerungen an sie, denn sie verstarb Mitte der 70er Jahre.
Tick-Tack-Oma erzählte immer wieder mit Freuden, wie sie als Kind und junges Mädchen noch am Hofe des Deutschen Kaiser’s im Chor gesungen habe. Das muss 1913 gewesen sein.
Am Ende des Ersten Weltkrieges lernte sie einen jungen Mann aus Kiel kennen, mit dem sie, nach der Gründung Groß-Berlins, einen Laden in der Hohenschönhauser Berliner Straße 72 aufmachte. Der besagte Laden, den ich obenhin erwähnte. Es war ein „Bonbonladen“ in dem sie selbst hergestellte Zucker- und Süßwaren verkauften. Ich kenne noch die Erzählungen von den in einer kleinen Werkstatt im Hinterhaus selbst hergestellten Schokoladenweihnachtsmännern und –-osterhasen, bei denen die nicht verkauften Exemplare wieder eingeschmolzen wurden. Gerade für einen Süßwarenladen muss die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Zeit danach, in der es an Rohstoffen für genau diese Waren mangelte, sehr, sehr schwer gewesen sein. Tick-Tack-Omas Mann, mein Uropa, verstarb noch 1953, sie selbst erst 1982. Aus dieser Verbindung gingen zwei Kinder hervor, meine Oma, geboren 1920, gestorben auch 1982, ein Vierteljahr vor ihrer Mutter und mein Großonkel 1929, Gerhard der erste, der zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Textes hier, 16.April 2011 und auch zum Zeitpunkt der Korrektur im April 2019 noch lebt.
Diese Oma lernte ende der 30er Jahre einen gewissen Rolf Kuschnerus kennen. Auch dieser Familienzweig kam aus Berlin und zwar aus der Gegend um die Uhlandstraße in .... was ist das da? Charlottenburg/Wilmersdorf? Auch die lebten da schon lange. Dessen Mutter, die „West-Tick-Tack-Oma“ verstarb, soweit ich weiß, so um 1977 herum.
Gemeinsam mit meiner Oma ging ende 1939 mein Opa Rolf, ein strammer Nazi, der nach einer fehlgeschlagenen Nasennebenhöhlenoperation auf einem Auge blind war, in die von der Wehrmacht eroberten neuen Ostgebiete in die Nähe von Danzig. Sie wohnten in Gossenthin bei Neustadt / Ostpreußen. Dort wurde 1943 meine Mutter geboren. Was mein Opa da genau war, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte immer, er sei dort wohl Bürgermeister oder Polizeichef gewesen. Auf Grund seiner Sehbehinderung diente er nicht in der Wehrmacht. Wenn ich mir die Bilder von ihm, die meine Oma noch hatte, ins Gedächtnis zurück rufe, sehe ich ihn nur in frisch gebügelter SS-Uniform. Als die Sowjetarmee ab Jahresbeginn 1945 in Ostpreußen einrückte, flüchtete meine Oma mit meiner damals zweijährigen Mutter und einer weiteren Tochter, Gisela, einem Neugeborenen. Sie kamen erst in Danzig bei Bekannten unter, flüchteten aber weiter und wurden von polnischen Partisanen für viele Tage gefangen genommen. Während der Zeit wurde meine Oma wohl mehrfach vergewaltigt und das Baby, Mutterns Schwester, verhungerte. Was aus Omas Mann wurde, wusste damals niemand. Ille-Oma (Ilse Kuschnerus) wartete viele Jahre auf ihn. Sie nutzte nach dem Krieg alle möglichen ... und üblichen Fahndungsmittel. Erst 1977 bekam sie Post vom Deutschen Roten Kreuz, dort vom Suchdienst, mit einem Foto vom Grab ihres Mannes in, ich glaube Kopenhagen liegt er. Klar, woher ich meinen Vornamen habe, vom verschollenen Mann meiner Oma.
Erst viele Jahre nach dem Tod meiner Oma, es muss ende der 90er gewesen sein, bekamen wir dann auch mal Kontakt zu einem älteren Herrn, der die letzten Feldpostbriefe, die Opa Rolf noch geschrieben und abgeschickt hatte und die meine Oma auch noch bekam und in ihrem Nachlass verwahrte, in dieser alten deutschen Handschreibschrift verfasst, lesen und uns somit mal vorlesen konnte.
Nach all dem, was ich behalten habe, ist Opa Rolf wohl noch zwei Tage in Gossenthin geblieben und erst, als er die Kanonen der sowjetischen Panzer auf das Dorf zurollen sah, ist wohl auch er in Richtung Danzig geflüchtet. Da aber war der direkte Weg nach Danzig für ihn schon abgeschnitten und er nahm einen großen, mehrtägigen Umweg entlang der sich immer weiter in Richtung Westen zurück ziehenden deutschen Front. Er muss meine Oma in Danzig nur um Stunden verpasst haben. Als eingefleischter Nazi und strammer SS-Mann gelangte er aber dann noch irgendwie auf das an diesem Tag aus Danzig auslaufende KdF-Schiff Gustloff und ist bei der legendären Torpedierung des Schiffes mit der Gustloff wohl abgesoffen.
Ille-Oma landete schließlich Anfang Juni 45 in Berlin bei ihrer Mutter, Tick-Tack-Oma. Erst lebten sie alle gemeinsam in der Ladenwohnung, später dann bekam sie im selben Haus, dritte Etage, Mitte, Gemeinschaftsklo auf halber Treppe, ihre eigene Wohnung mit Zimmer und Küche. Von ihren Fenstern aus konnte man immer herrlich auf das Gehöft, auf dem wir ab 1961 auf der anderen Straßenseite wohnten, hinein blicken. Da mein Vater im Herbst 1962 zu seinem anderthalbjährigen Grundwehrdienst, bis zum Mai 64, zur NVA musste, bürgerte es sich so ein, dass Ille-Oma, sie arbeitete bis zur Rente im Finanzamt des Berliner Magistrats in der Klosterstraße, so lange wir dort wohnten, jeden Abend auf einen kurzen Abstecher bei uns vorbei kam. Erst als wir dann in die Freienwalder Straße zogen wurde daraus ein wöchentlicher Besuch. Ille-Oma kam dann jeden Mittwoch zum Abendbrot.
An dieses Finanzamt in der Klosterstraße, direkt an der Spree, in dem meine Oma arbeitete kann ich mich noch sehr gut entsinnen. Es hatte einen Paternoster, den ich als Kind, wenn wir Oma da besuchten, total spannend, aber auch ein wenig unheimlich fand. Ihr Büro war relativ groß, hatte ein Telefon und ihre beiden Schreibtische- und Stühle standen etwas erhoben auf einem Podest, umzäunt von einem Geländer. In einer Ecke ein weiterer Tisch mit Blumen darauf und zwei weiteren Stühlen. Sie waren, so damals ihre Aussage, die einzigen beiden Personen, die in ganz Ostberlin, Zitat Ille-Oma: „Steuersünder verknackten.“ Das Finanzamt kontrollierte wohl insgesamt gerade die wenigen privaten Firmen sehr stringent. Ihr Arbeitskollege war ein Herr Gerhard Dobrunz, der Gerhard 4. Er und seine Frau Else, „Tante Elschen“, waren durch den Krieg, warum auch immer, kinderlos geblieben. Meine Oma und dieser Herr Dobrunz mochten einander wohl sehr, sie kamen als Arbeitskollegen sehr gut miteinander aus und das Ehe-Paar Dobrunz wurde recht bald Teil unserer Familie und Tante Elschen meine Patentante. Sie spielten an vielen Wochenenden in deren Garten in Karlshorst gemeinsam Skat und unternahmen viel miteinander. So kann ich mich beispielsweise an eine mehrtägige Busreise mit den dreien nach Prag im Jahre 1969 erinnern, oder an die gemeinsamen Maiferien nach Möllensee, Grünheide oder Arendsee. Onkel Gerhard verstarb in den 90er Jahren, danach zog Tante Elschen, noch immer Teil unserer Familie, aus deren gemeinsamer Wohnung in der Schivelbeiner Straße am Prenzlauer Berg aus und in ein Seniorenheim nach Tegel, direkt hinterm Flughafen, um, in dem sie, ich glaube 1998 verstarb.
Mit Krakow hatte es folgende Bewandtnis. Als Tick-Tack-Oma am Ende des Ersten Weltkrieges ihren Mann kennenlernte, kam der wohl gerade aus seiner Heimatstadt Kiel. Es waren dort vier Brüder etwa gleichen Alters, vermutlich auch noch mehr Kinder. Tick-Tack-Omas Mann verschlug es, wie gesagt, nach Berlin, einer der Brüder gelangte nach Krakow am See, wo er eine Bäckerei gründete, ein weiterer Bruder machte sich in Pruchten sesshaft und eröffnete dort gleichfalls eine Bäckerei und ein vierter Bruder, Onkel Karl, ging „zur See“, also zur Handelsmarine, landete aber später gleichfalls in Pruchten. Pruchten liegt am Bodden zwischen Barth und Zingst. Was aus der Bäckereifamilie dort geworden ist, weiß ich nicht. Als wir ab 1976, motorisiert dank Trabi, unseren Sommerurlaub dort machten, existierte die Bäckerei noch, sie war aber nicht mehr im Besitz der Familie. Der Zweig mit dem Seebären Onkel Karl und Tante Lotti vermieteten im Sommer immer ein paar Bungalows dort in Pruchten. Ihre Tochter, Tante Edith, heiratete einen ... Gerhard. Gerhard 3? Gerhard 6? Keine Ahnung. Sie blieben aber, warum auch immer, Kinderlos. Tante Lotti und Onkel Karl sind schon vor vielen Jahren gestorben. Die Zimmer in ihrem Wohnhaus waren so niedrig, dass ich dort immer den Kopf einziehen musste. Es roch dort nach Meer und Tang und Rum und auch nach den Priemstücken (Tabak), die Onkel Karl immer kaute und „in der guten Stube“ hingen viele Bilder von großen, stolzen Segelschiffen im Sturm oder es lagen solche Flaschenschiffe auf Schränken und exotische Muscheln und getrocknete Seesterne herum.
Als ich 1999 einmal zu einem spontanen Zwei-Tages-Ausflug mit meinem vierundzwanzig Jahre alten VW-Polo an die Küste aufbrach, fuhr ich auch durch Pruchten. ... Allerdings ohne bei der Verwandtschaft zu halten. Aber die Bäckerei existierte in Pruchten auch damals noch.
Der Zweig, der in Krakow am See gelandet war, um den geht es in meinen „Sommern zwischen Backhaus und See“.
Onkel Peter war der Patriarch dieses Familienzweigs. Seine Kinder waren der Cousin und die Cousinen meiner Ille-Oma. Onkel Peter war schon damals alt.
Er hatte so einen typischen Kaiser-Wilhelm-Schnauzbart, trug auch im Sommer komische geknöpfte lange Unterhosen und Hosenträger.
Er sprach nur Plattdütsch und nuschelte obendrein, weshalb ich ihn nie wirklich verstand und er mir deshalb auch immer ein wenig unheimlich war.
Die Sommer in Krakow hatte ich von 1968 bis 1975 regelmäßig. Ich war dort immer drei Wochen lang mit Ille-Oma, war dann in manchem Jahr bis zu einer Woche allein dort bei der Familie und dann nochmals zwei oder drei Wochen lang mit meinen Eltern dort. Wobei ich während der Zeit mit Ille-Oma direkt bei der Verwandtschaft wohnte, mit meinen Eltern und meinem Bruder hatten wir immer ein von uns bezahltes Zimmer bei Leuten dort im Ort. Mal war ich erst mit Ille-Oma in Krakow und dann übernahmen meine Eltern, mal war es umgekehrt. Auf jeden Fall war ich jedes Jahr zwischen vier und sechs Wochen lang in Krakow. das hieß, fast meine ganzen Sommerferien hindurch, die in der DDR immer mindestens acht Wochen lang dauerten.
Das erste mal waren Ille-Oma und ich bereits im Sommer 1964 dort, beim zweiten mal fuhren wir vor meiner Einschulung.
Genau am 1.Juni 68 zog unsere Familie von dem Gehöft in der Berliner Straße 55 um in die Freienwalder Straße 1. Den Umzug vollzogen wir mit mehreren Touren per Pferdewagen des Fuhrbetriebs vom Nachbargehöft. Ich durfte dabei mit auf dem Kutschbock sitzen und auch mal für fünf Minuten die Zügel der beiden, da stimmts wirklich, „Gäule“ halten.