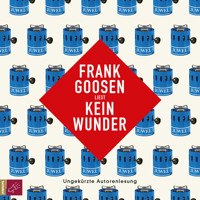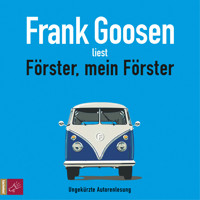9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Woanders weiß er selber, wer er ist, hier wissen es die anderen. Das ist Heimat.« »Storys, ehrlich, wo du hinguckst. Die liegen praktisch auf der Straße, die musst du nur aufheben!« Frank Goosens neuer Roman zelebriert ein Heimatwochenende voller skurriler Figuren – mit Fußball und Musik, mit großen Entscheidungen und viel Gefühl. Onkel Hermann, der seit dem Tod von Stefans Eltern in Bochum die Stellung hielt, ist gestorben, und Stefan muss zurück in die Heimat, um das kleine Bergarbeiterreihenhaus seiner Familie zu verkaufen. Zwei Tage, den Termin mit dem Makler hinter sich bringen, sich mit ein, zwei Leuten treffen, die es verdienen, und schnell wieder zurück nach München, ins wahre Leben. Rein, raus, keine Gefangenen. Das war der Plan. Doch schneller als man es für möglich hält, wird man in der Enge der Heimat zu Erinnerungen und Entscheidungen verurteilt.Just an diesem Wochenende wird die Sperrung der A40 im Ruhrgebiet zum kulturellen Happening, dessen Sog Stefan sich nicht entziehen kann. Und alle sind sie da, alle, mit denen er aufgewachsen ist: Toto, der Ver sager, Diggo, sein brutales Herrchen, Frank, der Statthalter, Karin, die Verwirrmaschine, Omma Luise, die Frau, die alles mitgemacht hat. Und Charlie. Sandkastenfreundin, nicht-leibliche Schwester, Jugendliebe. Keine Frau kennt Stefan so gut – und wegen keiner Frau ist er so viele Jahre einem Ort ferngeblieben ...Ein rasanter Roadtrip durch den »Pott« von heute; ein urkomischer Roman voller Wehmut und Tiefgang. Cool und sentimental, derb-witzig und warmherzig. Frank Goosen ist ein Meister der Zwischentöne und versteht es wie kein anderer, auf unbeschwerte Weise die großen Lebensthemen zu verhandeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Frank Goosen
Sommerfest
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Goosen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Goosen
Frank Goosen hat neben seinen erfolgreichen Romanen, darunter »Liegen lernen«, »Pokorny lacht« und »So viel Zeit«, zahlreiche Kurzgeschichten und Kolumnen in überregionalen Publikationen veröffentlicht. Darüber hinaus verarbeitet er seine Texte zu Kabarettprogrammen; unter anderem entwickelten sich seine Bestseller-Erzählbände »Weil Samstag ist« und »Radio Heimat« auch auf der Bühne zu Soloprogrammen, die deutschlandweit Presse und Publikum begeisterten. Frank Goosen lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Bochum. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.frankgoosen.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Storys, ehrlich, wo du hinguckst. Die liegen praktisch auf der Straße, die musst du nur aufheben!«
Onkel Hermann, der seit dem Tod von Stefans Eltern in Bochum die Stellung hielt, ist gestorben, und Stefan muss zurück in die Heimat, um das kleine Bergarbeiterreihenhaus seiner Familie zu verkaufen. Zwei Tage, den Termin mit dem Makler hinter sich bringen, sich mit ein, zwei Leuten treffen, die es verdienen, und schnell wieder zurück nach München, ins wahre Leben. Rein, raus, keine Gefangenen. Das war der Plan. Doch schneller als man es für möglich hält, wird man in der Enge der Heimat zu Erinnerungen und Entscheidungen verurteilt.
Ausgerechnet an diesem Wochenende wird die Sperrung der A40 im Ruhrgebiet zum kulturellen Happening, dessen Sog Stefan sich nicht entziehen kann. Und alle sind sie da, alle, mit denen er aufgewachsen ist: Toto, der Versager, Diggo, sein brutales Herrchen, Frank, der Statthalter, Karin, die Verwirrmaschine, Omma Luise, die Frau, die alles mitgemacht hat. Und Charlie. Sandkastenfreundin, nicht-leibliche Schwester, Jugendliebe. Keine Frau kennt Stefan so gut – und wegen keiner Frau ist er so viele Jahre einem Ort fern geblieben …
Cool und sentimental, urkomisch und warmherzig. Frank Goosens neuer Roman zelebriert ein Heimatwochenende voller unvergesslich skurriler Figuren - mit Fußball und Musik, mit großen Entscheidungen und viel Gefühl.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Dank & Gruß
Es war jede Menge los.
Und es geschah unentwegt praktisch überhaupt nichts.
Moritz von Uslar, Deutschboden
Für Omma
1
Als er aufwacht, kommt ihm alles sehr klein vor.
Auch in der Nacht hatte er diesen Eindruck schon, aber da hat er nicht so genau hingesehen. Es war dunkel, nur die Dielenlampe warf einen fahlen Kegel hier herein. Stefan zog sich schnell um und fiel ins Bett, einigermaßen angetrunken, weil er sich im Bordbistro die anderthalb Stunden Verspätung hatte schöntrinken müssen, die der Zug auf seiner Strecke von München hierher, nach Hause, zusammengefahren hatte. Außerdem hatte er getrunken, weil er sich kurz vor Aufbruch noch mit Anka gestritten hatte, die nicht verstehen konnte, weshalb er sie an diesem Wochenende nicht dabeihaben wollte, und er ihr zum x-ten Male hatte erklären müssen, dass er lauter Leute von früher treffen und über alte Zeiten reden würde, sodass sie sich elendiglich langweilen würde, was sie nicht glauben wollte, und es war ja auch tatsächlich nur die halbe Wahrheit.
Es schmerzt ihn, dass er Onkel Hermanns Beerdigung verpasst hat, die schon am Donnerstag gewesen ist, aber da hatte Stefan abends noch Vorstellung, sodass er erst am Freitag fahren konnte. Zwar ist die Beerdigung am Donnerstagvormittag gewesen, aber er hat so kurzfristig keinen Flug mehr bekommen, der ihn rechtzeitig zur Vorstellung nach München zurückgebracht hätte, und die Vorstellung ausfallen zu lassen war keine Option. Er hat Kollegen gesehen, die auf der Bühne gestanden haben, obwohl der Vater oder die Mutter am selben Tag überraschend gestorben waren, und wenn er ehrlich ist, hat er Onkel Hermann immer gemocht, ihm aber nie so richtig nahegestanden.
Freitag etwas zeitiger loszufahren war nicht möglich, da Anka ihn darauf festgenagelt hatte, am frühen Abend wenigstens noch einen Happen mit ihr zu essen, wenn sie schon nicht mitkommen dürfe. Das Wochenende hier mit Anka herumzulaufen wäre über seine Kräfte gegangen. Er will nichts erklären, er will niemandem irgendwelche Leute vorstellen, er will nur hier sein und erledigen, was zu erledigen ist.
Es fühlt sich ein bisschen so an, als sei Anka auch schuld daran, dass er die Beerdigung verpasst hat, obwohl das nicht stimmt, aber er hätte eben gern Onkel Hermann diese letzte Ehre erwiesen, zumal alles sicher in einem zünftigen Gelage in jener Kneipe oben am Hauptfriedhof geendet hat, der »Femlinde«, ein Name, über den Stefan sich schon vor dreißig Jahren gewundert hat, als er nach dem Begräbnis seiner Urgroßmutter mit der ganzen Familie dort gewesen ist, und eigentlich hat er immer nachschlagen wollen, was das noch gleich ist, »Feme«, aber man kennt das ja, man nimmt sich so was vor, und wenn man dann endlich in der Nähe eines Lexikons ist oder vor dem Rechner sitzt, wo man es googeln oder bei Wikipedia nachschlagen könnte, hat man es schon wieder vergessen oder verdrängt, genauso wie man immer wieder vergisst oder verdrängt, in was für einem verdammt kleinen Zimmer man aufgewachsen ist.
Er steht nicht gleich auf, sondern nimmt sich ein paar Minuten, um anzukommen. Er will nicht hier sein, aber es geht nun mal nicht anders, und es ist nur ein Wochenende. Er muss sich mit dem Makler treffen, und der erledigt dann den Rest. Vielleicht wird Stefan dann noch mal zum Entrümpeln kommen müssen. Sicher kann man das auch über eine Firma abwickeln lassen, aber das kommt ihm nicht richtig vor, genauso wie es falsch wäre, nur mit dem Makler zu telefonieren oder das per Mail zu regeln, nein, da muss man sich mal überwinden und persönlich hier auftauchen. Vor manchen Dingen kann man sich nicht drücken, das hat er gelernt, das hat ihm sein Vater klargemacht, da muss man einfach durch.
Genauso muss er jetzt durch dieses Wochenende durch. Er kann sich nicht einfach im Haus verkriechen, den Verkauf abwickeln und am Sonntag wieder abhauen. Er wird Leuten über den Weg laufen, das ist unvermeidlich. Mit Frank Tenholt ist er fest verabredet. Also wird er wohl auch dessen Frau über den Weg laufen. Bei dem Gedanken kribbelt es kurz. Dann wären da noch Toto Starek und Diggo Decker. Typen, vor denen seine Mutter ihn immer gewarnt hat, ein zweiköpfiges Sinnbild für schlechte Gesellschaft, Typen zu denen es Stefan immer wieder hingezogen hat. Aber vielleicht sitzt Diggo ja mal wieder im Knast, oder lässt er das jetzt auch von Toto erledigen, seinem ergebenen Diener und Paladin?
Paladin. Ist das überhaupt das richtige Wort in diesem Zusammenhang? Auch das muss er mal googeln, schließlich will man nicht wie ein Idiot dastehen, wenn man so ein Wort völlig falsch benutzt. Vielleicht kann er aber auch einfach Frank Tenholt fragen, wenn er ihn später besucht. Der hat doch Geschichte studiert, der muss so etwas wissen, wahrscheinlich kann der ihm auch beim Thema »Feme« weiterhelfen. Man muss solche Sachen klären, damit sie einem nicht das Gehirn verstopfen. In diesem Zusammenhang wäre vielleicht mal über einen Datentarif für sein schickes Mobiltelefon nachzudenken, das er sich bei der letzten Verlängerung seines Mobilfunkvertrages hat aufschwatzen lassen, mit dem er aber, wie er dem blasierten Bengel im Geschäft klarmachte, nur telefonieren wollte, woraufhin der ihn ansah, als spiele Stefan zu Hause noch Schellackplatten ab. Und es war klar, dass der Jüngling das nicht für einen sympathischen Spleen hielt. Stefan ärgerte sich am meisten darüber, dass ihn das überhaupt beschäftigte und der Blick des Bengels nicht einfach an ihm abprallte. Er hat dann, uneingestanden verunsichert, ziemlich schnell den Laden verlassen und kann deshalb bis heute mit seinem Telefon nicht ins Internet.
Seine Füße stoßen unten an. Das Konzept von Betten mit Fußende hat ihm nie eingeleuchtet. Stefan reibt sich einmal mit den Händen das Gesicht und greift nach seiner Armbanduhr auf dem Nachttisch. Einen Radiowecker mit Leuchtziffern gibt es hier nicht mehr, den hat er mitgenommen, als er auszog. Er fühlt sich etwas matt, aber das wird sich nach der ersten Tasse Kaffee erledigen. Er könnte sich unten einen kochen, doch er ist zum Frühstück mit Omma Luise verabredet, und wenn er jetzt einen Kaffee trinkt und bald darauf noch mal einen oder zwei, noch dazu das starke, fast zähflüssige Zeug, das seine Großmutter seit Jahrzehnten in sich hineinschüttet, dann wird ihm irgendwann die Pumpe galoppieren wie bei einem zünftigen Infarkt, was hier und jetzt gleich zwei Fragen aufwirft: Wie konnte Omma Luise trotz dieses Kaffees sechsundachtzig Jahre alt werden, ohne jemals Herzprobleme zu kriegen, und wann ist er eigentlich so ein Snob geworden? Schwarzen Filterkaffee, der womöglich schon eine ganze Weile auf einer Warmhalteplatte vor sich hin gammelt, empfindet Stefan mittlerweile als reines Gift.
Er nimmt frische Sachen aus dem Koffer, der geöffnet auf dem Boden unter dem Fenster liegt, vor dem alten Rippenheizkörper, den irgendein Bekannter seines Vaters installiert hat, wie das ganze Heizungssystem und wie überhaupt das ganze Haus praktisch in Eigenarbeit gebaut oder jedenfalls umgebaut worden ist, da ja hier jeder einen kennt, der noch zwei kennt, die bestimmte Sachen installieren oder reparieren oder besorgen können, das geht praktisch alles unter der Hand, die Welt besteht aus Handwerkern. Stefan nimmt sich ein schwarzes T-Shirt, legt es aber gleich wieder zurück. Nicht so künstlermäßig rüberkommen, denkt er sich, mit so einem schwarzen T-Shirt mit Rundhalsausschnitt sieht man doch gleich wie ein Künstler aus, und wer weiß, wie das hier ankommt. Wahrscheinlich macht sich andererseits niemand Gedanken darüber, also nimmt er das T-Shirt dann doch, dazu die Jeans und eine frische Unterhose, die nun gar nicht künstlermäßig ist, sondern einfach so ein Slip, und wer soll den heute schon zu sehen bekommen.
Das ist der Moment, in dem er zum ersten Mal an Charlie denkt, jedenfalls heute, aber wegen ihr ist er ja gar nicht hier, sondern wegen des Termins mit dem Makler. Immerhin, keine zehn Minuten hat es gedauert, denkt er, bis ich das erste Mal an sie gedacht habe, aber das geht auch wieder vorbei.
Den Termin mit dem Makler hinter sich bringen, sich mit ein, zwei Leuten treffen, die es verdienen, und dann wieder abhauen – das war der Plan. Schnell rein, schnell raus, keine Gefangenen.
Ganze zwei Mal ist er in den letzten zehn Jahren hier gewesen, und das auch nur wegen Omma Luise. Hat bei einem Kollegen in Essen übernachtet, sich wie ein Teilnehmer an einem Zeugenschutzprogramm in seine Heimatstadt geschlichen, bei Omma Luise Kuchen gegessen und ist wieder verschwunden. Telefoniert aber hat er immer wieder mit ihr. Mindestens einmal die Woche. Hat sich angehört, was ihre Beine und ihr Rücken machen und dass sie jetzt langsam Falten kriege, als würde sie alt. »Erst Mitte achtzig und schon Falten!«, hat Stefan mal gesagt, aber Omma Luise hat nicht gelacht. Einmal ist sie mit dem Zug nach München gekommen und hat eine seiner Vorstellungen besucht. Stefan brachte sie in einem sehr schicken Hotel unter, weil er ihr seine Bruchbude nicht zumuten wollte.
Der Makler konnte erst am späten Nachmittag und meinte, Stefan könne froh sein, am Wochenende überhaupt einen Termin zu bekommen, und der Ton, den der Typ am Telefon anschlug, machte Stefan mal wieder klar, dass er mit solchen Leuten eigentlich nichts zu tun haben wollte. Das hier ist kein Renommierprojekt, nur ein altes Bergarbeiter-Reihenhaus.
Bestimmt eine halbe Stunde hat er am letzten Dienstag mit Omma Luise telefoniert, die anrief, weil Onkel Hermann gestorben war. Eine halbe Stunde, in der ihm klar wurde, wie er sie vermisste. Sein schlechtes Gewissen fraß sich durch ihn hindurch wie ein Parasit. Wieder einer tot, sagte sie, bald bin ich dran. Nein, nein, Omma Luise, du lebst ewig, keiner kriegt dich kaputt, nicht mal der Sensenmann, aber sie lachte nur und sagte, er sei eben zu jung für so was, er habe noch so viel Zeit und müsse sich diese Gedanken nicht machen.
Und dann ist sie ins Erzählen gekommen. Nur ein paar Monate zuvor ist der Erich Grothemann unter die Erde gekommen, der alte Kommunist, der noch mit Omma Luises Vater, Otto Horstkämper, im Männergesangsverein gewesen war, jenem Verein, der sich im Hinterzimmer von Haus Rabe traf, der Kneipe, die Charlies Großvater Willy Abromeit, auch bekannt als Der Masurische Hammer, Anfang der Sechziger von Willi Jebollek übernommen hatte, dem verschwiegenen Wirt mit dem gebrochenen Herzen, und als Stefan all diese Namen gehört und gedacht hat, Horstkämper nämlich und Abromeit und Jebollek und Hermann Ellbringe und Wolfgang Mehls und Rosi Rabe und noch einige mehr, da wehte ihn so was an.
Auch an die Kneipe hat er sich erinnert, als er mit Omma Luise telefonierte. Nicht geringe Teile seiner Kindheit hat er dort verbracht, ist mit Charlie unter den Tischen herumgekrochen, hat später mit ihr hinterm Tresen ausgeholfen, hat den Männern zugehört, wie sie über Gott und die Welt und die Frauen und den Fußball herzogen. Er hat auch gesehen, wie sie sich geprügelt haben, hat gesehen, wie sein Onkel Joachim kräftig ausgeteilt und dabei gelacht hat. Nur wenn Messer ins Spiel kamen, war es nicht mehr lustig.
Und dann erzählte Omma Luise auch noch, dass ausgerechnet an diesem Sonntag die Autobahn gesperrt würde, sechzig Kilometer Tische und Aktionen, weil man ja jetzt Kulturhauptstadt war, und da dachte er dann doch, dass er sich das vielleicht nicht entgehen lassen sollte. Mal abgesehen davon, dass es dann nicht so aussah, als wolle er nur möglichst schnell wieder weg und den Leuten aus dem Weg gehen, weil er sich für was Besseres hielt, und man konnte sich ja einiges zuschulden kommen lassen, aber sich für was Besseres halten, das ging nun gar nicht. Also hängte er den Sonntag noch dran und buchte eine Fahrkarte für einen Zug am Abend.
Im Flur bleibt er kurz stehen und horcht. Nichts. Es ist still. Es war nie still in diesem Haus, denkt er, irgendwo wurde immer gemacht und getan und geklappert und gehämmert und geschraubt, oder es wurde gerülpst, gefurzt, gesungen, gelacht, geweint und geschrien, und wenn die Bewohner mal geschwiegen haben, hat das Haus seine Meinung gesagt und geächzt und geknackt und gestöhnt oder geseufzt, das war nicht immer so gut zu unterscheiden. Jetzt aber ist es still. Es ist so viel vorbei. Sogar das Haus hält die Klappe.
Das Herz des Hauses ist immer die Küche gewesen. Diese Familie hat immer aus Küchenmenschen bestanden, Menschen, die sich am liebsten in der Küche aufhalten, wenn sie ungestört und unbeobachtet sein wollen. Das Wohnzimmer ist zum Fernsehen und für den Besuch. Alle wichtigen Gespräche mit seinen Eltern haben in der Küche stattgefunden: Standpauken, Todesnachrichten und der Vortrag darüber, wo die kleinen Kinder herkommen, vom Storch nämlich, der einem Nachwuchs bringt, wenn man Zucker auf die Fensterbank legt. Na gut, auch die volle Wahrheit über Mamas Scheide und Pappas Penis ist in der Küche enthüllt worden, obwohl sich das alles völlig unglaubwürdig anhörte, aber da musste man durch, als Kind, das es nicht glauben, und als Vater, der es eigentlich nicht erzählen wollte.
Als Stefans Eltern Ende der Neunziger im Abstand von zwei Jahren starben, zog Onkel Hermann hier ein, weil seine Wohnung luxussaniert wurde und Stefan es damals nicht über sich brachte, das Haus zu verkaufen, und eigentlich war diese Lösung nur für den Übergang gedacht. Daraus wurden dann doch zehn Jahre, aber jetzt ist Schicht am Schacht, Ende Gelände beziehungsweise der Fahnenstange, Sense, Aus, Finito. Das Haus wird nicht viel bringen. Vielleicht gerade genug, dass sich Stefan keine Gedanken machen muss, selbst wenn das mit dem Vorsprechen am Montag nicht klappen sollte.
Stefan wollte von Onkel Hermann keine Miete haben, aber das ließ der Onkel – der eigentlich kein richtiger Onkel war, sondern nur ein »Nenn-Onkel« – nicht zu, also zahlte Onkel Hermann ein bisschen was und sorgte dafür, dass das Haus in Schuss blieb. Kleinere Reparaturen erledigte er bis zuletzt selbst, für den Rest hatte er einen Haufen Bekannte. Und wieder bleibt Stefan bei dem Gedanken hängen, dass diese Welt hier aus Handwerkern besteht, eine Welt, in der jeder jeden schon ewig kennt, nein, sogar länger als ewig, ein Leben lang nämlich, und man kann es glauben oder nicht, aber Onkel Hermann ist mit dem Schraubenzieher in der Hand gestorben, einfach umgefallen, auf dem Weg vom Werkzeugkasten in der kleinen Kammer in der Küche, irgendwohin, wo was wackelte. Ein schöner Tod, der beste, den man sich vorstellen kann, kein langes Dahinsiechen, sondern schnell und schmerzlos, in dem Gefühl, noch fix etwas Sinnvolles zu tun, etwas zu arbeiten, nicht so ein beschissener Tod, wie er Stefans Eltern ereilt hat, ein sadistischer, heimtückischer, folternder Tod, eine Drecksau.
Eigentlich ist Onkel Hermann gar nicht so dicke mit Stefans Vater und Großvater gewesen, sondern mehr mit Wolfgang Mehls, praktisch unzertrennlich waren die beiden. Dessen Schwester Paula war nicht nur Charlies Großmutter, sondern auch die beste Freundin von Omma Luise, obwohl sie beide hinter demselben Mann her waren, Willy Abromeit, dem Masurischen Hammer, bisweilen Preisboxer auf der Kirmes, ansonsten aber, obwohl einsneunzig, im Pütt, bevor er dann Wirt wurde. Bessere Schangsen bei Willy Abromeit hat Omma Luise gehabt, aber die war schon verlobt mit Fritz Borchardt, später Stefans Großvater mütterlicherseits. Und dann wurde Omma Luise ’44 von Oppa Fritz schwanger und im Januar ’45 wurde geheiratet, und zwar im Sauerland, wo man bei Verwandten Unterschlupf gefunden hatte, nachdem man dann doch mal komplett ausgebombt worden war. Nach der Heirat ging natürlich nichts mehr zwischen Omma Luise und Willy Abromeit, denn Oppa Fritz verschwand zwar für einige Zeit in amerikanischer Gefangenschaft, tauchte aber ’48 wieder auf, und das war nicht die Zeit, in der man als Frau sagte, ich will einen anderen, also hangelte man sich durch siebenundvierzig Jahre Ehe und fuhr zwischendurch in die Berge oder an die See, aber nicht zu weit weg, weil man zu weit weg dem Essen nicht trauen konnte.
So hängt alles irgendwie zusammen, denkt Stefan, man könnte glatt zum Buddhisten werden. Viel zu lange steht er jetzt schon im Flur und horcht. Denkt sich auch das Haus und lässt es irgendwo knacken, also betritt Stefan das seit zirka 1973 gelb gekachelte Bad und klemmt seinen Kulturbeutel hinter den Wasserhahn. Eine Dusche gibt es hier immer noch nicht. Ebenso wenig ein Fenster. Wie man das früher hat bauen können, wird ihm immer ein Rätsel bleiben, Badezimmer ohne Fenster, nur mit einem Gitter in der Wand über dem Klo, knapp unter der Decke, ein Gitter, in dem sich dicke Staubflocken sammeln. Über dem Waschbecken ein Spiegelschrank von Alibert, neben dem Wasserhahn eine Seifenschale mit einem Stück Industrieseife, die Onkel Hermann vor Jahren zentnerweise im Keller eingelagert hat. Immerhin gönnte er sich irgendwann normales Klopapier, wenn auch nur zweilagig, aber wenigstens nicht mehr dieses graue harte Zeug, mit dem man sich früher immer den Arsch aufgerissen hat.
Stefan steigt in die Wanne und geht in die Hocke. Er nimmt die Handbrause, dreht das warme Wasser auf, mischt es mit kaltem und duscht sich, so gut es geht, ohne das ganze Bad unter Wasser zu setzen. Er benutzt die Seife für den Körper und das ockerfarbene Schampong für die Haare. Ja, er denkt Schampong. Wie Pafföng und Grateng und Restorang.
Als er zurück in sein Zimmer kommt, vibriert sein Handy. Er kann sich denken, wer das ist, und zieht sich erst mal in aller Ruhe an. Dann sucht er seine Uhr. Ohne Uhr ist er aufgeschmissen. Er hat kein Zeitgefühl. Hell und dunkel, Tag und Nacht, das kann er auseinanderhalten, aber damit hat es sich auch schon. Er ist kein Pfadfinder, der am Stand der Sonne die Zeit auf fünf Sekunden genau eingrenzen kann, und weiß auch nicht, auf welcher Seite des Baumes das Moos wächst und wie einem das helfen kann, wenn man sich verlaufen hat. Überhaupt pflegt er ein eher angespanntes Verhältnis zur Natur. Diese ständige An-die-Isar-Rennerei, diese bescheuerten Fahrten in die Alpen wie der letzte Familiendepp, da kann man sich ja gleich irgendein Zeug mit Hirschhornknöpfen zulegen oder einen Hut mit einem Rasierpinsel dran. Außerdem heißt Natur ja immer auch Insekten und Gliedertiere, wie etwa Spinnen, die absolut verzichtbarsten Tiere auf der ganzen Welt. Na gut, die fressen Fliegen, aber mit Fliegen hat Stefan kein Problem. Lieber sechs Fliegen, die um eine Lampe kreisen, als eine Spinne, die hinterhältig in der Ecke hockt. Er hasst diese Biester und damit fertig, ja er hat sogar, wenn er ehrlich ist, Angst vor ihnen, und dagegen helfen auch so rationale Argumente nichts, wie, Spinnen seien nicht nur sehr nützlich, sondern auch extrem harmlos, jedenfalls diejenigen, die in unseren Breiten vorkommen, denn mit Vernunft hat das natürlich nichts zu tun. Es ist schon peinlich, wenn einem Kolleginnen und Kollegen, die ansonsten gern die irrationale Emotionskarte spielen, wenn es um schwierige Rollen geht, beim Thema Spinnen plötzlich mit Vernunft kommen.
Das Telefon vibriert schon wieder, aber jetzt muss er erst mal los und Brötchen besorgen und dann zu Omma Luise, und dann ruft er vielleicht mal in München an. Klar, sagt er sich, man soll so was nicht aufschieben, aber man soll auch gesünder leben und immer ehrlich sein und sich nicht so oft aufregen, aber das haut ja auch alles nicht hin, also geht er runter und tritt auf die Straße.
2
Oben steht Trinkhalle dran, aber das nennt eigentlich niemand so, auch Kiosk sagt keiner, das heißt nur Bude, manchmal noch Selterbude, aber das verliert sich auch allmählich. Schon von Weitem sieht Stefan die Langnese-Werbefahne.
Die Trinkhalle, der Kiosk, die Bude von Tante Änne ist nicht einfach ein Verkaufsschalter, sondern ein Exemplar, in das man sogar hineingehen kann. Tante Änne ist nicht Stefans richtige Tante, sondern mit dem Vornamen »Tante« schon auf die Welt gekommen. Wurde jedenfalls nie anders genannt. Und hatte schon immer diese Bude, wahrscheinlich von Geburt an. Genauso wie ihre alten Hände, die immer etwas schmutzig aussahen, auch wenn sie frisch gewaschen waren, wahrscheinlich weil sie so intensiv benutzt wurden.
Im weißen Haushaltskittel hat sie hinterm Verkaufsschalter gestanden und ist nie richtig freundlich gewesen, weshalb man sie auch gerne mal ärgerte. Da warf man mal eine Stinkbombe zu ihr hinein oder einen Chinakracher, und sie kam rausgeschossen auf ihren kurzen Beinen unter dem dicken Oberkörper und drohte einem mit der Faust und schimpfte über die scheiß Blagen, dass einem ganz komisch wurde.
Und ganz komisch wird es Stefan auch jetzt, wo er daran denkt. So geht es einem ja öfter mal mit dem Erinnern. Denn wenn man dann über das Erinnern noch mal ein bisschen nachdenkt, fällt einem auf, dass Tante Änne immer eine ziemlich arme Frau gewesen ist, mit einem Mann, den man niemals Onkel genannt hätte, ja, von dem man nicht mal den Vornamen kannte und der sich, wie so viele hier, langsam, aber sicher ins Grab gesoffen hat, als bester Freund vom prügelnden Decker, was ja auch schon einiges über ihn erzählt. Man hat nie verstanden, wieso Tante Änne trotzdem zusammengebrochen ist, als ihr irgendwie namenloser Mann endlich unter die Erde kam.
Stefan steigt die zwei Stufen hoch, öffnet die Tür und tritt ein. Ein elektrischer Gong ertönt, und ein Mann erhebt sich. Der hat aber nicht hinterm Tresen gesessen, sondern davor, auf einem weißen Holzstuhl. Links ist eine Glaswand, dahinter mehrere Reihen Schubfächer mit Bonbons drin. Beziehungsweise Klümpchen. Wieder so ein Wort, das schon in Köln keiner mehr versteht. Dann die Verkaufsöffnung und die Fortsetzung der Glaswand mit vergilbenden Zeitschriftencovern dahinter. Rechts an der Wand ein gut bestücktes Zeitschriftenregal: Illustrierte, Rätselhefte, Sportzeitschriften, Nachrichtenmagazine, Comics für Kinder, Popstarzentralorgane für Jungen und Mädchen.
»Ja, leck mich am Arsch«, ruft der Mann aus, als er Stefan sieht, »der verlorene Sohn ist wieder da!«
»Hallo, Thorsten«, sagt Stefan ohne viel Begeisterung. Noch vor dem Frühstück Thorsten Starek, genannt Toto, dem Enkel, nein Urenkel von Tante Änne über den Weg zu laufen ist schon ein verdammtes Pech. Toto Starek steht auf und hält ihm die Hand hin. Da ist er wieder, denkt Stefan, der feuchtwarme, immer etwas schlaffe Händedruck, für den die Familie Starek berüchtigt ist.
»Wurde auch Zeit, dass du hier aufschlägst! Hab mich schon gewundert, dass du nicht bei der Beerdigung vom Hermann warst.«
»Ging nicht.«
»War auch gesünder. Ich hatte am nächsten Tag Kopp wie’n Rathaus. Ich weiß auch nicht, aber auf Beerdigungen wird immer gesoffen wie Sau.«
»Vielleicht weil es für lau ist?«
Toto guckt, als wäre das ein sehr interessanter Gedanke. »Ist ja auch egal«, sagt er dann. »Hauptsache besoffen! Wie lange warst du jetzt weg?«
»Zehn Jahre, ungefähr.«
»Guck mal, Omma, der Stefan!«
Hinter dem Verkaufstresen sitzt tatsächlich Änne Starek, Tante Änne, in einem weißen Haushaltskittel, aus dem fleischige weiße Oberarme herauswachsen. Ihre Wangen sind rot vor kleinen, geplatzten Äderchen, ihre Haare weiß und hinten zu einem Dutt zusammengeknotet. Dutt, denkt Stefan, noch so ein Wort, das ich ewig nicht gedacht habe.
»Der kleine Zöllner!«, sagt Tante Änne, und ihre Stimme ist noch ein bisschen rauer, als sie früher ohnehin schon gewesen ist. Das hört sich nach Alkohol und Nikotin an, aber Tante Änne hat nie geraucht, ihre Stimme ist einfach durch fast ein Jahrhundert Benutzung so geworden.
»Guten Tag, Frau Starek«, hört er sich sagen, und die alte Frau holt sich seine Hand über den Tresen und sagt: »Getz hör dich den an! Als das letzte Mal einer Frau Starek für mich gesagt hat, war der Adenauer noch Bundeskanzler gewesen. Außer auf dem Amt!«
»Zu mir hat er Thorsten gesagt!«
»Wie lange ist das jetzt her, dass du weg bist?«, fragt Tante Änne, und Stefan blickt an ihr vorbei auf die große, alte Langnese-Eistruhe, aus der sie früher aufstöhnend Domino oder Happen oder Nogger hervorholte. Daneben steht ein Regal, in dem sich Sekt-, Wein- und Schnapsflaschen drängeln, auch Plätzchen-, Chips- und Kaffeetüten sowie ein eigentlich gar nicht hierher passender Kaffeeautomat, der auf Knopfdruck offenbar Cappuccino und Latte liefert. Also ist die Neue Deutsche Kaffeekultur auch bei Tante Änne in der Bude angekommen.
»Etwas mehr als zehn Jahre«, sagt Stefan noch einmal.
»Kommt mir viel länger vor. Wo bist du denn hin?«
»Mittlerweile wohne ich in München.« Wer als Erster Weißwurstäquator sagt, verliert, denkt Stefan.
»Übern Weißwurstäquator?«, grunzt Tante Änne. »Die können uns Preußen doch nicht verknusen!«
»Das geht schon.«
»Und was machst du da?«
»Mensch, Omma«, schaltet sich Toto wieder ein, »der Stefan ist doch Schauspieler geworden.«
»Was isser?«, ruft Änne Starek und dreht ihr Ohr in Richtung ihres Urenkels. »Schausteller? Was ist das denn für’n Blödsinn? Bist du mit ’ner Geisterbahn unterwegs, oder was?«
»Schauspieler, Omma!«, schreit Toto. »Wie der Heinz Rühmann!«
»Ach was!«, ruft Änne Starek. »Muss man dich kennen?«
»Nee«, sagt Stefan.
»Theater, Omma. Der Stefan ist am Theater!«
»Der Hannes Messmer war mal hier am Schauspielhaus. Da hatte ich ’ne Wahlmiete!«
»Ja, so was macht der!«
»Du bist doch immer mehr so ein Ruhigen gewesen«, sagt Tante Änne.
Stefan fragt sich, wie er an seine Brötchen kommen soll. Da hinten liegen sie, goldgelb, in einem geflochtenen Korb. Drei Stück sind noch da. Mehr braucht er nicht.
»Wo guckst du hin, Junge?«, fragt Tante Änne, die noch alles mitkriegt, das ist mal klar.
»Ich habe nur die Kaffeemaschine da hinten bewundert.«
»Das ist ein Dingen, was?« Tante Änne ist ganz stolz. »Muss man haben, heute. Man muss mit der Zeit gehen. Da drückst du einfach drauf, und dann kommt Kaffee raus!«
»Du musst natürlich einen Becher drunterstellen!«, schreit Toto und lacht sich kaputt über seinen eigenen Witz.
»Der hält mich für bekloppt!«, sagt Tante Änne ernst. »Was brauchst du noch Feinde, wenn du solche Verwandte hast! Willst du einen? Geht aufs Haus!«
»Nee danke«, erwidert Stefan. »Ich bin jetzt auf dem Weg zu Omma Luise, da wartet schon einer auf mich.«
»Wer nicht will, der hat schon!«
So ein Heimaturlaub ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sein Reservoire an Floskeln aufzufrischen, denkt Stefan.
»Aber heute gehst du nicht mehr ins Theater, was, Omma?«, reißt Toto das Gespräch wieder an sich. »Hier an der Bude hast du Theater genug, was, Omma?«
»Das kannst du laut sagen! Hier ist immer was los. Nix wie Theater hast du hier den ganzen Tag!«
»Erzähl doch mal«, ruft Toto, »von der Sache neulich!«
»Ach, das war doch nix!«
»Das stand doch sogar in der Zeitung!«
»In der Zeitung steht viel.«
»Ey, du glaubst es nicht! Voll die Story!«, plärrt Toto, und es ist klar, dass er die Geschichte erzählen wird, denn genauso hat er es von Anfang an geplant.
»Da sitzt die Omma hier einen Abend ganz gemütlich in der Bude«, beginnt er und macht dabei ganz komische Bewegungen, als wäre er Travis Bickle, der mit seinem Spiegelbild spricht, bevor er loszieht, um Leute umzulegen. »Und plötzlich kommt so ein Typ rein, Kapuzenpulli und so, und Omma denkt schon, was ist das denn für einer. Oder, Omma, der ist dir doch von Anfang an komisch vorgekommen, oder?«
»Die kommen mir doch heute alle komisch vor.«
»Der guckt sich jedenfalls die Klümpchen in den Schubfächern an«, macht Toto weiter.
»DAS kam mir komisch vor«, unterbricht ihn Tante Änne. »Der war doch für Klümpchen viel zu alt!«
»Jedenfalls«, macht Toto weiter, »was macht der Typ? Hä? Was meinst du macht der?«
»Erzähl es mir Toto!«
»Er holt ’ne Knarre aus der Jacke!«
»Kein Scheiß?«, entfährt es Stefan. Die Geschichte ist vielleicht interessanter als der Erzähler.
»Echt kein Scheiß jetzt! Der hält Omma also die Knarre unter die Nase und sagt, sie soll das ganze Geld rausrücken.«
»Das ganze Geld!«, empört sich Tante Änne. »Was haben die jungen Leute denn für Vorstellungen, was man mit so einer Bude verdient!«
»Und was sagt Omma?«, stößt Toto kurzatmig hervor. »Ey, was glaubst du, sagt Omma zu dem Typen mit der Knarre?«
»Keine Ahnung«, sagt Stefan, gegen seinen Willen sehr gespannt.
»Omma Änne sagt: Was willst du denn, du Idiot? Verpiss dich!«
»Echt wahr?«
»Echt wahr, kein Scheiß! Da hält der ihr ’ne Knarre ins Gesicht, und Omma Änne sagt, er soll sich verpissen!« Toto muss sich vor Lachen am Verkaufsschalter festhalten.
»Das war doch nur so’n Jüngelchen«, hält Tante Änne den Ball flach.
»Aber die Nerven muss man erst mal haben!«, keucht Toto. »Verpiss dich, du Idiot! Ey, ich dachte, ich brech ab!«
»Und was hat der Typ gemacht?«, will Stefan dann doch noch wissen.
»Der ist abgehauen, der Arsch!«, kreischt Toto. »Der hatte die Hosen gestrichen voll, dem ist die Angstpisse an den Beinen runtergelaufen! Verpiss dich, ich packe es nicht, ehrlich! Omma Änne ist echt ’ne Marke. Ich hab dann gleich die WAZ angerufen und bei den Ruhrnachrichten auch noch. Und beim Stadtspiegel. Echt, so Storys erlebst du nur hier! Die liegen praktisch auf der Straße!«
Ob die Geschichte stimmt oder nicht, denkt Stefan, ist letztlich egal. Man traut sie Tante Änne zu, das ist der springende Punkt. Wenn ich so alt bin, traut mir das keiner zu. Falls ich überhaupt so alt werde. Wenn ich nicht bald Frühstück bekomme, stehen die Chancen schlecht.
»Du bist doch nicht gekommen, um dir Geschichten anzuhören«, sagt Tante Änne jetzt. »Was kann ich für dich tun, Junge?«
»Drei Brötchen hätte ich gerne.«
Tante Änne nickt, rutscht von ihrem Hocker und schlurft zu den Brötchen hinüber.
»Hör mal«, sagt Toto und wischt sich die letzten Lachtränen aus den Augenwinkeln, »da fällt mir ein, ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich muss nachher noch einen Schrank in Dortmund abholen. Der Diggo wollte mir helfen, aber der liegt flach, weil er sich gestern Abend mal wieder abgeschossen hat.«
Das ist nun das Letzte, was Stefan will, mit Toto Starek nach Dortmund und einen Schrank durch die Gegend fahren! »Ich bin auf dem Weg zu Omma Luise«, sagt er, »und danach bin ich bei Frank Tenholt. Und dann ist da noch das Sommerfest von der Spielvereinigung.«
Stefan hört die Kaffeemaschine mahlen, festklopfen und schlürfen.
»Ey, kein Problem«, sagt Toto, und Stefan denkt schon, er hat die Sache abgebogen, als Toto fortfährt: »Ich hol dich beim Tenholt ab, und dann ziehen wir das einwandfrei durch. Dauert nicht länger als ’ne halbe Stunde, da hast du noch massig Zeit. Aber mal ’ne ganz andere Frage. Du bist doch bestimmt wegen Charlie hier, oder? Ich meine, die Beerdigung hast du doch verpasst. Hast du dich schon bei der gemeldet?«
Jetzt kommt der auch noch damit an, denkt Stefan.
»Hier, Jungchen, deine Brötchen«, sagt Tante Änne und legt eine weiße Tüte auf den Tresen. »Fünfundsiebzig Pfennig. Ich sag immer noch Pfennig, wie damals, als wir noch richtiges Geld hatten.« Außerdem stellt sie einen kleinen Pappbecher daneben, aus dem es dampft. »Und so ein kleiner Expresso für auf den Weg, der geht immer!«
Stefan legt ihr die fünfundsiebzig Cent passend auf die BILD-Zeitung auf dem Tresen und bedankt sich. Er nimmt den Espresso und will nach Zucker fragen, lässt es dann aber.
»Ich werde Charlie schon noch anrufen«, sagt er.
Toto nickt. »Mach das! Das ist gut!«
Stefan nippt von dem Espresso.
»Und wegen dem Schrank«, sagt Toto, »da lass dir mal keine grauen Haare wachsen. Das ist ’ne Stunde, und dann ist gut. Ist auch nicht schwer, nur unhandlich, deshalb kann ich das nicht alleine machen.«
Stefan stellt den leeren Becher ab und fühlt sich verhaftet. Er bedankt sich noch einmal bei Tante Änne, die ihm eine kleine, rosa und weiß gestreifte Tüte in die Hand drückt und sagt: »Aber sag der Mutter nix!«
»Also«, sagt Toto zum Abschied und sieht auf die Uhr, »ich hol dich so um eins beim Tenholt ab.«
Auf der Straße sieht Stefan sich an, was in der Tüte ist. Salmiakpastillen. Hat er noch nie ausstehen können.
3
Er geht zu Fuß in die Stadt, dorthin, wo Omma Luises Heim ist, obwohl sie es nicht gern hat, wenn man es Heim nennt. Eine Seniorenresidenz sei das, hat sie ihm erst kürzlich am Telefon eingebläut, und wenn man es recht bedenkt, ist Omma Luise auch tatsächlich keine Frau, die in einem Heim lebt, dafür ist sie viel zu jung, obwohl sie auf die neunzig zugeht. Hundert soll sie werden, wünscht Stefan ihr, mindestens, und dann soll sie in irgendeiner Boutique mit der Bluse in der Hand umfallen. Omma Luise hat immer gern Klamotten gekauft, hat nicht, wie viele alte Leute, das Geld zusammengehalten, sondern, wie sie selbst sagt, »immer gut gelebt, ich kann nix dafür«, und Stefan muss ihr immer klarmachen, dass sie sich dafür nicht entschuldigen muss, sie kann mit ihrem Geld machen, was sie will, es auch mit vollen Händen in den nächsten Gulli schmeißen, wenn es ihr Spaß macht. Omma Luise hat viel Schönes, aber auch viel Mist erlebt während ihrer Zeit auf diesem Planeten, sie hat einen Weltkrieg überlebt, fast fünfzig Jahre Ehe mit einem zunehmend schweigsamen, schwierigen Mann, der nicht die Liebe ihres Lebens war, und sie hat ihre Tochter überlebt, was das Schlimmste sein muss, das man sich vorstellen kann. Damals, vor dreizehn Jahren, nach dem Tod von Stefans Mutter, ist Omma Luise losgezogen und hat Geld ausgegeben, Blusen gekauft, teure Jacken, Kleider, die sie niemals anzog, aber scheiß drauf, hat Stefan gesagt, wenn es dir hilft.
Das Handy in seiner Hosentasche vibriert. Stefan wirft einen Blick aufs Display. Anka.
Er will eigentlich nicht rangehen, aber sie wird es immer wieder versuchen, also bringt er es am besten gleich hinter sich. Er drückt auf das grüne Hörer-Symbol und bleibt stehen. Er kann nicht im Gehen telefonieren. Zu Hause schon, da geht er gern auf und ab, setzt sich hin, steht wieder auf und ist immer noch dankbar für die Erfindung des schnurlosen Telefons, auch wenn er sich manchmal fragt, ob das mit den Funkwellen wirklich nicht schädlich ist für das Gehirn, die Nerven oder die Potenz, aber er übertreibt es eben manchmal mit dem Nachdenken. Auf der Straße kann er nicht im Gehen telefonieren, weil man sich auf der Straße einfach anders bewegt, mehr so zielgerichtet, auch schneller, und da fängt man dann irgendwann an zu keuchen, und das ist dann doch zu peinlich, weil der Gesprächspartner denken muss, man keuche wegen ihm, beziehungsweise ihr, und gerade Anka will er nicht ankeuchen, nicht mehr.
»Da bist du ja!«, sagt sie.
»Ja, wer sonst? Das hier ist mein Telefon.«
»Was weiß ich, wer da alles drangehen kann.«
»Niemand außer mir, Anka.«
»Du meldest dich gar nicht.«
»Gestern habe ich die ganze Zeit im Zug gesessen, dann habe ich geschlafen. Da war ja nun kaum Zeit.«
»Unser Abschied war so merkwürdig gestern.«
»Findest du?«
»Du warst so distanziert.«
»Nee, nee.«
»Ich wäre sehr gern mitgefahren.«
»Darüber haben wir doch geredet.«
Erst jetzt fällt ihm auf, dass Anka, den Hintergrundgeräuschen nach zu urteilen, nicht zu Hause, sondern irgendwo unterwegs ist. Erinnerungen an schlechte Filme steigen in ihm auf. Die durchgeknallte Fast-Exfreundin reist ihrem Typen hinterher und platzt in einen romantischen Moment mit der Frau, die ihn wirklich verdient.
»Wo bist du eigentlich?«, fragt er vorsichtshalber.
»Einkaufen.«
Die Antwort kam prompt, wie vorbereitet.
»Du hast mir gar nicht gesagt, wann du genau zurückkommst.«
»Weiß noch nicht.« Stimmt nicht, er hat eine Fahrkarte mit Zugbindung gebucht. Sparpreis.
»Aber du hast doch Montag früh dieses Vorsprechen.«
»Ich weiß.«
»Dann musst du doch morgen zurückkommen, sonst schaffst du das doch gar nicht!«
»Ich weiß.«
»Das kannst du dir nicht entgehen lassen, jetzt wo sie dir deinen Vertrag nicht verlängert haben.«
»Es ist ein Vorsprechen für eine Vorabendserie. Weiß der Geier, ob ich da mit einem Affen spielen muss oder einem Köter oder einem Elefanten oder einem Lama oder was weiß ich, jedenfalls ist es was mit Tieren.«
»Aber du musst doch arbeiten, Stefan! Wovon willst du denn leben?«
Da sagt er jetzt mal nichts zu.
»Oh Gott, ich komme mir so blöd vor«, sagt Anka. »Ich höre mich so verkrampft und spießig an. Ich mach mir einfach Sorgen. Ich weiß auch nicht.«
Was soll er darauf erwidern? Sie macht sich Sorgen um ihn. Das ist gut und richtig in einer Beziehung.
»Du musst dir keine Sorgen machen«, sagt er. »Ich verkaufe das Haus meiner Eltern, und mit dem Geld kann ich mich eine Zeit lang über Wasser halten. Und vielleicht haut das ja auch hin mit dem Vorsprechen.«
»Du hast recht. Tut mir leid.«
»Außerdem kann ich mich auch an anderen Theatern bewerben. Es ist ja nicht so, als hätte ich nichts vorzuweisen …«
In dem Moment, als er es ausspricht, wird ihm erst mal so richtig klar, dass ein neues Festengagement für ihn eigentlich nicht infrage kommt. Diese ewige Stadttheater-Tretmühle hat er satt. Aber ist eine Fernsehserie nicht auch eine Tretmühle, fragt er sich. Und gibt sich gleich die Antwort: Ja, aber eine neue, eine andere. Und eine, in der besser bezahlt wird.
Eine Zeit lang schweigen sie sich an. Stefan würde gern etwas Nettes zu Anka sagen, aber alles, was ihm durch den Kopf geht, kommt ihm falsch und aufgesetzt vor. Er fragt sich, ob das nur eine der Krisen ist, durch die Paare nun einmal gehen und von denen Anka und er auch schon ein paar mitgemacht haben, oder ob hier was in eine völlig falsche Richtung geht, und zwar endgültig. Er schließt kurz die Augen und schüttelt den Kopf. Das ist doch nicht mehr altersgemäß, diese ganze Beziehungskiste. Eigentlich müsste er Eheprobleme haben, irgendwas, das mit Kindererziehung, Schwiegermüttern, Hypotheken und Pflegschaftssitzungen zu tun hat, stattdessen fühlt er sich, als kaue er auf einem sehr alten Kaugummi herum, die Wangenmuskeln fangen schon an zu schmerzen.
Im Hintergrund hört er jetzt jemanden auf Bayrisch fluchen, irgendwas mit Depp und damisch, also ist Anka nicht auf dem Weg zu ihm. Das hat er auch nicht wirklich geglaubt, denn durchgeknallt ist sie nun wirklich nicht, nur manchmal etwas nervig, aber wahrscheinlich nicht nerviger als Stefan selbst, und er fragt sich, wieso er immer noch nicht weiß, wie man in einer Beziehung an so einen Punkt kommt, einen, den er nicht mal richtig beschreiben kann, einen, an dem man sich wünscht, dass der andere wenigstens ein Arschloch wäre, das würde nämlich vieles leichter machen. Ach ja, denkt Stefan, die Welt ist zu gut, jedenfalls zu mir, warum nur bin ich kein Opfer, das man ehrlich bedauert.
Anka sagt immer noch nichts.
Stefan auch nicht. Er muss los. Omma Luise wartet.
»Hör zu, Anka, ich muss den Bus kriegen.«
Wieder etwas, das er nicht sagen wollte.
»Aha, du musst den Bus kriegen, das ist natürlich wichtig, ich verstehe.«
Es hört sich an, als würde sie nur mit Mühe Tränen unterdrücken, und er fragt sich, ob sie da nicht ein bisschen zu viel auf die Tube drückt, aber gleich darauf denkt er, dass er ihr ja nicht gleich das Schlechteste unterstellen muss, nämlich, dass sie das alles nur spielt oder übertreibt oder was weiß ich denn, denkt Stefan. Wo sind die Zeiten hin, da man Frauen einfach schlecht behandeln konnte, ohne sich mies zu fühlen?
»Ich bin mit jemandem verabredet«, sagt er, bevor ihm klar wird, dass so was ein Sprengsatz in Ankas Ohren sein muss.
»Mit einem Mann oder einer Frau?«, fragt sie dann auch.
»Mit einer Frau«, sagt Stefan und lässt das wirken. Er muss ja nicht mal lügen dafür.
»Kenne ich sie? Diese eine?«
Natürlich hat er ihr mal von Charlie erzählt, so wie man in jeder Beziehung Zeugnis ablegt von seiner Vergangenheit. Auch Anka packte daraufhin aus, von einer Abtreibung und einem, der sich nicht zuletzt ihretwegen umgebracht hat, und Stefan kam sich wieder so langweilig und normal vor, wie so oft, wenn er den anderen Schauspielerinnen und Schauspielern zuhörte. Ich bin so uninteressant, denkt er, und deshalb kriege ich auch meinen Vertrag nicht verlängert.
»Ich treffe mich mit meiner Omma.«
»Ich verstehe«, sagt Anka.
»Gut«, sagt Stefan.
Dann schweigen sie sich wieder an, und das geht Stefan dann doch gehörig auf den Senkel. Wenn man sich so anschweigt, denkt er, dann ist der Wurm drin, dann hat man sich tatsächlich nichts mehr zu sagen, und da sollte man dann auch die Konsequenzen ziehen, besser gesagt den Schlussstrich.
»Ich werde nicht mehr da sein, wenn du zurückkommst«, sagt Anka.
Oho, denkt er, das ist aber mal ein Paukenschlag! Am liebsten würde er erwidern, sie solle seinen Wohnungsschlüssel einfach in den Briefkasten werfen, aber das ist ihm jetzt zu platt.
»Stefan …«, sagt sie dann noch und beweist damit, dass sie die Wenige-Worte-Strategie auch ganz gut draufhat, denn in diesem einen Wort, seinem Namen, stecken dann wieder viele Tränen, echte Tränen aber diesmal, das merkt er irgendwie, also sagt er, sie würden über alles reden, wenn er erst mal zurück sei, und als sie daraufhin Danke sagt, ärgert er sich schon wieder. Man kann mit niemandem zusammen sein, der sich bedankt, nur weil man ankündigt, mit ihm reden zu wollen, vor allem wenn beide davon ausgehen können, dass es kein schönes, sondern ein überaus anstrengendes, deprimierendes Gespräch sein wird. Mit Leuten, die sich noch entschuldigen, wenn man ihnen ins Gesicht schlägt, kann man sich nicht ordentlich prügeln, das steht mal fest.
Jetzt hat er doch eine ganze Zeit lang hier auf einem Fleck gestanden und einiges an Zeit verloren. Ein Bus fährt an ihm vorbei. Fünfzig Meter weiter ist die Haltestelle, aber den Bus kann er nur kriegen, wenn er jetzt losrennt, und hinter einem Bus oder einer Bahn herzurennen ist ungefähr so peinlich wie ins Telefon zu keuchen. Wenn es in deinem Leben darauf ankommt, genau diesen Bus, genau diese Bahn zu erwischen, dann hast du ein Problem, denkt Stefan.
Ein paar Sekunden starrt er auf das Telefon, dann ruft er bei Charlie an. Toto Starek hat ihn schon gefragt, ob er das erledigt habe, Omma Luise wird sicher ebenso fragen wie Frank Tenholt. Stefan wird dann sagen können, ja sicher, hab ich gemacht, und damit wäre die Luft erst mal raus aus dem Thema.
Also wählt er ihre Nummer, von der er hofft, dass sie noch die gleiche ist, aber so viel er weiß ist Charlie nicht umgezogen, auch wenn er sich fragt, woher er das hätte wissen sollen. Es klingelt und klingelt und noch immer geht niemand ran, es meldet sich auch kein Anrufbeantworter.
Zehn-, zwanzigmal lässt er es klingeln, dann legt er auf. Wenn sie nach dem neunzehnten Klingeln rangegangen wäre, wäre das Gespräch sowieso eine Katastrophe geworden, man kann nur sauer sein auf jemanden, der es so penetrant lange klingeln lässt, sechs-, siebenmal, das ist doch beim Klingelnlassen das Höchste der Gefühle. Aber Stefan hat jetzt seine Pflicht getan, er hat sich nicht gedrückt, niemand kann ihm einen Strick drehen, woraus auch immer. Langsam bekommt er Hunger auf die frischen Brötchen.
4
Hier sieht es tatsächlich nicht aus wie in einem Heim, eher wie in einem Hotel. Stefan durchquert die Eingangshalle, wo einige ältere Damen an runden Bistro-Tischen sitzen und Kaffee trinken. Zwei Rollatoren stehen daneben, eine Frau sitzt im Rollstuhl. Etwa die Hälfte der Frauen leidet an einer Art Altersübergewicht. An einem der Tische sitzt ein Mann mit einem weißen Haarkranz um den kahlen Schädel. Der Mann sitzt sehr aufrecht, als würde er fotografiert.
Stefan tritt an den Empfangstresen und sagt, er möchte zu Frau Borchardt. Die Dame hinter dem Tresen, die gerade mit einem Kugelschreiber ein Formular ausfüllt, hebt nur kurz den Kopf, lächelt ihn an und sagt, erster Stock, die Treppe hinauf und dann links, er könne auch den Fahrstuhl nehmen. Ohne Gesichtskontrolle kommt hier keiner rein.
Er öffnet die Tür zum Treppenhaus und geht in den ersten Stock hinauf. Er klingelt bei Omma Luise, die gleich darauf die Tür aufreißt und ihn mit einem gebrummten »Das wurde aber auch Zeit!« begrüßt. Stefan beugt sich zu ihr hinunter, da sie über einssiebenundfünfzig nie hinausgekommen ist, und gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Ihr Haar riecht ein wenig nach Nikotin, also hat Omma Luise heute Morgen schon eine durchgezogen.