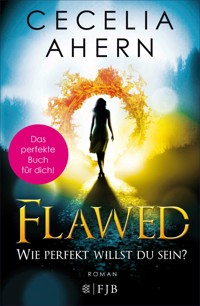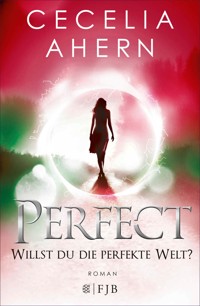9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es heißt, du bist eine Mischung aus den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wer sind deine fünf? »Eine wunderbare Geschichte über die Sehnsucht nach Verbundenheit, Freundschaften und Selbstfindung.« Freundin Allegra hat ihre Sommersprossen von ihrem Vater geerbt. Für sich selbst hat sie die Verbindung zwischen den wichtigen Punkten im Leben noch nicht raus. Sie ist nach Dublin gezogen, um ihre Mutter zu finden. Hier arbeitet sie als Hilfspolizistin, verteilt auf ihren täglichen Runden Strafzettel. Allegra lebt ziemlich allein, lässt niemanden nah an sich heran. Bis ihr eines Tages ein arroganter Ferrari-Fahrer diese Fünf-Menschen-Weisheit an den Kopf wirft. Allegra geht die Frage nicht mehr aus dem Kopf: Wer sind eigentlich die wichtigsten Menschen in meinem Leben? Eine Geschichte, die uns auf unsere ganz persönliche Suche schickt und zeigt: Wir sind wie Sternbilder am Nachthimmel, nur in Verbindung miteinander ergibt unser Leben Sinn. Humorvoll, phantasievoll, empathisch, unterhaltend und berührend. Der neue Roman der international gefeierten Autorin: Cecelia Ahern erzählt von unserer Sehnsucht nach Verbundenheit und nach Menschen, die uns durchs Leben tragen. »So klug und anregend! Cecelia Ahern ist eine unserer inspirierendsten Autor*innen überhaupt.« John Boyne Von der vielfach ausgezeichneten Autorin von Bestsellern wie »Postscript, »Frauen, die ihre Stimme erheben - Roar!«, »Das Jahr, in dem ich dich traf« und vielen anderen. Funkelnd, witzig, leicht und tief.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cecelia Ahern
Sommersprossen – Nur zusammen ergeben wir Sinn
Roman
Über dieses Buch
Es heißt, du bist eine Mischung aus den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wer sind deine fünf?
Der neue Roman der international gefeierten Autorin. Cecelia Ahern erzählt von unserer Sehnsucht nach Verbundenheit und nach Menschen, denen wir vertrauen können. Funkelnd, witzig, leicht und tief.
Allegra ist bei ihrem Vater aufgewachsen. Jetzt ist sie nach Dublin gezogen, um ihre Mutter zu finden. Allegra jobbt als Hilfspolizistin, verteilt auf ihren täglichen Runden Strafzettel. Sie lebt zurückgezogen, lässt niemanden an sich heran. Bis ihr eines Tages ein arroganter Ferrari-Fahrer eine Frage an den Kopf wirft. Völlig durcheinander, beginnt Allegra sich zu fragen: Wer sind eigentlich die fünf wichtigsten Menschen in meinem Leben? Und kriege ich überhaupt fünf zusammen? Eine mitreißende Sinn-Suche beginnt.
Eine Geschichte, die uns auf unsere ganz persönliche Suche schickt und zeigt: Wir sind wie Sternbilder am Nachthimmel, nur in Verbindung miteinander ergibt unser Leben Sinn.
Humorvoll, phantasievoll, empathisch, unterhaltend und berührend. Von der vielfach ausgezeichneten Autorin von Bestsellern wie »Postscript, »Frauen, die ihre Stimme erheben – Roar!«, »Das Jahr, in dem ich dich traf« und vielen anderen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecelia Ahern erzählt Geschichten, die unvergleichlich inspirieren und berühren. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt und vielseitig wie wenige andere, schreibt zeitgenössische Romane, Novellen, Storys, Jugendbücher, TV-Konzepte und Theaterstücke. Für ihre Werke wurde sie vielfach ausgezeichnet. Ihre Romane wurden fürs Kino oder fürs Fernsehen verfilmt, zum Beispiel »P.S. Ich liebe Dich« mit Hilary Swank und »Für immer vielleicht« mit Lily Collins. Cecelia Ahern ist Jahrgang 1981, hat Journalistik und Medienkommunikation studiert und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Norden von Dublin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Freckles« bei HarperCollins, London
© 2021 Cecelia Ahern
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt a. M.
Covergestaltung: Cornelia Niere nach einer Idee von Holly Macdonald / © HarperCollinsPublishers 2021
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490559-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Susana Serradas
Prolog
In der Dunkelheit das leise Knirschen einer Schnecke unter meinem Schuh. Das Gehäuse knackt. Dann der Matsch. Das träge Sickern.
Es tut mir weh, hinten an den Zähnen, ein stechender Schmerz im Zahnfleisch, irgendein Nerv.
Ich kann meinen Fuß nicht schnell genug wegziehen, kann das Geschehene nicht rückgängig, den Schaden nicht ungeschehen machen. Ich habe das weiche, schwammige Innere der Schnecke getroffen. Habe sie plattgewalzt, sie schief und krumm in den Boden getreten. Bei den nächsten Schritten fühle ich noch den weichen Glibber an den Schuhsohlen. Ich trage den Tatort eines Verbrechens unter meiner rutschigen Sohle. Der Tod klebt an meinem Schuh. Verschmierte Innereien. Eine entschlossene Dreh- und Wischbewegung befreit mich von ihnen.
So etwas passiert bei Nachtspaziergängen auf regendurchweichtem Boden, wenn ich nicht sehen kann, wo ich hintrete, und die Schnecke nicht sehen kann, was auf sie zukommt. Schon immer hab ich mich in solchen Fällen der Schnecke gegenüber schlecht gefühlt, aber jetzt hab ich am eigenen Leib erfahren, wie es ist. Ausgleichende Gerechtigkeit. Karma. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn die äußere Schutzschicht zerbricht und das Innere wehrlos bloßliegt.
Er hat mich zertreten.
Auch er hat meinen Matsch noch ein paar Schritte mitgeschleppt, auch seine Schuhsohlen waren schmierig davon. Ich frage mich, ob auch seine Seele schmierig geworden ist. Ob er gefühlt hat, wie ich unter seinem Blick zu Brei geworden bin, wie ich mich aufgelöst habe, als er seine hasserfüllten Worte auf mich gespuckt und dann das Weite gesucht hat. Hat er bemerkt, dass er meinen Panzer noch ein paar Schritte mitgeschleppt hat? Eine Drehbewegung mit dem Schuh, ungefähr so wie man eine Zigarette austritt, und schon war er mich wieder los.
Meine Überreste liegen auf dem Gehweg, zerquetscht und entblößt, das schutzlose, weiche Innere, das ich so mühsam zu schützen versuchte. Die Teile, auf die ich so gut aufgepasst habe, alles läuft aus. Gefühle, Gedanken, die ganze Unsicherheit, eine silbrige, schleimige Spur emotionaler Eingeweide.
Ich habe seinen Fuß nicht kommen sehen. Ich frage mich, ob ich auch für ihn eine Überraschung war.
Obgleich es sich für mich so anfühlt, endet hier nicht alles. Ich bin nicht tot. Ich bin zerquetscht und zerlaufe. Allegra Bird in tausend Fetzen. Die kaputte äußere Schale ist irreparabel. Aber man kann alles wieder aufbauen.
1
Als ich dreizehn Jahre alt war, fing ich an, die Sommersprossen auf meinem Arm miteinander zu verbinden, eine Art Punktebild. Da ich Rechtshänderin bin, entstand auf meinem linken Arm ein Netz aus blauen Linien. Nach einer Weile entwickelten sich daraus Sternbilder, nachgezeichnet von Sommersprosse zu Sommersprosse, bis meine Haut den Nachthimmel widerspiegelte. Der Große Wagen, manchmal auch Großer Bär genannt, war mein liebstes Sternbild. Nachts erkannte ich es sofort. Wenn wir im Internat das Licht ausmachen mussten und sich Stille über die Korridore senkte, dimmte ich mein Leselicht, nahm einen blauen Tintenroller und zeichnete die sieben Sterne nach, eine Sommersprosse nach der anderen, bis meine Haut einer Nachtkarte ähnelte.
Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar und Alkaid. Nicht immer verwendete ich dieselben Sommersprossen, manchmal hatte ich Lust, mich der Herausforderung zu stellen, die Konstellation anderswo nachzuzeichnen, zum Beispiel auf meinen Beinen. Allerdings tat mir vom Zusammenkauern irgendwann der Rücken weh. Außerdem fühlte es sich unnatürlich an – als zwänge ich die anderen Sommersprossenansammlungen dazu, etwas zu werden, was sie gar nicht waren. Es gab die idealen sieben Sommersprossen auf meinem linken Arm, für den Großen Wagen perfekt angeordnet. Deshalb gab ich die Versuche mit den anderen Sommersprossen schließlich auf, und wenn die morgendliche Dusche die Tinte weggespült hatte, begann ich von neuem.
Dem Großen Wagen folgte Kassiopeia. Sie war einfach. Dann kamen das Kreuz des Südens und Orion. Pegasus mit insgesamt vierzehn Sternen – beziehungsweise Sommersprossen – war kompliziert, aber meine Arme bekamen, vom Gesicht abgesehen, mehr Sonne als der Rest meines Körpers und bildeten daher mehr Sommersprossen, die perfekt für eine Vierzehn-Sterne-Konstellation positioniert waren.
Wenn es im Internatsschlafsaal dunkel wurde, fasste sich Caroline in der Schlafnische neben mir schwer atmend selbst an – sie dachte wohl, niemand würde es mitkriegen –, von der anderen Seite hörte ich Louise in den Anime-Comics blättern, die sie im Schein ihrer Taschenlampe las. Gegenüber arbeitete Margaret sich durch eine ganze Tüte Minicrunchys. Später steckte sie sich dann den Finger in den Hals und kotzte sie wieder aus. Olivia übte mit einem Spiegel das Küssen, während Liz und Fiona es lieber zusammen ausprobierten. Catherine schluchzte leise, weil sie Heimweh hatte, und Katie schrieb Hassmails an ihre Mam, die ihren Dad betrogen hatte. Auch alle anderen im Mädcheninternat nutzten den einzigen winzigen Raum, den sie ihr Eigen nannten, um sich in ihre Privatgeheimnisse zu vertiefen, während ich meine Sommersprossen kartographierte, als wären es Sterne.
Mein Geheimnis blieb nicht sehr lange geheim. Schließlich war ich jeden Abend dabei, neue blaue Linien über alte blaue Linien zu zeichnen, und irgendwann ließen sie sich nicht mehr abwaschen. Die Tinte setzte sich in meinen Poren fest, und nicht mal eine Scheuerbürste, heißes Wasser und die hoch motivierte Nonne Schwester Lasstuns (von uns allen so genannt, weil sie dazu neigte, jeden Satz mit »Lasst uns« zu beginnen, beispielsweise »Lasst uns danksagen und beten« oder »Lasst uns unsere Bücher auf Seite sieben aufschlagen« und – da sie auch unsere Basketballtrainerin war – »Lasst uns Korbleger üben«) konnten etwas dagegen ausrichten oder mich davon abbringen. Im Duschraum, beim Schwimmen oder wenn ich etwas Kurzärmeliges anhatte, wurde ich komisch angeschaut. Das sonderbare Mädchen mit den Linien auf dem Arm. Zwar schämte ich mich nicht im Geringsten meiner Zeichnungen, streckte stolz den Arm aus und erklärte allen, dass es Sternkonstellationen, Tiere, mythologische Gestalten und Kreaturen, Götter und Objekte waren, doch die Antworten darauf beliefen sich auf eine Lektion über Tintenvergiftung, Termine bei der Schulpsychologin oder Extrarunden auf der Aschenbahn. Sie wussten, dass körperliche Gesundheit gleich geistige Gesundheit war, und versuchten, mich mit möglichst vielen Aktivitäten zu beschäftigen, um mich davon abzubringen, meine Haut zu malträtieren. Für mich fühlte sich alles an wie eine Strafe. Zwingt sie, im Kreis zu laufen. Bringt sie dazu, sich von ihrer Haut fernzuhalten. Aber man kann niemanden von der eigenen Haut fernhalten. Schließlich steckt doch jeder in seiner eigenen Haut und kann sie nicht einfach ablegen. Ganz gleich, was sie mir sagten, ich konnte jedenfalls nicht aufhören. Sobald das Licht ausging und die Stille wie Nebel vom Meer hereinzog, verspürte ich das vertraute Sehnen, mich mit meiner Haut zu verbinden.
Die Linien waren mir nicht peinlich. Mich störte es nicht, wenn ich angestarrt wurde. Das einzige Problem war das Theater, das die anderen deswegen veranstalteten. Dabei war ich keineswegs das einzige Mädchen, das Male auf der Haut trug. Jennifer Lannigan ritzte sich mit einer Klinge, überall auf den Beinen hatte sie winzige Schnitte. Im Englischunterricht konnte ich sie gut sehen, in der weißen Lücke zwischen dem Rand ihrer grauen Socken und dem Saum ihres grauen Rocks. In der Schule durften wir uns nicht schminken, aber nach Schulschluss trug Jennifer weißes Make-up, schwarzen Lippenstift, piercte sich eigenhändig die Lippe und hörte wütende Musik von wütenden Männern. Aus irgendeinem Grund machte ihre Gesamterscheinung es jedoch akzeptabel für uns, dass sie sich so etwas Verrücktes antat.
Aber ich war kein Goth, und es ließ sich keine psychologische Erklärung dafür finden, warum jemand sich Sternbilder auf die Haut zeichnete. Also durchsuchte die Schlafsaalaufseherin abends meinen Schrank und entfernte alle Stifte. Am nächsten Morgen bekam ich sie vor dem Unterricht zurück und musste sie nach den Hausaufgaben wieder abgeben. Wenn Stifte in meiner Nähe waren, wurde ich bewacht wie ein kleines Kind in der Nähe einer Schere. Meiner Stifte beraubt, geriet ich ins gleiche Lager wie Jennifer. Ich hab nie verstanden, wie man den Drang verspüren kann, sich selbst zu verletzen, für mich war es ein Mittel zum Zweck. Ich gewöhnte mir an, mit der angespitzten Ecke meines Lineals eine Linie von einer Sommersprosse zur anderen zu ziehen. Allerdings hütete ich mich, die Sommersprosse selbst zu zerkratzen, denn ich hatte gehört, es sei gefährlich, Leberflecke und Sommersprossen zu verletzen. Als ich schärferes Werkzeug entdeckte und auf meinen Kompass, auf Rasierklingen etc. umstieg, war die Aufseherin vom Zustand meiner Haut so entsetzt, dass sie mir kurz darauf meine Stifte zurückgab. Aber es war zu spät, ich kehrte nicht mehr zur Tinte zurück. Der Schmerz gefiel mir zwar nicht, aber Blut war wesentlich haltbarer. Der trockene Schorf zwischen den Sommersprossen war ausgeprägter, und nun konnte ich die Sternbilder nicht nur sehen, sondern sogar fühlen. Sie brannten, wenn sie an die Luft kamen, sie pochten unter meiner Kleidung. Ihre Gegenwart war tröstlich, ich trug sie wie eine Rüstung.
Jetzt, mit vierundzwanzig, zerkratze ich meine Haut nicht mehr, aber die Sternbilder sind immer noch sichtbar. Wenn ich Sorgen habe oder gestresst bin, erwische ich mich dabei, wie ich mit dem Finger über die verdickten Narben auf meinem linken Arm streiche, immer wieder, von einem Stern zum nächsten, in der richtigen Reihenfolge. Ich verbinde die Punkte, löse das Rätsel, bringe die Ereignisse in einen Zusammenhang.
Von der ersten Schulwoche an, seit ich mit zwölf Jahren ins Internat kam, bis ich es mit achtzehn wieder verließ, nannte man mich Freckles – Sommersprosse. Wenn ich zufällig jemanden aus der Schule treffe, werde ich bis heute so angesprochen. Meistens kann sich diejenige nicht an meinen richtigen Namen erinnern oder wusste ihn von vornherein nicht. Meine Mitschülerinnen haben es nie böse gemeint, aber ich glaube, ich wusste schon immer, dass sie im Grunde von mir nur meine Haut sahen. Nicht schwarz, aber auch nicht weiß wie bei den meisten von ihnen – so hell, dass die Sonne darauf reflektierte. Meine Haut ist nicht bleich wie die Haut der meisten Leute aus Thurles. Nein, sie ist so, wie sie es sich selbst wünschten und mit Hilfe zahlloser Tuben und Sprays zu erreichen versuchten, dabei aber bestenfalls bei einem grellen Orangeton landeten. Es gab eine Menge Mädchen mit Sommersprossen, die keinen Spitznamen bekamen, aber ich hatte Sommersprossen auf dunklerer Haut, und das war etwas anderes. Mich störte der Spitzname nie, ich akzeptierte ihn, weil es nicht nur ein Spitzname war, sondern für mich auch eine tiefere Bedeutung hatte.
Pops’ Haut ist weiß wie Schnee, an manchen Stellen so blass, dass sie fast so durchsichtig ist wie Pauspapier, mit blauen Linien darunter. Bleiblaue Flüsse. Inzwischen sind seine Haare grau und dünner geworden, aber früher waren sie rot, lockig und wild. Er hat auch Sommersprossen, sehr viele sogar, rötlich wie ein Sonnenuntergang. »Du kannst froh sein, dass sie dich Freckles nennen, Allegra«, sagte er oft. »Mich hat man Streichholz genannt oder gleich total hässlich.« Dann lachte er. »Dingelingeling, meine Haare brennen, dingelingeling, die Feuerwehr muss rennen«, sang er, ich stimmte ein, und zusammen sangen wir das Lied, mit dem man ihn damals geärgert hatte. So verbündeten wir uns gegen die Erinnerung.
Meine Mutter habe ich nie kennengelernt, aber ich weiß, dass sie Ausländerin war. Eine mediterrane Schönheit, die in Irland studierte. Olivfarbene Haut, schwarze Haare, braune Augen, geboren in Barcelona. Die katalanische Carmencita Casanova. Sogar ihr Name klingt wie ein Märchen. Allem Anschein nach hatte die Schöne das Biest getroffen.
Pops sagt, ich musste doch auch was von ihm mitbekommen. Wenn ich keine Sommersprossen hätte, wie hätte er dann Anspruch auf mich erheben können? Natürlich macht er Witze, aber die Sommersprossen waren meine Visitenkarte. Er ist der einzige Mensch, der zu mir gehört, und meine Sommersprossen verbinden mich auf eine Art mit ihm, die sich lebenswichtig anfühlt. Sie sind mein Beweis. Ein offizieller Stempel vom Himmelsbüro, der mich an ihn knüpft. Keine wütende Meute konnte mit brennenden Fackeln zu unserem Haus galoppieren und von ihm verlangen, das Baby herauszugeben, das die Mutter nicht gewollt hatte. Schaut alle her, sie gehört ihm, sie hat seine Sommersprossen. Also.
Ich habe den Teint meiner Mutter geerbt, aber Pops’ Sommersprossen. Im Gegensatz zu Mam, die mich aufgegeben hat, um alles haben zu können, hat er alles aufgegeben, um mich zu haben. Die Sommersprossen sind die unsichtbare blaue Tintenlinie, die permanente Narbe, die mich mit ihm verbindet, Punkt für Punkt, Stern für Stern, Sommersprosse für Sommersprosse. Wenn man sie verbindet, dann verbindet man uns weiter und immer weiter.
2
Mein Berufswunsch war immer, mich den Gardaí Síochána, der irischen Polizei, anzuschließen. Es gab nie einen Plan B, das wussten alle. In unserem letzten Schuljahr sagten alle Detective Freckles zu mir.
Mrs. Meadows, die Berufsberaterin, versuchte, mich dazu zu bringen, Betriebswirtschaft zu studieren. Ihrer Meinung nach sollten das alle tun, sogar die Kunstschülerinnen, die mit kreativen, verdrehten Ideen zu ihr kamen. Nachdem Mrs. Meadows ihnen ihren Vortrag über die Vorteile eines BWL-Diploms gehalten hatte, wirkten sie, als wären sie einer Elektroschockbehandlung unterzogen worden. Betriebswirtschaft sei etwas, worauf man immer zurückgreifen könne, lautete die Botschaft. Aber ich wollte nicht auf etwas zurückgreifen, ich blickte zuversichtlich nach vorn und war überzeugt, dass es für mich gar keinen anderen Platz auf der Welt gab. Wie sich herausstellte, irrte ich mich gewaltig. Meine Bewerbung bei der Polizei wurde abgelehnt. Ich war fassungslos. Schnappte förmlich nach Luft. Schämte mich. Ohne andere Pläne, auf die ich zurückgreifen konnte, musste ich neu überlegen und landete beim Zweitbesten.
Jetzt bin ich bei der Kreisverwaltung von Fingal County angestellt und für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Ich trage eine Uniform, graue Hose, weißes Hemd und Warnweste, und mache meine Runden, einer Polizistin nicht unähnlich. Also ganz nah bei dem, was ich ursprünglich wollte, eine Art Hilfspolizistin. Ich arbeite auf der Seite des Gesetzes, ich mag meinen Job, meine Routine, meine Route, mein Revier. Ich schätze gute Organisation, Ordnung, Regeln und Klarheit. Die Regeln sind eindeutig, und ich halte sie rigoros ein. Es gefällt mir, dass ich eine wichtige Aufgabe erfülle.
Ich wohne in Malahide, einem Vorort Dublins am Meer. Eine schöne, wohlhabende Gegend. Mein Einzimmerapartment liegt über einem Fitnessraum im Garten der Villa meiner Vermieter, in einer Straße mit viel Grün, die an den Park des Malahide Castle grenzt.
Sie, Becky, macht irgendetwas mit Computern. Er, Donnacha, arbeitet zu Hause in seinem Kunstatelier, einem hübschen Gartenzimmer, und stellt Kunstkeramik her. Seine »Gefäße« nennt er sie. Für mich sehen sie aus wie kleine Schüsseln. Nicht für Müsli, man würde kaum zwei Weetabix reinkriegen, und sie sind auch nicht tief genug, dass die ganze Milch Platz hätte, die zwei Weetabix aufsaugen können. Im Kulturmagazin der Irish Times habe ich ein Interview mit ihm gelesen, in dem er ausführlich darlegt, dass diese Gefäße definitiv nicht als Schüsselchen gemeint sind, eine solche Bezeichnung beleidigend und der Fluch seiner Laufbahn sei. Die Gefäße transportieren nämlich seine Botschaft. Leider habe ich nicht weit genug gelesen, um diese Botschaft wirklich zu begreifen.
Mit verträumtem Blick redet er merkwürdiges Zeug, als hätten die Fragen, mit denen er sich den Kopf zermartert, irgendeine Bedeutung. Eigentlich dachte ich, Künstler seien typischerweise gute Zuhörer, aber auf ihn trifft das ganz und gar nicht zu. Ich dachte, Künstler seien wie Schwämme, die alles in ihrer Umgebung aufsaugen. Damit hatte ich wenigstens halbwegs recht. Leider ist Donnacha aber schon so vollgestopft mit irgendwelchem Unsinn, dass er nichts mehr aufnehmen kann. Jetzt sondert er das ganze Zeug einfach in die Umgebung ab. Und seine winzigen Schüsseln kosten mindestens fünfhundert Euro pro Stück.
Fünfhundert Euro beträgt auch meine Monatsmiete, und der Haken dabei ist, dass ich auch noch den Babysitter für die drei Kinder der beiden spielen muss, wenn sie ausgehen wollen. Normalerweise passiert das dreimal pro Woche. Und immer am Samstagabend.
Ich wache auf und schaue auf mein iPhone. 06.58, wie immer. Ich hab noch Zeit klarzukriegen, wo ich bin und was los ist. Meiner Erfahrung nach ist es ein guter Start in den Tag, meinem Handy immer einen Schritt voraus zu sein. Zwei Minuten später klingelt der Wecker. Pops will kein Smartphone, weil er glaubt, dass wir alle beobachtet werden. Einmal hat er mir zum Geburtstag einen Wochenendausflug nach London geschenkt, und wir haben die meiste Zeit vor der ecuadorianischen Botschaft verbracht und Julian Assanges Namen skandiert. Zweimal hat die Polizei uns verscheucht. Julian hat rausgeschaut und gewinkt, und Pops war der Ansicht, dass zwischen ihnen beiden etwas Monumentales passiert sei. Ein Verstehen zwischen zwei Männern, die an dieselbe Sache glauben. Alle Macht dem Volk, power to the people. Danach haben wir uns im West End Mary Poppins angesehen.
Um sieben stehe ich auf und gehe unter die Dusche. Ich esse was. Ich ziehe mich an. Graue Hose, weißes Hemd, schwarze Stiefel, Regenjacke, falls ich in einen Aprilschauer gerate. In dieser Uniform könnte ich für eine Garda gehalten werden. Zumindest stelle ich mir das gern vor. Manchmal tue ich so, als wäre ich eine Garda, natürlich imitiere ich sie nicht, das wäre ja illegal, nur in Gedanken. Und ich spreche so. Die Aura, die Autorität. Freund und Helferin, wenn man sie braucht, der Feind, wenn man sich danebenbenimmt. Sie entscheiden je nach Umstand, welche von beiden sie sind. Reine Magie. Schon die Neulinge schaffen es, diesen strengen enttäuschten Ausdruck aufzusetzen, und werden plötzlich ganz erwachsen, obwohl sie noch lange nicht so weit sind. Als würden sie dich kennen und genau wissen, dass du es doch eigentlich besser weißt, und warum musstest du sie so bitter enttäuschen, Himmel nochmal. Sorry, Garda, sorry, ich will’s nie wieder tun. Selbst mit den jungen Polizistinnen willst du dich nicht anlegen, aber du würdest dich jederzeit gern auf ein Bier mit ihnen verabreden.
Meine Haare sind lang, dick und schwarz, so schwarz, dass sie bläulich schimmern, wie Öl. Es dauert eine Stunde, sie trocken zu föhnen, weshalb ich sie nur einmal pro Woche wasche. Meistens mache ich mir einen Knoten im Nacken, Mütze drüber, weit in die Stirn gezogen. Dann noch die Ticketmaschine über die Schulter. Fertig.
Ich verlasse meine Wohnung. Das Haus ist fünfzig Meter entfernt, dazwischen liegt ein riesiger Garten, entworfen von einem preisgekrönten Landschaftsarchitekten. Der Pfad schlängelt sich durch einen versteckten Teil des Gartens; ich bleibe auf der Route, die man mir angewiesen hat, seitlich am Haus entlang, durch ein alarmgesichertes Gartentor. Der Code lautet 1916, das Jahr des Osteraufstands irischer Republikaner gegen die Briten, und ausgewählt hat ihn Donnacha McGovern aus Ballyjamesduff. Wenn Padraig Pearse, Anführer der Irish Volunteers, doch nur sehen könnte, wie sich dieser Mann für die Republik einsetzt. Indem er in seinem Gartenzimmer Schüsselchen töpfert.
Die Wände des Erdgeschosses mir gegenüber sind fast komplett aus Glas. Deckenhohe Schiebetüren, die im Sommer offen stehen wie bei einer Brasserie. Bringt das Draußen nach drinnen und das Drinnen nach draußen. Man weiß nicht, wo das Haus aufhört und der Garten beginnt, alles geht ineinander über. Diese Art Designergeschwafel. In jedem Zimmer erkenne ich es. Es erinnert mich an Dyson-Staubsauger-Werbung. In jedem Zimmer runde, futuristisch anmutende Gegenstände, die entweder Luft einsaugen oder ausstoßen. Eigentlich enthüllt die Fensterfront nur das Chaos in der Küche, in der Becky rumrennt und sich bemüht, die drei Kinder schulfertig zu machen, bevor sie selbst zur Arbeit fährt, irgendwo in der Stadt, glaube ich. Für mich ist sie eine dieser Latte-Macchiato-Mütter, die Grünkohl und Avocados auf der Einkaufsliste hat, Chiasamen niest und Granatäpfel pupst.
Ich tue ihnen leid, den beiden in ihrer Villa; ich, die ich in einem einzigen Zimmer über einem Fitnessraum lebe. Ganz weit hinten in ihrem Garten. Die ich eine Warnweste und Sicherheitsschuhe trage. Ich lasse ihnen dieses Gefühl gern. Mein Zimmer ist stylish, sauber und warm, und überall sonst müsste ich genauso viel Miete zahlen, mir die Wohnung aber mit drei Leuten teilen. Um jemals in meine Lage zu kommen, müssten Leute wie meine Vermieter alles verlieren. So sehen sie das. Ich habe alles hinter mir gelassen, um das hier zu kriegen. So sehe ich das.
Ich bin nicht einsam. Jedenfalls nicht die ganze Zeit. Und ich bin nicht frei. Jedenfalls nicht die ganze Zeit. Denn ich kümmere mich um Pops. Aus einer Entfernung von vierhundert Kilometern ist das nicht immer ganz einfach, aber ich habe es mir so ausgesucht. Ich habe mich entschieden, hier zu leben, weit weg von ihm, damit ich ihm näher sein kann.
3
Ich versuche, im Vorbeigehen nicht in die Küche zu sehen, aber Becky stößt ein mächtiges Gebrüll aus, alle sollen sich verdammt nochmal beeilen, und ich werfe unwillkürlich doch einen Blick hinein. Die Kücheninsel ist mit Milch-, Saft- und Frühstücksflockenpackungen, Brotdosen und unfertigen Schulbroten bedeckt, überall wuseln mehr oder weniger vollständig angezogene Kinder herum, im Fernsehen plärren Trickfilme. Ganz untypisch für sie, ist auch Becky selbst noch in Pyjamashorts und Spitzenunterhemd, kein BH, wabernde Brüste. Sie ist schlank, schließlich macht sie fast jeden Tag von sechs bis sieben morgens Sport im Fitnessraum unter meinem Zimmer. Sie ist eine der Frauen, um die es in Frauenzeitschriften immer geht, eine Frau, die sich richtig reinhängt, bis kurz vorm Umfallen. Wenn ich daran denke, stelle ich mir immer Michael Jackson vor, wie er bei dieser Tanzbewegung der Schwerkraft trotzt. Allerdings kam später raus, dass er Spezialschuhe trug, mit denen er sich im Bühnenboden festhaken konnte, und das Ganze gar nicht echt war.
Donnacha sitzt auf einem hohen Hocker am Frühstückstresen und liest etwas auf seinem Handy, als ginge ihn das ganze Chaos nichts an. Für ihn ist Zeit kein Problem. Er wird die Kinder in der Schule abladen und dann an seinen Schüsselchen rumpuzzeln. Gerade als ich ungefährdet vor dem Haus angekommen bin und auf die Auffahrt einbiegen will, dort, wo die zwei schicken Autos der beiden parken, prunkvolle Tore das Haus beschützen und die wilden Kaninchen vor mir Reißaus nehmen, höre ich Becky meinen Namen rufen. Ich schließe die Augen und seufze. Zuerst überlege ich noch, ob ich vielleicht so tun kann, als hätte ich sie nicht gehört, aber das bringe ich nicht fertig. Also drehe ich mich um. Becky steht an der Haustür. In der kühlen Morgenluft haben sich ihre Brustwarzen unter dem dünnen Hemdchen aufgerichtet. Sie versucht, sich hinter dem Türrahmen zu verstecken.
»Allegra!«, ruft sie, denn so heiße ich nun mal, »kannst du heute Abend babysitten?«
Es ist keiner meiner üblichen Babysittingabende, und ich bin nicht in der Stimmung. Es war eine lange Woche, ich bin noch müder als gewöhnlich. Den Abend mit Kindern zu verbringen, die für sich in ihren Zimmern bleiben oder regungslos vor einem Computerspiel sitzen, ist nicht anstrengend, aber auch nicht das Gleiche wie allein und in aller Ruhe zu entspannen. Aber wenn ich Becky jetzt sage, dass ich heute nicht kann, und sie mich dann in meinem Zimmer sehen, wäre das auch keine richtige Entspannung.
»Ich weiß, es ist ein bisschen kurzfristig«, fügt Becky hinzu und eröffnet mir einen Ausweg, doch ehe ich die Chance habe, ihn einzuschlagen, weist sie darauf hin, dass bald der 1. Mai ist. »Wir müssen über die Miete sprechen«, fährt sie jetzt in geschäftsmäßigem Ton fort, »ich hab ja schon angekündigt, dass wir sie nach einem halben Jahr noch mal neu einschätzen müssen.« Obwohl sie sich die ganze Zeit bemüht, ihre Brustwarzen zu verstecken, demonstriert sie Selbstbewusstsein und Stärke. Und es klingt wie eine Drohung. Ein einziges Mal konnte ich ihr nicht aushelfen, als ich zu Pops gefahren bin, worüber ich sie rechtzeitig informiert hatte. Eigentlich bin ich immer verfügbar. Aber das alles erwähne ich jetzt nicht.
»Die Sache mit der Miete, klar«, sage ich. »Aber ich kann trotzdem nicht babysitten, ich habe heute Abend schon was vor.« Sobald ich es ausgesprochen habe, weiß ich, dass ich entsprechende Pläne machen muss, was mich nervt.
»Oh, Allegra, das sollte wirklich keine Andeutung sein«, erwidert Becky mit schockiertem Gesicht, weil ich ihr praktisch vorgeworfen habe, eine Diskussion über meine Miete sei eine nur dünn verschleierte Drohung. Noch dünner als ihr zartes Hemdchen. Die Menschen sind so leicht zu durchschauen, dass ich gar nicht weiß, warum wir uns überhaupt die Mühe machen, andere zu verarschen.
»Dann wünsch ich dir einen schönen Abend, was immer du vorhast«, sagt sie noch, schließt dann die Tür und verschwindet mitsamt ihren wabernden Brüsten.
Eine höhere Miete kann ich mir nicht leisten, aber ich kann es mir genauso wenig leisten, nicht hier zu wohnen. Ich habe noch nicht alles erledigt, weshalb ich hergekommen bin.
Vielleicht hätte ich doch babysitten sollen.
Auf dem Weg in den Ort schlendere ich durch den Park des Malahide Castle. Alte Bäume und schön gestaltete Wege, Bänke mit Messingplaketten zu Ehren derer, die hier herumspaziert sind, hier gesessen und sich dies und jenes angeschaut haben. Makellos gepflegte Blumenbeete, kein Müll, zumindest nicht in Sichtweite. Gelegentlich ein graues Eichhörnchen. Neugierige Rotkehlchen. Verschmitzte Kaninchen. Eine Amsel beim morgendlichen Einsingen. Ein stressfreier Start in den Tag. Meistens begegne ich denselben Leuten an denselben Stellen. Wenn nicht, sind sie spät dran, nicht ich. Ein Mann im Anzug, auf dem Rücken einen Rucksack, riesige Kopfhörer über den Ohren. Eine Frau mit besorgniserregend rotem Gesicht, die joggt, als kippe sie gleich zur Seite. Die schiefe Joggerin. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie bleibt aufrecht und läuft immer weiter. Die ersten paar Tage hat sie meinen Blick gesucht, als wäre sie eine Geisel ihres Ehrgeizes und ich müsste sie befreien, aber jetzt ist sie zombifiziert, starrt in die Ferne, auf der Jagd nach dem, was sie weitertreibt, die unsichtbare Karotte vor ihrer Nase. Dann gibt es noch den Hundeausführer mit der Deutschen Dogge, gefolgt von einem alten Mann mit Rollator in Begleitung eines jüngeren Mannes, der dem Aussehen nach wohl sein Sohn ist. Beide wünschen mir unweigerlich einen guten Morgen, jeden Tag. »Guten Morgen«, sagt der Ältere, »Guten Morgen«, sagt der Jüngere, »Guten Morgen«, sage ich zu den beiden.
Meine Schicht beginnt um acht und geht bis sechs. Im Ort selbst ist es relativ ruhig, bis der Schulverkehr einsetzt und Chaos ausbricht. Bevor ich anfange, gehe ich jeden Morgen in die Bäckerei in der Main Street. Die Village Bakery. Sie gehört Spanny und wird von ihm ganz allein geführt. Trotzdem hat er, wenn ich da bin, immer Zeit für ein Schwätzchen, weil ich früher dran bin als die meisten. Wenn die Sieben-Uhr-achtundfünfzig-Bahn ankommt und alle, die hier ausgestiegen sind, bei ihm einen Kaffee trinken wollen, wird es kurz hektisch. Spanny ist schon seit 5 Uhr in seiner Backstube und backt. Alle möglichen Brote und Teilchen. Man sieht ihn kaum hinter der Theke, die gefüllt ist mit einem Dutzend verschiedener Brotsorten, gedreht und geflochten, voluminös, auf Hochglanz gebracht, dekoriert mit Sesam, Mohn und Sonnenblumenkernen. Das sind die Renner der Bäckerei, zu bewundern in bester Lage, direkt über der Glasvitrine mit den Kuchen. Er besteht darauf, dass ich ihn Spanny nenne, obwohl »Spanner« im Dublin-Slang Idiot bedeutet. Als Schüler hat er irgendeine Dummheit begangen, und der Name ist an ihm hängengeblieben. Vielleicht waren es auch mehrere Dummheiten, soweit ich weiß, war er sogar im Gefängnis. Er hat mir erzählt, dass er dort backen gelernt hat, und ich hab ihm erzählt, dass ich auch mal einen Spitznamen hatte und man mich in der Schule Freckles genannt hat. Seither nennt er mich so. Mich stört das nicht. Als ich nach Dublin gezogen bin, war es ganz nett, etwas Vertrautes zu haben, als würde jemand mich kennen.
»Morgen, Freckles, das Übliche?«, fragt er und schaut kaum von der Teigmaschine auf. »Blätterteig«, erklärt er mir, noch ehe ich fragen kann. »Mit Apfel und Zimt, die blöde Maschine hat heute früh schlappgemacht. Bis zum Lunch bin ich fertig, das reicht für die Deppen.«
Von seinen Kunden redet er gern, als wären sie seine Feinde, als würden sie ihn in den Ruin treiben. Natürlich gehöre ich auch zur Kundschaft, aber ich bin nicht beleidigt, es ist ja auch ein gutes Gefühl, dass er mit mir redet, als wäre ich keine Kundin.
Er faltet den Teig noch mal zu einer weiteren Schicht zusammen. Weiß und blasig, erinnert mich das Zeug an Tina Rooneys Bauch, als sie nach der Geburt ihres Babys wieder zur Schule kam und das Fleisch wie roher Teig über ihre Kaiserschnittnarbe hing. Ich hab sie in der Umkleide beobachtet, als sie ihr Hurling-Trikot über den Kopf gezogen hat. Damals kam sie mir so außergewöhnlich vor. Ein Mädchen in meinem Alter, das ein Baby zur Welt gebracht hatte. Sie durfte ihren Sohn nur am Wochenende sehen, und ihre Nische im Schlafsaal war gepflastert mit Fotos von dem kleinen Würmchen. Ich glaube nicht, dass eine von uns verstanden hat, wie schwer es für Tina Rooney gewesen sein muss. Dass sie von einem Tag auf den anderen zwei vollkommen unterschiedliche Leben lebte. Sie hatte mir erzählt, dass sie beim Electric Picnic, dem Musikfestival, mit einem Typen geschlafen hatte. In ihrem Zelt, während auf der Hauptbühne Orbital spielte. Sie kannte den vollständigen Namen des Kerls nicht, hatte keine Telefonnummer, aber den Vorsatz, nächstes Jahr wieder zum Festival zu gehen und ihn zu suchen. Manchmal frage ich mich, ob sie es tatsächlich getan hat.
»Von Whistles musste ich mir ganz schön was anhören wegen der Teilchen«, sagt Spanny und holt mich zurück in die Gegenwart. Mit dem Rücken zu mir fügt er noch hinzu: »Ich sage dir, der hat Nerven, mich wegen dem runterzuputzen, was er von mir zum Frühstück kriegt. Der sollte froh sein, dass ich ihm überhaupt was gebe.« Den letzten Satz sagt er lauter, über die Schulter, in Richtung Tür.
Ich schaue nach draußen, wo der obdachlose Whistles auf seinem flachgedrückten Karton sitzt, in eine Decke gewickelt, einen Becher mit heißem Kaffee in der Hand, und herzhaft in ein Fruit Scone beißt. Er spricht nie, sondern pfeift, um sich zu äußern.
»Er hat Glück, dass er dich hat«, sage ich zu Spanny, und er beruhigt sich ein bisschen, wischt sich die Stirn, wirft sich ein Handtuch über die Schulter und holt einen Kaffee und eine Waffel für mich.
»Ich weiß gar nicht, wo du das Zeug lässt«, sagt er, streut Puderzucker über die Waffel, nimmt ein Stück Wachspapier, das aussieht wie Zeitung, und überreicht sie mir darin.
Er hat recht – ich esse, was ich will, und mein Körper bleibt, wie er ist. Vielleicht, weil ich auf Streife den ganzen Tag herumlaufe. Vielleicht liegt es auch an den Genen meiner Mam. Angeblich war sie Tänzerin oder wollte jedenfalls eine sein. So hat sie Pops kennengelernt, sie machte darstellende Kunst, er war Musikdozent. Vielleicht hat sie zumindest für eine Weile bekommen, was sie wollte. Ich hoffe es für sie, niemand möchte etwas aufgeben, um alles zu kriegen und am Ende mit nichts dastehen. Das wäre auch ziemlich unfair.
Zwei Euro zwanzig für Kaffee und Gebäck, ein Frühstücks-Special. Nicht mal die Hälfte dessen, was man beim Café Insomnia oder Starbucks ein Stück weiter die Straße runter bezahlt. Eine richtige Bäckerei, die mit diesen Ketten konkurrieren muss, das bringt Spanny immer auf die Palme: »Ich bin seit 5 Uhr früh hier …« Aber meistens ist Spanny gut gelaunt, er ist ein guter Start in meinen Tag, meistens ist die Unterhaltung mit ihm die beste und interessanteste, die ich an dem Tag führe. Jetzt kommt er hinter der Ladentheke hervor, gräbt seine Zigaretten aus der Schürzentasche und geht vor die Tür.
Ich setze mich auf einen Hocker am Fenster, mit Blick auf die langsam zum Leben erwachende Main Street. Die Frau vom Blumengeschäft schiebt ihre Auslagen auf den Bürgersteig. Der Spielzeugladen wird aufgeschlossen, jetzt, kurz vor Ostern, ist das Schaufenster mit Blumen, Hasen und handbemalten Eiern dekoriert. Der Optiker hat noch zu, ebenso das Spirituosengeschäft, die Schreibwarenhandlung und die Anwaltskanzlei. Die anderen Cafés öffnen jetzt auch, aber Spanny ist jeden Morgen der Erste.
Gegenüber beim The Hot Drop stellt die Inhaberin eine Tafel mit Werbung für Spezialomelette und Karottenkuchen auf. Langsam, aber sicher setzt sie immer mehr Kuchen auf die Speisekarte. Früher gab es nur getoastete Sandwiches. Ich frage mich, warum sie sich überhaupt die Mühe macht, denn Spannys Kuchen sind und bleiben die besten. Doch jetzt beobachtet er die Tafel mit zusammengekniffenen Augen. Als die Frau nervös herüberwinkt, nickt er ihr beim Inhalieren kaum merklich zu. Rauch zieht durch die Tür herein.
»Freitagabend«, sagt Spanny, bläst Qualm aus dem Mundwinkel und redet mit schiefem Mund. »Hast du was vor?«
»Ja«, antworte ich und setze damit die Lüge fort, die ich bei Becky angefangen habe.
Jetzt habe ich mich festgelegt und muss nur noch etwas finden, wo ich hingehe. Ich frage Spanny nach seinem Wochenende.
Er schaut die Straße rauf und runter, wie ein Einbrecher, der ein Objekt ausspioniert.
»Ich besuche Chloe.«
Chloe ist die Mutter seiner Tochter, die Frau, die ihn seine Tochter nicht sehen lässt. Chloe, die Weight-Watchers-Schwindlerin, der Kopfschmerztabletten-Junkie, das Monster. Spanny zieht an der Zigarette und saugt die Wangen ein.
»Ich muss zu ihr und die Sache ein für alle Mal klären. Sie muss mir einfach nur zuhören, mir ins Gesicht sehen, nur wir zwei, ohne dass Leute sich einmischen und alles mit ihren Meinungen durcheinanderbringen. Chloes Schwestern zum Beispiel.«
Er verdreht die Augen.
»Du weißt, was ich meine, Freckles. Sie wird bei einer Tauffeier im Pilot sein, und wenn ich da ganz zufällig auch auftauche – spricht ja nichts dagegen, ich hab da schon oft was getrunken, mein Kumpel Mossy wohnt um die Ecke, mit dem gehe ich hin, kippe ein paar Pints, alles offen und ehrlich. Dann bleibt ihr keine Wahl, als mit mir zu reden.«
Ich hab noch nie jemanden so inhalieren sehen wie ihn, so lang und hart, bevor er die halbe Kippe wegschnippt. Sie fliegt einer Frau vor die Füße. Ich erkenne die Apothekerin aus der Gegend hier, sie fährt einen blauen Fiat, den sie immer auf dem Schlossparkplatz abstellt. Erschrocken jault sie auf, die Zigarette saust um Haaresbreite an ihr vorbei, und sie schaut Spanny wütend an. Aber dann geht sie weiter, offensichtlich machen seine Größe und sein Auftreten ihr Angst. Ein Bäcker, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte. Whistles pfeift entrüstet, wegen der verschwendeten halben Zigarette, steht auf und schlurft zu dem noch qualmenden Glimmstängel in der Gosse und kehrt mit seiner Beute zurück zu seinem Kartonsitz.
»Ratte«, zischt Spanny ihn an, gibt ihm aber eine frische Zigarette, ehe er wieder in den Laden kommt.
»Du solltest vorsichtig sein, Spanny«, warne ich ihn. »Als du das letzte Mal bei Chloe warst, hast du dich furchtbar mit ihren Schwestern gestritten.«
»Die drei hässlichen Schwestern, ja«, sagt er. »Gesichter wie Kohlköpfe.«
»Und Chloe hat dir daraufhin mit einer einstweiligen Verfügung gedroht.«
»Das konnte sie nicht mal buchstabieren«, lacht er. »Ich habe das Recht, Ariana zu sehen. Und dafür tue ich alles. Wenn es nicht anders geht, bin ich eben nett. Kinderspiel.«
Die Pendler aus der Sieben-Uhr-achtundfünfzig-Bahn fangen an, die Main Street zu bevölkern. Bald wird die kleine Bäckerei gerammelt voll sein, und Spanny muss im Alleingang schnellstmöglich Kaffee, Kuchen und Sandwiches servieren. Ich trinke meinen Kaffee aus und verdrücke den letzten Bissen meiner Waffel, wische mir den Puderzucker vom Mund, werfe die Serviette in den Mülleimer und gehe zur Tür.
»Beweg dich, Whistles«, ruft Spanny. »Du verdirbst den Leuten bloß den Appetit, und keiner von denen gibt dir auch nur einen Cent.«
Langsam steht Whistles auf, packt seine Sachen zusammen, nimmt den Karton, schlurft um die Ecke und die Old Street hinunter. Der Wind trägt sein unmelodisches Singen in meine Richtung.
Die ersten Stationen meines Tages sind die Schulen. Nicht genug Platz, zu viele Autos. Müde, gestresste Eltern, die wild am Straßenrand halten und parken, wo sie nicht parken dürfen, Pullover und Jacken nur notdürftig über den Schlafanzug gezogen, Joggingschuhe zur Geschäftskleidung, alle schwitzend und unter Druck, nur schnell weiter, die Arbeit ruft. Verschlafene, zerzauste Kids mit Schultaschen, die größer sind als sie selbst, werden angebrüllt, sich beim Aussteigen gefälligst zu beeilen. Könnte ihnen bitte jemand um Himmels willen ihre Kids abnehmen, damit sie ihr Ding machen können? Jeden Morgen werde ich von den gleichen in zweiter Reihe parkenden Stressköpfen beschimpft. Die Kinder sind nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Niemand ist schuld. Aber ich muss trotzdem meine Runde machen.
Zuerst nehme ich den freien Platz vor dem Friseursalon in Augenschein, der innerhalb der nächsten halben Stunde von einem silbernen 3er-BMW eingenommen werden wird. Rasch werfe ich einen Blick in den kleinen Salon. Kein Licht brennt, bis neun bleibt alles leer und geschlossen. Während ich durchs Fenster spähe, fährt ein Auto auf den leeren Platz, ich drehe mich um und mustere den Fahrer. Der Mann stellt den Motor ab und löst den Sicherheitsgurt. Dabei sieht er mich die ganze Zeit an. Er öffnet die Tür, setzt einen Fuß aufs Pflaster und starrt mich an.
»Kann ich hier etwa nicht parken?«, fragt er.
Ich schüttle den Kopf. Obwohl ich keine Garda imitiere, bin ich in meinem Kopf sehr wohl eine. Und Gardaí müssen nicht immer alles begründen.
Der Mann verdreht die Augen, schwingt die Beine zurück ins Auto, und während er den Sicherheitsgurt anlegt und den Motor wieder startet, schaut er sich nach der Beschilderung um, verwirrt und irritiert.
Ich bleibe stehen, bis er weggefahren ist.
Es ist erst 8 Uhr. Parken mit Parkschein beginnt um halb neun. Es gibt keine rechtlichen Gründe, weshalb der Mann hier nicht parken dürfte.
Aber hier parkt jemand anderes, hier parkt sie.
Jeden Tag.
Es ist ihr Platz.
Und ich bewache ihn.
4
Von neun bis zwölf geht es hauptsächlich um Parksünden. Pkw in Ladezonen, die Lieferungen behindern und auf den schmalen Straßen Chaos verursachen. Dazu kommen Strafzettel für Autos, die am Vorabend stehen gelassen worden sind, meistens von Fahrern, die etwas getrunken und sich für den Heimweg ein Taxi genommen haben, aber nicht rechtzeitig am nächsten Morgen zurückgekommen sind, um die fälligen Parkgebühren zu entrichten. Damit habe ich heute mehr zu tun als sonst an einem Werktag, denn Donnerstagabend ist ein beliebter Ausgehabend. Sonntags parkt man umsonst, da kann jeder tun, was er will.
Ich bin gut beschäftigt.
Inzwischen steht der silberne BMW vor dem Friseursalon. An ihrem Platz. Wie es sich gehört. Parkgebühr für Anwohner bezahlt, Parkausweis an der korrekten Stelle. Korrektes Fahrzeug, korrekter Ausweis. Gute Frau. Die meisten Leute vergessen, Bescheid zu geben, wenn sie sich ein neues Fahrzeug zulegen. Was eine Ordnungswidrigkeit ist, für die man Strafe zahlen muss. Aber der BMW ist absolut legal. Sechshundert Euro pro Jahr für den Parkausweis. Der kleine Friseursalon läuft sehr gut, hat zwar nur sechs Plätze, ist aber immer voll. Zwei Becken zum Haarewaschen, drei Stühle vor einem Spiegel und ein kleiner Tisch am Fenster für die Nägel, Shellac und Gel. Die Chefin ist immer da. Wenn ihr BMW mal nicht hier parkt, fällt mir das sofort auf, und ich frage mich, ob mit ihr oder ihrer Familie etwas nicht in Ordnung ist, tröste mich aber damit, dass ich es sicherlich an den Gesichtern ihrer Angestellten erkennen würde, wenn etwas Schreckliches passiert wäre. Trotzdem schaue ich nach. Schließlich ist niemand unfehlbar. Parkausweis auf dem Armaturenbrett, hinten ein Kindersitz.
Für einen Augenblick beansprucht das meine ganze Aufmerksamkeit.
Um die Mittagszeit gehe ich durch die James’ Terrace, eine Sackgasse mit georgianischen Reihenhäusern, inzwischen allesamt gewerblich genutzt. Gegenüber liegt der Tennisplatz. Ich bewundere die Aussicht, auf die ich jetzt zusteuere, man sieht direkt rüber nach Donabate. Fischerboote, Segelboote, Blau, Gelb, Braun und Grün. Es erinnert mich an zu Hause. Mein Zuhause liegt auch an der Küste, nicht so wie hier, aber durch die Seeluft fühle ich sofort eine Verbindung. So zu Hause fühle ich mich in Dublin sonst nirgends. Große Städte machen mich klaustrophobisch, dieser Ort lässt mir mehr Raum zum Atmen.
Meine Heimat liegt im County Kerry, auf Valentia Island, aber das Internat war in Thurles. Die meisten Wochenenden habe ich trotzdem daheim verbracht. Pops arbeitete als Musikdozent an der Universität in Limerick, bis er vor einer Weile in den Ruhestand gegangen ist, allerdings nur halbherzig. Er spielt Cello und Klavier und hat am Wochenende und in den Sommerferien zu Hause auch Unterricht gegeben. Aber sein Job und seine Leidenschaft waren das Sprechen über Musik. Ich konnte mir immer gut vorstellen, wie er in seinen Vorlesungen mit flammender Begeisterung über sein Lieblingsthema dozierte. Deshalb hat er mich ja auch Allegra genannt, was auf Italienisch so viel wie »fröhlich und munter« heißt, aber hauptsächlich hat er mir den Namen in Anlehnung an die musikalische Bezeichnung »Allegro« gegeben, die bedeutet, dass ein Stück schnell und lebhaft gespielt werden soll. Das beste Instrument war und ist übrigens Pops’ Summen – er beherrscht noch immer Mozarts kompletten Figaro.
Während ich auf dem Internat war, arbeitete Pops von Montag bis Freitag an der Uni, und am Freitagabend nahm ich den Zug zu ihm nach Limerick. Dort holte er mich vom Bahnhof ab, und wir fuhren zusammen nach Hause, nach Knightstown auf Valentia Island. Eigentlich dauerte die Fahrt drei Stunden, aber wenn Pops am Steuer saß, ging es gefährlich schneller, denn für ihn waren Geschwindigkeitsbegrenzungen nur ein weiterer Versuch der Regierung, uns zu kontrollieren. Sobald ich am Freitagabend mein Zuhause sah, in dem Augenblick, wenn wir die Brücke von Portmagee auf dem Festland zur Insel überquerten, fühlte ich, wie sich Frieden in mir ausbreitete. Ich freute mich mindestens so, zu Hause zu sein, wie ich mich freute, Pops zu sehen. Das ist zu Hause, richtig? All die Kleinigkeiten, die direkt unsere Seele berühren – das Gefühl meines Betts, das Kissen, das genau richtig ist, das Ticken der Großvateruhr auf dem Korridor, der Fleck an der Wand, wie er aussieht, wenn das Licht auf ihn fällt. Wenn du glücklich bist, können sogar Dinge, die du hasst, sich in Dinge verwandeln, die du liebst. Beispielsweise, wenn Pops den Klassiksender im Radio viel zu laut stellt. Der Geruch von verbranntem Toast, jedenfalls bis zu dem Moment, wenn man ihn essen muss. Wie der Boiler jedes Mal röhrt, wenn das Wasser läuft. Das Geräusch der Ringe am Duschvorhang, wenn sie über die Stange rutschen. Die Schafe auf der Wiese hinter dem Haus bei Nessies Farm. Der Klang der Schaufel, die hinten im Kohlenschuppen über den Betonboden schrappt. Das Poch-poch-poch, wenn Pops an sein gekochtes Ei klopft, immer dreimal. Manchmal habe ich schreckliches Heimweh. Nicht wenn ich hier am Meer bin und mich daran erinnere, sondern vor allem dann, wenn ich überhaupt nichts um mich herum habe, das mich daran erinnert.
Abgesehen vom Gelb des Sandstrands sehe ich noch ein anderes mir vertrautes Gelb. Vor James’ Terrace Nummer acht steht der kanariengelbe Ferrari. Ich ahne schon, dass er keinen gültigen Parkausweis auf dem Armaturenbrett hat, denn das ist bereits seit zwei Wochen der Fall. Ich überprüfe alle Autos, die auf meiner Runde vor ihm an die Reihe kommen, aber ich kann mich schlecht konzentrieren, denn ich muss das gelbe Auto erreichen, ehe jemand einsteigt und wegfährt, sonst kann ich keinen Strafzettel ausstellen. Dann würde ich mich betrogen fühlen. Am Ende lasse ich die anderen Autos links liegen und gehe direkt zu dem gelben Sportwagen.
Natürlich – kein Parkausweis am Fenster. Auch kein Parkschein. Ich scanne die Zulassung. Auch online wurde keine Gebühr entrichtet. Das Auto parkt jetzt die zweite Woche hier, mehr oder weniger am gleichen Platz, und ich habe täglich einen Strafzettel hinterlassen. Jedes Mal kostet es den Eigentümer vierzig Euro, nach achtundzwanzig Tagen erhöht sich der Betrag um fünfzig Prozent, und wenn nach weiteren achtundzwanzig Tagen immer noch nichts bezahlt worden ist, wird ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Vierzig Euro jeden Tag seit zwei Wochen, das ist kein Pappenstiel. Praktisch meine Monatsmiete. Aber ich habe kein Mitleid mit dem Eigentümer, ich bin wütend und aufgebracht. Macht sich hier jemand über mich lustig?
Wer auch immer dieses Auto fährt, muss sowieso ein Arsch sein. Ein gelber Ferrari, also echt. Könnte natürlich auch einer Frau gehören. Einer Frau, die sich vielleicht ein bisschen zu sehr reingehängt hat, bis sie umgekippt ist und sich den Kopf angeschlagen hat. Ich stelle den Strafzettel aus und klemme ihn hinter den Scheibenwischer.
Zum Lunch setze ich mich auf die Bank die Straße runter, hinter dem Tennisclub und dem Sea Scouts Club, mit Blick aufs Meer. Es ist Ebbe, die schlammigen Steine sind zu sehen, ein paar Plastikflaschen, ein Joggingschuh und ein Schnuller ragen aus dem glitschigen Seetang heraus. Aber selbst in der Hässlichkeit liegt eine gewisse Schönheit. Ich hole meine Lunchbox aus dem Rucksack. Vollkorn-Käsesandwich, ein Granny-Smith-Apfel, eine Handvoll Walnüsse und eine Thermosflasche heißen Tee. Jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche und immer am selben Ort, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Bei schlechtem Wetter stelle ich mich unter das schützende Dach der öffentlichen Toiletten. Für gewöhnlich ist an Regentagen mehr zu tun, weil keiner Lust hat, im Regen zum Parkscheinautomaten und wieder zurück zum Auto zu laufen. Dann wird in Ladezonen geparkt, mit eingeschaltetem Warnblinker in zweiter Reihe angehalten, damit man sich schnellstmöglich wieder in Sicherheit bringen kann. Aber die Regeln gelten bei jedem Wetter.
Manchmal gesellt Paddy sich zum Lunch zu mir. Er verteilt Strafzettel wie ich, und wir teilen uns die Zonen in dieser Gegend. Paddy ist dick, hat Schuppen, die überall auf seine Schultern regnen, und schafft seine Zonen nicht immer rechtzeitig. Meistens bin ich froh, wenn er nicht auftaucht. Er redet die ganze Zeit übers Essen, wie er alles vorbereitet und dann gekocht hat, bis ins kleinste Detail. Vielleicht wüsste ein echter Feinschmecker seine Gesprächsthemen zu schätzen, aber ich finde es seltsam, mir seine Geschichten über vierundzwanzigstündiges Köcheln und die Zubereitung von Marinaden anzuhören, während er neben mir ein Eisandwich und Käse-Zwiebel-Chips von der Tankstelle verschlingt.
Ich höre jemanden laut fluchen und eine Autotür knallen. Als ich mich umschaue, sehe ich den Ferrari-Typen seinen Strafzettel lesen. Das ist er also, so sieht er aus. Überraschend jung. Mein Käsebrot verbirgt mein Grinsen. Normalerweise genieße ich solche Situationen nicht, das Ausstellen von Strafzetteln ist nichts Persönliches, sondern eine Pflicht, aber dieses Auto ist ein Fall für sich. Der Kerl ist groß, schlank, jungenhaft und in den Zwanzigern. Auf dem Kopf eine rote Kappe. Sieht fast aus wie eine Trump-Wahlkampf-Kappe, aber als ich genauer hinschaue, erkenne ich das Ferrari-Logo. Noch bescheuerter. Er stopft den Strafzettel in die Tasche, seine hektischen Bewegungen wirken gereizt und beleidigt. Er öffnet die Autotür.
Ich kichere.
Er kann mich unmöglich gehört haben, ich war ganz leise, und mein Sandwich schluckt jedes Geräusch, außerdem bin ich viel zu weit weg, zwischen uns liegt eine Straße. Aber er schaut sich um und entdeckt mich, als spüre er, dass er beobachtet wird.
Auf einmal fühlt sich das Sandwich in meinem Mund an wie aus Backstein. Ich versuche zu schlucken, aber zu spät fällt mir ein, dass ich überhaupt noch nicht gekaut habe. Ich würge, huste und schaue schnell weg von dem Ferrari-Typen. Endlich löst sich der Bissen, ich spucke ihn in ein Papiertaschentuch, aber ein paar Krümel bleiben zurück und kitzeln höllisch. Schnell spüle ich sie mit Tee runter, aber als ich wieder zu dem Typen hinüberschaue, starrt er mich immer noch an. Nicht als mache er sich Sorgen um mich, sondern eher, als hoffe er, dass ich ersticke. Mit einem wutentbrannten letzten Blick steigt er ins Auto, knallt die Tür zu und rast davon. Der Motor heult so laut, dass sich ein paar Leute umdrehen.
Mein Herz klopft.
Ich hatte recht. Ein Arsch.
5
Nach dem Lunch mache ich meine Runde auf der Küstenstraße. Hier parken viele Leute, die mit der Bahn zur Arbeit fahren, anscheinend denken sie, hier wäre ein Park-and-Ride-Bereich. Aber sie lernen ihre Lektion ziemlich schnell. Anfangs glauben sie, dass es reicht, wenn sie die maximalen drei Stunden bezahlen, den Zug in die Stadt nehmen, ihr Auto den ganzen Tag hier stehen lassen und es abends um sechs wieder abholen. Vielleicht lässt Paddy das durchgehen, aber ich nicht. Ich belohne solche halbgaren Versuche nicht, die nicht mehr sind als eine Art Anzahlung. Du bezahlst für die Stunden, die du den Platz nutzt, es gibt keine Extrabehandlung, nicht einmal wenn du humpelst.
Als ich mich auf den Weg zurück in den Ort mache, sehe ich den gelben Ferrari ein paar Plätze entfernt von der Stelle, an der er vorhin stand, und ein aufgeregtes Kribbeln überläuft mich. Es ist wie Schach. Er hat seinen nächsten Zug gemacht. Eigentlich könnte ich für heute Feierabend machen, es ist fünf Minuten vor sechs, um sechs endet die kostenpflichtige Parkzeit. Für fünf Minuten kann man nicht bezahlen, das braucht man gar nicht erst zu versuchen, zehn Minuten sind das Minimum. Und obwohl ich ansonsten eine Paragraphenreiterin bin, erwarte ich von den Leuten ja auch nicht, dass sie zu viel bezahlen. Mit Geld macht man keine Scherze. Ich schaue mich um und vergewissere mich, dass der Ferrari-Typ nicht in Sicht ist und mich auch nicht beobachtet, ziehe meine Kappe ins Gesicht und gehe im Eilschritt zum gelben Auto. Mit wild klopfendem Herzen werfe ich einen Blick auf die Windschutzscheibe.
Er hat bezahlt. Zum ersten Mal. Meine Strafzettel haben gewirkt, ich habe seinen Widerstand gebrochen. Meine Maßnahmen waren erfolgreich. Aber er hat um 14.05 Uhr bezahlt, die drei Euro für die Höchstparkdauer von drei Stunden, also nur bis 17.05 Uhr. Und es wurmt mich immens, dass er anscheinend gedacht hat, dann kriegt er die letzte Stunde umsonst. Doch so funktioniert das nicht.
Ehe ich einen neuen Strafzettel ausstelle, scanne ich zur Sicherheit noch mal seine Registrierung, für den Fall, dass er womöglich online bezahlt hat. Hat er aber nicht.
Ich mache ein missbilligendes Geräusch und schüttle den Kopf. Dieser Kerl tut sich wirklich keinen Gefallen. Wenn er seinen Strafzettel an der Windschutzscheibe gelassen hätte, könnte ich ihm jetzt keinen neuen ausstellen. Ganz offensichtlich hat er daran nicht gedacht.
Ich verhänge das Bußgeld.
Und gehe schnellen Schrittes davon.
Als ich mit der Arbeit fertig bin, kann ich nicht nach Hause gehen, weil ich Becky ja gesagt habe, ich hätte etwas vor, und an einem Freitagabend gibt es nicht viele Orte, an denen man sich in einer Uniform der Verkehrswache verstecken könnte. Also kaufe ich mir an einer Imbissbude Fish and Chips, gehe in den Park von Malahide Castle und beobachte eine Gruppe Teenager, die mit verdächtig vollen Rucksäcken auf der Suche nach einem geheimen Plätzchen zum Trinken sind.
Gegen 21 Uhr wird es allmählich dunkel, ich kann nicht mehr viel länger draußen bleiben. Der Park wird nachts geschlossen, mir ist langweilig und kalt, und ehrlich gesagt möchte ich mir meinen Freitagabend nicht verderben lassen, nur weil ich mich geweigert habe, den Babysitter zu spielen. Wenn meine Vermieter jemand anderen gefunden haben, ist es sicher inzwischen ungefährlich für mich, nach Hause zu gehen.
Als ich ankomme, ist es 21.30 Uhr. Durch mehrere Fenster sehe ich Kinder vorbeisausen, aber nirgends entdecke ich die Eltern, ich weiß also nicht, ob Becky und Donnacha daheimgeblieben sind oder einen anderen Babysitter aufgetrieben haben. Für alle Fälle ziehe ich den Kopf ein, hoffe, dass sie mich nicht sehen und womöglich sagen: »Ach schau mal, du bist aber früh zurück, können wir jetzt ausgehen?« Mir ist kalt, ich bin müde, ich will eine Dusche und meinen Schlafanzug.
Sobald ich den Fitnessraum betrete, weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Alle Lichter sind aus, aber es fühlt sich an, als sei jemand im Gebäude. Für den Fall, dass es sich um einen Einbrecher handelt und ich schnell weglaufen muss, mache ich die Tür nicht hinter mir zu. Ich habe keine Angst, ich gehe davon aus, dass es Donnacha ist. Vom Fitnessraum führt eine Tür zu seinem Büro und eine Wendeltreppe hinauf zu meiner Studiowohnung. Sein Büro liegt unter meinem Zimmer und wird zum Pornoschauen und Masturbieren benutzt. Möglicherweise auch zum Schreiben von Rechnungen und für anderen Papierkram.
Im Büro ist niemand, das Geräusch kommt von oben, aus meinem Zimmer. Einen Moment überlege ich, ob ich vielleicht den Fernseher angelassen habe, aber ich weiß genau, dass das nicht sein kann. Es klingt viel zu real. Schnaufen und Ächzen, Stöhnen und Seufzen. Da hat jemand Sex in meinem Zimmer. Vermutlich sind es zwei, nur einen zu entdecken wäre mir noch unangenehmer.
Mein erster Gedanke ist, dass es Becky und Donnacha sind, die mich, weil ich nicht babysitte, damit bestrafen, dass sie in meinem Bett Sex haben, während ich unterwegs bin. Eklig, verwöhnt und überprivilegiert, wie sie sind. Kann man eigentlich überprivilegiert sein? Reicht es nicht, wenn man privilegiert sagt? Ich bin nicht sicher. Mein zweiter Gedanke: Es ist Donnacha. Vielleicht ist Becky ausgegangen, und er musste zu Hause bleiben. Vielleicht hat er gedacht, er kann mal ein bisschen Spaß ohne seine Frau haben. Die schauerliche Geschichte von der erfolgreichen Ehefrau, die von ihrem finanziell nicht abgesicherten Ehemann betrogen wird. Schaudernd frage ich mich, wie oft er mein Zimmer wohl schon dafür benutzt hat.
Leise steige ich die Wendeltreppe hinauf. Trotz ihres superleichten Designs sind meine Stiefel zu schwer und klobig, um Detektivin zu spielen. Mein Handy halte ich einsatzbereit in der Hand. Als ich sehe, dass meine Tür einen Spaltbreit offen steht, weiß ich, dass es Absicht sein muss, weil es sonst ein echt dämlicher Fehler wäre. Man lässt die Tür ja nicht auf, um erwischt zu werden, sondern um zu hören, wenn jemand kommt. Aber wenn man so lauten Sex hat, hört man gar nichts. Ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, halte mein Handy hoch und filme los, denn das macht man doch so, wenn etwas Gewalttätiges, Gefährliches oder Seltsames passiert. Erst filmen, dann denken. Wir haben unseren gesunden Menschenverstand verloren. Unser Mitgefühl. Unseren Instinkt, angemessen zu reagieren. Jetzt haben wir nur noch den Instinkt, sofort zu filmen und erst später zu denken und zu fühlen.
Ein behaarter, muskulöser Hintern ruckelt heftig zwischen zwei sonnengebräunten, schlanken, beeindruckend weit gespreizten, von manikürten Fingernägeln gehaltenen Beinen auf und ab. Ob die Nägel mit Shellac oder Gel behandelt sind, kann ich nicht erkennen. Wie biegsam sie ist und wie zuvorkommend, dass sie sich für ihn offen hält. Ein höchst damenhaftes Verhalten im Bett. Die Fingernägel erkenne ich, die Beine ebenfalls. Es sind Beckys.
Aha. Dann muss das also wohl Donnachas Hintern sein. Freut mich, dich kennenzulernen.
Jetzt, wo ich meine Vermieter erkannt habe, bilde ich mir nicht mehr ganz so viel auf meine Entdeckung ein, sondern bin in erster Linie angeekelt. Sicher, das Haus gehört ihnen, aber hier ist mein Privatbereich, und den haben sie verletzt, ohne jeden Zweifel. Wenn ich ihnen einen Strafzettel ausstellen könnte, würde ich es tun. Den würde ich auf diesen haarigen Hintern klatschen und hoffen, dass der Kleber gut hält und beim Abziehen richtig weh tut. Aber jetzt lasse ich mein Handy sinken, gehe leise die Treppe wieder runter und warte, dass sie zum Ende kommen. Was sie kurz darauf auch tun, lautstark und mit Genuss. Wahrscheinlich enorm stolz auf sich selbst und ihre pfiffige Idee.
Langsam gehe ich die Treppe wieder hoch, normal dieses Mal, schwere Füße nach einem harten Arbeitstag. Da ich ihnen reichlich Zeit gegeben habe, hoffe ich, dass sie inzwischen wenigstens einigermaßen präsentabel sind. Ich schiebe die Tür auf und achte darauf, dass man mir ansieht, wie überrascht ich bin, weil meine Tür nicht abgeschlossen ist und sich außerdem jemand in meinem Zimmer befindet.
»Herrje, Allegra, ich dachte, du wärst den ganzen Abend weg«, sagt Becky, eine echt amüsante Verteidigung, finde ich. Wie kann ich es wagen, hier einzudringen? Sie hat sich in eine Decke gewickelt, meine türkisfarbene Fleecedecke. Auf ihrem verschwitzten nackten Körper. Ihr Gesicht ist rot und sieht aus, als sei sie etwas aus der Fassung, wahrscheinlich hauptsächlich vom Sex und längst nicht so sehr aus Verlegenheit, wie ich es für angemessen halten würde. Zu meiner eigenen Überraschung reagiere ich tatsächlich schockiert, als ich sehe, dass der Hintern keineswegs Donnacha gehört. Allerdings scheint mein Auftauchen den Mann, der nicht Donnacha ist, weit weniger zu stören als Becky. Nämlich kein bisschen. Mit amüsiertem Gesichtsausdruck bückt er sich, in aller Ruhe und ungeachtet der Tatsache, dass er mir dabei seinen Hodensack direkt vors Gesicht hält.
»Könntest du uns bitte einen Moment Zeit lassen?«, fragt Becky gereizt, weil ich immer noch da bin. Als verfügte ich nicht mal über genügend soziale Intelligenz, um zu verschwinden und den beiden endlich ihre Privatsphäre zu lassen. Wortlos gehe ich wieder hinunter in den Fitnessraum, wo ich mich aufs Rudergerät setze und beim Nachdenken ein bisschen vor und zurück schaukle.