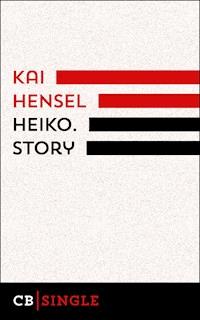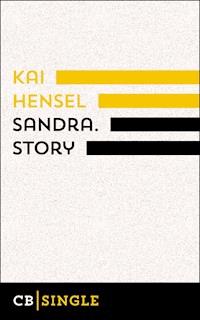Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Haiti, einige Jahre nach dem Erdbeben von 2010. Armut, Gewalt, Cholera. Hunderte Millionen Dollar Spendengelder. Ein mysteriöser Autounfall in den Bergen. Und eine junge Frau auf der Suche nach der Wahrheit. Jooly wollte ausbrechen aus ihrer satten Existenz in Deutschland. Sie wollte ein Leben mit Sinn, Teil werden einer besseren Welt. Gestorben ist sie in den Trümmern eines Geländewagens, in den schroffen Bergen Haitis. Alles sieht nach einem Unfall aus. Doch warum scheint niemand in Haiti sie gekannt zu haben? Warum gibt es keine Informationen über die letzten Wochen ihres Lebens? Und wer hat ihre Leiche verschwinden lassen? Maria Brecht, nach abgebrochenem Studium nun Barkeeperin in Berlin, fliegt in die Hauptstadt Port-au-Prince, auf der Suche nach der Wahrheit über ihre Freundin. Sie dringt ein ins Milieu der Entwicklungshilfe, in eine Welt von Elend und schönem Schein, Gewalt und Prasserei, Zärtlichkeit und Zynismus. Sie begegnet Rafael, einem jungen Fotografen aus Bremen. Gemeinsam brechen sie auf in die Berge. Und geraten auf die Spur eines Arztes, dessen Hilfsprojekt tödlich schief gelaufen ist. Sonnentau ist ein fesselnder, genau recherchierter Thriller über die Wahrheit hinter den Bildern von Armut und Krieg. Über Wohltäter und ihre Opfer, über Mitleid, Gier und die Sehnsucht nach einer besseren Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SONNENTAU. EIN FALL FÜR BRECHT UND VELASCO
Haiti, einige Jahre nach dem großen Erdbeben.
Armut, Gewalt, Cholera. Hunderte Millionen Dollar Spendengelder.
Ein mysteriöser Autounfall in den Bergen. Und eine junge Frau auf der Suche nach der Wahrheit.
Jooly wollte ausbrechen aus ihrer satten Existenz in Deutschland. Sie wollte ein Leben mit Sinn, Teil werden einer besseren Welt. Gestorben ist sie in den Trümmern eines Geländewagens, in den schroffen Bergen Haitis. Alles sieht nach einem Unfall aus. Doch warum scheint niemand in Haiti sie gekannt zu haben? Warum gibt es keine Informationen über die letzten Wochen ihres Lebens? Und wer hat ihre Leiche verschwinden lassen?
Maria Brecht, abgebrochene Studentin und Barkeeperin aus Berlin, fliegt in die Hauptstadt Port-au-Prince, auf der Suche nach der Wahrheit über ihre Freundin. Sie dringt ein ins Milieu der Entwicklungshilfe, in eine Welt von Elend und schönem Schein, Gewalt und Prasserei, Zärtlichkeit und Zynismus. Sie begegnet Rafael, einem jungen Fotografen aus Bremen. Gemeinsam brechen sie auf in die Berge. Und geraten auf die Spur eines Arztes, dessen Hilfsprojekt tödlich schief gelaufen ist.
Sonnentau ist ein fesselnder, genau recherchierter Thriller über die Wahrheit hinter den Bildern von Armut und Krieg. Über Wohltäter und ihre Opfer, über Mitleid, Gier und die Sehnsucht nach einer besseren Welt.
PRESSESTIMMEN ZU DAS PERSEUS-PROTOKOLL
»Ein unglaublich spannender, hochaktueller Polit-Thriller!«
FAZ
»Kai Hensel versteht es, aus Information und Phantasie ein so dichtes Netz zu knüpfen, dass dem Leser keine Gelegenheit bleibt, das Buch aus der Hand zu legen. Bis zur letzten Seite bleibt es spannend – von Anfang an.«
BAYERISCHER RUNDFUNK
»Absolut auf der Höhe der Zeit!«
FOCUS
KAI HENSEL
SONNENTAU
Ein Fall für Brecht und Velasco
15. Januar 2010
»Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker.«
Che Guevara
»Mitleid mit den Schuldigen ist Verrat an den Unschuldigen.«
Ayn Rand
0
»Möchtest du beten?«
Mads schüttelte den Kopf.
»Möchtest du schreien? Gott verfluchen?«
Mads wollte nicht beten. Er wollte nicht schreien. Er wollte nur, dass er nicht hier saß. Dass er nichts fühlte. Dass das alles nie passiert war.
»Es gibt Tage«, sagte der Pastor, »da können wir nicht beten. Wir möchten schreien: Wo war Gott? Warum hat er das Schreckliche nicht verhindert? Warum hat er die Unschuldigen nicht geschützt? Du hast gekämpft, mein Junge. Bis zum Schluss. Warum hat Gott dir nicht beigestanden?«
Faulige Luft wehte durch die zersplitterten Kirchenfenster. Draußen hustete ein Kind.
»Du kannst Gott nicht anklagen«, sagte der Pastor. »Also klagst du dich an. Du hast zu schnell gehandelt. Oder zu langsam. Du wolltest zu viel. Oder zu wenig. Wer kann das jetzt noch wissen? Weil Gott über dich nicht den Stab bricht, brichst du ihn selbst. Du verdammst dich. Du wünschst dich in die tiefsten Tiefen der Hölle.«
Das stimmte. Mads war bereit für die Hölle. Er war bereit, für seine Schuld zu zahlen. Wenn es einen Gott gab: Dann sollte er ihn jetzt von dieser Erde verstoßen! Er war nicht sicher, woher der Gestank von Kot und Erbrochenem kam. Ob er von draußen hereinwehte oder von den Kirchenbänken aufstieg. Vielleicht hing der Gestank auch in seinem Hemd, das er seit vier Tagen nicht gewechselt hatte. In den Poren seiner Haut, den Haaren seiner Nase. Der Mond schien durch einen Riss in der Mauer, genau hinter dem Kreuz. Das Taufbecken warf einen langen Schatten. Wieder hörte er das Kind husten.
»Du warst guten Willens, mein Junge.«
»Das reicht nicht.«
»Guter Wille muss reichen! Immer! Der Mensch besitzt keinen größeren Schatz als den Willen zum Guten! Die Sehnsucht nach dem Guten! Der Wille zum Guten ist die Sehnsucht nach Gott! Er heiligt unser Tun!«
Mads fühlte die große, warme Hand des Pastors, die sich auf seine Schulter legte. Draußen hörte er das Kind schluchzen, unterbrochen von Husten.
»Warum weint das Kind?«, fragte Mads.
»Es hat seine Eltern verloren. Soll ich es herbringen?«
»Der Husten klingt nicht gut.«
»Möchtest du es untersuchen?«
»Lieber nicht.«
»Das Kind hat sonst niemanden.«
Mads hörte die schweren Schritte des Pastors auf dem Zementboden. Hörte das Aufschieben einer Tür, die schief in den Angeln hing. Die Schritte kamen zurück, begleitet vom Tapsen kleiner, nackter Füße. Mads hob den Kopf. Ein Mädchen stand vor ihm, in einem eingerissenen, ärmellosen Kleid unbestimmter Farbe, das kaum die mageren Schenkel bedeckte. Vier oder fünf Jahre, hätte Mads noch vor wenigen Wochen vermutet. Inzwischen wusste er, was chronische Mangelernährung in einem Kinderkörper anrichtet. Das Mädchen war mindestens sieben.
»Wie heißt du?«, fragte Mads.
»Marie-Lourdes«, flüsterte das Mädchen.
Er fühlte ihm die Stirn: Fieber. Er tastete die Lymphknoten am Hals und in den Achselhöhlen ab: geschwollen. Er fühlte den Puls: über einhundertvierzig und schwach. Die Atmung war schnell, flach, er hörte leises Rasseln.
»Ich tippe auf Lungenentzündung«, sagte Mads. »Aber es kann auch Tuberkulose sein.«
Das Mädchen hustete.
»Sie muss an den Tropf«, sagte Mads. »Sie braucht Antibiotika und Paracetamol.«
»Wir müssen sehen, was möglich ist«, sagte der Pastor.
»Vor allem muss sie trinken. Sie braucht viel sauberes Wasser.«
»Ich möchte dir etwas zeigen.«
»Ihr Bauch ist gebläht. Sie muss –«
»Komm, mein Junge.«
Er fühlte die großen Hände, die ihn hochzogen. Ihm schwindelte, der Pastor stützte ihn. Führte ihn den Gang hinunter, weg von dem Mädchen.
»Aber –«
»Das Mädchen wird Hilfe bekommen.«
Der Pastor stieg eine steile, aus Brettern genagelte Stiege hoch. Mads folgte ihm, sah den ausgefransten Saum der schwarzen Hose, die Schuhe, die staubig waren und neue Sohlen brauchten. Oben stieß der Pastor die Luke auf. Mads sah Sterne und schwarzen Himmel. Am Himmel kreiste ein Hubschrauber.
»Du hast es gleich geschafft, mein Junge.«
Sie kletterten aufs Dach. Die Luft war schwül, stank nach Rauch und Verwesung. Aber sie war nicht so stickig wie in der Kirche. Sie standen zwischen Kabeln, zerbrochenen Plastikstühlen, dem Motor eines Generators. Der Pastor zündete eine Zigarette an und hielt Mads die Packung hin. Mads schüttelte den Kopf. Der Pastor stieß den Rauch durch Mund und Nase. Sie blickten über Wellblechhütten und ausgetrocknete Abwasserkanäle. Hier und da brannte eine Kerosinlampe. Drüben in Port-au-Prince loderten mehrere Feuer. Autos standen im langen Stau auf der Route Soleil.
»Sie reden von achtzigtausend Toten«, sagte der Pastor.
»Ich dachte fünfzigtausend?«
»Es werden von Stunde zu Stunde mehr. Morgen früh werden es einhunderttausend sein. Übermorgen einhundertfünfzigtausend. Wer kann das wissen?«
»Wenn erst die Seuchen ausbrechen …«
»Überall liegen Leichen unter den Trümmern. Keiner kann sie bergen. Die Straßen sind verschüttet, zu den Überlebenden kommt keine Hilfe. Alle haben Angst vor neuen Beben. Vielleicht steht uns das Schlimmste noch bevor.«
In der Cité Soleil hatte das Erdbeben nur wenig zerstören können. Die Menschen hatten ihre Bretter- und Wellblechhütten in wenigen Stunden wieder aufgebaut. Mads wusste nur von einigen Dutzend Toten und Verletzten, vor allem wegen Glassplittern und den scharfen Kanten der Bleche. Aber es gab nur wenige Nahrungsmittel. Vor allem fehlte Trinkwasser.
»Gott wollte uns strafen«, sagte der Pastor und sog an seiner Zigarette. »Für unsere Gewalt. Unsere Korruption. Unsere Verderbtheit.«
»Vater –«
»Ich weiß, du glaubst nicht an Gott. Und Gott zwingt dich nicht zum Glauben. Du bist nach Haiti gekommen, um Gutes zu tun. Um den Ärmsten zu helfen, die sich nicht helfen können. Gott, das Schicksal, nenne es, wie du willst – es hat dich hart geprüft. Wozu? Damit du aufgibst? Deine Koffer packst und nach Hause fliegst? Nach Europa, wo die Menschen es weich und bequem haben?«
Ja, das wollte Mads. Er wollte zurückfliegen. Er hatte kein Recht, noch länger hier zu sein. Nicht nach dem Schrecklichen, das unter diesem Kirchendach passiert war.
»Du hast in die Kameras gesprochen«, rief der Pastor. »Du hast die Menschen wachgerüttelt. Jede Minute, hast du gerufen, stirbt in Haiti ein Kind! Deine Stimme hat gebebt vor Zorn. Die Kameraleute, die Reporter, die Menschen in Europa vor den Fernsehern – sie haben dir geglaubt.«
Mads sah wieder die Kameras, die ihn umringten. Die Reporter in ihren schusssicheren Westen, als sei die Cité Soleil ein Kriegsgebiet. Seit zwei Tagen hatte er die Kranken und Verletzten ohne Strom behandelt, Tag und Nacht, im Schein von Kerzen und Kerosinlampen. Unter den Presseleuten hatte sich die Nachricht von dem jungen Dänen verbreitet, der Menschen in der Cité Soleil behandelte, wo sich sonst kein Helfer hintraute. Sie waren eingefallen wie hungrige Ratten. Plötzlich hatte es Strom gegeben, für Kameras, Scheinwerfer, Mikrofone. Überall waren eisgekühlte Cola- und Wasserflaschen aufgetaucht. Es hatte Mads Mühe gekostet, sich zu beherrschen. Den Reportern zu erklären, dass sie hier nicht auf einem Abenteuerspielplatz waren, sondern in der Cité Soleil. Dem am dichtesten besiedelten Slum der westlichen Welt. Dass die Patienten in der Kirche keine Statisten waren, sondern echte Slumbewohner. Für die es keinen Strom gab, kein Wasser, nur Müll, Exkremente und Moskitos. Dass diese Menschen deshalb, im Falle eines Ausbruchs von Seuchen, zu den ersten Opfern gehören würden. Und dass er, Mads Lerby, angehender Tropenmediziner aus Esbjerg, sich durch die verwüstete Stadt hierhergekämpft hatte, mit einem Wagen voller Impfstoffe. Um so viele Menschen zu impfen, wie er konnte. Ja, die Cité Soleil war für ihre Gewalt berüchtigt. Ja, aus einem zerstörten Gefängnis waren Bandenchefs ausgebrochen. Ja, es gab Gewalt und Plünderungen. Aber diese Kirche schützte ihn, Vater Boisseau schützte ihn, er tat, was er für diese Menschen tun musste. Und jetzt sollten sie ihn verdammt noch mal arbeiten lassen!
»In dir, mein Junge«, sagte der Pastor, »glüht die Kraft des Guten.«
Sie hatten seinen Wutausbruch gesendet. In Dänemark und noch ein paar anderen Ländern. Vielleicht sendeten sie ihn immer noch. Wahrscheinlich zeigten sie längst neue Szenen des Grauens, Material gab es genug. Niemand hatte Mads Lerbys Kampf der letzten vierundzwanzig Stunden gefilmt. Gegen Nebenwirkungen, die er sich in dieser Heftigkeit nicht erklären konnte: Krämpfe, Atemnot, Erbrechen. Er hatte gesagt, sie würden bald abklingen. Sie seien nichts gegen die Qualen, die ihnen drohten, wenn Seuchen ausbrachen; Cholera, Typhus, Diphterie, alles war möglich und eine Frage von Tagen. Sie hatten ihm geglaubt. Er hatte weitergeimpft. Hatte gegen das Misstrauen gekämpft, die eigene Erschöpfung, gegen Angst und Entsetzen. Was hätte er tun sollen, als die ersten Menschen starben? Aufgeben? Er hatte keine Kinder mehr geimpft, keine Alten, nur Starke und Gesunde. Aber auch sie waren kollabiert. Die sich erholt hatten, lagen immer noch schwach in ihren Hütten. Das letzte Opfer, eine Mutter von vier Kindern, war vor drei Stunden auf der Kirchenbank gestorben. Allergischer Schock? Überlastung des Immunsystems? Mads wusste es nicht. Er wusste nur, er durfte hier nicht bleiben.
»Morgen fliege ich zurück«, sagte er.
»Unsinn.«
»Ich kann für die Menschen nichts mehr tun.«
»Du bist ihre größte Hoffnung.«
»Ich habe keine Kraft mehr.«
»Wie willst du aus dem Land kommen? Jetzt?«
Mads zuckte die Schultern. Angeblich stand der Flughafen unter Kontrolle der US-Marines. Es musste Transporte über Land geben, in die Dominikanische Republik.
»Gras, mein Junge. Über eine Sache Gras wachsen lassen. Du weißt, was das Sprichwort bedeutet? Es bedeutet nicht, wir sollen die Hände in den Schoß legen. Es bedeutet schon gar nicht, wir sollen fliehen und uns vor der Verantwortung drücken. Das Gras braucht jemanden, der es sät. Das Sprichwort fordert uns auf zum Handeln.«
Der Pastor sog an seiner Zigarette. Unten wimmerte das Mädchen.
»Aber warum sollen wir Gras wachsen lassen? Warum nicht Unkraut oder Blumen? Kühe fressen Gras und geben Milch. Kinder spielen auf der Wiese Ball und stärken ihre Körper. Das Sprichwort fordert nicht bloß auf zum Handeln. Es fordert auf zum guten und nützlichen Handeln.«
Mads hörte die Stimme des Pastors, warm und dunkel. Aber er verstand den Sinn nicht. Er verstand nicht, warum sie hier oben standen, statt das Fieber des Mädchens zu senken.
»Warum aber sollen wir Gras über genau diese Sache wachsen lassen? Weil die Sache selbst zu Gras wird! Das Verwesende blüht, der Tod wird zu Leben! Das Gras nährt die Kühe, die Milch nährt die Kinder!«
»Vater –«
»Das Gras wächst, die Sache löst sich auf. Es kommt der Tag, an dem sie vollkommen verschwindet. Nur noch Kühe, nur noch Kinder!«
»Vater, wir müssen –«
»Leben und Gottes Schöpfung!«
»Das Kind krepiert!«
Boisseau blickte ihn an, aus seinen großen, auseinanderliegenden Augen. Das Mondlicht glänzte auf dem kahlen, schwarzen Schädel wie ein silberner See. Die sichelförmige Narbe auf der Stirn schien gütig auf Mads herunterzulächeln.
»Siehst du, mein Junge? Wie viel Kraft noch in dir steckt? Wie viel Wut? Du liebst Haiti! Du liebst seine Menschen. Ein Unglück ist geschehen. Ich rede nicht von ein paar Dutzend Toten. Ich rede von Hunderttausenden, von Verstümmelten ohne Arme, ohne Beine! Von Kindern ohne Eltern! Ich rede von einem kleinen Mädchen in einem zerrissenen Kleid, das ohne dich nur noch wenige Tage lebt! Diese Menschen leben! Sie brauchen dich!«
In dem Gewimmer des Mädchens verstand Mads die Worte: »Dlo! Dlo!« Wasser! Wasser!
»Eine Sache zwischen dir und mir«, sagte der Pastor. »Und einigen anständigen Männern, die nicht reden. Gras, mein Junge! Unter einer Bedingung: Du bleibst, wo dein Platz ist. In Haiti!«
Der Pastor warf den Rest seiner Zigarette in die Dunkelheit und hielt ihm seine Hand hin. Eine breite, kräftige Hand, mit Schwielen und einem eingerissenen Daumennagel. Eine Hand, die Steine geschleppt, Mörtel gerührt und Bretter genagelt hatte. Eine Hand, die diese Kirche gebaut hatte, eines der wenigen gemauerten Gebäude der Cité Soleil, das noch stand.
»Du glaubst nicht an Gott? Aber Gott glaubt an dich!«
Mads schlug ein. Schlug seine schmale, spröde Hand, die er regelmäßig eincremte, in die breite Hand des Pastors. Boisseau drückte ihn an seine Brust, er roch Schweiß und Zigarettenrauch. Boisseau lachte, hielt mit einem Arm Mads’ Schultern, breitete den anderen Arm aus, über die Cité Soleil, die Lichter und Feuersäulen von Port-au-Prince. Ja, Mads wollte bleiben. Er wollte arbeiten, seine Schuld wiedergutmachen, Haiti brauchte Männer wie ihn! Er fühlte keine Erschöpfung mehr, nur noch Schwindel und Euphorie. Er wollte die Stiege hinunterklettern, sofort, er wollte alles geben, seine letzte Kraft, um das Leben von Marie-Lourdes zu retten.
Boisseau trat an den Rand des Daches. Er pfiff durch zwei Finger. Mads sah Schatten, die sich von den Wänden lösten. Über den Hof huschten. Als hätten sie dort unten gelauert, schon die ganze Zeit, und nur auf diesen Pfiff gewartet. Der Schuppen hinter der Kirche wurde geöffnet. Die Schatten eilten hinein, kamen Sekunden später wieder heraus, beladen mit großen, blauen Plastiksäcken. Mads glaubte hier die Umrisse eines Beines, dort eines Kopfes zu erkennen.
»Wohin –«
»Gras, mein Junge.«
Einen Moment fühlte er sich betrogen. War alles nur Spiel gewesen? Scharade? Die Plastiksäcke wurden auf die Gepäckträger von Motorrädern gebunden, zwei, manchmal drei pro Motorrad. Sie haben Seile, dachte Mads. Sie sind vorbereitet. Alles geschah schnell und nahezu lautlos. Unter den geflüsterten Kommandos eines hochgewachsenen, kräftigen Jungen mit Brille und kahl rasiertem Schädel, den Mads öfter an der Seite des Pastors gesehen hatte. Er mochte um die zwanzig sein und trug als Einziger ein Sakko über seinem weißen T-Shirt. Ein Motorrad wurde gestartet, dann noch eines. Scheinwerfer flammten auf, der Junge in dem Sakko zischte ein Kommando. Sofort wurden die Scheinwerfer wieder gelöscht.
»Anständige junge Männer«, sagte der Pastor. »Sie werden schweigen.«
Die Motorräder verließen den Hof, ohne Rufe, ohne Licht. Mads sah ihre Schatten, die sich zwischen den Hütten verloren. Er hörte die Motoren, die leiser wurden, er konnte nur vermuten, dass sie die Cité Soleil Richtung Norden verließen, auf der Route Soleil. Der Junge im Sakko blieb allein auf dem Hof. Er schloss die Tür des Schuppens. Er blickte hoch zum Pastor. Der Pastor nickte. Mads hörte das Knarren der Kirchentür. Nahm der Junge das Mädchen mit? War auch sie Teil der Inszenierung gewesen?
»Weinen wir, mein Junge«, sagte Boisseau und zündete sich eine neue Zigarette an. »Weinen wir um die Toten. Aber um die Lebenden dürfen wir nicht weinen. Um die Lebenden müssen wir kämpfen!«
Einige Jahre später
Mittwoch
»Glück ist zuerst und vor allen Dingen das stille, frohe, sichere Gefühl der Schuldlosigkeit.«
Henrik Ibsen
1
Draußen fiel Regen aufs Pflaster. Die Sirene eines Krankenwagens kam näher und entfernte sich über die Prinzenbrücke. Kurz nach Mitternacht. Kaum Gäste in der Bar. Vor einer halben Stunde hatte Maria das letzte Glas gespült. Jetzt saß sie auf ihrem Hocker und hörte den Improvisationen Lennie Tristanos zu. Die Lieblingsmusik auflegen, solange sie noch konnte. Solange sie diesen Job noch hatte.
»Ich halte das nicht mehr aus«, sagte Annett.
Annett kam immer vor ihrer Schicht, nach ihrer Schicht oder wenn sie ihr Leben nicht mehr aushielt. Also eigentlich jede Nacht. Sie galt als fähigste Krankenschwester des Urban-Krankenhauses und trank nie etwas anderes als Grüne Wiese: Blauer Curaçao, Wodka, Sekt, Orangensaft. Den Orangensaft ließ Maria meistens weg. Schwester Annett litt, wenn sie ihr Leben nicht aushielt, unter Vitamin-Intoleranz. Sie konnte Stunden auf ihrem Hocker sitzen, dick, grauhaarig, mit verquollenem, rot geädertem Gesicht. Saugte an ihrem Strohhalm. Wartete, dass sich ein Mann in die Bar verirrte, ebenso einsam und betrunken wie sie. Hin und wieder passierte das sogar. Dann lehnte Annett ihren Kopf an seine Schulter, strich mit ihren Fingern über seinen Arm und flüsterte: »Hältst es mit mir aus?«
Heute nicht. Kein Mann an der Bar. Nur ein paar englische Jugendliche, die sich hinten auf den Sofas lümmelten und auf den Fernseher starrten. Philips Kugelfernseher von 1972. Alle Folgen Raumpatrouille Orion, nonstop. Manche Gäste kamen nur wegen des Fernsehers. Eine Ecstasy, zwei Joints, drei doppelte Wodka, Raumpatrouille Orion gucken – das war der Kreuzberger Geheimtipp. Hin und wieder zog der Fernseher die falschen Gäste an, aber meist blieb alles friedlich. Englische Touristen waren besser als ihr Ruf. Fast immer schafften sie es rechtzeitig zum Kotzen vor die Tür.
Annett schob Maria ihr Glas hin: »Mach mal ohne Sprudel.«
Maria nickte und stand auf. Also keinen Sekt. Digression endete, Intuition begann, während sie Curaçao und Wodka in den Mixer kippte. Sie stellte sich Lennie Tristano vor, der seit seiner Kindheit blind gewesen war. Und trotzdem einer der besten Cool-Jazz-Pianisten der Welt. Weil er einfach wusste, welche Tasten er drücken musste. Weil er wusste, was richtig war und was falsch.
Sie hörte das Aufstoßen der Tür. Sie zuckte zusammen, als sie, vor einer Wand aus Regen, einen hochgewachsenen Mann im Kamelhaarmantel sah. Der Anwalt? Blödsinn, ein Anwalt kam nicht nachts in die Bar. Sie schenkte den Cocktail ins Glas. Hinter dem Mann fuhr ein Taxi an, bevor die Tür wieder zufiel.
Maria stellte Annett das Glas hin. Der Mann mochte Mitte fünfzig sein und sah nach Geld aus. Er blickte sich um. Was er sah, gefiel ihm offenbar nicht: Schwarz gestrichene Wände. Glühbirnen, verhängt von grünen Glasperlen. Betrunkene Engländer auf Chintz-Sofas. Er knöpfte seinen Mantel auf. Maria deutete auf die Haken neben der Tür. Er entschied sich, seinen Mantel anzubehalten. Als habe er nicht vor, sich hier lange aufzuhalten. Er setzte sich auf einen Hocker und lockerte den Knoten seiner Krawatte.
»Was haben Sie?«, fragte er.
»Ziemlich alles«, sagte Maria.
»Was trinkt die Dame?«
»Grüne Wiese.«
»Ganz schön blau für Grüne Wiese.«
»Wie wär’s mit einem Gimlet?«
Er nickte. Chandler, Hemingway, Bogart … Kein mittelalter Mann mit Geld sagte Nein zu einem Gimlet.
Maria verrührte Gin, Limettensaft und Eiswürfel. Ab und zu erwiderte sie den Blick des Mannes. Volles, graues Haar. Glatte, gebräunte Haut. Kräftiges Kinn. Sehr weiße Zähne. Maria war nicht sicher, ob sie diesen Mann schon einmal gesehen hatte. Wenn, dann nicht in dieser Bar. Annett linste herüber. Hoffentlich beherrschte sie sich.
»Streit gehabt?« Er deutete auf das Pflaster an ihrem Unterkiefer.
»Gegen den Schrank gestoßen.«
»Großes Pflaster.«
»War eine scharfe Kante.«
Maria stellte ihm das Glas hin.
Er nippte.
Er sagte nichts.
Manche Gäste lobten, indem sie sich nicht beschwerten.
Progression endete. Requiem begann. Einer der Engländer stand auf, ein magerer Jüngling mit blasser Haut und einem Ring in der Augenbraue. Er rülpste, streckte die Brust heraus und taumelte zur Tür.
»Jeden Abend in der Bar?«, fragte der Mann.
»Fast«, sagte Maria, während sie die Armaturen der Spüle wischte.
»Kein Studium? Keine Ausbildung?«
»Die Bar ist mein Studium.«
»Lassen Sie mich raten«, sagte er. »An Ihren freien Tagen wissen Sie nichts mit sich anzufangen.«
Sie zuckte die Schultern. Was sollte sie sagen? Er hatte recht. Draußen kotzte der Jüngling.
»Keine Richtung, kein Ziel«, sagte er. »Das Leben grau und trübe. Eigentlich hätten wir viele Möglichkeiten. Wir sind jung. Wir sind gesund. Wir sind nicht einmal dumm. Wir müssten uns nur aufraffen. Uns für eine Sache entscheiden. Aber irgendwie – wir kriegen’s nicht hin. Wie alt sind Sie? Fünfundzwanzig, sechsundzwanzig?«
Auch mit der Schätzung ihres Alters lag er richtig. Er schüttelte den Kopf und trank. Etwas stimmte mit seinem Gesicht nicht. Wenn er redete, zog er den rechten Mundwinkel höher als den linken. Trotzdem blieb die Wange rechts glatt, links legte sie sich in Falten. Er war ein gut aussehender Mann. Aber reden sollte er lieber nicht.
»Plötzlich taucht eine alte Freundin auf«, sagte er. »Seit Jahren nicht gesehen. Genauso unglücklich und verwirrt wie wir selbst. Weiß nicht, wohin mit ihrem Leben. Aber dieser Freundin geben wir Ratschläge. Ihr setzen wir einen Floh ins Ohr. Abhauen soll sie! Mutig sein! In der Ferne neu anfangen! Genau das neue Leben, das wir uns selbst nicht trauen. Habe ich recht, Frau Brecht?«
Maria hielt inne. Der Mann wusste ihren Namen. Er fixierte sie und sah nicht freundlich aus. Etwa doch der Anwalt? Jetzt, dachte sie, sollte Annett kommen. Sich auf den Hocker nebenan setzen, an seinem Ohrläppchen lecken und Obszönitäten flüstern. Aber irgendetwas schien Annett einzuschüchtern. Sie blieb auf ihrem Hocker sitzen, kaute an ihrem Strohhalm und linste herüber.
»Oder wollten Sie gar nicht, dass Juliane ein neues Leben anfängt?«, fragte er.
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»War es von Anfang an Ihr Plan?«
»Sie –«
»Noch einen Gimlet!«
Marias hatte das Gefühl, den Mann zu erkennen. Aber das war unmöglich. Sie hatte ihn zuletzt vor acht Jahren gesehen. Schon damals hatte er weniger Haare auf dem Kopf gehabt als heute. Hatte älter ausgesehen. Zu viel Verantwortung. Zu wenig Schlaf. Sie schaute von ihrem Mixer hoch. Sie blickte auf eine faltenfreie Stirn und überweiße Zähne. Es gab nur eine Lösung: Er hatte es auch getan. Hatte sich unters Messer gelegt wie seine Patienten. Unter das Messer seiner eigenen Chirurgen wahrscheinlich. Sie hatten gute Arbeit geleistet. Wenn Doktor Ahrens sich im Spiegel anblickte, konnte er sich für einen gutaussehenden Mann halten. Solange er den Mund nicht bewegte.
»Wo ist Juliane?«, fragte er.
»Ich habe von ihr seit Monaten nichts gehört.«
»Wie viele Monate?«
»Drei oder vier.« Sie stellte ihm seinen zweiten Gimlet hin. »Sie haben recht, Juliane war hier. Aber nicht, damit ich ihr Ratschläge gebe. Sondern um sich zu verabschieden.«
»Sind Sie sicher?«
»Sie hatte gerade ihr Cabrio verkauft.«
»Haben Sie versucht, sie daran zu hindern?«
»Warum sollte ich?«
»Sie war ihre Freundin.«
»Wir waren Schulfreundinnen. Wir hatten uns seit Jahren nicht gesehen.«
»Und in der letzten Nacht kommt sie zu Ihnen?«
»Ich glaube, es gab in ihrem Leben nicht mehr viele Menschen, zu denen sie gehen wollte.«
Der englische Jüngling kam zurück. Schwankend blieb er im Raum stehen und wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht.
»Danach haben Sie nichts mehr von ihr gehört?«, fragte Ahrens.
»Sie hat Newsletter geschrieben. Aus El Salvador, Costa Rica, Honduras … Sie hat für Entwicklungshilfeprojekte gearbeitet, meistens etwas mit Umwelt oder Kindern. Die letzte Mail kam aus Nicaragua. Ich glaube, es ging ihr nicht gut. Sie war enttäuscht von den Projekten. Sie hatte das Gefühl, dass sie keiner braucht. Vor allem hatte sie Geldprobleme.«
»Wollte sie zurückkommen?«
»Davon hat sie nichts geschrieben.«
»Haben Sie ihr abgeraten, zurückzukommen?«
»Ist das ein Verhör, Doktor Ahrens?«
»Juliane wollte zurück nach Deutschland kommen.«
»Kann sein.«
»Ich habe ihr Geld nach Nicaragua geschickt, für den Rückflug.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Sie hat versprochen, sie kommt zurück!«
Er trank sein Glas leer und setzte es ab. »Haben Sie ihr geschrieben, sie solle weitermachen?«
»Warum sollte ich?«
»Weil Sie Ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen!«
»Mein Leben geht Sie –«
»Sie lügen!«
Maria blickte auf Adern, die unter den glatten Schläfen schwollen. Auf Operationsnarben, die sich als weiße Streifen neben den Mundwinkeln abzeichneten. In fiebrig glänzende Augen.
»Sie wollten immer sein wie Juliane!«
»Lange her.«
»Juliane war alles, was Sie nicht waren!«
»Schwachsinn!«
»Ist das Ihre Rache?!«
Plötzlich stand der Engländer am Tresen. Ließ seine Faust auf Ahrens’ Schulter fallen und sagte auf Deutsch:
»Ich schlage deine Fresse.«
»Verzieh dich!«, rief Ahrens.
»Du hörst auf, die Frau herumzuschreien, oder ich schlage deine Fresse.«
»Wisch dir den Mund ab«, sagte Maria.
Der Engländer begriff nicht. Annett schnippte mit dem Finger und fasste sich an die Lippe. Der Engländer fühlte den Rotz auf seinem Mund. Er ließ seine Faust sinken und ging langsam, sehr aufrecht zu den Toiletten.
»Ich weiß nicht, wo Jooly ist«, sagte Maria. »Ich habe seit drei Monaten nichts gehört. Ich hatte ganz bestimmt keinen Grund, mich für irgendetwas zu rächen!«
Ahrens schüttelte den Kopf, in ungläubigem Staunen über eine so plumpe Lüge. Er richtete seine Krawatte. Er fingerte einen Fünfzig-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie und legte ihn auf den Tresen:
»Rest für Sie.«
»Sie sind großzügig.«
»Ihre Gimlets sind schwach.«
»Sie verletzen meine Gefühle.«
Er stand auf. Er schwankte und musste sich am Barhocker festhalten. So viel zu den schwachen Gimlets. Er knöpfte seinen Mantel zu. Der Engländer kam von den Toiletten, einige Sekunden standen sie sich gegenüber. Crosscurrent begann, eines von Marias Lieblingsstücken. Der Engländer zog sich zurück zu seinen Kameraden auf die Sofas. Ahrens ging zur Tür, zog sie auf und trat in den prasselnden Regen.
»Ich halte das nicht mehr aus«, sagte Annett.
Maria setzte sich wieder auf den Hocker. Warne Marsh spielte sein Solo. Dietmar Schönherr kämpfte mit Außerirdischen um die Zukunft der Galaxie. Maria spürte Erleichterung, fast Stolz. Diesen Konflikt hatte sie ohne Eskalation überstanden. Vielleicht war ihr Fall doch nicht hoffnungslos. Aber was war mit Jooly? Wo war sie? Maria hatte in den letzten Wochen ein paarmal an sie gedacht. Hatte ihren Namen gegoogelt. Leute gefragt, die sie kannten. Hatte ihr zwei Mails geschrieben. Keine Antwort, kein Lebenszeichen. Sie hatte sich Sorgen gemacht, aber nur flüchtig. Jooly war nie zuverlässig gewesen. Und die meisten ihrer Hilfsprojekte waren in Dörfern. Solange sie dort lebte, kam sie nicht ins Internet.
»Machst noch einen?«, fragte Annett. »Ohne die blaue Sauce?«
»Du willst eine Grüne Wiese, aber ohne Orangensaft, ohne Sekt und ohne Blauen Curaçao?«
»Getroffen.«
»Du willst einen Wodka, Annett. In Wahrheit willst du ein Cocktailglas voll Wodka.«
»Sei nicht so direkt.«
Maria schenkte das Glas voll. Annett war Alkoholikerin. Man konnte mit ihr nicht darüber reden, weil sie es wusste. Vor niemandem stritt sie es ab. Auf ihrer Station arbeitete sie präzise. Alkoholiker, die sozial funktionierten, waren hoffnungslose Fälle. Maria funktionierte auch noch, mehr oder weniger. Wie lange noch?
Joolys Mail aus Nicaragua war an dem Tag gekommen, an dem Maria endgültig ihr Politikstudium abgebrochen hatte. Als sie vor den Trümmern ihrer Zukunft gestanden und sich gefühlt hatte wie der letzte Dreck. Deshalb war ihre Antwort auf die Mail heftiger ausgefallen als sonst. »Hör auf zu jammern!«, hatte sie geschrieben. »Wenn das Leben zu hart ist, bist du zu weich! Wenn du es in der Entwicklungshilfe nicht packst, entwickele dich erst mal selbst!« Noch einige andere Dinge hatte sie geschrieben, an die sie sich nicht genau erinnerte.
Auf diese Mail hatte Jooly nie geantwortet.
2
»Wie lange noch bis Port-au-Prince?«, fragte Michelle.
»Eine Stunde, Madame.«
»Wir kommen bei Dunkelheit an?«
»Jawohl, Madame.«
Seit zwanzig Minuten fuhren sie hinter einem Pick-up her. Menschen kauerten auf der Ladefläche, zwischen Reissäcken und Getränkekisten. Hühner und Ziegen hingen kopfüber von den Seiten, die Beine mit Schnüren an die Ladeklappen geknotet. Menschen und Tiere starrten aus ausdruckslosen Augen auf den Toyota Landcruiser, der hinter ihnen herfuhr. Courtois schaltete einen Gang herunter, setzte zu einem Überholmanöver an … Keine Chance. Ein Konvoi von UN-Fahrzeugen kam ihnen entgegen.
»Ist es abends in Port-au-Prince gefährlich?«
»Fast nie, Madame.«
Rafael saß auf dem Rücksitz und überprüfte auf dem Display seiner Kamera die Bilder des Tages. Singende Kinder. Tanzende Frauen. Kranke, denen Michelle die Hand hielt. Mikrofone, in die sie Wörter wie espoir, avenir, croissance durable sprach. Wörter, die Rafael inzwischen verstand, weil sie sich überall, wo sie hinkamen, wiederholten: Hoffnung, Zukunft, nachhaltiges Wachstum. Die Besichtigung der Meerwasserentsalzungsanlage in Jacmel war ein Flop gewesen. Vor zwei Jahren hatten die Deutschen die Gelder bewilligt, heute hatten sie nicht mehr besichtigen können als eine Planierraupe und ein paar Säcke Zement. Michelle hatte in die Runde gestrahlt, als stehe die Entsalzungsanlage kurz vor der Eröffnung, und von progrès und développement geredet. Die Menschen hatten applaudiert. Rafael waren immerhin ein paar schöne Fotos gelungen: eine Plastiktüte, die sich in der Schaufel der Planierraupe verfing. Eine Krähe im Baum, die skeptisch auf den dicken Bürgermeister mit seiner goldenen Uhrkette herabblickte.
»Können Sie nicht überholen?«, fragte Michelle.
»Ich kann es versuchen, Madame.«
»Ja, bitte.«
Courtois beschleunigte, bremste … Ein Pick-up kam ihnen entgegen, die Ladefläche voller Kinder in Schuluniformen.
»Es ist nicht möglich, Madame.«
»Schon gut.«
Michelle lehnte sich auf dem Vordersitz zurück. Sie war ungeduldig. Rafael kannte sie nicht anders. Sie schaute auf die Uhr ihres Blackberrys, den sie im Wagen fast immer in der Hand hielt. Wahrscheinlich überlegte sie, ob sie um diese Zeit in Deutschland anrufen und ihre Referentin aus dem Bett klingeln konnte. Es war halb sieben. In Deutschland war es sechs Stunden später. Selbst Michelle musste einsehen, dass das zu spät war. Sie begann, auf ihren Blackberry einzutippen.
»Haben Sie gesehen?«, rief Courtois. »Der Wagen vor uns fährt ohne Bremslicht! Fast wäre ich in die Ziegen gefahren!
Auf der Gegenspur kam ihnen ein Geländewagen von CARE INTERNATIONAL entgegen. Die weiße, blitzsaubere Lackierung glühte im violetten Abendlicht. Courtois fuhr an, nach einigen Metern standen sie erneut.
»So ist das in diesem Land«, schimpfte er. »Keine Verantwortung!«
Junge Frauen gingen an den wartenden Autos vorbei, Tabletts voller Bananen, Erdnüsse, gegrillter Hühnerspieße auf dem Kopf. Plastikbeutel mit Ananasstückchen wurden den Pick-up hoch-, einige Münzen heruntergereicht. Ein Huhn pickte in den Arm einer Verkäuferin.
»Wollen wir etwas kaufen?«, fragte Rafael.
»Sie werden krank«, sagte Courtois.
»Ich habe schon oft auf der Straße gegessen.«
»Courtois hat recht«, sagte Michelle. »Ich kann nicht riskieren, dass du die letzten Tage im Bett liegst. Ich brauche dich.«
»Für den Präsidenten?«
»Unter anderem für den Präsidenten.«
In ihrer Stimme hörte er einen Hauch Gereiztheit. Heikles Thema. Der Präsident. Sein Büro hatte zweimal den Termin verschoben. Michelle wollte den Termin, unbedingt. Politische Hoffnungsträgerin. Reise an den Ort ihrer Kindheit. Kontakt mit den Menschen, Aufbau und Hoffnung. Und als Höhepunkt: Treffen mit dem Präsidenten, Lächeln und Handschlag. Projekte für die Zukunft, Aufträge für die Bremer Industrie. Klar, damit konnte sie Eindruck machen.
Ein Mädchen kam zu ihrem Wagen, zeigte Plastiktüten mit Mangostückchen und geschälten Orangen. Michelle sah von ihrem Blackberry auf und schüttelte den Kopf.
Sie fuhren an einem umgekippten Biertransporter vorbei. Wahrscheinlich hatte der Fahrer den Riss im Asphalt zu spät gesehen. Oder die Bremsen hatten versagt. Zerbrochene Flaschen lagen in schaumigen Pfützen, Biergestank drang in den Wagen. Männer standen gestikulierend am Straßenrand.
»Eine neue Straße«, sagte Courtois. »Die Franzosen haben sie letztes Jahr gebaut. Aber haben sie auch den Kanal entsandet? Sie haben ihn nicht entsandet! Und schon ist der Asphalt unterspült! Was sage ich? Keine Verantwortung!«
Er beschleunigte und überholte den Pick-up. Ein halber Mond stand über den kahlen Bergen. Sie waren nun acht Tage im Land. Und noch immer faszinierte es Rafael, wie schnell es hier dunkel wurde. Haiti lag bloß zweitausend Kilometer nördlich des Äquators. Tag oder Nacht, dazwischen gab es nicht viel.
»Habe ich dir erzählt, dass die Süddeutsche Zeitung einen Gastbeitrag von mir will?«, fragte Michelle.
»Nein.«
»Gewalt, Korruption, Naturkatastrophen, das Übliche. Ich will den Akzent mehr auf Hoffnung legen. Dass die Menschen anpacken, nach vorn schauen, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.«
»Dann schreiben Sie lieber nichts von der Entsalzungsanlage.«
»Wir sind nicht hier, um uns als Zuchtmeister aufzuspielen. Angeblich liegt dringend benötigtes Baumaterial seit Monaten beim Zoll. Was sollen sie machen? Und dann diese Straßen! Ich werde schreiben, eine bessere Infrastruktur ist der Schlüssel.«
Sie tippte, als habe sie einen wichtigen Einfall, in ihren Blackberry. Sie fuhren durch ein Dorf. Kerosinlampen flackerten vor Lehmhütten. Nackte Kinder standen am Straßenrand und winkten.
Die letzten Tage in Haiti. Montag der Rückflug. Bis jetzt war die Reise ein Erfolg gewesen. Für Michelle de Sélestat war es die Rückkehr in das Land ihrer Vorfahren. Für Rafael sein erster größerer Auftrag als Fotograf. Blieb der Termin beim Präsidenten. Und morgen früh die Besichtigung ihres Geburtshauses. Rafael kannte sie inzwischen gut genug, um zu wissen, in welchen Momenten, aus welchen Perspektiven er am besten abdrückte. Sie war kein einfaches Motiv: Das Gesicht war rund und eher flach, der Ansatz ihrer kurzen, grauen Haare zu hoch. Die Vorderzähne standen ein wenig auseinander, was ihrer Mimik, vor allem, wenn man von schräg unten fotografierte, eine aggressive Note gab. Der Rest ihres Körpers machte nichts besser: der Rücken rund, die Hüften breit, die Beine kurz. Sie war keine schöne Frau, schon gar nicht nach den Maßstäben Haitis. Sie wusste es und machte den Mangel an Attraktivität mit Schnelligkeit und Intelligenz wett. Je größer die Menschenmenge, zu der sie redete, umso mehr war sie in ihrem Element. Doch in den letzten Tagen hatte Rafael in ihrem Gesicht immer öfter Anspannung und Erschöpfung gesehen. Wie im Gesicht eines Schauspielers, dessen Hauptrolle in einem Stück nicht enden will. »Müssen wir da wirklich hin?«, hatte sie ihn heute Morgen gefragt, vor der Besichtigung der Entsalzungsanlage. Aber schon war sie aus dem Wagen gestiegen, hatte gewinkt, gelacht und Babys an ihre Brust gedrückt.
Was wollte sie beweisen?
3
Maria schloss die Wohnungstür auf.
Etwas roch verbrannt.
Sie tastete nach dem Lichtschalter.
Drückte ihn.
Nichts.
Sie tastete sich an der Wand entlang. Stolperte über etwas Hartes. Schuhe, die jemand ausgezogen und in der Diele hatte liegen lassen. Sie tastete sich weiter bis zum Türrahmen. Sie sah einen schwachen, rötlichen Lichtschein. Sie drückte, auf der anderen Seite des Türrahmens, den Lichtschalter…
An der Decke leuchtete eine Glühlampe auf. Sie schien auf einen Eichentisch voller Wachs- und Rotweinflecken. Auf Holz- und Plastikstühle. In der Spüle stapelten sich verdreckte Teller, Gläser, Pizzakartons. Am Herd glühte ein rotes Licht, kaum sichtbar hinter einer Kruste von Sauce Bolognese.
»Hallo, Adorno«, sagte Maria.
Auf der Fensterbank, zwischen Töpfen mit längst vertrocknetem Schnittlauch und Basilikum, hockte eine Ratte. Sie hob leicht den Kopf, als sie Maria kommen sah, und ließ sich von ihr zwischen den Ohren kraulen.
»Schönen Tag gehabt?«
Wenn Maria auf die fünfundzwanzig Jahre ihres Lebens zurückblickte, fand sie nur eine Sache, die sie wirklich gut gemacht hatte: Sie hatte Adorno aus der Bio-Tonne gerettet. Als winziges, halbtotes rosa Baby hatte er zwischen verfaulten Salatblättern gelegen. Maria hatte ihn an den Fingerspitzen herausgehoben, nach oben getragen und in Taschentücher gewickelt. Aus einer Pipette hatte sie ihm warme Milch gegeben, alle zwei Stunden. Niemand sonst in der WG hatte an sein Überleben geglaubt. Man war sich nicht einmal einig gewesen, um was für ein Tier es sich handelte: Hamster, Hase, Meerschweinchen, es konnte alles sein. Aber das Baby hatte überlebt und war zu einer Ratte gereift: einer hübschen Husky-Ratte mit weißem Fell und grauem Rücken. Fredrik, mit vierunddreißig Jahren die graue Eminenz der WG, hatte ihr den Namen gegeben: Adorno. Weil es zu Brecht passte. Adorno hielt mit seiner heiteren Intelligenz die Wohngemeinschaft zusammen. Er hatte inzwischen einen Käfig, aber meist lief er frei herum und erledigte sein Geschäft brav in den Blumentöpfen. Er ließ sich gern streicheln und schlief am liebsten in einem Schoß oder auf einer Schulter. Aber nur wenn Maria ihn rief, kam er angelaufen. Sie hatte ihm das Leben gerettet. Ratten merken sich so etwas.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!