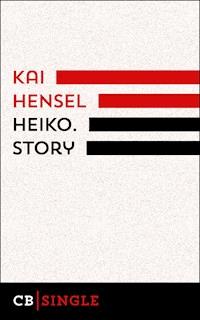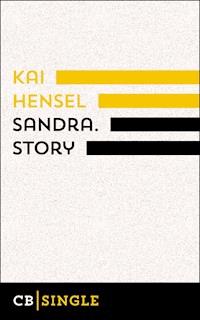12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jana kommt aus der Provinz nach Berlin mit einem Plan: Geld verdienen für ihren Traum, als erste Frau die Rallye Dakar zu gewinnen. In einer schicksalhaften Nacht begegnet sie dem ehemaligen Bürgermeister Pankelow – einst umschwärmt, heute verfemt, eines von vielen Opfern des neuen Flughafens. Der brütet seit Jahren vor der Stadt, verweigert seine Eröffnung, ruiniert Karrieren und produziert Baumängel wie giftige Blüten. Was ist sein Geheimnis? Tiefer und tiefer dringt Jana ein in die Wahrheit des Terminals. Rasant und witzig erzählt dieser Roman von Gier, Neid, Illusionen - und den vielen falsch verlegten Kabeln in uns allen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Jana zieht aus der Provinz nach Berlin, für ihren Traum braucht sie Geld. Dort reden alle vom neuen Flughafen: Vor den Toren der Stadt brütet er, erzeugt Baumängel und ruiniert Karrieren. Eines seiner Opfer ist der ehemalige Bürgermeister Pankelow. Als Jana ihm begegnet, gerät sie in ein gefährliches Dickicht aus Gier, Neid und Illusionen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Kai Hensel (*1965) arbeitete zunächst als Werbetexter und Comedy-Autor sowie als Drehbuchschreiber. Seine Theaterstücke Klamms Krieg und Welche Droge passt zu mir? wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für sein Werk wurde Hensel mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Kurzkrimi-Preis.
Zur Webseite von Kai Hensel.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Kai Hensel
Terminal
Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
© by Kai Hensel 2021
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Lex Rayton (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31090-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 19:48h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TERMINAL
20. Juli 200514. November 2012Erster Teil — Einige Jahre später1 – Wer nachts um drei Pizza bestellt, hat ein …2 – Es ist alles lange her«, sagte Staatssekretär a …3 – Was ist gestern passiert?«, fragte Manolo und bestreute …4 – Sie fuhren auf der Avus zurück nach Berlin5 – Wenn jeder einfach seine Arbeit macht, wird die …6 – Sie fuhren auf der Sonnenallee Richtung Osten …Zweiter Teil — Drei Tage später7 – Bienchen stand am Fenster, rührte in ihrem Kaffee …8 – Sie fuhren auf der Greifswalder Straße Richtung Alexanderplatz …9 – Die beiden Frauen joggten nebeneinander auf der Startbahn …10 – Seit zwanzig Minuten saß Jana im Rometsch und …11 – Sam stand im Türrahmen und sah den Afrikanerinnen …12 – Auf dem Glastisch der ockerfarbenen Sitzecke lag der …13 – Jana stand unter der Dusche, ließ heißes Wasser …14 – Der Tag war ein großer Erfolg«, sagte Pankelow …15 – Einen Gute-Laune-Saft für die Lady.«Dritter Teil — Einige Tage später16 – Liebe Mama17 – Ich freue mich, dass wir uns nach so …18 – Viele meiner Mitschüler wollen später das Familienunternehmen klimaneutral …19 – Ich leg jetzt auf«, sagte Bienchen. »Ruf nie …20 – Der Regenschauer war vorbeigezogen. Sam hatte gesagt …21 – Minister Breyer stand im Jacob-Astor-Saal des Hotels Waldorf …22 – Weil du nichts begreifst.«23 – Versuchen Sie Ihr Glück im Tiergarten.« Die Stimme …24 – Zoë war nur zufällig hier. Sie hatte nicht …25 – Reichert hob einen Pflasterstein hoch, darunter lag ein …26 – Sam ging auf das Terminal zuVierter Teil — Am nächsten Tag27 – Jana drückte die Ladentür auf. Sie roch Farne …28 – Wir müssen ihnen bald was bieten«, sagte Pankelow29 – Jana lag auf dem Bett und starrte an …30 – Diese Nachricht«, sagte Schnettke, »ist sehr, sehr gut.«31 – Ich habe einen Fehler gemacht«, sagte Jana. »Es …32 – Sam loggte aus und fuhr seinen Computer herunter …33 – Es tat gut, wieder die Kälte zu spüren …34 – Bienchen stand an der Tür zum Wintergarten …35 – Seit einer halben Stunde schon folgte Jana dem …36 – Sam trat aus dem Fahrstuhl. »Hier«, sagte er …37 – Bei Tina und Horst – Bienchen blieb vor …38 – Sam stand auf der Terrasse. Sie führte um …Fünfter Teil — Am nächsten Tag39 – Man weiß über einen Menschen nie alles40 – Von: Gisela T. Hornbusch [email protected] – Zoë lief allein über das Tempelhofer Feld …42 – Der SUV hielt im Gewerbehof am Westhafen43 – Von: Sam Yun [email protected] – Jana las von der Sache mit den Bäumen …45 – Dieser Artikel ist eine Katastrophe«, sagte Breyer46 – Jana ließ Bienchen, die weiter vorn in der …47 – Sam stand am Fenster, auf halber Höhe zwischen …48 – Manchmal scheitern große Pläne an banalen Dingen …49 – Breyer saß in der winzigen Küche seiner Dienstwohnung …50 – Jana saß schwer atmend neben ihrem Spind …51 – Jana drückte die Luke hoch. Eisregen schlug ihr …Sechster Teil — Am nächsten Tag52 – Guten Morgen53 – In der Küche pfiff der Teekessel54 – Schnettke saß am Schreibtisch und zupfte ein Haar …55 – Jana erwachte mit einem Ruck. Ihr Fuß schmerzte …56 – Sie fuhren auf der Waltersdorfer Chaussee Richtung Flughafen …57 – Jana stand unter dem Vordach und schaute aufs …58 – Breyer saß im Fond seines Dienstwagens. Achtzehn Uhr …59 – Jana stand an der Nordpier, unter einer Fluggastbrücke …60 – Die VIP-Lounge war in warmen und hellen Naturtönen …61 – Breyer stand in der S-Bahn und hielt sich …62 – Der VW-Bus fuhr auf einer geraden, neu geteerten …63 – Dunkle Audi-, Mercedes-, BMW-Limousinen näherten sich dem Terminal …64 – Pankelow schlug mit einer Dessertgabel gegen sein Champagnerglas …65 – Hinter der Mauer sah Jana Kabel. Überall Kabel …66 – Zoë stand am östlichen Ende der Pier Süd …67 – Was passiert«, fragte Sam, »wenn Wissenschaftler eine Maschine …68 – Ein Stoß erschütterte das Terminal. Lampen flackerten …Siebter Teil — Zwanzig Minuten später69 – Schneeflocken wehten durch die Lichtkegel der Scheinwerfer …70 – Sam saß auf einer Bank in der Mitte …Mehr über dieses Buch
Über Kai Hensel
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Berlin
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Spannung
Zum Thema Großstadt
»Hoffnung ist nicht die Überzeugung,dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit,dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.«
VÁCLAVHAVEL
»Bei straffer Behördenarbeit kann der Flughafenim Jahr 2000 eröffnet werden.«
MATTHIAS PLATZECK,Brandenburgischer Umweltminister, 1991
20. Juli 2005
Diese Minuten gehörten nur ihm.
Links und rechts von ihm standen Männer in Anzug und Krawatte, mit roten Spaten in der Hand. Eine Kapelle spielte, am Rande seines Blickfeldes kroch ein kleiner Junge durch die Absperrung. Eben hatte er seine Rede gehalten: Berlin … Weltstadt … internationales Drehkreuz … Region, Wachstumsschub … Keine große Rede, keine, an die man sich als eine seiner bedeutenden Reden erinnern würde. Aber die Menschen hatten sich gefreut, ihn zu sehen. Schon auf dem Weg vom Dienstwagen zur Tribüne hatte er Hände geschüttelt und Autogramme gegeben. Andere, die weiter wegstanden, hatten ihm zugewunken und seinen Namen gerufen. Am Ende der Rede hatte er sich einen Seitenhieb geleistet, auf den Flughafen München und die Probleme mit dem Bahnzubringer. Die Leute hatten gelacht und applaudiert, der Seitenhieb würde die Runde machen, vielleicht abheben zum geflügelten Wort. Alles würde von heute an abheben, wachsen zu einer Größe und Modernität, von der sich die meisten Berliner, da machte er sich keine Illusionen, noch keine Vorstellung machten.
Ein heißer Julimorgen. Die Männer standen bereit mit ihren Spaten. Die Kapelle spielte immer noch, ein Schweißtropfen lief ihm ins Auge. Einen Moment verschwamm das Bild vor seinen Augen: Märkischer Sandboden, ausgedörrtes Gras, Weite bis zum Horizont. Noch stand hier nichts, noch war alles Planung, Aufbruch, Vision. Aber in wenigen Jahren würde sich hier der modernste Flughafen erheben, mit Terminals und Landebahnen, umringt von Hotels, Einkaufszentren, Hightech-Unternehmen. Seine Vision würde sich bis zum Horizont erstrecken, er sah sich jetzt und in fünf Jahren, die Welt zu Gast, dann würde eine Kapelle nicht mehr reichen, die Berliner Philharmoniker müssten es schon sein oder Marius Müller-Westernhagen, nachher gleich mal anrufen, die Privatnummer hatte er im Handy …
Bewegung, anfeuernde Rufe – jetzt hatte er tatsächlich das Signal überhört. Umso kräftiger stieß er seinen Spaten in den Sand. Er wusste, dass er jünger und dynamischer wirkte als die Männer neben ihm, dass sein Anzug besser saß und alle Kameras auf ihn gerichtet waren. Kraftvoll warf er eine Schippe in die Luft, das Sonnenlicht brach sich in den Sandkörnern. »Hier!«, riefen die Kameraleute, er winkte, stieß erneut zu und warf den Sand in ihre Richtung. Er wusste, dass auf den Bildern alles leicht aussehen würde, spielerisch, keine Anstrengung würde man ihm ansehen, nicht wie bei den anderen, die schnaufend mit ihren Spaten hantierten. »Noch einmal, Herr Bürgermeister!« Er war stärker als jeder Widerstand! Er lachte, warf für die Presseleute die Schippe hoch in die Luft.
14. November 2012
Sie hatte etwas gesehen.
Sie saß auf einem Gepäckband, keuchend, sie wusste nicht, wie sie hierhergekommen war. Ein Lüftungsrohr hing von der Decke wie eine erhängte Schlange. Aus dem Fußboden quollen Kabel wie Gedärme, blanke Drähte ragten in die Luft.
Sie versuchte aufzustehen, ihre Beine gaben nach, sie sank zurück auf die Gummimatte. Oben hörte sie Lachen. Sie musste zu den anderen, ihnen sagen, was sie gesehen hatte! Sie drückte sich hoch, schwankte, stand, wischte sich Schweiß von der Stirn. Versuchte, die Bilder in ihrem Kopf festzuhalten: Schatten, Blitze. Sie ging auf die Rolltreppe zu, hielt sich an einem Stapel Kalksandsteinquadern fest, schloss die Augen. Erinnere dich! Was hast du gesehen? Sie stolperte, die Rolltreppe war zu kurz, sie trat auf eine herausgebrochene Fliese. Sie fuhr, den Griff umklammert, in die Abflugebene. Da waren die Check-in-Schalter aus Nussbaumfurnier, in Plastik gewickelte Monitore, das Panoramafenster, grauer Himmel über dem Flugfeld … Wieder hörte sie das Lachen, näher jetzt, sie stolperte durch die Sicherheitsschleuse, Schwindel, flaues Gefühl im Magen, was hatte sie gesehen?
Da saßen ihre Kollegen, stießen mit Bierflaschen an, überall lagen Skizzen und Papiere. »Regenwasser kniehoch im Schacht!«, rief einer oder »Lichtschalter hinter den Bodenleisten!« Das war ihr Wettbewerb gewesen, die letzten Wochen, wer entdeckt den lustigsten Mangel? Es hatte sie angefeuert und vorangetrieben, immer tiefer in die Eingeweide des Flughafens. Aber keiner hatte gesehen, was sie gesehen hatte.
Gesine blickte auf. Auf ihrem Gesicht malte sich Entsetzen: »Wie siehst du aus?!«
Alle blickten zu ihr, das Lachen verstummte.
»Verdammt, was ist passiert?«, rief Harald.
»Ich habe …«
»Du bist rot wie eine Tomate!«
Ihre Beine knickten ein, ihre Kollegen stürzten auf sie zu, fingen sie auf, sie hörte:
»Atmen! Atmen!«
»Unten die Schächte!«
Sie sank auf einen Stapel Dämmplatten, jemand hielt ihr eine Flasche Wasser an den Mund, Gesine hielt ihren Arm, ihren Kopf. Wasser lief ihr Kinn hinunter, sie sagte: »Wir müssen noch mal nach unten …«
»Sieht aus wie Kohlenmonoxidvergiftung.«
»Trink … Atme …«
»Wir müssen nach unten!«, schrie sie und stieß die Wasserflasche weg. »Da ist noch was! Es ist nicht vorbei!«
Erster Teil
Einige Jahre später
»Hätte ich bloß Flügel, träumte die Schlange,so könnte ich noch schneller kriechen!«
MICHAIL GENIN
1
Wer nachts um drei Pizza bestellt, hat ein Problem. Du kannst ihm Pizza liefern. Aber du kannst sein Problem nicht lösen.«
Jana fuhr auf der Gitschiner Straße Richtung Osten. Sie hatte die Straße fast für sich allein. Weil es weit nach Mitternacht war, das Thermometer minus acht Grad zeigte und halb Berlin krank im Bett lag.
»Die Leute denken, sie haben eine Thunfischpizza bestellt und zwei Dosen Red Bull«, hörte sie Ahmads Stimme. »Aber dann stehst du vor ihrer Tür, jung, frisch, Mädchen aus der Provinz. Sie denken: ›Scheiße, eigentlich hab ich ein neues Leben bestellt.‹ Du bist aber nicht ihr neues Leben. Du lieferst bloß Fett, Kohlehydrate, Koffein, damit ihr altes Leben irgendwie weiterläuft.«
Manolo hatte ihr den Job nicht geben wollen. Zu jung, zu weiblich, zu Ruhrgebiet. Und konnte sie überhaupt Motorrad fahren? Seine Kuriere waren nicht auf Mopeds unterwegs, sondern auf Honda-Leichtkrafträdern; er erwartete, dass sie den Vorteil nutzten. »Was willst du überhaupt in Berlin? Erzähl mir nicht, du planst irgendein Projekt.« – »Ich muss zehntausend Euro verdienen, dann haue ich ab.« Manolo hatte ihr eine Probeschicht gegeben. Neun Stunden später, um sieben Uhr morgens, hatte sie mehr Bestellungen ausgeliefert als alle anderen und zwischendurch den Bowdenzug eines Kollegen repariert. Manolo hatte gesagt, sie könne bleiben.
Sie bog Richtung Süden in die Baerwaldstraße. Bäume ohne Laub, Straßenlaternen im Dunst, Altbauten, in denen hier und da Licht brannte. Grippe-Epidemie, hieß es in den Zeitungen. Jana war gesund. Als einzige Kurierin war sie diese Nacht zur Schicht erschienen; Manolo hatte behauptet, das sei noch nie vorgekommen. Es bedeutete, dass die Pizzeria Insomnia diese Nacht die meisten Bestellungen ablehnen musste. Die wenigen Stammkunden, die beliefert wurden, brauchten Geduld.
Sie parkte ihr Motorrad, holte Pizzakartons und Weinflasche aus der Transportbox und klingelte an einem Messingschild.
»Eine Pizza Primavera mit doppelt Guarana, eine Flasche Pinot Grigio.«
Sie stand vor einem jungen Mann mit randloser Brille und Ziegenbart, der die Pizzakartons anstarrte wie ein Süchtiger seinen Stoff.
»Einundzwanzig Euro.«
Er hielt ihr ein paar Scheine hin. »Behalten Sie den Rest. Gute Fahrt.«
Egal was Ahmad behauptete: Die meisten Kunden waren, auch wenn sie mitten in der Nacht Pizza mit doppelt Guarana bestellten, nicht gestört. Krankenschwestern im Schichtdienst. Architekten vor einer Präsentation … Der eben konnte Referendar gewesen sein, der trotz Krankheit Klausuren korrigierte.
Landwehrkanal. Weißer Neubau, große Fenster, Terrassen, von denen Pflanzen hingen. Vor der Eingangstür stand ein Kinderfahrrad aus Karbon, mit schwerem Schloss gesichert. Neben den Klingeln ein Aufruf, Solidarität mit irgendwas.
»Ja, bitte?«, hörte Jana aus der Gegensprechanlage.
Die Frau im geblümten Bademantel, die am Ende des Ganges wartete, lächelte. Ihre Lippen waren eingecremt. Die Augen glänzten. Das Alter war, wegen der Fettcreme in ihrem Gesicht, schwer zu schätzen. »Bulimiker«, hatte Ahmad gesagt, »sind nicht immer dünn. Du erkennst sie an den Rissen im Mundwinkel vom Kotzen. Fingernägel meistens kurz, weil das Reinstecken sonst wehtut. Dann die Stimme, belegt, als ob die Kotze gleich wieder hochkommt.«
»Endlich!«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Wir feiern gerade eine kleine Party. Und plötzlich hatten alle Lust auf etwas Süßes!«
Raumduft wehte Jana entgegen, Kiefernnadel oder nordische Tundra (»zum Überdecken des Kotzgeruchs«).
»Manchmal ist das so, nicht wahr? Man feiert ausgelassen, es ist spät, plötzlich haben alle Appetit auf etwas Süßes. Manchmal muss man sich das gönnen.«
»Absolut«, sagte Jana und stellte fünf Alupackungen Tiramisu vor die Wohnungstür, aus der kein Laut kam.
»Werden Sie nicht krank?«, fragte die Frau, während sie in ihrem Portemonnaie kramte.
»Noch gehts.«
»Amüsieren Sie sich auch manchmal? Ich habe das Gefühl, die jungen Leute sind nur noch am Strampeln. Wie alt sind Sie?«
»Neunzehn.«
»Sie brechen zusammen, bevor Sie dreißig sind.«
»Dann habe ich noch zehn Jahre.«
»Machen Sie Witze?« Die Frau gab Jana einen Geldschein, ihre Finger waren eiskalt. »Kein Wechselgeld, ich bitte Sie. Wenn Sie nach Hause kommen – gönnen Sie sich etwas. Belohnen Sie sich.«
»Ich denk dran.«
»Ich sehe diese Fälle in meiner Praxis. Die jungen Leute verlieren den Kontakt zu ihrer inneren Stimme.«
Draußen setzte sich Jana auf ihr Motorrad, setzte den Helm auf, zog die Handschuhe über. Ob die Frau Hilfe brauchte? Vielleicht sollte Jana umdrehen, klingeln, fragen, ob ihr etwas fehlte? Doch wieder hörte sie Ahmads Stimme: »Werd nie mit den Kunden vertraulich. Als Pizzakurier brauchst du professionelle Distanz, sonst gehst du kaputt.« Er hatte recht. Die Frau hatte gutes Trinkgeld gegeben, der Rest ging sie nichts an.
Auf der Hasenheide beschleunigte sie. Nichts als Kälte und grüne Ampeln. Sie fühlte einen seltsamen Schauer von Macht. Als ob sie die Stadt kontrollierte, als ob sie ihr gehörte. »Pass auf, dass du dich nicht verirrst«, hatte ein Kunde gesagt. »Wärst nicht die Erste, die mit großen Plänen nach Berlin kommt und versumpft.« Jana hatte nicht vor zu versumpfen. Sie kannte ihre Richtung und ihr Ziel. Ihr Leben konnte besser sein, keine Frage. Aber vor allem deutlich schlechter.
2
Es ist alles lange her«, sagte Staatssekretär a. D. Günter Treskeit und schwenkte Weinbrand in seinem Glas.
»Aufregende Zeiten«, sagte Pankelow. »Damals wurden die Weichen gestellt. Entscheidungen getroffen, die bis heute wichtig sind. Sie, Herr Staatssekretär, waren der starke Mann im Hintergrund.«
»Zu viel der Ehre.«
»Sie hatten den Weitblick. Sie wussten, worauf es ankommt.«
Im Kamin knackten Holzscheite. In der Diele schlug eine Standuhr. Treskeit saß in seinem Ohrensessel, den dürren Körper in eine Strickweste gehüllt, die Beine unter einer Wolldecke.
»Der gute Goldbrand«, sagte er und nippte an seinem Glas. »Was haben wir dieses Zeug in uns reingeschüttet. Nach der Wende war er jahrelang nicht zu bekommen. Heute stellen sie ihn wieder her. Aber er schmeckt nicht mehr. Nicht wie früher, als ich jung war.«
»Wir werden alle älter«, sagte Pankelow.
»Sie nicht.« Treskeit betrachtete Pankelow über den Rand seiner Messingbrille. »Sie sind immer noch der jugendliche Typ. Wie viele Jahre sind vergangen seit Ihrem Rücktritt? Man sieht Sie kaum noch. Nicht im Fernsehen, nicht in der Zeitung.«
»Mir sind diese Sachen nicht mehr wichtig.«
»Tatsächlich?« Treskeit kicherte. »Oder sind Sie den Medien nicht mehr wichtig?«
Pankelow prostete ihm zu, wie in Anerkennung eines guten Scherzes. Drehte sich zu Sam, um ihn zum Mitlachen zu animieren. Doch der saß abseits auf einem weniger bequemen Stuhl und starrte in sein volles Glas.
»Was ich sagen will«, sagte Pankelow. »Mit dem Alter verschieben sich die Perspektiven. Der innere Blick wird scharf. Für das, was im Leben wirklich zählt.«
»Ich bin zweiundachtzig. Ich sehe nicht mehr viel.«
»Wir sehen, worauf es eigentlich ankommt.«
»Sie glauben, es gibt für meinen inneren Blick noch Hoffnung? Auf was, wenn ich fragen darf, hoffen Sie?«
»Auf die Wahrheit, Herr Staatssekretär. Dass sie eines Tages ans Licht kommt.«
»Nennen Sie mich nicht Staatssekretär.«
»Sie haben recht. Ich müsste Sie Minister nennen. Ministerpräsident. Das hätten Sie werden müssen, wir wissen es beide. Ohne das, was damals passiert ist, diese Schändlichkeit, diesen Skandal …«
»Ich erinnere mich an keinen Skandal.«
»Skandal trifft es vielleicht nicht. Dazu lief die Sache zu geräuschlos ab, zu hinterhältig. Trotzdem, in Berlin waren wir alle fassungslos. Verabschiedung in den Ruhestand, ohne Festakt, ohne Verdienstkreuz …«
»Ich bin gescheitert, Herr Pankelow.«
»Einer der besten Männer, die Brandenburg je hatte …«
»In allem bin ich gescheitert.« Treskeit hob sein Glas. »Genau wie Sie.«
Seit einer halben Stunde saßen sie in diesem überheizten Kaminzimmer und tranken klebrigen Weinbrand. Pankelow schmeichelte dem alten Mann, dicht an der Schwelle zur Penetranz. Aber er überschritt die Schwelle nicht. Und meist, musste Sam zugeben, hatte er mit seiner Taktik Erfolg. Doch bei diesem Staatssekretär war er noch nicht weit gekommen.
»1990«, sagte Pankelow, »Beginn der Standortsuche für den Flughafen. Die Genshagener Heide und Parchim schieden schnell aus. Zwei Jahre später waren nur noch drei Standorte in der engeren Wahl: Sperenberg, Schönefeld, Jüterbog-Ost.«
»Sperenberg!«, rief Treskeit. »Sperenberg hätte es werden müssen! Vielleicht noch Jüterbog-West. Aber niemals Schönefeld!«
»Alle wussten das. Die Gutachten waren eindeutig. Ebenso das Raumordnungsverfahren. Schönefeld war als Standort für den neuen Flughafen ungeeignet.«
»Komplett! Der Lärmschutz! Die Umsiedlung ganzer Dörfer! Kein 24-Stunden-Betrieb, den Sie für ein Drehkreuz nun einmal brauchen …«
»Aber dann hätten Sie auch eine dritte Landebahn gebraucht.«
»Keine Kapazität!« Treskeit ruckte nach vorn. »Schönefeld war unbrauchbar. In jeder Hinsicht. Noch einen Goldbrand?«
Pankelow leerte sein Glas und hielt es ihm hin, als könne er einen weiteren Schluck dieser Köstlichkeit kaum erwarten. Treskeit ließ es sich nicht nehmen, sich selbst aus seinem Sessel zu stemmen und die Gläser vollzuschenken – aus einer Kristallkaraffe, die alt und teuer aussah.
»Es ist schön, nach so langer Zeit Besuch zu bekommen«, sagte er, sank zurück und wickelte seine Beine in die Decke. »In Erinnerungen schwelgen. Keinen angenehmen Erinnerungen, gewiss nicht. Aber wir müssen in den Erinnerungen schwelgen, die wir haben, nicht wahr?«
»Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie sich Zeit für uns nehmen«, sagte Pankelow.
Sie hoben die Gläser, nickten sich zu und tranken. Vor dem Fenster ließ sich ein Vogel in der Tanne nieder, pickte an einem Futterkranz. Sam kannte Pankelows Masche: Bald würde er anfangen, von verpassten Chancen zu reden. Den Lügen der Presse. Verrat der Genossen. Schäbigkeit des politischen Gegners. Und dass die wenigen Übriggebliebenen, Aufrechten zusammenstehen und sich wehren mussten.
»1996«, sagte Pankelow, »für alle überraschend der berüchtigte Konsensbeschluss. Die beteiligten Bürgermeister und Ministerpräsidenten von – «
»Unbedeutende Männer«, sagte Treskeit. »Alle vergessen.«
»Völlig Ihrer Meinung. Die politisch Verantwortlichen waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Wie sonst war die Entscheidung für Schönefeld zu erklären? Gegen den Rat aller Experten! Die Einsprüche der Fluggesellschaften, die Proteste der Anwohner!«
»Vergessen!« Treskeit fuchtelte mit dem Arm.
»Von Anfang an gab es allerdings Gerüchte. Bei der Entscheidung, hieß es, sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Geld sei geflossen, in dunkle Kanäle. Das Gerücht von Korruption machte die Runde. Konkret ging es um den Ankauf von einhundertachtzehn Hektar Bauland zu massiv überhöhten Preisen. Sie erinnern sich?«
»Dunkel.«
»Fünfhundert Millionen D-Mark. Für Bauland, das letztlich nie gebraucht wurde. Aber es lag in Schönefeld. Und gekauft wurde es schon 1992 – vor den Gutachten, vor dem Raumordnungsverfahren. Bevor die Entscheidung gefallen war, hatten Eingeweihte bereits mit Grundstücken und öffentlichen Geldern spekuliert. Eingeweihte, die nah an den Entscheidungsträgern waren. Und ihre Spuren so geschickt verwischten, dass die Sache nie aufgeklärt wurde.«
Treskeit kratzte seinen weiß behaarten Schädel.
»Nicht einmal ein Untersuchungsausschuss brachte Licht ins Dunkel. Weil wichtige Akten fehlten. Zwanzig Ordner, mindestens, über die Zeit von 1992 bis 1996. Verschwunden! Aus dem Ministerium, in dem Sie Staatssekretär waren!«
»Ist das möglich«, sagte Treskeit.
»Verstehen Sie mich nicht falsch: Niemand konnte sich vorstellen, dass Sie, ein Mann der reinen Weste und harten Hand, in diese Sache verwickelt waren. Trotzdem wurden Sie in den Ruhestand geschickt. Ohne Sang, ohne Klang. Zurück blieb die Flughafengesellschaft mit einem Finanzloch von fünfhundert Millionen D-Mark. Von nun an musste gespart werden, bis es quietscht. Auch an Stellen, an denen nie hätte gespart werden dürfen. Der Grundstücksskandal ist die Ur- und Erbsünde. Dieser Flughafen, der Milliarden und immer neue Milliarden kostet, der die Karrieren von Politikern und Unternehmern ruiniert … Er ist nicht zu verstehen ohne das, was damals geschah.«
Im Kamin brach ein Holzscheit auseinander, Funken stoben. Treskeit strich mit seiner blau geäderten Hand über die Wolldecke, als läge dort eine Katze. »Warum, Herr Bürgermeister, sind Ihnen diese Dinge heute wichtig?«
»Sie müssen jedem wichtig sein, dem Berlin und Brandenburg etwas bedeuten.«
»Glauben Sie, man hat Ihnen damals unrecht getan?«
»Politik ist selten gerecht.«
»Als ich in den Ruhestand geschickt wurde, stand ich zwei Jahre vor meiner Pensionierung. Minister wäre ich nicht mehr geworden, meine Karriere hatte ihren Höhepunkt erreicht. Aber Sie? Sie waren jung. Aufwärts sollte es gehen, in die Bundespolitik, bis ganz nach oben. Und dann? Sind Sie gefallen. Bodenlos, ins Nichts. Heute kennt man Sie kaum noch. Ein Name, der den Jüngeren nichts mehr sagt. Aber nicht wegen des Flughafens sind Sie gestürzt.« Er beugte sich vor. »Soll ich Ihnen sagen, was Sie zu Fall gebracht hat?«
Pankelow, sein Glas in der Hand, blickte ihn auffordernd an.
»Sie waren nie Bürgermeister. Sie haben den Bürgermeister nur gespielt. Ein Leichtfuß waren Sie. Ein Bruder Luftikus.«
»Haha!«
»Gefeiert haben Sie! Die Nächte durchgetanzt! Wie war Ihr Sprüchlein, das Sie berühmt gemacht hat? Hungrig, aber nackig? Nackig, aber nicht tot? Vergessen, alles vergessen! Der richtige Mann zur richtigen Zeit, hieß es bei den Genossen. Aber für Politiker, die ihr Amt nicht im Griff haben, die keine Akten lesen, die Sprüche klopfen, aber nicht entscheiden – für die gibt es keine richtige Zeit!«
»Die gemeinsame Verantwortung …«
»In Potsdam haben wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Bürgermeister? Dieses Windei?« Treskeit schlug seine Hand gegen die Stirn. »Ein Willy Brandt, ein Weizsäcker waren Sie nicht. Nicht mal ein Diepgen. Flach waren Sie! Flach wie eine Mecklenburger Flunder!« Er leckte sich die Lippen, schnalzte mit der Zunge, endlich schien ihm der Goldbrand zu schmecken.
Pankelow saß im Sessel, die Beine übereinandergeschlagen. Sein Lächeln war festgefroren. Er blinzelte, die Augenlider zuckten.
»Was die Ordner angeht«, sagte Treskeit, »ich habe sie nicht.«
»Könnten Sie – «
»Nein.«
»Oder ob – «
»Weg sind sie. Vernichtet. Vor Jahren verbrannt.«
Die Holzscheite knackten. Treskeit hatte Sam die ganze Zeit kaum beachtet. Nun wandte er sich an ihn: »Nun, junger Mann? Aus dem Land des Lächelns kommen Sie wohl nicht?«
»Ich komme aus Bonn«, sagte Sam.
»Da kann einem allerdings das Lachen vergehen.«
»Herr Yun studiert Mathematik und Informatik an der Freien Universität Berlin«, sagte Pankelow. »Er ist mir eine große Hilfe.«
»Wobei?«
»Auch er sucht nach der Wahrheit.«
»Noch so ein Windei.«
»Er hat das beste Abitur seines Jahrgangs gemacht. Er ist Stipendiat der Studienstiftung Deutsches Volk.«
»Bedeutet alles nichts.«
»Wir sind hier wegen der Ordner«, sagte Sam.
»Wie gesagt, ich habe sie nicht.«
Treskeit stemmte sich aus dem Sessel. Hielt sich einen Moment den Rücken, das Gesicht verzerrt. Dann richtete er sich auf, den Stock, der an seinem Schreibtisch lehnte, brauchte er nicht. »Gern würde ich mit Ihnen länger über vergangene Zeiten plaudern. Aber ich bin ein alter Mann. Ich ermüde schnell. Bevor ich Sie zur Tür bringe, gebe ich Ihnen einen Rat: Leben Sie mit dem, was Sie nicht ändern können. Der Flughafen war zu groß für Sie. Eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern, mehr war Ihr Leben nicht wert. Treten Sie in Unterhaltungssendungen auf. Wo ausrangierte Prominente im Urwald sitzen und Insekten essen. Ich sitze hier, trinke meinen Goldbrand und wähle Sie zum König!«
Er kicherte, hustete, Pankelow sprang auf und wollte ihn stützen. Treskeit wehrte ihn ab und deutete zur Tür.
Sam blieb sitzen. »Herr Pankelow, lassen Sie mich einen Moment mit dem Staatssekretär allein?«
»Sie sollten beide gehen.« Treskeit betupfte seine Augen mit einem Taschentuch.
»Es dauert nicht lange«, sagte Sam.
Pankelow zögerte, blickte zwischen den beiden hin und her. Sam nickte Richtung Tür.
»Nun gut«, sagte Pankelow, »genieße ich ein wenig die frische Brandenburger Luft.« Einige Augenblicke hörte man ihn in der Garderobe, dann fiel die Haustür ins Schloss.
Treskeit lehnte sich an den Schreibtisch und betrachtete Sam aufmerksam. »Bonn also.«
»Bad Godesberg.«
»Haben Sie sich im Osten ein wenig integriert?«
»Nicht einfach. Gibt Widerstände. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt.«
»Die richtige Einstellung. Wie alt sind Sie?«
»Vierundzwanzig.«
»Ich war immer der Meinung, die Zeit zwischen achtzehn und fünfundzwanzig ist die wichtigste im Leben eines Mannes. Die Weichen werden gestellt, Fehler, die Sie jetzt machen, können Sie nie mehr korrigieren.«
»Ich mache keine Fehler.«
»Eine kühne Behauptung.«
»Das mit der flachen Flunder hätten Sie besser nicht gesagt.«
Treskeit hob die Brauen, überrascht von der Härte in Sams Stimme. »Ganz so einsam, wie Sie denken mögen, bin ich hier draußen nicht. Ein paar Dinge kommen mir zu Ohren. Was Ihr Bürgermeister in Berlin treibt. Was er vorhat, mit seiner geheimen Firma. Wahnsinn, vollkommener Wahnsinn. Warum stoppt ihn niemand? Sie sind ein intelligenter junger Mann. Sie gehen Ihren Weg, das spüre ich. Binden Sie sich nicht an Menschen, die ihre Zukunft hinter sich haben. Und die eine zweite Chance nicht verdienen.«
»Schöne Villa haben Sie.«
»Damals war sie erschwinglich.«
»Auch der Porsche vor der Garage.«
»Ich fahre ihn kaum noch.«
»Muss Geld gekostet haben.«
»Ich beziehe eine Pension.«
»So hoch?«
»Ein alter Mann braucht nicht viel.«
»Sie waren der Kopf hinter dem Grundstücksdeal.«
»Verleumdung.«
»Wo sind die Ordner?«
Treskeit griff in die Tasche seiner Weste. Sam sprang auf, packte die Hand. Er hatte mit einer Waffe gerechnet, doch nur ein Mobiltelefon fiel auf den Teppich. Sam packte den Hemdkragen des alten Mannes, die oberen Knöpfe rissen ab und gaben den Blick auf dünnes, weißes Brusthaar frei.
»Angenommen, Sie haben die Ordner doch«, flüsterte er in Treskeits Ohr. »Angenommen, es besteht die winzige Möglichkeit, dass sie in diesem Haus sind. Muss ich nicht, wenn sie mich weiterbringen auf meinem Weg, alles tun, um sie zu bekommen? Jede Wand niederreißen? Das ganze Haus, wenn es sein muss?« Sam drehte den Kragen fester, der Stoff drückte auf die Adern. Treskeit röchelte, Speichel lief aus seinem Mund. »Haben Sie mal zugesehen, wie ein altes Haus abgerissen wird? Hier fällt eine Wand, da stürzt eine Decke ein. Der Schmutz bröckelt raus. Von außen sah die Villa noch gut aus, jetzt sieht man, wie morsch alles ist und zusammengepfuscht. Wie es stinkt, wenn Würmer aus dem Holz kriechen. Der Bagger schlägt gegen den Giebel, die Rohre platzen, die Kacheln splittern …« Das Gesicht des alten Mannes färbte sich blau. »Man stellt sich vor, wie das wäre, wenn die Villa ihrem eigenen Abriss zusehen kann. Die letzten Augenblicke, was für ein Haufen Dreck sie war … Die Schuttlaster stehen bereit und eine Planierraupe. Alle stehen drum herum und sehen dem Abriss zu … Die freuen sich, dass diese beschissene Villa endlich verschwindet.«
3
Was ist gestern passiert?«, fragte Manolo und bestreute eine Pizza mit Chia-Samen.
»Nichts ist passiert«, sagte Jana.
Sie standen in der Küche der Pizzeria. Mehlstaub hing in der Luft, es roch nach Tomaten, Oregano, geschmolzenem Mozzarella.
»Gab ’ne Beschwerde. Vom Hausboot.«
»Vom Hausboot? Ich habe die Frau gerettet. Okay, nicht gerettet, aber …«
Jana hatte am Ufer gestanden und wollte die Pizzen wie bestellt unter den Steg legen. Sie hatte vom Hausboot Schreie gehört, Zerbrechen von Gläsern. Eine Frau hatte gerufen, sie sei eingesperrt und bräuchte den Schlüssel. Zuerst hatte Jana daran gedacht, die Polizei zu rufen. Aber erstens hätte das zu lange gedauert, zweitens: Die Situation hatte sich als harmlos herausgestellt. Die Frau, alt und gebrechlich, lebte auf dem Hausboot mit ihrem Kater. Er hatte den Schlüssel wie eine Beute versteckt und randalierte nun, weil er nicht rauskonnte. Aber es gab einen Ersatzschlüssel, unter der Plane des Steuerrads. Jana war über die Reling geklettert, hatte den Schlüssel gefunden und die Tür aufgeschlossen. Der Kater war geflüchtet, die Frau – klein und ausgezehrt, mit verwirrten grauen Haaren – hatte gesagt, bei der Kälte komme er bestimmt bald wieder, und sich herzlich bedankt.
»Das war alles«, schloss Jana.
»Das ist nicht alles.« Manolo schöpfte Tomaten-Taurin-Soße aus der Schüssel und verteilte sie auf dem Teig. »Die Frau ist dement. Sie lebt bei ihrem Sohn auf dem Hausboot, weil er keinen Heimplatz findet. Wenn er arbeitet, schließt er sie ein. Er hat sie heute Morgen halb erfroren unter der Stubenrauchbrücke gefunden.«
»Oh.«
»Eine Stunde später wärs zu spät gewesen.«
»Das wusste ich nicht.«
»Du solltest die Pizzen unter den Steg legen.«
»Da wären sie festgefroren.«
»Was geht dich das an? Wenn er von der Arbeit kommt, macht er sie heiß.«
»Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Frau dement ist. Ich dachte – «
»Wie alt bist du?«
»Bald zwanzig.«
»Schlechte Antwort! Bald ist diese Pizza ein Haufen Scheiße in einer Kloschüssel! Jetzt ist sie eine Pizza Insomnia Detox! Du bist neunzehn! Du bist seit zwei Wochen in Berlin! Du kommst aus einem Dorf in Westdeutschland – «
»Bottrop.«
»Du verstehst nichts von dieser Stadt. Du hilfst niemandem, wenn du dich in Dinge einmischst, die dich nichts angehen.« Er schob die Pizzen in den Ofen, streute Mehl über die Arbeitsplatte.
Manolo hieß eigentlich Miroslav und kam aus Bulgarien. Jana wusste wenig über ihn, außer dass er in seiner Jugend politisch aktiv gewesen und wegen eines Flugblatts vom bulgarischen Geheimdienst verhört worden war; seitdem hatte er ein schiefes Kinn und konnte das rechte Handgelenk nicht richtig bewegen.
»Eine einfache Regel«, sagte er. »Mach deinen Job. Nichts als deinen Job. Wie ist Ahmads Spruch?«
»Nicht denken – liefern.«
»Der andere?«
»Curiosity killed the Pizzakurier.«
»Klingt hart. Grausam, kaltes Herz. Aber glaub mir: Wenn jeder einfach seine Arbeit macht, nichts als seine Arbeit und pfuscht nicht ins Leben von anderen Leuten – die Welt wird ein besserer Ort.«
4
Sie fuhren auf der Avus zurück nach Berlin.
»Das war nicht richtig«, sagte Pankelow.
»Es war nötig«, sagte Sam.
»Ein alter Mann. Verbittert und einsam. Wir hatten ihn fast auf unserer Seite. Wenn wir ein bisschen länger geredet hätten … Ein, zwei Gläser Goldbrand …«
»Zeitverschwendung.«
»Ich hatte Geld dabei. Bis zehntausend wäre ich gegangen.«
»Er brauchte kein Geld.«
»Was ist unsere Mission, Sam? Liebe ist unsere Mission! Und du? Brichst ihm die Knochen!«
»Ich habe ihm nichts gebrochen.«
»Seine Schreie, bis in den Garten …«
»Ich habe ihm bloß gezeigt, welche Knochen ich ihm brechen könnte.«
Die Wagen vor ihnen schalteten Warnblinklicht ein. Ein Lastwagen war gegen die Mittelplanke gekracht, der Anhänger lag quer über der Fahrbahn.
»Ein Baby kommt mit über dreihundert Knochen auf die Welt«, sagte Sam. »Später wachsen sie zusammen, beim Erwachsenen sind es noch zweihundertsechs. Zieht man ein paar für Prothesen und Hüftgelenke ab, bleiben immer noch fast zweihundert Knochen zum Brechen übrig.«
»Lernt man so was in Bonn?«
»Mein Biologielehrer war sehr gut.«
Ein Polizist winkte sie vorbei. Als Pankelow beschleunigte, fiel einer der beiden Kunstlederkoffer vom Rücksitz. Sam drehte sich nach hinten, stellte ihn zurück auf den Sitz. Der Inhalt war kostbar. Achtzehn Ordner. Treskeit hatte ihnen das Versteck im Keller mit zitternder Stimme beschrieben. Sie dürften die alten Koffer mitnehmen, hatte er gestammelt.
»Außerdem hätte er das nicht sagen sollen«, sagte Sam.
»Was?«
»Die Flunder.«
»Ich bitte dich …« Pankelow lachte, es klang gezwungen. »Die Leute sagen solche Sachen, sie denken sich nichts dabei.«
»Trotzdem.«
»Es ist mir egal.«
Sie wussten beide, dass das nicht stimmte. Sie hatten Ihr Amt nicht im Griff. Sie haben den Bürgermeister bloß gespielt. Diese Sprüche waren ein Stich, jedes Mal.
»Du musst dir hin und wieder Gedanken über Grenzen machen«, sagte Pankelow.
»Ich war sicher, dass er lügt.«
»Und wenn er weiter gelogen hätte? Wie weit wärst du gegangen? Du weißt selbst nicht, wie weit du gegangen wärst.«
»Wir haben die Ordner.«
»Manchmal machst du mir Angst.«
Pankelow blinkte und verließ die Avus. Vor ihnen leuchtete das grüne Schild des S-Bahnhofs Halensee.
»Ich fahre mit der Bahn weiter«, sagte Sam. »Ich bring die Koffer in die Villa.«
»Um diese Zeit?«
»Nur für einen ersten Eindruck.«
»Du arbeitest zu viel.«
»Ich will aussteigen.«
Pankelow seufzte und hielt am Straßenrand. Ihr größter Erfolg seit Monaten. Unschätzbare Informationen über die Vor- und Frühgeschichte des Flughafens. Warum freuten sie sich nicht? Warum schlugen sie sich nicht in die Hände, lagen sich in den Armen?
»Noch ein Glas Wein?«
»Heute lieber nicht.«
Manchmal, wenn sie Erfolg gehabt hatten, gingen sie in das Charlottenburger Bistro, in dem Pankelow Stammgast war und er kein Aufsehen erregte. Oder in das koreanische Restaurant in Friedenau, in dem fast nur Asiaten aßen. Pankelow wurde nicht mehr so oft erkannt wie früher. Aber wenn, ging es mit den Witzen los. Ob er sich beruflich neu orientiert habe, zum Beispiel als Fluglotse … Ob es nicht billiger wäre, Berlin abzureißen und neben einem funktionierenden Flughafen wieder aufzubauen …
»Du hast recht«, sagte Pankelow. »Treskeit hat mich beleidigt. Aber ich spüre diese Sachen kaum noch. Weil ich weiß, bald werden mich die Leute anders sehen. Sie werden begreifen, was ich tue. Nicht für mich. Sondern für eine Sache, die größer ist.«
»Trotzdem.«