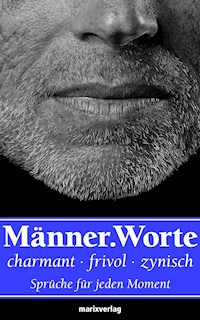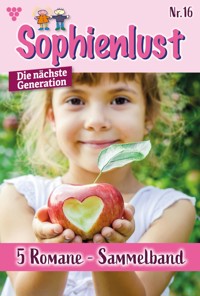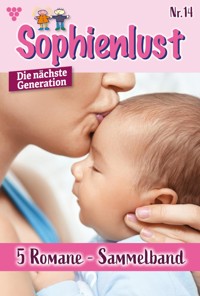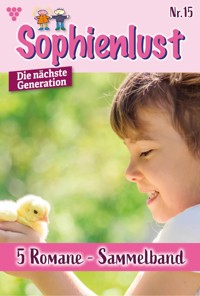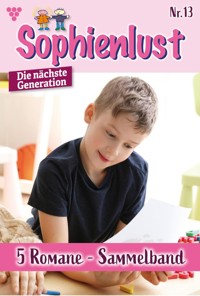
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust - Die nächste Generation – Sammelband
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie wird die von allen bewunderte Denise Schoenecker als Leiterin des Kinderheims noch weiter in den Mittelpunkt gerückt. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. E-Book 1: Wir wollen bei Oma bleiben! E-Book 2: Papa, Mama und die Pferde E-Book 3: Pflegekind Mila E-Book 4: Jan und Paul wollen die Mama zurück! E-Book 5: Ein richtiger Papa für Annina
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Ähnliche
Inhalt
Wir wollen bei Oma bleiben!
Papa, Mama und die Pferde
Pflegekind Mila
Jan und Paul wollen die Mama zurück!
Ein richtiger Papa für Annina
Sophienlust - Die nächste Generation – Sammelband – 13 –
5 Romane - 61-65
Diverse Autoren
Wir wollen bei Oma bleiben!
Pascal und Amelie verstehen die Welt nicht mehr…
Roman von Aigner, Simone
Irmgard Menzel rührte in dem Kochtopf mit dem Schokoladenpudding. Aus dem Wohnzimmer drangen die Geräusche des Fernsehers. Sie rührte langsam und versuchte, ruhig zu atmen. Ihr Herz schlug zu schnell und ihr war ein wenig schwindelig. Das mochte mal wieder am Kreislauf liegen, das war in letzter Zeit schon öfters vorgekommen. Dr. Pietsch meinte, sie sollte sich mehr schonen. Sie bräuchte Ruhe und ab und an Zeit für sich. Doch wie sollte das gehen?
Der Pudding dickte ein. Endlich. Irmgard schaltete den Herd aus und zog den Topf von der noch heißen Platte. Vorsichtig setzte sie sich an den Küchentisch. Tatsächlich war ihr sogar ein wenig übel. Sie fasste nach dem Griff des Fensters, den sie von ihrem Platz aus gut erreichen konnte und öffnete es. Milde Frühjahrsluft drang in die Küche, und draußen zwitscherten die Vögel. Die Sonne schien, und an den Büschen, die im Vorgarten des Hauses wuchsen, drängten erste zarte Blättchen dem Sonnenlicht entgegen. Was für ein herrlicher Tag!
Eigentlich war es nicht zu verantworten, dass Pascal und Amelie bei dem Wetter vor dem Fernseher saßen.
Irmgards Blick ging zu dem Küchenbüffet, auf dem ein Foto ihres Sohnes Daniel stand. Er lachte in die Kamera, hielt Amelie auf dem Arm, und Pascal stand an seiner Seite. Auch die Kinder sahen fröhlich drein. Die Aufnahme war vor über drei Jahren entstanden. Auch damals war die Welt schon nicht mehr heil gewesen. Nicole, ihre Schwiegertochter, hatte Daniel verlassen und die Kinder gleich mit dazu. Sie hatte einen anderen Mann kennengelernt und sich seither kaum je gemeldet. Nur zum ersten Weihnachtsfest, ein halbes Jahr nachdem sie gegangen war, hatte sie eine Postkarte an ihn und die Kinder geschickt, aus der Toskana.
Irmgard hörte Amelie aus dem Wohnzimmer lachen. Pascal sagte etwas, was sie durch die Geräusche des Fernsehers nicht verstand. Vielleicht sollte sie mit den Kindern zum Spielplatz gehen, der war ja nur hundert Meter die Straße runter.
Augenblicklich verstärkte sich das Herzrasen. Irmgard öffnete das Fenster noch weiter. Nein, sollten die beiden ihren Film ansehen. Später am Tag war immer noch Zeit, nach draußen zu gehen. Sie dachte an die Worte von Dr. Pietsch. Sie brauchte Ruhe und ab und an Zeit für sich. Vielleicht sollte sie ein paar Schritte alleine an die frische Luft gehen? So klein waren die Kinder nicht mehr, dass sie das nicht für eine halbe Stunde verantworten konnte. Pascal war mit seinen sieben Jahren schon recht vernünftig, und Amelie saß stets wie gebannt vor dem Fernseher, selbst wenn sie die DVDs, die Irmgard ihren Enkeln erlaubte, schon unzählige Male gesehen hatte.
Für einen Augenblick wurde ihr leichter. Ja, sie würde sich einen kleinen Spaziergang gönnen. Sie sah zur Küchenuhr. Es war jetzt gleich halb zwei, der Film ging noch etwa 45 Minuten. Sie wollte auf jeden Fall vorher zurück sein.
Irmgard stand auf und schloss das Küchenfenster. Ihr Handy lag auf dem Küchenbüffet. Das würde sie auf jeden Fall mitnehmen, damit Pascal sie anrufen konnte, falls doch irgendwas war. Sie warf einen Blick auf das Display, und ihr schöner Plan, der kleine Ausblick auf eine halbe Stunde nur für sich, drohte zusammenzufallen. Der Akku zeigte nur drei Prozent, sie hatte vergessen das Mobiltelefon aufzuladen. Nun war das Gerät auch nicht mehr das Neueste. Wahrscheinlich fielen die besagten drei Prozent in sich zusammen, noch ehe sie aus dem Haus war. Ohne Handy wollte sie die Wohnung aber keinesfalls verlassen.
Niedergeschlagen steckte sie das Ladekabel an das Telefon und in die Steckdose und sah ins Wohnzimmer. Amelie lag bäuchlings auf dem Teppich, das Gesicht in die Hände gestützt, und verfolgte fasziniert den Film über die Eiskönigin. Pascal flegelte auf dem Sofa und wollte sich über eine schneemannartige Figur kaputtlachen, die fortwährend fröhlich grinste und Olaf hieß. Ein Lächeln glitt über Irmgards Gesicht. Ihre Enkel, das Beste, was ihr im Leben geblieben war! Sie würde alles daransetzen, für die beiden dazu sein und ihnen helfen, einen guten Weg in die Zukunft zu finden, soweit ihr das möglich war. Hoffentlich war ihr die Zeit noch gegeben. Ein Druck senkte sich auf ihre Brust.
„Oma?“, sagte Amelie, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden. „Ist der Pudding fertig?“ Erneut musste Irmgard lächeln. Die Kleine hatte sie offenbar aus den Augenwinkeln gesehen. Pascal fasste nach seinen Füßen, die in bunten Ringelsocken steckten, und erging sich in eigentümlichen Verrenkungen auf dem Sofa. Offenbar nahm er seine eigenen Zappeleien gar nicht wahr, denn auch er verfolgte gebannt den Film.
„Ja, Amelie, der Pudding ist fertig, aber er ist noch zu heiß. Pascal, kannst du kurz den Ton ausschalten?“ Pascal ließ seine Füße los und setzte sich. Artig nahm er die Fernbedienung vom Couchtisch, stoppte aber mit einem Tastendruck den Film, statt nur den Ton auszuschalten.
„He!“, sagte seine Schwester empört und drehte sich auf dem Bauch zu ihm herum.
„Die Oma hat gesagt, ich soll den Ton ausmachen“, verteidigte sich Pascal.
„Kinder, nicht streiten“, mahnte Irmgard. Schon wieder beschleunigte sich ihr Puls. „Ihr könnt gleich weitersehen. Ich gehe eine halbe Stunde an die frische Luft. Ihr seid artig, hört ihr? Keinen Unfug machen.“
Pascal nickte.
„Amelie?“, wandte Irmgard sich an die Kleine.
„Ja-ha, Om-a“, erwiderte das Kind.
„Gut. Ich bin zurück, ehe euer Film aus ist. Bis später.“
„Darf ich wieder anmachen?“, fragte Pascal.
„Ja“, sagte Irmgard. Sie überlegte, ob sie noch einen Abschiedsgruß sagen sollte, doch die Aufmerksamkeit ihrer Enkel hing schon wieder am Bildschirm.
Sie ging in den Flur, zog eine leichte rosa Strickjacke über ihr geblümtes Kleid, schlüpfte in bequeme Laufschuhe und verließ die Wohnung, nur ihr Schlüsselbund nahm sie mit. Im Hausflur überlegte sie, ob sie zuschließen sollte. Sie war nicht sicher, womit ihr wohler war. Falls doch jemand klingelte, und war es nur der Postbote, bestand durchaus die Möglichkeit, dass die kleinen Hände und Füße schneller waren als der Kopf, und eines der Kinder rannte zur Tür und öffnete. Das durften sie nicht. Wobei vom Postboten keine Gefahr drohte, den kannte Irmgard schon lange. Schloss sie zu, beschäftigte sie der Gedanke, dass die Kinder nicht aus der Wohnung kämen, falls es doch notwendig sein sollte. Vielleicht weil sie doch Unfug machten und mit den Zündhölzern spielten, an die sie gar nicht gelangen konnten, weil die sicher verstaut im obersten Fach vom Küchenschrank lagen, wo beide noch nicht rankamen.
Irmgard seufzte. So viele Gedanken, so viele Sorgen. Sie würde jetzt zuschließen. Ein Zweitschlüssel lag in einer Schale auf dem Schuhschrank. Das wussten die Kinder, und damit konnte sogar Amelie schon umgehen, sie hatte es mit ihr geübt. Pascal sowieso, er war wirklich schon ein großer Junge.
Leise ging Irmgard die Treppe hinunter. Im Erdgeschoss wohnte Jette Widmann. Die Frau war unerträglich. Unerträglich neugierig, geschwätzig und aufdringlich. Wie eine Klette hing sie an ihr, sowie sie eine Möglichkeit fand, und bedrängte sie mit Informationen, die sie nicht haben mochte. So zum Beispiel, dass der junge Mann im Haus nebenan angeblich wöchentlich die Freundin wechselte und sie, Jette, den Verdacht hegte, dass der Pfarrer ein Alkoholproblem hätte. Oft schon war Jette genau in dem Moment, rein zufällig natürlich, aus ihrer Wohnung gekommen, wenn Irmgard zum Briefkasten oder Mülleimer gewollt hatte, oder außer Haus. Dann kam sie so rasch nicht weg und musste sich sämtliche Unterstellungen anhören.
So geräuschlos wie möglich öffnete Irmgard die Haustür. Sie sah, dass Jettes kleiner roter Fiesta, der seine besten Zeiten schon lange hinter sich hatte, nicht auf dem Parkplatz stand. Jette war also unterwegs, und sie hätte gar nicht so leise sein müssen. Dafür musste sie jetzt schnell sein, denn wenn Jette nun zurückkam, stand das gleiche Problem an.
Irmgard wandte sich Richtung Ortsausgang. Sie musste nur an wenigen Häusern vorbei, dann kam sie auf einen Feldweg, und der wiederum führte in den nahen Wald. Die Stille dort würde ihr guttun. Tief atmete sie die milde Frühjahrsluft ein und machte sich auf den Weg.
*
Georg Bergmann parkte seinen weißen VW auf dem für Wanderer ausgewiesenen Parkplatz und stieg aus. Es war ein herrlicher Frühlingstag, wie geschaffen für einen schönen langen Spaziergang mit Hector. Er stieg aus, umrundete das Fahrzeug und öffnete die Kofferraumklappe. Hector, ein struppiger Rauhaardackel, saß hechelnd und schwanzwedelnd in seiner Transportbox und konnte es offensichtlich kaum erwarten, dass es endlich losging.
„So mein Junge, ich denke, ich habe ein nettes Fleckchen für uns gefunden“, ließ er den Hund wissen. Hector hechelte noch ein wenig schneller, seine rosa Zunge hing aus der Schnauze, und sein Schwanz klopfte beim Wedeln gegen die Plastikwände der Box. Bergmann sah sich um. Weit und breit war niemand außer ihm. Felder und Wiesen erstreckten sich zu beiden Seiten der schmalen Landstraße, und nur wenige Meter entfernt begann der Wald. Ein Feldweg führte direkt dorthin. Ein Pfeilwegweiser deutete Richtung Wald. ‚Rundweg ca. 1 Stunde’ stand in das verwitterte Holz geschnitzt.
Wo hier der Rundweg sein sollte, erschloss sich Georg Bergmann nicht, er sah nur einen einzigen Weg. Doch das war ihm ziemlich egal, den würde er jetzt gehen. Und so ruhig, wie es hier war, konnte er es verantworten, Hector ohne Leine laufen zu lassen, zumindest im Moment. Er öffnete das Gitter der Box, um seinen Dackel herauszuheben, doch der Hund war schneller und sprang mit einem großen Satz auf den Parkplatz.
„Hector!“, sagte Bergmann, gleichermaßen erschrocken wie vorwurfsvoll. „Das ist nicht gut für deinen Rücken.“ Schnüffelnd untersuchte der Dackel den Parkplatz, ohne seinem Herrn Beachtung zu schenken. Bergmann nahm die Hundeleine, die neben der Box lag, und schloss den Kofferraum.
„Komm mein Junge“, forderte er den Hund auf, der jetzt am Mülleimer das Hinterbein hob. Hector sah ihn an. „Da lang“, ergänzte Georg und zeigte auf den Weg. Eilig wackelte der Dackel voran.
*
Irmgard war bereits ein gutes Stück in den Wald hineingegangen. Ihr Herz schlug nach wie vor zu schnell, manchmal auch ein wenig ungleichmäßig. Ihre Knie zitterten und sie fühlte sich mit jedem Schritt schwächer. Das war nicht gut. Was war denn nur los mit ihr? Sie konnte es sich nicht leisten, krank zu sein. Wer sollte für die Kinder sorgen?
Sie sehnte sich nach einer Bank, doch soweit sie wusste, war der nächste Ruheplatz seitlich des Spazierweges noch etliche hundert Meter entfernt. Aber es gab einen Baumstumpf, nicht weit von hier. Der tat es auch. Bedächtig schritt sie voran. Wo war denn jetzt der Baumstumpf? Hatte sie ihn übersehen? War er doch weiter weg, als sie es in Erinnerung hatte? Irmgard wurde schwindelig, und jetzt bekam sie Angst. Sie musste sich unbedingt hinsetzen. Sie stützte sich mit der flachen Hand am Stamm einer Buche ab. Dort vorne machte der Weg eine Biegung. Wenn sie sich recht erinnerte, war dahinter der Baumstumpf. In ihrem Kopf fuhr etwas Karussell. Sie konzentrierte ihren Blick auf den Waldboden, der noch mit dem Laub des vergangenen Herbstes bedeckt war. Die Blätter, in ihren braunen, orangenen und gelben Farbtönen, feucht vom Tau der vorangegangenen Nacht, kamen auf sie zu. Irmgard spürte, wie ihre Hand am rauen Stamm der Buche entlangglitt. Ihre Knie gaben nach, der Boden kam auf sie zu. Sie schlug auf, geriet ins Straucheln und Rutschen und glitt die Böschung an der Wegseite hinunter. Kopf und Schulter taten ihr weh, aber nicht so schlimm, wie es hätte kommen können. Dann wurde es dunkel um sie.
*
Georg Bergmann lief den Waldweg entlang. Er wäre gerne etwas langsamer gelaufen, um die Natur zu genießen, doch Hector eilte voran, schnüffelte hier und da und hatte es eilig. Einen Versuch, ihn an der Leine zu führen, hatte der Hund erst mit vorwurfsvollen Blicken quittiert und schließlich mit hektischem Ziehen an derselben. Bergmann gestand sich ein, in der Hundeerziehung nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein, und hatte Hector wieder frei laufen lassen.
„Hector!“, rief er, weil der Abstand zwischen ihm und seinem Dackel zunehmend größer wurde. „Hierher!“ Hector blieb stehen und sah zu ihm. Mit dem Blickkontakt, so schien er zu glauben, war dem Gehorsam Genüge getan. Er lief weiter. „Wuff“, machte er plötzlich, blieb stehen und hob witternd die Schnauze. „Wuff.“ Nun fing er an zu rennen.
„Hector, hierher!“, wiederholte Bergmann seinen Befehl, doch der Dackel hörte nicht. Stattdessen wandte er sich vom Weg ab und schlug sich ins Gebüsch. Hier fiel das Gelände ein wenig ab, nicht tief, einen Meter vielleicht oder anderthalb.
„Hector!“ Hoffentlich hatte keinen Hasen gewittert oder ein Reh. Bergmann brach der Schweiß aus, und er beschleunigte seinen Schritt. Schlimmstenfalls ging der Dackel komplett durch, das mochte er sich gar nicht vorstellen. Zudem kannte der Hund sich hier auch gar nicht aus. Selbst wenn sein Jagdeifer, aus welchen Gründen auch immer, erlahmte, er würde den Rückweg nicht finden. Weder zu ihm, noch zum Parkplatz und schon gar nicht nach Hause beziehungsweise zu seinem Sohn, bei dem sie derzeit zu Besuch waren. Außerdem war er mit dem Wagen bestimmt zwanzig Minuten bis hierhergefahren. Eine weite Strecke für den kleinen Kerl. Es war fatal.
„Hector!“, rief er erneut, atemlos und mit einem Anflug von Panik in der Stimme.
„Wuff“, ertönte es, gar nicht weit von ihm. Georg war schwach erleichtert, verlangsamte sein Tempo und sah sich suchend um. „Wo bist du denn? Was machst du?“, regte er sich dennoch auf.
„Wuff“, kam es wieder aus dem Unterholz. Er ging dem Bellen nach und sah über den Rand der Böschung hinunter, etwa in dem Bereich, wo er seinen Hund vermutete. Das Entsetzen fuhr ihm wie ein Hieb in den Magen. Dort saß sein Dackel neben einer älteren Frau, die tot oder zumindest bewusstlos im Gestrüpp lag. Es schnürte Bergmann die Kehle zu, und eiskalt überlief es ihn.
Lieber Himmel, dachte er und kraxelte vorsichtig das leichte Gefälle hinunter. Jetzt nur nicht selbst noch stürzen, am Ende gar auf die Frau drauf. Hector beobachtete ihn aufmerksam.
Endlich war er unten angelangt. Georg stand stocksteif. Er musste Hilfe holen. Aber vielleicht sollte er zunächst nachsehen, ob die Frau noch am Leben war. Er verkrampfte die Hände. Das war nichts für ihn! Wäre nur Kai hier gewesen! In seinem Beruf als Arzt kannte er solche Berührungsängste nicht. Bergmann trat der Schweiß auf die Stirn. „Wuff“, machte Hector wieder, als wollte er ihn ermahnen, endlich zu handeln.
„Hast ja recht, mein Junge“, krächzte er. Er würde Kai anrufen. Der wusste, was zu tun war. Mit klammen Fingern nestelte er sein Handy aus der Jackentasche. Es entglitt ihm und landete im Laub. Mit fahrigen Griffen klaubte er es hervor und entfernte mit dem Ärmel ein paar anhaftende Blätter. Wenigstens hatte er Empfang, das zeigten ihm die drei kleinen Balken im oberen rechten Eck seines Telefons. Zitternd rief er die Kurzwahl auf, unter der die Nummer seines Sohnes eingespeichert war.
„Papa, was gibt’s?“, hörte er die Stimme seines Sohnes, als er noch gar nicht damit gerechnet hatte. Es hatte ja kaum einmal getutet. „Ich bin auf dem Sprung in die Klinik.“
„Junge, du musst mir helfen. Stell dir vor was passiert ist.“ Beinahe hätte er sich beim Reden verhaspelt. Kais Hinweis, dass er zur Arbeit müsste, beschloss er für den Moment zu ignorieren. Es ging schließlich um Leben und Tod, bestenfalls. Schlimmstenfalls war eh schon alles zu spät. Rasch berichtete er, was vorgefallen war.
„Fühl mal den Puls“, wies ihn sein Sohn an. Er hatte es geahnt. Sein Mund wurde trocken. „Papa? Hörst du“, drängte Kai.
„Ja, ja. Ich mach schon. Moment.“ Steifbeinig ging er in die Knie. Mit spitzen Fingern berührte er die Stelle über dem Handgelenk der Frau, wo er den Puls vermutete. Immerhin, ein wenig Wärme war noch in dem scheinbar leblosen Körper, und nun fühlte er auch, ganz sacht, ein Pulsieren.
„Puls hat sie noch“, verkündete er erleichtert und richtete sich auf.
„Okay, Papa. Ich schicke einen Notarzt. Wo genau bist du?“
„Aber Junge, ich hab doch keine Ahnung wo ich bin! Ich wollte mit Hector schön spazieren gehen. Wir sind in der Nähe von einem Ort, der heißt Bachenau. Ich habe ein Hinweisschild gesehen, kurz bevor wir an dem Parkplatz angekommen sind.“
„Gut. Das ist nicht so weit von Maibach. Schick mir doch bitte deinen Standort, den kann ich weiterleiten.“
Bergmann brach zum x-ten Mal der Schweiß aus. Immer dieser Firlefanz mit der modernen Technik.
„Ich weiß doch gar nicht, wie das geht“, regte er sich auf.
„Das ist ganz einfach. Du gehst jetzt auf WhatsApp …“
„Kai! Falls es dir entgangen ist, wir telefonieren gerade miteinander. Wie soll ich denn da auf WhatsApp gehen?“
„Ganz ruhig Papa, das geht, und du schaffst das. Ich erkläre es dir Schritt für Schritt.“ Georg schnaufte. Hätte nicht die hilflose Frau zu seinen Füßen gelegen, er hätte am liebsten das Telefon ins Gebüsch geworfen und seinen Spaziergang mit Hector fortgesetzt. Der Dackel saß wie festgewachsen neben der Frau und fixierte ihn aus seinen dunklen Augen.
„Also, du machst jetzt Folgendes…“, setzte Kai seine Erklärung fort. Georg Bergmann biss die Zähne aufeinander und tat, was sein Sohn ihm sagte.
*
Der Film war aus. Pascal wollte nach der Fernbedienung greifen, die auf dem Wohnzimmertisch lag, um den Fernseher und den DVD-Player auszuschalten.
„Ich will!“, rief Amelie und sprang auf. Schulterzuckend überließ Pascal seiner kleinen Schwester die Aufgabe. Dass Oma noch nicht zurück war, gab ihm zu denken. Sie hatte gesagt, sie würde wieder hier sein, noch ehe der Film zu Ende war. Nun war er zu Ende, aber sie war noch nicht da. Amelie hopste neben ihn auf das Sofa, sodass das Polster federte.
„Ich hab Hunger. Wo ist Oma?“, fragte sie.
„Weiß nicht“, murrte Pascal. Er hatte ein bisschen Angst. Es geschah immer, was Oma sagte, und wenn sie etwas versprach, dann war es auch so. Nun hatte sie gesagt, sie wäre wieder hier, ehe der Film aus war, und jetzt war er aus, aber sie noch nicht hier. Dabei hatte sie es versprochen, und ein Versprechen musste man halten. Aber eigentlich hatte sie es nicht versprochen, sie hatte es nur gesagt. Ob das dasselbe war? Er hätte gern jemanden gefragt, nur wusste er nicht, wen. Amelie war zu klein.
„Wann kommt Oma wieder?“, fragte Amelie. Die kleine Schwester nervte. Er wusste es ja selbst nicht.
„Weiß nicht“, wiederholte er.
„Ich will aber, dass Oma wiederkommt.“ Um Amelies Mundwinkel fing es an zu zucken, und Pascal erschrak. Wenn Amelie anfing zu weinen, wurde es richtig schlimm. Sie weinte nämlich eigentlich nicht, sondern stimmte eher eine Art Geheul an, das war ganz furchtbar, und dann ließ sie sich nicht mehr beruhigen, schon gar nicht von ihm. Dazu brauchte es dann Oma.
„Sie kommt schon wieder“, versuchte er rasch, das Unglück aufzuhalten.
Amelie schniefte und rieb sich mit dem Handrücken über die Augen.
„Ich will den Pudding“, jammerte sie. Immerhin, da konnte er helfen.
„Ich gebe dir was davon“, versicherte er und stand auf. Amelie schob den Po über die Sofakante und trottete hinter ihm her in die Küche.
Der Topf stand auf dem Herd, da kam er gut ran. Mit einem Schüsselchen wurde es schwierig. Die waren oben im Schrank. Selbst wenn er auf einen Stuhl kletterte, kam er wahrscheinlich nicht ran. Aber er konnte den Topf herunterheben und auf den Tisch stellen, und dann bekam Amelie eben nur einen Löffel dazu. Seinetwegen konnte sie auch den ganzen Topf leer essen, er hatte keinen Hunger. Außerdem wollte er erst wieder was essen, wenn Oma zurück war. Plötzlich war ihm selber nach Weinen. Was sollte er nur tun, wenn sie gar nicht wiederkam?
Amelie krabbelte auf allen vieren auf die Küchenbank und setzte sich auf ihren Platz.
„Soll ich aus dem Topf essen?“, fragte sie vorwurfsvoll.
„Ja“, erwiderte Pascal und legte ihr einen Löffel hin. Es war ein großer Löffel. Kleine waren keine mehr in der Schublade. Die waren wahrscheinlich alle in der Spülmaschine, die mochte er nicht anfassen. Wenn das Geschirr dort drinnen noch schmutzig war, roch es immer ziemlich eklig. Wenn es schon sauber war, war es in Ordnung. Das wusste er aber erst, wenn er die Maschine geöffnet hatte, und dann war es zu spät.
„Ich will keinen großen Löffel“, maulte Amelie.
„Ich hab aber keinen anderen“, erwiderte er und dachte, er könnte versuchen, Oma anzurufen. Bei dem Gedanken wurde ihm leichter. Das Telefon lag im Wohnzimmer auf der Kommode. Omas Nummer war eingespeichert.
„Bin gleich wieder da“, erklärte er seiner kleinen Schwester, die missmutig anfing, den Pudding aus dem Topf zu essen, wobei sie nur die Spitze des Löffels in die schokoladige Masse eintauchte. Er rannte fast ins Wohnzimmer, griff nach dem mobilen Hörer und tippte die Kurzwahl von Oma. Aufgeregt lauschte er. Es klackerte in der Leitung. Jetzt wählte das Telefon fast von alleine zu Omas Handy durch. Das war ziemlich toll. Sekunden darauf läutete es aus der Küche, und vor Schreck und Enttäuschung schossen im die Tränen in die Augen.
„Telefon“, rief Amelie mit vollem Mund. Pascal drückte auf die rote Taste des Hörers, und das Läuten aus der Küche brach ab. Er trocknete sich mit dem Ärmel die Augen. Warum hatte Oma ihr Telefon nicht mitgenommen? Sie nahm es immer mit, wenn sie wegging. Jetzt konnte er nur noch Tabea anrufen. Die wohnte über ihnen, und Oma hatte mal gesagt, Tabea würde helfen, wenn es notwendig wäre. Tabea war sehr lieb. Er und Amelie waren schon ein paar Mal bei ihr oben gewesen, wenn Oma zum Frisör oder zum Doktor gewollt hatte. In letzter Zeit aber nicht mehr, denn inzwischen ging er in die Schule und Amelie in den Kindergarten, und Oma nutzte diese Zeit für den Doktor und den Frisör, das hatte sie ihm erzählt. Er mochte Tabea aber trotzdem noch, und manchmal schenkte sie ihm und seiner Schwester Gummibärchen, wenn sie sich im Treppenhaus oder vor dem Haus zufällig trafen.
Auch Tabeas Nummer war im Telefon eingespeichert, unter ihrem Namen. Pascal wählte die Nummer der Nachbarin. Nach dem dritten Läuten meldete sie sich: ‚Hallo lieber Anrufer, ich bin im Moment nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton.’ Pascals Lippen fingen an zu zittern. Tabea war auch nicht daheim. Er schluchzte auf und hielt sofort erschrocken die Luft an. Wenn Amelie merkte, dass er weinte, würde sie Angst bekommen und ein Riesentheater machen, und davor hatte er ziemlich Angst. Schnell drückte er auf die rote Taste am Hörer und legte ihn weg. Das blöde Telefon half im überhaupt nicht weiter.
„Ich mag keinen Pudding mehr“, hörte er Amelies Stimme hinter sich. Er drehte sich zu ihr um. Sie stand unter dem Rahmen der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Ihr Mund war braun verschmiert.
„Du musst dich saubermachen“, würgte er hervor.
„Hm“, machte Amelie und rührte sich nicht von der Stelle. Er könnte nach oben zu Tabea gehen. Vielleicht war sie ja doch daheim und hatte das Telefon nur nicht gehört? Oder, sie hatte nicht rangehen können, weil sie im Bad war? Wenn Oma im Bad war, ging sie auch nie ans Telefon, dann schickte sie meistens ihn. Tabea hatte aber niemanden, den sie schicken konnte. Er würde jetzt bei ihr klingeln. Vielleicht war sie ja doch da und wusste Rat. In Pascals Hals saß ein dicker Kloß. Trotzdem hatte er ein kleines bisschen Hoffnung.
„Ich geh nach oben zu Tabea“, erklärte er seiner kleinen Schwester. „Vielleicht weiß sie, warum Oma so lange braucht.“
Bedächtig nickte Amelie. „Ich komm mit“, entschied sie.
„Nein“, sagte Pascal schnell. Warum er das nicht wollte, war ihm selbst nicht klar. Vielleicht, weil er doll Angst hatte, dass Tabea nicht da war und Amelie dann Theater machen würde. „Du musst deinen Mund saubermachen.“
„Mach ich. Dann darf ich mit?“, fragte Amelie.
„Das geht nicht. Du musst dableiben, weil, wenn Oma jetzt doch gleich wieder hier ist, bekommt sie einen Schrecken, wenn wir beide nicht da sind.“ Das war ein guter Grund, das musste Amelie einsehen. Tatsächlich nickte sie.
„Aber du kommst ganz schnell wieder?“, fragte sie.
„Ja“, versicherte er, erleichtert, die Schwester überzeugt zu haben. Amelie trottete Richtung Badezimmer, und Pascal eilte in den Flur. Die Wohnungstür war abgeschlossen, aber das war nicht schlimm. In der Schale auf dem Schuhschrank lag der Reserveschlüssel. Aufschließen war auch ganz einfach. Schnell stand er im Hausflur, zog sorgfältig die Tür hinter sich zu und bekam den nächsten Schrecken: Er hatte vergessen, den Schlüssel von innen abzuziehen und mitzunehmen. Am liebsten hätte er sich jetzt auf den Boden gesetzt und geweint, aber das half ja nichts.
Hoffentlich machte Amelie ihm die Tür auf, wenn er klopfte und klingelte. Eigentlich durften sie die Tür nicht aufmachen, wenn sie alleine waren. Wenn Amelie jetzt artig sein wollte, hatte er das nächste Problem. Er tröstete sich damit, dass er durch die Tür mit ihr sprechen konnte. Dann wusste sie, dass er es war, und würde öffnen.
Er stapfte die Treppe nach oben, zu Tabeas Wohnung.
Auch nach dem dritten Klingeln rührte sich innen nichts. Jetzt musste er wirklich weinen.
Im Erdgeschoss ging die Haustür auf. Pascals kleines Herz machte einen Satz. War es endlich die Oma? Oder Tabea? Augenblicklich hielt er die Luft an und lauschte. Von irgendwo, weit weg, hörte er die Sirene von einem Polizeiauto. Vielleicht war es auch ein Auto, das kranke Leute abholte. Und im Flur hüstelte jemand, und Pascal wagte nicht, sich von der Stelle zu rühren. Das war weder die Oma noch Tabea. Das war die nervige Jette, die immer braune Röcke trug und glänzende Blusen mit spitzem Kragen und immer lauschte, was im Haus vor sich ging. Oma mochte die Jette nicht, und er mochte sie auch nicht. Manchmal zupfte sie mit spitzen Fingern an seinem Pullover oder seiner Jacke herum und meinte, was er für feine Sachen anhätte. Das gefiel ihm nicht.
Jettes Schlüssel klapperte, und dann klappte ihre Wohnungstür. Rasch lief Pascal ein Stockwerk tiefer und klopfte an die eigene Tür. Amelie machte auf, ohne zu fragen, wer davorstand. Er beschloss, deswegen nicht zu schimpfen. Er war zu froh, dass sie überhaupt aufgemacht hatte.
„Tabea ist auch nicht da“, teilte er seiner Schwester so gelassen wie möglich mit. Amelie nickte.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte sie.
„Nix. Wir warten, bis die Oma wiederkommt“, entschied er, völlig resigniert und ratlos.
„Und bis sie wiederkommt? Was machen wir in der Zeit?“, forschte Amelie. Ihr Mund war nicht richtig sauber geworden. Besser schon, aber nicht richtig.
„Fernsehen“, beschloss er. Was anderes fiel ihm nicht ein.
*
Nicole Menzel stand auf der kleinen Terrasse ihres Hauses in der Toskana und blickte über die Landschaft. Sie sah sanfte Hügel, wogende Blumenfelder und schlanke Zypressen, überhaucht vom goldenen Licht der Abendsonne. Es war friedlich hier, mitten in der Natur, unweit der Hauptstadt Florenz. Milde Frühjahrsluft strich ihr durch die langen blonden Haare und trug den betörenden Duft von Akazienblüten und Ginster zu ihr. Dennoch war etwas leer in ihr. Sie hatte niemanden mehr, mit dem sie diese Herrlichkeiten teilen und mit dem sie sich im Alltag austauschen konnte. Seit Adriano und sie übereingekommen waren, getrennte Wege zu gehen, fühlte sie sich einsam, obwohl ihre Tage nach wie vor ausgefüllt waren. Sie malte und zeichnete von früh bis abends ihre Landschaftseindrücke auf Leinwand und seit kurzem auch auf Holz. An den Markttagen verkaufte sie ihre Werke in der Stadt. Zwar wurden ihr die Bilder nicht gerade aus der Hand gerissen, doch sie hatte ein schönes Einkommen, auf das sie zudem nicht angewiesen war. Eine Erbschaft ihres Patenonkels erlaubte ihr ein angenehmes Leben. Zu der Erbschaft gehörte das kleine Haus hier sowie einige Ersparnisse.
Das Haus hatte Onkel Andreas viele Jahre als Feriendomizil genutzt. Es war aus Natursteinen gebaut, mit einer überdachten Terrasse, deren mit Ziegeln bedecktes Dach von Säulen getragen wurde. In großen Terrakottakübeln blühten üppig farbenprächtige Bougainvillea, und seitlich der Terrasse gab es einen Brunnen, dessen Schacht jedoch seit langem von einem Gitter abgedeckt wurde. Ja, sie lebte in einem Paradies, aber sie lebte alleine hier.
Nicole setzte sich auf einen der Terrassenstühle. Seit Tagen musste sie immer öfter an ihre Kinder denken. Sie stellte sich vor, wie die beiden hier groß werden könnten, in dieser ruhigen, friedlichen Landschaft. Sie hätten in Florenz zur Schule gehen können und mit neuen Freunden hier auf der Terrasse oder im weitläufigen Garten spielen. Allerdings war völlig klar, dass das mit Daniel nicht einfach geworden wäre. Aus seiner Sicht hatte sie sämtliche Rechte als Mutter verspielt, weil sie damals von einem Tag auf den anderen mit Adriano in dessen Heimat gegangen war. Dass sie zur gleichen Zeit die Erbschaft angetreten hatte, war Zufall gewesen, doch ihr war es wie ein Wink des Schicksals erschienen, und sie war mit ihrem Liebhaber hier eingezogen.
Nicole lehnte sich im Stuhl zurück und legte die Beine auf einen Hocker. Es war ihr nicht schwergefallen, Deutschland, ihre Ehe und ihre Kinder hinter sich zu lassen. Deutschland war geprägt von Regeln, Gesetzen und Pflichten, in Italien rief die Freiheit. Nun, ganz so war es nicht, wie sie mit der Zeit festgestellt hatte, und doch lebten hier die Menschen anders. Gelassener und lebensfroher. Ihre Ehe war ihr eintönig und festgefahren erschienen, und Mutter hatte sie nie werden wollen. Daniel hatte sie überredet, und so war Pascal zur Welt gekommen. Daniel war überglücklich gewesen. Dass Amelie noch nachgekommen war, war nicht geplant gewesen, es war einfach passiert. Ab da hatte sich ihr Dasein endgültig festgefahren. Ihr Alltag bestand aus Kinderarzt und Kindergarten und Kindergruppe. Aus Kinderturnen und Kinderbasteln, aus Windeln und Babygeschrei und Kleinkinder-Genörgel und Geheule. Dann hatte sie Adriano kennengelernt, abends in einer Bar, in die sie nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann geflohen war. An dem Abend hatte sie ihm überlassen, was er so unbedingt gewollt hatte: den kräftezehrenden Nachwuchs.
Alles, was danach gekommen war, war wie im Roman gewesen. Sie hatte sich an die Bar gesetzt, neben den dunkelhaarigen Südländer, und er hatte sie angesehen und ihr zugelächelt. Ein Blick in seine Augen hatte genügt. Sie waren dunkel gewesen, fast schwarz, nicht himmelblau, wie in den Büchern, die sie als junge Frau so gern gelesen hatte. Und plötzlich war in ihrem Leben ein Prickeln gewesen, ein Stück Helligkeit und Leichtigkeit, wie sie es schon lange vermisst hatte.
Nicole verschränkte die Hände im Nacken. Sie waren in die Toskana gezogen und zwei Jahre glücklich gewesen. Dann war Adriano unruhig und unzufrieden geworden. Es zog ihn in das pulsierende Leben der Großstadt, die Ruhe in Onkel Andreas‘ Ferienhaus hatte ihn zunehmend gelangweilt. Vielleicht hatte auch sie ihn gelangweilt, mit ihren Farben und Leinwänden. Vor ein paar Monaten hatte er seine Koffer gepackt.
Nicole griff nach ihrem Handy, das auf dem Terrassentisch lag. In Deutschland waren doch bald Ferien, oder? Osterferien, in zwei oder drei Wochen. Sie könnte Pascal und Amelie abholen, um die Zeit hier mit ihnen zu verbringen. Mittlerweile waren die beiden größer, und die leidigen Zeiten von Windeln, Babybrei und Krabbelgruppe waren vorbei. Sie konnte mit ihnen etwas Richtiges unternehmen, sie konnten einander wieder kennenlernen. Die Idee war nicht schlecht. Sie überlegte, ob sie ihren Mann auf ihre Rückkehr und Pläne vorbereiten sollte, und entschied sich dagegen. Es war besser, wenn Daniel nicht viel Zeit zum Nachdenken hatte. Sie würde nächste Woche nach Deutschland fliegen und ihn aufsuchen. Sie waren immer noch verheiratet, und sie hatten das gemeinsame Sorgerecht. Niemand konnte ihr verbieten, die Kinder für ein paar Wochen mit in die Toskana zu nehmen. Der Gedanke gefiel Nicole.
*
Pascal lag in seinem Bett und betrachtete die blauen und gelben Flugzeuge, die auf die Tapete aufgedruckt waren. Die Nachttischlampe brannte. Mit Licht konnte er nicht einschlafen, aber Amelie hatte darauf bestanden, weil sie sich im Dunklen fürchtete, wenn Oma nicht da war. Sie lag neben ihm, schlief tief und fest und klammerte sich an ihn. In ihrem Zimmer hatte sie nicht bleiben wollen. Er hätte sich gerne auf die Seite gelegt, aber das ging nicht, weil sie sonst aufwachte, und das wollte er auf keinen Fall. Er war froh, dass sie überhaupt schlief. Oma kam nicht wieder, da war er sicher. Sie kam genauso wenig wieder wie der Papa. Irgendwann war er einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Das war noch gar nicht so lange her. Damals hatte die Oma viel geweint. Andere Kinder hatten noch eine Mutter, aber ihre war auch weg. An sie konnte er sich gar nicht mehr erinnern. Er hatte mal Oma nach der Mutter gefragt, da hatte sie ganz böse geguckt und nur gesagt, sie würde weit weg leben, in einem anderen Land. Danach hatte er sich nicht mehr getraut, weiter zu fragen.
Tabea war auch nicht da. Er war, als es dunkel geworden war, noch einmal nach oben gegangen, ganz leise, damit Jette es nicht hörte. Jette hörte eigentlich alles. Trotzdem hatte er Glück gehabt. Unten in ihrer Wohnung war der Fernseher gelaufen, vielleicht hatte sie deswegen nicht gemerkt, dass er durchs Treppenhaus geschlichen war. Der Pudding war jetzt auch alle. Im Kühlschrank hatte noch Wurst gelegen, und Brot war auch noch da, aber nicht viel. Er hatte für sich und Amelie Brote zum Abendessen belegt. Für morgen früh würde es auch noch reichen, aber dann gab es nur noch Sachen, die man erst kochen musste, und das konnte er nicht. Nudeln zum Beispiel oder Reis. Dosen hatte Oma auch immer welche im Vorratsschrank, mit Ravioli und Thunfisch. Die bekam er aber nicht auf. Und weil Amelie immer und oft Hunger hatte, brauchte er eine Lösung. Wenn er Geld gehabt hätte, hätte er was einkaufen können. Oma hatte in ihrer Handtasche ihren Geldbeutel, und die Tasche stand im Flur. Da traute er sich aber nicht ran. Nach Weinen war ihm jetzt ständig, nur half das nicht. Also beschloss er, es zu lassen.
Vielleicht hätte ihm Frau Schmolke, seine Klassenlehrerin, helfen können. Leider war Wochenende, und er hatte keine Schule. Wochenende fand er immer prima, noch besser waren nur noch Ferien. Jetzt aber war Wochenende gar nicht gut.
Plötzlich fiel ihm etwas ein. Jeden Morgen, wenn er zur Schule musste, ging er am Tierheim ‚Waldi & Co.’ vorbei. Es war noch gar nicht so lange her, da hatten sie mit Frau Schmolke und der ganzen Klasse einen Besuch dort gemacht. Das Tierheim gehörte Andrea und ihrem Mann. Andrea war sehr nett gewesen und hatte ihnen viel gezeigt: die Tiere, die bei ihnen lebten, und die Arzträume von ihrem Mann Hans Joachim, der kranke Tiere wieder gesund machte. Das war sehr spannend gewesen.
Heidi, die in seine Klasse ging, war sehr aufgeregt gewesen und hatte sich recht wichtiggemacht. Sie kannte nämlich das Tierheim und Andrea und Hans Joachim schon ganz lange und war öfters dort. Heidi wohnte im Kinderheim Sophienlust, das war nicht weit weg von Bachenau, und der Mann, dem das Heim gehörte, hieß Nick und war mit Andrea irgendwie verwandt. Das hatte Heidi erzählt. Er fand das alles recht kompliziert, und es interessierte ihn auch gar nicht. Aber Andrea war ganz lieb gewesen, und als sich die neugierige Anne den Finger in der Tür vom Hasenstall eingeklemmt hatte, hatte sie ihre Mama angerufen, damit die sie abholte. Anne hatte nämlich ein ähnliches Theater gemacht wie Amelie, wenn was schiefging. Und das nur, weil ihr Finger ein bisschen geblutet hatte.
Bei dem Gedanken an Andrea wurde Pascal ein bisschen leichter. Wenn sie Anne geholfen hatte, konnte sie ihm und Amelie vielleicht auch helfen. Es war nicht weit bis zum Tierheim. Den Weg fand er. Amelie so lange alleine in der Wohnung zu lassen, traute er sich allerdings nicht. Diesmal musste er sie mitnehmen. Andrea konnte ihnen bestimmt helfen. Pascal machte die Augen zu. Endlich konnte er auch einschlafen.
*
Pascal lauschte ins Treppenhaus. Unten war es ganz ruhig. Er drehte sich zu seiner Schwester um und legte mahnend den Finger an die Lippen. Amelie nickte ernsthaft. Sie trug ihre hellblaue Popeline-Jacke, darunter ihr kariertes Kleid und geringelte Strumpfhosen. Dazu hatte sie unbedingt ihre roten Sandalen anziehen wollen, die ihr inzwischen zu klein waren. Pascal war sicher, die Oma hätte ihr das nicht erlaubt, aber damit konnte er sich jetzt nicht aufhalten. Vielleicht konnte Andrea Amelie erklären, dass man keine Schuhe tragen sollte, die zu klein waren. Sorgsam steckte er den Wohnungsschlüssel in seine Jackentasche, zog die Tür hinter ihnen zu und nahm Amelie an die Hand. Sie sprachen kein Wort, bis sie das Haus verlassen hatten.
„Wir rennen jetzt bis ums Eck“, wisperte Pascal, als sie draußen standen. „Damit uns die Jette nicht sieht.“ Wieder nickte Amelie. Sie hielt seine Hand sehr fest.
Außer Atem bogen sie um die Kurve.
„Sind wir bald da?“, fragte Amelie schnaufend.
„Bald, ja“, versicherte er.
„Mir ist zu warm“, klagte Amelie.
„Dann zieh halt deine Jacke aus“, schlug er vor. Er hatte es ja geahnt. Das Wollkleid war für den Winter gut und nicht für den Frühling, und die dicke Strumpfhose auch. Amelie zerrte an ihrer Jacke, wand sich heraus und reckte sie ihm entgegen.
„Nee“, sagte er entschlossen. „Die kannst du selber tragen.“ Amelie machte den Mund auf, als wollte sie protestieren, klappte ihn dann aber wieder zu und klemmte sich die Jacke unter den Arm. Sie blickte finster, sagte aber nichts mehr.
„Da vorn ist das Tierheim“, versuchte er sie abzulenken.
„Wo?“ Amelie sah geradeaus.
„Wir müssen noch um die Kurve, dann sind wir fast da“, erklärte er.
*
Das Tierheim war sehr groß, fand Amelie. Es war ein weißes, langes Haus, und auf einer Seite war noch ein Haus angebaut und davor war ein Garten. Vor dem Haus stand eine Bank. Die Haustür war aus Glas, und eigentlich waren es zwei Türen. Pascal hatte jetzt schon zweimal geklingelt, aber es machte niemand auf. Irgendwo bellte ein Hund, sie sah aber keinen. Ihr taten die Füße weh. Die Schuhe waren zwar voll schön, aber inzwischen wirklich zu klein, und mit den dicken Strumpfhosen wäre sie fast nicht in die Sandalen gekommen. Das wollte sie Pascal aber nicht sagen. Pascal sah aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. Wenn der große Bruder weinte, bekam sie doll Angst und fühlte sich ganz schrecklich alleine. Ihr fehlte die Oma, aber so lange Pascal da war und sich um alles kümmerte und sagte, was sie als Nächstes machen würden, war es nicht so schlimm. Wenn er weinte war es schon schlimm, denn das hieß, dass er auch nicht mehr weiterwusste.
„Sollen wir warten, bis jemand kommt?“, piepste sie, in der Hoffnung ihm Mut zu machen, damit das Weinen gar nicht erst anfing. Pascal nickte. Gemeinsam setzten sie sich auf die Bank vor dem Haus. Amelie saß ganz still.
„Die kommen nicht“, sagte sie leise, nach einer Weile, die ihr endlos vorkam.
„Hm“, machte Pascal, der völlig niedergeschlagen dreinsah. Sie hätte ihn gern gefragt, was sie als Nächstes machen sollten, aber sie traute sich nicht. Die Bank, auf der sie saßen, lag im Schatten, und trotz des schönen Frühlingstages wurde es Amelie kalt. Sie überlegte, ihre Jacke wieder anzuziehen. Durst hatte sie auch. Der Durst war ziemlich schlimm.
„Ich mag was trinken“, sagte sie leise. So leise, dass sie hoffen konnte, Pascal hätte es nicht gehört, denn er wüsste ja auch keine Lösung für ihr Problem.
„Wir gehen ins Kinderheim“, sagte Pascal, auch ganz leise. Seine Stimme klang sehr kratzig.
„Ins Kinderheim?“, erschrocken sah Amelie ihren großen Bruder an.
„Ja. In das Heim, in dem Heidi wohnt.“
„Die Heidi, die in deine Klasse geht?“, fragte Amelie. Sie hatte Angst. Kinderheim klang sehr seltsam.
„Ja. Sie wohnt in einem großen Haus mit vielen anderen Kindern, die keine Eltern mehr haben“, flüsterte Pascal.
„Aber wir haben doch Oma“, wandte Amelie ein.
„Jetzt nicht mehr.“ Pascals dunkle Augen füllten sich mit Tränen. Bestürzt schob Amelie ihre kleine Hand in seine.
„Oma kommt bestimmt wieder“, versuchte sie ihn zu trösten. Pascal gab keine Antwort.
„Ist es weit bis ins Kinderheim?“, erkundigte sie sich und sah besorgt auf ihre zu engen Schuhe.
„Ein bisschen weit ist es“, gab Pascal zu und stand von der Bank auf. „Wir müssen da lang.“ Er zeigte die Straße hinunter.
*
Nick von Wellentin-Schoenecker schob einige Papiere auf seinem Schreibtisch zusammen und fuhr den Computer herunter. Es war gleich elf Uhr, und um 11.30 Uhr hatte er einen Termin beim Zahnarzt in Maibach. Er verließ sein Büro im Kinderheim Sophienlust und schloss die Tür hinter sich. In der großzügigen Eingangshalle des Heims begegnete ihm Magda, die Köchin des Hauses, die eben auf einem Servierwagen das Geschirr für das Mittagessen ins Esszimmer brachte.
„Hallo, Magda“, begrüßte er sie und lächelte. „Was gibt es denn heute Köstliches zu Mittag? Es duftete ja schon wieder ganz wunderbar.“
„Hallo, Nick. Heute gibt es eine Reis-Hackfleisch-Pfanne mit Gemüse, und als Dessert rote Grütze mit Vanillesoße“, berichtete Magda und strahlte ihn an. Ihre Wangen waren gerötet und aus ihren Haaren, die sie im Nacken zusammengefasst hatte, hatten sich ein paar Strähnen gelöst. Die Küchenschürze spannte um ihre rundliche Figur.
„Das klingt phantastisch. Ich hoffe, es ist eine Portion übrig, bis ich vom Zahnarzt zurückkomme?“, fragte er.
„Zahnarzt? Du lieber Himmel.“ Erschrocken sah Magda ihn an. Nick lachte.
„Nur zur Kontrolle, Magda. Zumindest hoffe ich das, nicht, dass der Doktor doch etwas findet.“
„Ach so. Dann bin ich beruhigt. Natürlich habe ich reichlich gekocht, und für dich ist immer etwas übrig, das weißt du doch.“
„Ja, das weiß ich.“ Noch einmal lächelte er die Köchin an. „Jetzt muss ich aber wirklich los, sonst komme ich zu spät.“
Magda nickte ihm zu.
„Bis später“, sagte sie und schob ihren Servierwagen Richtung Esszimmer.
Nick verließ das Haus und eilte die Freitreppe hinunter, zu deren Füßen die Parkplätze waren. Eben stieg seine Mutter, Denise von Schoenecker aus ihrem Wagen. Auch sie lächelte ihrem Sohn zu.
„Hallo, Nick, du bist ja noch hier. Ich dachte, du hast um elf Uhr einen Termin beim Zahnarzt?“
„Hallo, Mama. Erst um 11.30 Uhr. Die Praxis hat noch mal angerufen und gefragt, ob ich eine halbe Stunde später kommen kann. Jetzt muss ich mich aber trotzdem beeilen. Ich habe mich noch kurz mit Magda unterhalten und bin jetzt tatsächlich spät dran.“
„Gut.“ Denise lächelte ihren Sohn an. „Dann bis später.“
„Bis dann, Mama.“ Nick öffnete seinen Wagen mit der Fernbedienung und setzte sich hinters Steuer. Gleich darauf fuhr er die Zufahrt hinunter und passierte das zweiflügelige Tor zur Straße, das immer offenstand. Bis Maibach brauchte er mit dem Auto etwa zwanzig Minuten. Parkplätze gab es hinter der Zahnarztpraxis, sodass er zumindest in dieser Hinsicht kein Problem bekommen würde. Obwohl er mittlerweile wirklich knapp in der Zeit war, fuhr er achtsam und hielt sich genau an die erlaubte Geschwindigkeit.
Er hatte etwa ein Viertel der Strecke geschafft, als er seitlich der Straße zwei Kinder laufen sah. Er fuhr langsamer. Beim Näherkommen erkannte er, dass es sich um einen Jungen und ein kleines Mädchen handelte. Der Junge mochte vielleicht schon zur Schule gehen, das Mädchen wahrscheinlich noch nicht. Sie hielten einander an den Händen und sahen zu Boden.
Hier stimmte etwas nicht. Die Gegend war nicht unbedingt einsam, doch letzten Endes handelte es sich um eine Landstraße, die die Orte Maibach, Bachenau und Wildmoos, wo sich das Kinderheim befand, verband. Diese Landstraße führte teilweise auch durch den Wald. Erwachsene Begleitpersonen sah er keine.
Nick setzte den Blinker und hielt wenige Meter vor den Kindern am Straßenrand an. Er ließ die Seitenscheibe herunter.
„Hallo ihr beiden. Habt ihr euch verlaufen? Kann ich euch helfen?“, fragte er.
Die Kinder waren stehengeblieben. Ängstlich sah der Junge ihn an. Das Mädchen drückte sich an seine Seite. Sie gaben keine Antwort.
„Ich bin Nick“, sagte er. „Wie heißt ihr denn?“
„Pascal“, sagte der Junge leise.
„Und wie heißt du?“, wandte Nick sich an das Mädchen.
„Amelie“, wisperte sie.
„Wohin wollt ihr denn?“, fragte er.
„Wir wollen ins Kinderheim“, sagte Amelie. „Die Oma ist nämlich weg.“
„Wie meinst du das: Die Oma ist weg?“ Ein Alarmglöckchen in seinem Inneren schlug an. Sein erster Gedanke, dass hier etwas nicht stimmte, war wohl berechtigt gewesen.
„Sie wollte nur kurz weg und ist nicht mehr wiedergekommen“, sagte jetzt der Junge.
„Wann war das?“, fragte Nick und warf einen Blick in den Rückspiegel. Ein weißer Mercedes näherte sich, setzte den Blinker und überholte ihn.
„Gestern“, antwortete Pascal bedrückt und sah zu Boden. Liebe Güte. Und seither waren die Kinder alleine?
„Und wer passt sonst noch auf euch auf? Wo sind eure Eltern?“, fragte Nick.
„Wir haben keine Eltern. Wir wohnen bei Oma, und die ist jetzt auch weg. Manchmal passt Tabea auf, aber die ist auch weg“, berichtete der Junge.
Das klang alles gar nicht gut. Er konnte die Kinder unmöglich hier stehen lassen, beziehungsweise alleine weiterlaufen lassen.
„Und jetzt wollt ihr ins Kinderheim?“, vergewisserte er sich noch einmal.
„Ja. Da wohnt nämlich die Heidi“, sagte Pascal. „Die geht in meine Klasse.“
„Heidi, ja. Die kenne ich“, antwortete Nick. Misstrauisch und verwundert gleichermaßen sah Pascal ihn jetzt direkt an.
„Mir gehört das Kinderheim“, erklärte Nick. „Ich bin Nick von Wellentin-Schoenecker. Ihr könnt Nick zu mir sagen. Steigt ein, ich bringe euch nach Sophienlust.“ Den Zahnarzt-Termin konnte er vergessen.
„Nein“, sagte Pascal und trat schnell einen Schritt nach hinten, sodass er ins Stolpern geriet, da der Straßenrand hier ein wenig abfiel. Gerade noch schaffte er es, nicht hinzufallen. „Wir dürfen zu niemand ins Auto steigen.“
„Da habt ihr recht“, stimmte Nick zu und überlegte, wie er die beiden sicher ins Kinderheim bringen könnte. Vielleicht hatten sie zu einer Frau mehr Vertrauen. Sicher war seine Mutter bereit, die Kinder abzuholen. Andererseits, so furchtsam wie die beiden dreinsahen, mochten sie sich auch weigern, zu seiner Mutter ins Auto zu steigen. Dass sie so skeptisch waren, war ja im Prinzip ganz richtig.
Ein neuer Gedanke ging ihm durch den Kopf: Wenn er seine Mutter anrief und sie bat, Heidi mitzubringen, vielleicht waren sie dann bereit, mitzufahren.
„Was haltet ihr davon, wenn ich Heidi bitte, euch abzuholen?“, fragte er. Überrascht sah Pascal ihn an. „Natürlich nicht alleine. Meine Mutter würde mit ihr hierherkommen, und ich warte, bis die beiden da sind. Ihr müsst nicht zu mir ins Auto steigen.“ Pascal und Amelie tauschten einen Blick. Zögernd nickte Pascal.
„Meine Mutter ist Tante Isi. Vielleicht hat Heidi ihren Namen schon mal erwähnt?“, fragte Nick, um das verhaltene Vertrauen zu stärken. Jetzt nickte Pascal, und sein ängstliches Gesicht entspannte sich ein wenig.
„Gut. Ich rufe jetzt Tante Isi an und bitte sie, Heidi mitzubringen. Dann fahrt Sophienlust, und wenn ich aus der Stadt zurück bin, erzählt ihr mir, was genau passiert ist. Vielleicht können wir euch helfen, die Oma zu finden.“ Wieder nickte Pascal. Nick sah eine Spur Erleichterung in seiner Miene. Amelie schien sich weniger Sorgen zu machen, hielt sich aber dicht an ihren Bruder gedrückt. „Seid ihr Geschwister?“, vergewisserte er sich noch und nahm sein Handy aus der Hemdtasche.
„Ja“, sagte Pascal leise. Nick suchte in der Kontaktliste nach dem Namen seiner Mutter und drückte auf Anrufen.
*
Denise von Schoenecker legte den Hörer des Telefons auf und erhob sich von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch. Eben hatte Nick angerufen. Er brauchte ihre Hilfe. Sie nahm ihre Handtasche, die unter dem Tisch stand, und verließ das Büro.
An diesem herrlichen Frühlingstag waren die Kinder vermutlich alle draußen und spielten auf den Spielplätzen oder mit den Hunden. Heidi und Kim waren bestimmt schaukeln oder rutschten oder spielten Verstecken. Sie musste Heidi suchen.
Denise durchquerte die Eingangshalle, öffnete die Haustür und sah über den weitläufigen Rasen zu den Spielplätzen. Tatsächlich sah sie das blonde kleine Mädchen, das mit Kim Federball spielte. Heidi war schon recht geschickt, Kim brauchte noch ein wenig Übung. Er traf den Ball eher zufällig. Denise lief die Freitreppe hinunter und überquerte den Rasen.
„Tante Isi, guck mal. Ich kann das schon so gut!“, rief Heidi. Sie warf den Federball in die Luft, schwenkte dabei den anderen Arm, in dessen Hand sie den Schläger hielt, und traf den Ball. Leider landete er fast unmittelbar vor ihren Füßen im Gras.
„Manno!“, rief sie und lachte.
„Du noch nicht kannst gut“, kritisierte Kim, der kleine Asiate mit den glänzenden schwarzen Haaren, und schüttelte den Kopf.
„Besser als du aber schon“, entgegnete Heidi.
„Ihr macht das beide ganz prima“, versicherte Denise. „Heidi, ich bräuchte deine Hilfe. Eben hat Nick angerufen.“ Kurz erklärte sie der Kleinen die Situation.
„Pascals Oma ist weg? Oh, oh“, machte Heidi besorgt.
„Ja. Er und seine Schwester machen sich große Sorgen. Würdest du mit mir mitfahren, die beiden abholen? Sie wollten nicht zu Nick ins Auto steigen, und da haben sie ja auch völlig recht. Sie kennen ihn ja gar nicht.“
Verständig nickte Heidi.
„Ja, das darf man nicht“, stimmte sie zu. „Klar komme ich mit.“
„Ich auch mit mag“, erklärte Kim und wedelte mit seinem Federball-Schläger.
„Natürlich darfst du auch mit“, versicherte Denise. „Wir brauchen auch nicht lange. Mit dem Auto sind wir in ein paar Minuten da.“
*
Heidi saß neben Kim auf der Rückbank von Tante Isis Wagen. Sie fühlte sich sehr wichtig. Dass Pascals Oma weg war, war schlimm. Er war bestimmt traurig und hatte Angst. Es war sehr gut, dass die beiden jetzt auch ins Kinderheim kamen. In Sophienlust war es sehr schön und alle waren ganz lieb und nett. Sie war schon ganz aufgeregt, den beiden alles zu zeigen und zu erklären.
Kim hätte ihretwegen nicht mitfahren müssen, außerdem wurde es auf der Rückfahrt bestimmt eng im Auto. Irgendwer musste vorne sitzen. Sie hoffte sehr, dass sie das sein durfte. Andererseits saß dann Kim mit Pascal und seiner Schwester hinten bei ihm, das gefiel ihr nicht so. Sie wollte ihnen schon auf der Fahrt einiges von Sophienlust erzählen, und sie wollte natürlich auch wissen, was genau passiert war. Das konnte sie auch von vorne, vom Beifahrersitz aus. Aber dann musste sie sich dauernd umdrehen, das war doof, und noch mehr doof würde es sein, wenn Kim sich vordrängeln und mit Pascal unterhalten würde. Heidi sah eine schwierige Situation auf sich zukommen.
Schon sah sie Nicks Wagen am Straßenrand stehen. Er hatte den Warnblinker eingeschaltet und wartete selbst neben dem Auto. Sie sah auch Pascal, und das Mädchen daneben musste seine Schwester sein. Tante Isi hielt hinter Nicks Wagen.
„Ihr bleibt sitzen“, wies sie Heidi und Kim an. Heidi, die bereits ihren Sicherheitsgurt hatte lösen wollen, war ein wenig frustriert. Nun konnte sie die beiden gar nicht richtig begrüßen.
Tante Isi sprach mit Nick und Pascal und seiner Schwester. Nick stieg in sein Auto, winkte und fuhr davon. Tante Isi führte Pascal und seine Schwester zu ihrem Auto.
„Kim“, sagte Tante Isi. „Magst du vorne bei mir sitzen? Dann können Pascal und Amelie hinten zu Heidi und sich ein bisschen unterhalten.“ Kim nickte eifrig, und in Heidis Bauch zwickte es ein wenig. Vorne sitzen war eine ganz tolle Sache. Es wäre viel besser gewesen, wenn Kim gar nicht mitgekommen wäre. Dann hätte sie sich jetzt nicht ärgern müssen, wegen der Sitzregelung.
Pascal und Amelie kletterten auf die Rückbank, und Tante Isi half Amelie beim Anschnallen. Keiner hatte Hallo gesagt, und die beiden guckten sie auch gar nicht an. Heidi war Pascal ein bisschen böse deswegen. Wenn er nicht mit ihr sprach, hätte sie auch gar nicht mitfahren müssen, dachte sie und sah aus dem Fenster.
„Wir brauchen nicht lange, bis wir in Sophienlust sind“, sagte Tante Isi und blickte durch den Rückspiegel nach hinten. Das merkte Heidi aus den Augenwinkeln. „Wenn wir dort sind, gibt es auch gleich Mittagessen. Ihr habt doch sicher Hunger?“, fragte sie.
„Ich hab Durst, aber auch Hunger“, ließ sich Amelie vernehmen. Heidi schielte zu ihr. Sie trug dicke Wollstrümpfe zu Sandalen. Das passte gar nicht zusammen, und die Sandalen quetschten ihre Füße ein. Die waren zu klein. Aber bestimmt hatte Tante Ma, die Heimleiterin, etwas anderes zum Anziehen in ihrem Vorrat. Tante Ma hatte immer fast alles da, wenn ein Kind was brauchte.
„Es gibt Reis mit Hackfleisch“, rang Heidi sich zu sagen durch. Amelie wandte ihr den Kopf zu.
„Das kenn ich nicht“, sagte sie. „Also Reis kenn ich schon, und Hackfleisch auch. Aber das kocht die Oma zu Nudeln.“
„Man aber auch kann essen mit Reis“, ließ sich Kim von seinem Prinzenplatz vernehmen. „Und hinterher es gibt roten Pudding mit weißer Soße.“
„Das heißt rote Grütze mit Vanillesoße“, korrigierte Heidi.
„Du sprichst komisch“, sagte Amelie.
„Ich noch muss besser lernen deutsche Sprache“, erklärte Kim. „Ich von weit weg komme.“
„Ja, mit Boot über große Wasser“, ergänzte Heidi, und verlegener Schrecken durchfuhr sie, als Tante Isi mahnend durch den Rückspiegel zu ihr sah.
„Du mich nicht nachmachen musst“, protestierte Kim prompt. „Du von hier kommst, du kannst Deutsch gut. Nicht ich.“
Heidi schämte sich plötzlich, und das war doppelt schlimm, weil Pascal und Amelie ihren Schnitzer mitbekommen hatten. Es war wirklich nicht schön von ihr gewesen, Kim nachzuahmen. Pascal guckte aus dem Fenster, als würde er gar nicht zuhören. Aber Amelie sah interessiert zwischen ihnen hin und her.
„Was ist denn mit eurer Oma?“, wandte sie sich an Amelie, wohl wissend, dass sie sich eigentlich bei Kim hätte entschuldigen sollen. Tante Isi würde sie bestimmt noch einmal darauf ansprechen. Es war gerade alles ein bisschen doof.
„Die Oma wollte spazieren gehen und ist nicht mehr zurückgekommen“, erklärte das Mädchen.
„Vielleicht hat sie sich verlaufen“, überlegte Heidi.
„Vielleicht. Nick sagt, er hilft uns, die Oma wiederzufinden“, klärte Amelie Heidi auf.
„Er findet sie bestimmt“, versicherte Heidi. Nick konnte ganz viel, und Tante Isi auch. Und auch Tante Ma und Kinderschwester Regine, sie halfen alle überall, wo sie konnten. Das war sehr schön. Und Magda half auch ganz viel, nämlich, dass keiner Hunger haben musste. Im Moment hatte Heidi schon ziemlich Hunger, vor allem, wenn sie daran dachte, was es heute Leckeres gab. Sie sah zwischen den Vordersitzen durch die Frontscheibe des Wagens. Dort vorne war schon Sophienlust.
„Wir sind gleich da“, verkündete sie und sah abwartend die beiden Neuankömmlinge an. Amelie blickte interessiert aus dem Fenster, Pascal aber senkte den Kopf. Er wollte nicht hier sein, stellte Heidi fest. Aber vielleicht war er auch nur traurig wegen seiner Oma.
*
Pascal saß im Esszimmer von Sophienlust an einem sehr langen Tisch mit vielen anderen Kindern. Manche waren schon recht groß, andere waren etwa so alt wie er und Amelie. Ein großes Mädchen mit rotblonden krausen Haaren und vielen Sommersprossen fiel ihm besonders auf. Die anderen nannten das Mädchen ‚Pünktchen‘. Pünktchen war auch schon fast erwachsen. Sie war sehr freundlich, und ihre leuchtenden kringeligen Haare hätte er echt lustig gefunden, wenn er nicht so traurig gewesen wäre. Solche Haare hatte er noch nie gesehen, aber sie gefielen ihm. Ihm gegenüber saßen zwei Jungen, die hießen Fabian und Martin. Sie waren auch schon größer.
Gleich nachdem sie in Sophienlust angekommen waren hatte Tante Isi ihnen im ersten Stock des Kinderheims ein Zimmer gezeigt, in dem er und Amelie schlafen sollten. Dann hatte Tante Isi ihnen Tante Ma vorgestellt. Sie hieß eigentlich Else Rennert und war die Heimleiterin. Das verstand er nicht ganz, denn das Heim gehörte ja Nick und vielleicht auch seiner Mama, die eben Tante Isi war. Warum brauchte es da noch eine Heimleiterin? Aber es war nicht wichtig. Wichtig war, dass Tante Ma Amelie ein schönes leichtes Kleid gegeben hatte, mit vielen Schmetterlingen drauf, weiße Söckchen und Sandalen, die gut passten. Er überlegte, dass sie weder Schlafanzüge dabeihatten, noch was zum Umziehen und auch kein Zahnputz-Zeug. Aber vielleicht wusste Tante Ma auch hier Abhilfe.
Am anderen Ende vom Tisch saß eine blonde Frau, das war Kinderschwester Regine. Sie hatte ihn und Amelie auch ganz freundlich begrüßt und ihnen das Esszimmer gezeigt und das Spielzimmer, das war gleich nebenan. Im Spielzimmer hatten zwei große Hunde auf noch größeren Kissen gelegen und ihnen neugierig entgegengeguckt. Als sie ins Zimmer gekommen waren, waren die beiden aufgestanden und zu ihnen gekommen. Sie hatten sie beschnuppert und mit dem Schwanz gewedelt. Pascal mochte Hunde gern, nur die zwei waren schon sehr groß. Sie hießen Barri und Anglos, und Schwester Regine hatte gesagt, Barri wäre ein Bernhardiner und Anglos eine Dogge. Amelie hatte sich zuerst hinter ihm versteckt. Dann hatte Barri gegähnt und dabei ein ulkig quietschendes Geräusch gemacht, da hatte Amelie lachen müssen und sich sogar getraut, beide Hunde kurz zu streicheln. Pascal schwirrte der Kopf von den vielen neuen Namen und Gesichtern. Von hinten beugte sich jemand zu ihm.
„Hallo, junger Mann. Ich bin Magda. Ich koche für euch. Und wer bist du?“
„Pascal“, erwiderte er leise. „Und meine Schwester heißt Amelie.“
„Hallo, Amelie“, begrüßte Magda auch sie. „Mögt ihr eine Portion Reis mit Hackfleisch?“ Beide nickten. Pascal merkte, dass er doch ziemlich Hunger hatte, und außerdem roch das Essen sehr gut. Auch die Schüsselchen mit dem Nachtisch gefielen ihm. Er hatte ganz viele davon auf einem Servierwagen stehen sehen. Magda lächelte ihm zu und stellte einen vollen Teller vor ihn.
„Guten Appetit, kleiner Mann“, sagte sie. Plötzlich wurde ihm ein bisschen leichter. Alle hier waren wirklich sehr lieb, und vielleicht fand Nick die Oma tatsächlich. Pascal nahm einen großen Schluck von seiner Apfelsaft-Schorle und begann zu essen.
*
Nick betrachtete grübelnd das Telefon. Er hatte nach dem Mittagessen mit Amelie und Pascal gesprochen, um etwas über deren Großmutter zu erfahren. Ihren Namen zum Beispiel. Hier hatte Pascal helfen können. Die Oma hieß Irmgard Menzel. Er wusste auch, dass sie 72 Jahre alt war. Ihr letzter Geburtstag war nämlich noch nicht lange her. Schwieriger wurde es schon, sie zu beschreiben und was sie angehabt hatte, als die beiden sie das letzte Mal gesehen hatten. Doch das schien Nick dann nicht mehr so wichtig. Pascal hatte ihm auch sagen können, wo sie alle zusammen wohnten, und dass sie keine Eltern mehr hatten. Von Freunden oder Bekannten der Großmutter, bei denen man hätte nachfragen können, wusste der Junge nichts. Es gab nur eine Nachbarin, Tabea, die ein Stockwerk höher wohnte und auch nicht zu Hause gewesen war.
Gleich die Polizei zu informieren, erschien Nick übertrieben. Er wollte es erst in der Klinik versuchen. Vielleicht hatte die alte Dame einen Unfall gehabt. Er griff nach dem Hörer des Telefons und wählte die Rufnummer der Zentrale des Klinikums in Maibach. Nach dem zweiten Läuten wurde abgehoben.
„Klinikum Maibach, Zentrale, Stiegler am Apparat“, hörte er eine sonore Männerstimme.
„Guten Tag“, meldete er sich. „Mein Name ist Dominik von Wellentin-Schoenecker. Ich suche eine ältere Dame, die seit gestern von ihren Enkeln vermisst wird. Eine Frau Irmgard Menzel, 72 Jahre alt. Ist Frau Menzel gestern oder heute bei Ihnen eingeliefert worden?“
„Moment, ich sehe nach“, erwiderte Herr Stiegler. Es dauerte eine Weile, er hörte ihn brummelnd sprechen, verstand aber nicht, was er sagte. Vermutlich redete er mit sich selbst, denn es gab keine zweite Stimme, die antwortete.
„Nein, den Namen haben wir nicht gelistet“, sagte Herr Stiegler nach knapp einer Minute. „Es ist aber tatsächlich eine ältere Frau eingeliefert worden, und zwar gestern Nachmittag. Sie ist allerdings noch bewusstlos und sie hatte keine Papiere bei sich. Vielleicht ist das die Dame, die Sie suchen? Ich verbinde Sie auf die Station.“ Ehe Nick sich bedanken konnte, klackerte es in der Leitung und eine Melodie ertönte. Dazwischen informierte ihn eine vermutlich computergesteuerte Frauenstimme, dass er verbunden werden würde. Sekunden später brach die Melodie ab.
„Schwester Anja, Station drei“, sagte eine Frau. Sie klang gehetzt. Erneut trug Nick sein Anliegen vor.
„Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die Frau, die bei uns liegt, die von Ihnen gesuchte Irmgard Menzel ist. Sie hatte absolut nichts bei sich, keine Papiere, kein Handy, gar nichts. Nur ein Schlüsselbund, das keine Rückschlüsse auf ihre Person oder ihre Adresse zulässt. Das Alter könnte passen“, sagte Schwester Anja.
„Können Sie mir sagen, was passiert ist, beziehungsweise wie es ihr geht?“, fragte Nick.
„Tut mir leid, dazu darf ich keine Auskünfte geben. Oder sind Sie ein Angehöriger?“
„Nein.“ In wenigen Sätzen erklärte Nick auch Schwester Anja, aus welchem Grund er anrief.
„Ach so, ja, ich verstehe. Das ist natürlich schlimm für die Kinder. Trotzdem, ich weiß nicht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Ich kann Ihnen nur anbieten, dass wir uns bei Ihnen melden, sowie die Patientin erwacht und wir mit ihr sprechen konnten.“
„Das wäre sehr freundlich. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummern. Das Festnetz und auch die Mobilfunknummer“, sagte Nick.