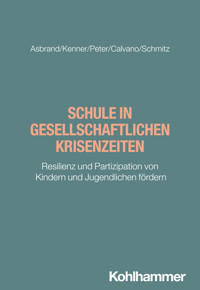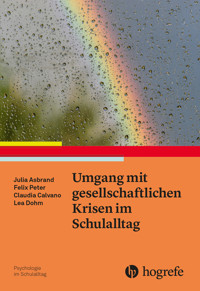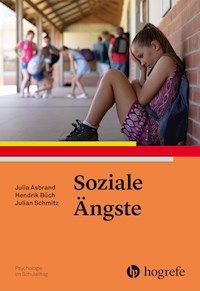
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Soziale Ängste gehören zu den häufigsten psychischen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. Sie sind gekennzeichnet durch die Furcht, sich gegenüber fremden Personen peinlich zu verhalten oder sich zu blamieren. Typische Situationen sind das Treffen von neuen Kindern und Jugendlichen, der Besuch von Gruppen wie Sportvereinen und Leistungssituationen im Schulalltag. In der Schule stellen diese Ängste die betroffenen Kinder und Jugendlichen wie auch die Lehrkräfte vor erhebliche Herausforderungen. Das Buch beschreibt, wie sich soziale Ängste im Kindes- und Jugendalter in der Schule äußern, wie sie entstehen, wodurch sie aufrechterhalten werden und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Darüber hinaus liefert es Lehrkräften und anderen Personen im Schulkontext Hilfestellungen, wie sie Kinder und Jugendliche mit sozialen Ängsten in der unterstützen und fördern können. Arbeitsmaterial im Anhang unterstützt die Lehrkräfte, soziale Ängste zu erkennen und betroffene Schülerinnen und Schüler im Schulalltag anzuleiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Julia Asbrand
Hendrik Büch
Julian Schmitz
Soziale Ängste
Psychologie im Schulalltag
Band 5
Soziale Ängste
Julia Asbrand, Hendrik Büch und Julian Schmitz
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Caterina Gawrilow, Prof. Dr. Marcus Hasselhorn, Prof. Dr. Ulrich Trautwein, Prof. Dr. Christina Schwenck, Dr. Anke Leuthold-Zürcher
Die Reihe wurde begründet von:
Caterina Gawrilow, Marcus Hasselhorn, Ulrich Trautwein, Christina Schwenck, Stefan Drewes
Prof. Dr. Julia Asbrand, geb. 1985. 2005 – 2011 Studium der Psychologie in Freiburg. 2011 – 2020 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 2016 Promotion. Seit 2020 Professorin für Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -psychotherapie an der HU Berlin. Arbeitsschwerpunkt: Multimethodale Grundlagen- und Psychotherapieforschung, Angst im Kindes- und Jugendalter.
Dr. Hendrik Büch, geb. 1975. 1997 – 2003 Studium der Psychologie in Kiel und Marburg. 2008 Promotion. 2007 – 2008 Stationspsychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der RWTH Aachen. Seit 2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Psychotherapeutischen Ambulanz für Kinder- Jugendliche und Familien der Hochschulambulanz am Institut für Psychologie der Uni Freiburg. Seit 2010 Ambulanzleitung am Freiburger Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Prof. Dr. Julian Schmitz, geb. 1983. 2002 – 2008 Studium der Psychologie in Marburg und Freiburg. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Albert-Ludwigs-Universität und am Universitätsklinikum Freiburg. 2012 Promotion. Seit 2014 Professor für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Arbeitsschwerpunkt: Multimethodale Erfassung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter in sozialen Kontexten.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com by Getty Images / wavebreakmedia
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3058-4; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3058-5)
ISBN 978-3-8017-3058-1
https://doi.org/10.1026/03058-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Fallbeispiele
1.1 Fallbeispiel 1: Kind, 8 Jahre – Jonas, Grundschule, 2. Klasse, Diagnose Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
1.1.1 Vorstellungsanlass und Entwicklungsgeschichte
1.1.2 Familiäre Situation
1.1.3 Diagnose
1.1.4 Weitere Entwicklung und Förderung
1.2 Fallbeispiel 2: Jugendliche, 14 Jahre – Lena, Realschule, 9. Klasse, Diagnose soziale Phobie
1.2.1 Vorstellungsanlass und Entwicklungsgeschichte
1.2.2 Familiäre Situation
1.2.3 Diagnose
1.2.4 Weitere Entwicklung und Förderung
1.3 Fallbeispiel 3: Kind, 11 Jahre – Marissa, Gymnasium, 6. Klasse, keine Diagnose
1.3.1 Vorstellungsanlass und Entwicklungsgeschichte
1.3.2 Familiäre Situation
1.3.3 Diagnose
1.3.4 Weitere Entwicklung und Förderung
2 Phänomene und definitorische Festlegungen
2.1 Was ist soziale Angst?
2.2 Wie äußert sich Angst?
2.3 Begriffliche Abgrenzungen
2.3.1 Schüchternheit
2.3.2 Soziale Angst
2.3.3 Soziale Angststörung/soziale Phobie
2.4 Häufigkeit
2.4.1 Häufigkeit soziale Ängste und Schüchternheit
2.4.2 Häufigkeit soziale Angststörung
2.4.3 Häufigkeit in Abhängigkeit anderer Faktoren
2.5 Komorbid auftretende Phänomene und Abgrenzung zu anderen Symptomen
2.5.1 Differenzierung von Ängsten im Schulalltag
2.5.2 Klinische Differenzialdiagnostik
2.5.3 Abgrenzung zu anderen Ängsten
2.6 Zusammenfassung
3 Ursachen
3.1 Entstehung und Aufrechterhaltung von sozialen Ängsten
3.2 Biologische Risiko- und Schutzfaktoren
3.2.1 Genetische Risikofaktoren
3.2.2 Temperament
3.3 Psychische Risikofaktoren
3.3.1 Kognitive Verzerrungen
3.3.2 Soziale Kompetenz
3.3.3 Emotionsregulation
3.4 Soziale Risikofaktoren
3.4.1 Familie
3.4.2 Gleichaltrige
3.4.3 Schule
3.4.4 Cyberbullying
3.5 Schutzfaktoren und Ressourcen
3.5.1 Psychische Faktoren
3.5.2 Soziale Unterstützung
3.5.3 Positive Lernerfahrungen
3.6 Zusammenfassende Betrachtung der Entstehung und Aufrechterhaltung
3.6.1 Wie kommt es zu einer sozialen Angststörung?
3.6.2 Modellerklärung der Entwicklung der sozialen Ängste in den Fallbeispielen
4 Folgen
4.1 Normativer Entwicklungsverlauf
4.1.1 Entwicklungsaufgaben im Kindergarten- und Vorschulalter
4.1.2 Entwicklungsaufgaben im frühen Schulalter
4.1.3 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
4.2 Klinische Folgen der sozialen Angststörung
4.3 Schulische Folgen sozialer Angst und der sozialen Angststörung
4.3.1 Leistungsbezogene Folgen
4.3.2 Soziale Folgen
4.4 Zusammenfassung
5 Diagnose
5.1 Klinische Diagnostik
5.1.1 Grundlagen der Diagnostik
5.1.2 Klinische Interviews
5.1.3 Fragebögen
5.1.4 Beobachtung
5.1.5 Leistungsdiagnostik
5.1.6 Klinische Diagnostik im Schulkontext
5.2 Erkennen von sozialen Ängsten durch Lehrkräfte im Schulkontext
5.2.1 Beobachtung
5.2.2 Gespräch mit dem*der betroffenen Schüler*in und den Eltern
5.2.3 Mögliche Schwierigkeiten im Gespräch
5.2.4 Entscheidung zur psychotherapeutischen Übergabe
6 Schulzentrierte Maßnahmen zur Unterstützung und Begleitung sozial ängstlicher Kinder und Jugendlicher
6.1 Die innere Haltung im pädagogischen Umgang mit sozial ängstlichen Schüler*innen
6.2.1 Psychoedukation zu sozialen Ängsten
6.2 Kognitive Methoden zur Umstrukturierung von Angst auslösenden Gedanken
6.3 Training sozialer Kompetenzen
6.4 Expositions- oder Konfrontationstechniken
6.5 Besonderheiten im Umgang mit Leistungsängsten
6.5.1 Lernstrategien zur gezielten Vorbereitung
6.5.2 Positive Selbstverbalisation in der Leistungssituation
6.6 Die Zusammenarbeit mit Eltern von sozial ängstlichen Kindern und Jugendlichen
6.7 Weitere schulische und außerschulische Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten
6.8 Zusammenfassung
7 Ausblick
7.1 Relevanz sozialer Ängste im Schulkontext
7.2 Möglichkeiten der externen Unterstützung
7.3 Erwartungen und Entwicklungen im Umgang mit sozialen Ängsten im Schulkontext
7.4 Erwartungen und Entwicklungen im Umgang mit sozialen Ängsten in der psychotherapeutischen Versorgung
Literatur
Anhang
|9|1 Fallbeispiele
1.1 Fallbeispiel 1: Kind, 8 Jahre – Jonas, Grundschule, 2. Klasse, Diagnose Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
1.1.1 Vorstellungsanlass und Entwicklungsgeschichte
Der 8-jährige Jonas M. kommt mit seinen Eltern und der 6 Monate alten Isabella zur Schulpsychologin. Frau M. berichtet, Jonas habe starkes Bauchweh vor Aufführungen in der Schule, aber auch bei großen Festen. Er berichtet, dass er sich sorge, dass er den Text vergesse, den er aufsagen müsse und die anderen dann lachen würden. Seit Beginn des zweiten Schuljahres würden die Ängste verstärkt auftreten und immer weitere Kreise ziehen, sodass diese schon Wochen vor einer Veranstaltung zuhause Thema seien. Auch in anderen sozialen Situationen sei Jonas sehr schüchtern. In der Pause spiele er nur mit seinem besten Freund. Wenn dieser mal krank ist, habe Jonas Angst, sich anderen anzuschließen. Auch im Sportunterricht habe er Angst, im Mittelpunkt zu stehen oder ausgelacht zu werden. Er traue sich vieles nicht zu und sitze dann immer wieder auf der Bank. Auch außerhalb der Schule sei Jonas ängstlich und schüchtern. So traue er sich nicht, im Restaurant zu sagen, was er essen wolle. Die Eltern berichten, dass sie ihm viele Situationen abnehmen. Auch sei es für Jonas schwierig, in den Basketballverein zu gehen, wo er viele Kinder nicht kenne. In der Schule sei Jonas vom Lernstoff schnell frustriert. Wenn er etwas nicht verstehe, stehe er auf und kaspere viel.
Eine strukturierte Erfassung der Symptome anhand eines diagnostischen Interviews in der Psychotherapie ergibt im gemeinsamen Urteil durch Herrn M. und Jonas eine Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters. Jonas berichtet zudem leichte Symptome einer Einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, welche Frau M. im Nachhinein mit den Ängsten in Verbindung bringt.
Jonas habe als Kleinkind auf Trennungen sehr ängstlich und weinerlich reagiert, wobei insbesondere die Eingewöhnung in der Kita extrem schwierig gewesen sei. Der Übergang in den Kindergarten sei leichter gewesen. Unter diesen Schwierig|10|keiten habe auch Frau M., die die Eingewöhnung alleine begleitet habe, sehr gelitten. Gegenüber fremden Kindern sei er schon immer eher zurückhaltend und beobachtend gewesen. Nach einiger Zeit habe er in der Kita Freunde gefunden, die ihm auch im Kindergarten erhalten geblieben seien. Er sei mit diesen nicht in eine Grundschulklasse gekommen, was erneut zu einem schwierigen Übergang vom Kindergarten zur Grundschule geführt habe. In der Grundschule komme er gut mit. Er habe sehr hohe Ansprüche an sich selbst und sei schnell frustriert, wenn er diese nicht erreiche. Mit den hohen Anforderungen einher ginge eine starke Angst vor Vorführungen, die sich körperlich durch Bauchschmerzen äußere. Er berichtet, dass er dann die Sorge habe, dass er den Text vergessen würde und ihn jemand auslachen könne. Er habe oft Angst, dass er „sich blöd anstelle“. Er versuche daher, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wenn er gezwungen sei, z. B. vor der Klasse etwas zu sagen, schaue er auf den Boden und spreche leise. Konflikten gehe er lieber aus dem Weg, sodass er z. B. nicht für sich und seine Wünsche eintrete. Die Angst vor den Vorführungen sei in der ersten Klasse zum ersten Mal aufgetreten und seit Beginn der zweiten Klasse erheblich gestiegen. In diesen Situationen werde er vorher sehr wortkarg, erstarre regelrecht und berichte immer wieder von Bauchschmerzen. Jonas selbst ergänzt, dass er dann wütend auf die Schule sei und sich sicher wäre, dass er den Text vergessen und sich blamieren würde. Zwei Kinder in der Klasse würden ihn ab und zu damit aufziehen, dass er in Auftrittssituationen erstarre. Da er einige Male gestottert habe, würden sie ihn vor Auftritten immer wieder „Jo-Jo-Jonas“ nennen. Jonas werde dann wütend und habe einmal eine Schlägerei mit einem der Kinder angefangen. Mit beiden Kindern komme er außerhalb der Vortragssituationen relativ gut klar.
1.1.2 Familiäre Situation
Jonas lebt gemeinsam mit seinem Bruder Mario (–3), seiner Schwester Isabella (–8) und seinen Eltern im elterlichen Haus in einer Kleinstadt und besucht die 2. Klasse einer örtlichen Grundschule. Der Vater arbeite als Ingenieur für einen großen Automobilhersteller, die Mutter leite im gleichen Betrieb die Personalabteilung und sei aktuell in Elternzeit.
Das Verhältnis zum Bruder sei von Konkurrenz geprägt, da dieser sehr gerne im Mittelpunkt stehe, in die kleine Schwester sei er dagegen regelrecht „vernarrt“. Zu beiden Elternteilen habe er ein enges Verhältnis, mit der Mutter gemeinsam könne er seine kreative Seite ausleben. Charakterlich sei er dem Vater sehr ähnlich, der sich früher ebenfalls mit Aufführungen sehr schwergetan habe und sich als zurückhaltend beschreibt. Herr M. berichtet, dass Jonas ihn stark an ihn selbst als Kind erinnere, da er ebenfalls eher ängstlich gewesen sei.
|11|Ressourcen
Die Eltern berichten, dass Jonas kreativ sei, gerne Fußball und Lego spiele. Er sei generell ein mitfühlendes Kind. Jonas sei sozial gut integriert und beschreibe weniger Ängste im Kontakt mit anderen Kindern außerhalb der Schule.
1.1.3 Diagnose
F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
1.1.4 Weitere Entwicklung und Förderung
Begleitend zur Psychotherapie unterstützt Jonas‘ Klassenlehrer ihn bei seinen Übungsaufgaben in der Schule. Als er beispielsweise ein Buch vortragen soll, bespricht er in der Pause zuvor seine mutmachenden Gedanken noch einmal mit ihm. Er erinnert ihn daran, dass er sich vorgenommen hat, nicht nur auf sein Buch zu schauen, sondern mindestens seine beste Freundin und den Klassenlehrer anzuschauen. Nach der Übung fragt er ihn, wie stark seine Angst war, und lobt ihn, dass er sich getraut hat, das Buch vorzustellen.
Nach 9 Monaten Psychotherapie mit intensiver Begleitung in der Schule traut sich Jonas auf das Schulfest. Er möge es immer noch nicht im Mittelpunkt zu stehen, schaffe es aber mit positiven Gedanken („Ich mache es so gut ich kann.“) sich in die Situationen zu trauen.
1.2 Fallbeispiel 2: Jugendliche, 14 Jahre – Lena, Realschule, 9. Klasse, Diagnose soziale Phobie
1.2.1 Vorstellungsanlass und Entwicklungsgeschichte
Die 14-jährige Lena A. kommt mit ihrer Mutter zur Schulpsychologin. Lena und Frau A. berichten, dass Lena große Angst davor habe, auf andere Kinder und Jugendliche zuzugehen sowie sich am Schulunterricht zu beteiligen. Immer wieder passiere es ihr, dass sie rot anlaufe wie eine Tomate. Ihr seien viele Situationen total peinlich. Auch sei sie oft in sozialen Situationen sehr aufgeregt und habe Angst, sich zu verhaspeln. Sie sei sich sicher, dass sie von den anderen ausgelacht werden würde, wenn diese bemerkten, wie sie sich blamiere. Sie sei schon immer eher schüchtern gewesen. Seit dem Übergang auf die weiterführende Schule seien die Ängste nach einer kurzen Mobbing-Situation, die eine Lehrerin entschärft habe, |12|verstärkt aufgetreten. In letzter Zeit mache sie sich zunehmend Gedanken, was andere über sie denken. Aus Angst, ausgelacht zu werden, vermeide sie viele soziale Situationen. Auch grüble sie im Nachhinein viel, ob sie sich richtig verhalten habe. Oft käme dann nach der Situation noch viel stärker der Gedanke, dass sie sich total peinlich verhalten habe und die anderen denken würden, sie sei dumm. Seit Beginn des Schuljahres habe sie immer wieder im Unterricht gefehlt. Ihr früheres Hobby Reiten habe sie aufgegeben, als eine neue Reitlehrerin angefangen habe. Sie habe eine Freundin aus der Grundschule und treffe sich sonst nie mit anderen Kindern in ihrem Alter. In der letzten Zeit sei sie oft müde und unkonzentriert. Sie habe morgens dann keine Lust aufzustehen und bleibe am Wochenende auch manchmal den ganzen Tag im Bett.
Zu Beginn der Psychotherapie wird im Rahmen der Diagnostik zur strukturierten Erfassung der Symptome ein diagnostisches Interview durchgeführt. Sowohl in der Auskunft der Mutter als auch der Lenas ergibt sich eine soziale Phobie. Die Mutter ergänzt, dass Lena früher häufig durch Alpträume aufgewacht sei. Weitere internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten werden aktuell und in der Vergangenheit verneint.
Als Kleinkind sei Lena schlecht eingeschlafen und habe stundenlang geschrien, sodass der Vater mit ihr abends lange spazieren gegangen sei. In den ersten Kindergarten habe sich Lena im Alter von 2 Jahren gut integrieren können und einige gute Freundschaften gehabt. Im Alter von 4 Jahren sei sie im September aufgrund eines Umzugs in einen anderen Kindergarten eingewöhnt worden. Dies habe zu einer ersten ängstlichen Reaktion geführt. Der Übergang in die Grundschule habe gut funktioniert, eine große Gruppe von Kindern sei mitgekommen. Die Leistungen seien immer gut bis sehr gut gewesen. Lena sei jedoch von Anfang an eher zurückhaltend und schüchtern gewesen. In der dritten Klasse habe sie aufgrund eines neuen Lehrers, der auf sie sehr einschüchternd gewirkt habe und vor dem sie Angst gehabt habe, drei Monate lang überhaupt nicht in der Schule gesprochen, dies habe sich von selbst wieder geregelt. Sie habe eine Empfehlung zum Besuch des Gymnasiums erhalten, sich aber für die Realschule entschieden, weil sie befürchtet habe, dass sie auf dem Gymnasium mehr Referate halten müsse. Aktuell gehe sie in die 9. Klasse einer Realschule. Aufgrund der Fehlzeiten und der fehlenden Beteiligung im Unterricht hätten die Lehrer*innen bereits um Rücksprache gebeten. Lena sei eigentlich sehr fleißig und ehrgeizig, schaffe es jedoch nicht sich zu melden. Ihre Freizeit verbringe sie vor allem mit Lesen und Zeichnen.
1.2.2 Familiäre Situation
Lena lebt mit ihren Eltern und der Schwester (+2 Jahre) in der elterlichen Wohnung und besucht die örtliche Realschule. Ihr Vater arbeite in der Logistik eines mittelständischen Unternehmens, die Mutter sei als Lehrerin tätig.
|13|Das Verhältnis zur Schwester sei sehr gut, diese schütze Lena oft, wenn sie etwas nicht machen wolle und nehme ihr z. B. ab, im Supermarkt an der Kasse zu sprechen. Hin und wieder gebe es Streit, bei dem Lena sehr stur auftreten könne. Die Ehe der Eltern sei schon seit längerem sehr instabil, worüber sich auch Lena immer wieder Gedanken mache und unter dem Streit leide. Die Mutter beschreibt Parallelen zwischen Lena und ihrem eigenen Bruder, der auch immer sehr schüchtern gewesen sei. Dadurch könne sie ihr Verhalten nachvollziehen, ärgere sich jedoch auch manchmal darüber. Der Vater reagiere oft unwirsch, vor allem auf die aktuellen Schwierigkeiten in der Schule.
Ressourcen
Lena sei intelligent und interessiert daran, Neues zu lernen. Sie könne gut zeichnen und habe bereits einige Comic-Strips angefertigt. Sie sei sehr empathisch und merke schnell, wenn es jemandem nicht gut gehe. Sie versuche dann, die andere Person aufzubauen.
1.2.3 Diagnose
F40.1 Soziale Phobie
1.2.4 Weitere Entwicklung und Förderung
Lena ist zu Beginn wenig begeistert, dass sie nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch in der Schule intensiv an ihren Ängsten arbeiten soll. Die Eltern werden zu Beginn sowohl von der Psychotherapeutin als auch von der Schule etwas gebremst, um Lena den Druck zu nehmen. Der Klassenlehrer erinnert Lena wiederholt daran, sich in der Schule zu beteiligen. Als sich abzeichnet, dass Lena dies zu schwerfällt, findet ein Beratungsgespräch zwischen Klassenlehrer, Psychotherapeutin und Schulsozialarbeiterin mit Lena und ihren Eltern statt. Es wird vereinbart, dass Lena ihre mündliche Mitarbeit zunächst über kurze Referate nur mit dem Klassenlehrer und der Schulsozialarbeiterin verbessert und zugleich am Angstabbau und dem Aufbau von Selbstbewusstsein in sozialen Leistungssituationen arbeitet. Nach circa acht Wochen schafft Lena es von sich aus, sich zwei Mal in den Unterrichtsstunden des Klassenlehrers zu melden.
Nach 1 Jahr und 3 Monaten Psychotherapie mit intensiver Begleitung in der Schule traut sich Lena, sich in den meisten Fächern mindestens zwei Mal pro Stunde zu melden. Es besteht lediglich Angst in Physik, Lenas schwächstem Fach. Die Eltern werden informiert und stoßen auf Lenas Idee hin Nachhilfeunterricht an.