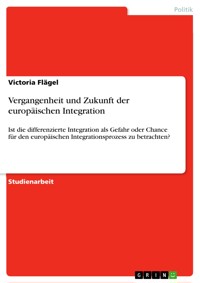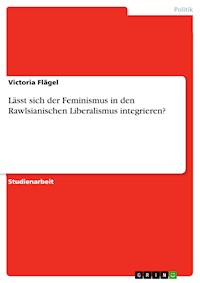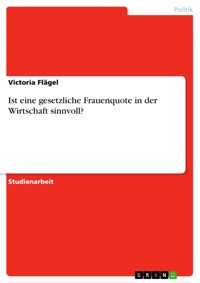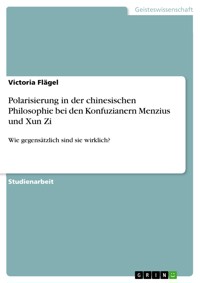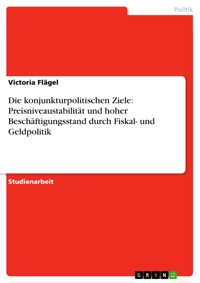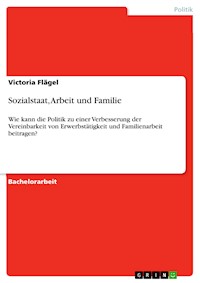
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Sonstige Themen, Note: 1,0, Universität Rostock (Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Aufgrund der stetig wachsenden Erwerbsbeteiligung von Frauen, was sich als europaweiter Trend abzeichnet, ergibt sich ein Problem mit der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen unbezahlter häuslicher und familiärer Arbeit, die von Frauen übernommen wird, und bezahlter Lohnarbeit, welche von den Männern geleistet wird. Umso mehr Frauen erwerbstätig sind, desto weniger Zeit haben sie für die Fürsorge- und Hausarbeit. Daraus folgt, dass Frauen, die berufstätig sein wollen, sich vermehrt gegen Kinder entscheiden, um einer Doppelbelastung zu entgehen. Diese Entscheidung trägt allerdings zum demografischen Wandel bei, welcher zur Alterung und Kinderarmut der Gesellschaft führt, was wiederum Probleme nach sich zieht, bspw. mit dem bestehenden Rentensystem, da immer weniger Beitragsleistende immer mehr Beitragsempfangenden gegenüberstehen. Andere Frauen wiederum entscheiden sich für Kinder und gegen eine Erwerbstätigkeit, was das Brachliegen von wertvollem Potential des Arbeitsmarktes zur Folge hat und aufgrund des Fachkräftemangels nicht haltbar ist. Neben den volkswirtschaftlichen Gründen soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine geschlechtergerechtere Gesellschaft ermöglichen. Um gleichzeitig einerseits die Geburtenrate zu steigern und andererseits Frauen die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, bedarf es einer Verbesserung der Vereinbarkeitsstruktur von Beruf und Familie. Da die Familien- und Hausarbeit, welche traditionell in den Aufgabenbereich der Frauen und Mütter fällt, keine Ansprüche auf Leistungen außerhalb der Sozialleistungen begründet, waren und sind Frauen oftmals von der Erwerbstätigkeit der Männer und Väter abhängig. Durch eine neue Austarierung der familiären Arbeitsteilung, in welcher Männer und Frauen sowohl Hausarbeit als auch Erwerbsarbeit verrichten, sowie durch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann dieser Abhängigkeit entgegengewirkt werden. Innerhalb dieser Arbeit soll die aktuelle Problemlage bezüglich der Schwerpunkte "Familie", "Erwerbstätigkeit" und "Politik" ausführlich dargestellt sowie die Klassifizierung von Wohlfahrtssystemen erläutert werden. Anschließend werden verschiedene Indikatoren ausgesuchter europäischer Länder verglichen, um abschließend zwei Staaten miteinander zu vergleichen. Anhand der vergleichenden Länderprofile soll offenbar werden, welche Einflussmacht die Politik auf die Gestaltung der Gesellschaft hat bzw. haben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bestandsaufnahme
2. 1 Familie
2. 2 Erwerbstätigkeit
2. 3 Politik
3. Regimeforschung
3. 1 Esping-Andersens Welten des Wohlfahrtskapitalismus
3. 2 Clusterbildung
4. Ein europäischer Vergleich
4. 1 Schweden
4. 2 Deutschland
4. 3 Vergleich: Politikempfehlungen für die BRD
5. Chancen und Grenzen – eine Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Selbstständigkeitserklärung
Einverständniserklärung
1. Einleitung
Aufgrund der stetig wachsenden Erwerbsbeteiligung von Frauen, was sich als europaweiter Trend abzeichnet, ergibt sich ein Problem mit der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen unbezahlter häuslicher und familiärer Arbeit, die von Frauen übernommen wird, und bezahlter Lohnarbeit, welche von den Männern geleistet wird. Umso mehr Frauen erwerbstätig sind, desto weniger Zeit haben sie für die Fürsorge- und Hausarbeit. Daraus folgt, dass Frauen, die berufstätig sein wollen, sich vermehrt gegen Kinder entscheiden, um einer Doppelbelastung zu entgehen. Diese Entscheidung trägt allerdings zum demografischen Wandel bei, welcher zur Alterung und Kinderarmut der Gesellschaft führt, was wiederum Probleme nach sich zieht, bspw. mit dem bestehenden Rentensystem, da immer weniger Beitragsleistern immer mehr Beitragsempfängern gegenüberstehen. [1] Andere Frauen wiederum entscheiden sich für Kinder und gegen eine Erwerbstätigkeit, was das Brachliegen von wertvollem Potential des Arbeitsmarktes zur Folge hat und aufgrund des Fachkräftemangels nicht haltbar ist. [2] Um gleichzeitig einerseits die Geburtenrate zu steigern und andererseits Frauen die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, bedarf es einer Verbesserung der Vereinbarkeitsstruktur von Beruf und Familie. Neben diesen volkswirtschaftlichen Gründen soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine geschlechtergerechtere Gesellschaft ermöglichen.
Da die Familien- und Hausarbeit, welche traditionell in den Aufgabenbereich der Frauen und Mütter fällt, keine Ansprüche auf Leistungen außerhalb der Sozialleistungen begründet, waren und sind Frauen oftmals von der Erwerbstätigkeit der Männer und Väter abhängig. Dies wird dadurch ersichtlich, dass Alleinerziehende – zumeist Mütter – die höchste Sozialhilfequote aller Bevölkerungsgruppen aufweisen: 35,4 % der Alleinerziehenden waren 2005 in Deutschland auf Sozialhilfe angewiesen. Durch eine neue Austarierung der familiären Arbeitsteilung, in welcher Männer und Frauen sowohl Hausarbeit als auch Erwerbsarbeit verrichten, sowie durch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann dieser Abhängigkeit entgegengewirkt werden. [3]
Die Abhängigkeit der die Hausarbeit leistenden Person von dem erwerbstätigen Partner ist nicht zwangsläufig als eine Diskriminierung von Frauen zu betrachten. Auch bei einer Umkehrung der traditionellen Geschlechterrollen wird der „Hausmann“ von der erwerbstätigen Frau abhängig. [4] Doch da die geschlechtsspezifische innerfamiliäre Arbeitsteilung – insbesondere in der BRD, aber auch in allen anderen europäischen Staaten – noch immer stark kulturell verankert und Realität ist, wird sich im Laufe der Arbeit zumeist mit dem Bedingungsgefüge Familie, Erwerbstätigkeit und Mütter – nicht Väter - auseinandergesetzt.
Nach Sigrid Leitner gibt es drei Lösungsmöglichkeiten für die Problematik, dass die Differenzierung von Erwerbs- und Familienarbeit zu geschlechterungerechten Machthierarchien und Abhängigkeitsverhältnissen führt: 1. Frauen wird die Erwerbstätigkeit in Vollzeit gänzlich ermöglicht. 2. Erwerbs- und Familienarbeit müssen sozialpolitisch gleichgestellt werden. 3. Die Auflösung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Alle drei Lösungsmöglichkeiten haben Potentiale und Grenzen. [5] Daher wird die vorliegende Arbeit in der Überzeugung verfasst, dass versucht werden muss, alle drei Lösungen zeitgleich zu verwirklichen: Für Frauen muss der Zugang zu allen Bereichen und Sektoren des Arbeitsmarktes gleichberechtigt ermöglicht und die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt verhindert werden. Darüber hinaus müssen Anreize für Väter geschaffen werden, ihre Vaterrolle und Familienarbeit wahrzunehmen: „Freuden und Pflichten der Vaterschaft konnten immer schon dosiert als Freizeitvergnügen genossen werden.“[6] Dadurch soll die durch Geschlecht legitimierte Aufteilung zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit, aber auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb des Arbeitsmarktes, aufgelöst werden. Da die Frage besteht, ob die Familienarbeit aufgewertet wird, indem Männer sie übernehmen, oder Männer sie verrichten, nachdem sie aufgewertet worden ist, müsste beides zeitgleich implementiert werden. D. h. Männer müssen vermehrt ihren familiären Pflichten nachkommen und die Hausarbeit muss sozialpolitisch höhergestellt werden. Dadurch sollte die Fürsorgearbeit steigende Anerkennung erfahren, was dazu führen kann, dass die Fürsorgearbeit Leistenden, ebenso wie Erwerbstätige, Ansprüche und Rechte auf soziale Sicherung haben. [7]
Die Entscheidung von Eltern, erwerbstätig zu sein und zeitgleich Kinder zu betreuen (bzw. betreuen zu können), ist in ein multifaktorielles Bedingungsgefüge eingebettet. Sehr viele unterschiedliche Faktoren sind für diese Entscheidung maßgeblich: ökonomische Kosten-Nutzen-Kalkulationen, individuelle psychologische Faktoren und soziokulturelle Umstände. [8] Auch politische Gegebenheiten, wie sozialpolitische Rahmenbedingungen, welche es Eltern ermöglichen können, neben der Erwerbstätigkeit Kinder zu betreuen und großzuziehen, spielen eine große Rolle. Dazu gehören bspw. der Umfang an Kinderbetreuungsangeboten, Regelungen bezüglich der Elternzeiten und ein bedürfnisgerechtes Steuersystem. [9]
Andererseits richten die Menschen ihren Wunsch nach Kindern nicht ausschließlich nach dem Angebot von Betreuungsmöglichkeiten oder anderen sozialen Leistungen aus. Einen ebenfalls hohen Stellenwert bei der Entscheidung für eine Familie trotz Erwerbstätigkeit bzw. für eine Erwerbstätigkeit trotz Familie sind länderspezifische kulturelle Leitbilder und Normen. So beeinflussen Geschlechterrollen, das Konzept und Ideal einer guten Mutter und die Annahmen über die Bedürfnisse von Kindern die Entscheidung, ob neben der Kindererziehung auch eine Erwerbstätigkeit in Frage kommt. Frauen müssen sich dementsprechend mit den Wertvorstellungen ihrer Umwelt auseinandersetzen. [10]
Daher scheint die Wirkungsmacht politischer Maßnahmen beschränkt zu sein: Nicht alle sozialpolitischen Maßnahmen, die Mütter motivieren sollen, einen Beruf zu ergreifen, sind unbedingt fruchtbar. Als Beispiel lassen sich die unterschiedlichen Erwerbsquoten von Frauen und Müttern in Ost- und Westdeutschland anführen, welche gravierende Differenzen aufweisen, obwohl die sozialpolitischen Rahmenbedingungen dieselben sind. Die Annahme, dass diese Entwicklung kulturellen Unterschieden – bspw. dem Ideal der perfekten Mutter – geschuldet ist, ist naheliegend.
Ebenfalls beeinflussen individuelle Persönlichkeitsprofile, wie die Berufsbildung der Frau und Mutter, die Entscheidung für oder gegen das Ergreifen eines Berufs. So entscheiden sich Mütter mit geringerer Bildung eher, Hausfrau und Mutter zu sein und Sozialhilfe zu empfangen, während alleinerziehende Mütter mit höherer Bildung eher sozialpolitische Leistungen in Anspruch nehmen, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. [11]
Ersichtlich wird, dass es zahlreiche Motive und Rahmenbedingungen gibt, welche in Ergänzung zueinander erst erklären können, warum sich eine Mutter für die Erwerbstätigkeit entscheidet oder nicht.
Innerhalb dieser Arbeit soll die aktuelle Problemlage bezüglich der Schwerpunkte „Familie“, „Erwerbstätigkeit“ und „Politik“ ausführlich dargestellt, sowie die Klassifizierung von Wohlfahrtssystemen erläutert werden. Dazu wird sich auf Gøsta Esping-Andersen und Weiterentwicklungen seiner Klassifizierungen bezogen. Anschließend werden verschiedene Indikatoren – wie die Differenzen zwischen Erwerbsquote und Arbeitslosenquote zwischen Männern und Frauen – ausgesuchter europäischer Länder verglichen, um abschließend zwei Staaten miteinander zu vergleichen. Anhand der vergleichenden Länderprofile soll offenbar werden, welche Einflussmacht die Politik auf die Gestaltung der Gesellschaft hat bzw. haben kann.
2. Bestandsaufnahme
Im Folgenden werden die drei zentralen Begriffe der Fragestellung näher beleuchtet und definiert. In dem Abschnitt über die Familie wird der Wandel der Familie – ihrer Modelle, Kultur und ihrer Bedeutung als Institution – erläutert. Dabei wird dieser Wandel mit der Frauenerwerbstätigkeit und der niedrigen Fertilitätsrate in Bezug gesetzt und untersucht, wie diese Faktoren aufeinander einwirken. Nachdem im Abschnitt über die Erwerbstätigkeit verschiedene Modelle der Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorgestellt werden, geht es um die Unterschiede in der Erwerbstätigkeit und den Erwerbsbiografien von Männern und Frauen und um die damit einhergehenden Probleme. Anschließend wird der Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit von Frauen und ihrer Fertilität untersucht. Im letzten Abschnitt des ersten Teils der Arbeit wird erläutert, was im Laufe der Arbeit mit „Politik“ gemeint ist und welchen Einfluss die Politik theoretisch auf die vorher erläuterte Problemlage hat und haben kann. Um die Einflussmöglichkeiten der Politik zu untersuchen, werden verschiedene Faktoren, welche sich eventuell auf die Erwerbsbeteiligung und Fertilität auswirken können, auf ihre Kausalität hin untersucht. Diese Faktoren reichen vom Angebot an Teilzeitstellen über die Bildung bis hin zur Steuerpolitik.
2. 1 Familie
Wenn im Folgenden davon gesprochen wird, Erwerbstätigkeit mit der Familie zu vereinbaren, geht es um den Unterschied zwischen bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Fürsorge-, Pflege-, Betreuungs- und Hausarbeit. Die Trennung von Erwerbs- und Hausarbeit ist eine Folge der Industrialisierung, in welcher sich Arbeits- und Wohnort, welche in vorherigen Epochen im „ganze[n] Haus“[12] zusammentrafen, trennten. Im Englischen wird die Fürsorgearbeit mit dem Wort „care“ ((Für-)Sorge, Betreuung, Kümmern) wiedergegeben, welches weiter greift als der deutsche Terminus, da mit ihm auch die entgeltliche Fürsorgetätigkeit gemeint ist. [13] Im Folgenden meint Fürsorgetätigkeit allerdings die Betreuung von v. a. Kindern, aber mitunter auch älteren und anderen der Pflege bedürftigen Personen innerhalb der Familie, welche zwar unbezahlt, aber elementar ist - „und zwar in dem Sinne, daß Erwerbsarbeit Hausarbeit voraussetzt“[14].
Wandel der Familienkultur
Traditionell kam diese Aufgabe den Frauen der Familie zu, während der Mann bezahlter Erwerbsarbeit nachging. Dass sich mittels dieser Arbeitsteilung die Frau von dem Mann ökonomisch abhängig machte, wurde in Kauf genommen.
„Die unbezahlte Familienarbeit wird dem Grundriß der alten Industriegesellschaft nach der natürlichen Mitgift qua Ehe zugewiesen. Ihre Übernahme bedeutet prinzipiell Versorgungsunselbstständigkeit. Wer sie übernimmt – und wir wissen, wer das ist -, wirtschaftet mit Geld aus ιzweiter Hand᾿ und bleibt auf die Ehe als Bindeglied zur Selbstversorgung angewiesen. Die Verteilung dieser Arbeiten – und darin liegt die feudale Grundlage der Industriegesellschaft – bleibt der Entscheidung entzogen. Sie werden qua Geburt und Geschlecht zugewiesen.“[15]
Diese geschlechtsspezifische innerfamiliäre Arbeitsteilung charakterisiert das „Ernährermodell“, auf welchem die Sozialpolitik in den westlichen Ländern fußt und arbeits- und sozialrechtlich unterschiedlich stark verankert und präsent ist. Das Ernährermodell hat zwar – wie die meisten Modelle - nie real in Reinform existiert, da die Frauen der Unterschicht schon immer einer Erwerbsarbeit nachgehen mussten, hat aber noch heute eine hohe normative Bedeutung, v. a. in konservativen Staaten. Neben dieser normativen Komponente beinhaltet das Ernährermodell die Annahme, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung natürlich sei.
Durch die Veränderungen des Erwerbsverhaltens von Frauen, welche konstant vermehrt auf den Arbeitsmarkt strömen, wurde die Beschäftigungsförderung zum zentralen Anliegen der Wohlfahrtspolitik, woraufhin sich das „Modell der erwachsenen Erwerbstätigen“ (engl.: adult worker model) herausgebildet hat, in welchem sich die Annahme manifestiert, dass alle erwachsenen Menschen bezahlter Arbeit nachgehen sollen. Da es in diesem Modell nicht nur den männlichen Ernährer gibt, sondern sowohl der Mann als auch die Frau erwerbstätig sind, wird es auch als das „Doppelverdienermodell“ bezeichnet. Dass in einer Zwei-Erwerbstätigen-Familie kein Erwachsener mehr die Zeit aufbringen kann, die notwendige Fürsorgearbeit zu leisten, auf welcher alle Staaten basieren, wurde außer Acht gelassen. Neben der Nicht-Schätzung der unbezahlten familiären Fürsorgearbeit ignoriert dieses Modell Geschlechterverhältnisse und noch heute bestehende strukturelle, soziale und ökonomische Unterschiede, welche systematisch an der Linie der Geschlechter verlaufen und unterstellt, dass es von jedem Individuum selbst abhängt, wie erfolgreich es sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren vermag. [16]
Obwohl sich das Erwerbsverhalten der Frauen verändert hat, leisten sie noch immer den größten Teil der Fürsorgearbeit, wohingegen sich die Situation der Männer weit weniger verändert hat: „Noch gibt die Mehrheit der Männer sich der Illusion hin, daß der Kuchen zweimal gegessen werden kann. Sie halten Gleichstellung von Frau und Mann und Beibehaltung der alten Arbeitsteilung (insbesondere im eigenen Fall) für ohne weiteres vereinbar.“[17] Daraus resultiert eine Doppelbelastung der Frauen, neben dem Beruf die Kinderbetreuung und Hausarbeit leisten zu müssen. [18]
„Gegenwärtig ist die Erwerbstätigkeit fest in weibliche Lebensbiographien eingebunden. Dabei sind Frauen daran interessiert, Familie und Beruf zu verbinden, womit das alltägliche Dilemma der Doppelbelastung einhergeht, denn die Realisierung beider Lebensbereiche ist nach wie vor in erster Linie ιFrauensache᾿[19]. Die Verbindung von Familie und Beruf steht für Männer hingegen außer Frage.“[20]
Aus dem Übergang vom Ernährermodell hin zum Modell der erwachsenen Erwerbstätigen ergeben sich weitere Probleme: Dass die Frauen weiterhin den Großteil der Fürsorgearbeit leisten, da für viele Frauen die Kinderbetreuung nach wie vor Priorität hat - sei es, weil sie es wollen oder weil sie denken, es wollen zu müssen und es als ihre moralische Pflicht ansehen - hat weitreichende Folgen für die Frauen auf dem Arbeitsmarkt, was sich darin zeigt, dass Frauen in „prekären“ und „atypischen“ Beschäftigungsverhältnissen – sprich: in Teilzeitarbeit und/oder befristeten Arbeitsverhältnissen - überproportional vertreten sind. Dies führt auch dazu, dass nicht ein Doppelverdiener-, sondern ein „Anderthalbverdienermodell“ realisiert wird. Des Weiteren führen die wenigen guten und günstigen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder dazu, dass Frauen die Fürsorgetätigkeit informell übernehmen und daher noch immer vom Mann abhängig sind. Ulrich Beck nennt dies die „ institutionell gut gesicherte[..] Unmöglichkeit, Kinderbetreuung und berufliches Engagement zu vereinen“[21], da die Verfügbarkeit von bezahlbaren Kinderbetreuungsinstitutionen eine Schlüsselvariable für die Erwerbstätigkeit von Frauen darstellt. „Abgerundet wird dieses Bild weiblicher Unterprivilegierung im Beruf durch einen – im Schnitt – schlechteren Verdienst.“[22] Gründe hierfür sind die Teilzeitbeschäftigung und die Art der Berufe, in denen ein Großteil der Frauen beschäftigt ist - gering bezahlt, weniger prestigeträchtig und kaum Aufstiegsmöglichkeiten bietend (z. B. soziale Berufe). Allerdings verdienen Frauen häufig auch dann weniger, wenn sie die gleiche Arbeit leisten wie Männer. [23]
Diese Probleme machen deutlich, dass das Modell der erwachsenen Erwerbstätigen einen kulturellen Wandel in der Anerkennung und Verteilung der Fürsorgetätigkeit erforderlich macht: Der Wegfall von Fürsorgekapazitäten, der entsteht, wenn alle Erwachsenen als Erwerbstätige betrachtet werden, muss mittels kollektiv bereitgestellter Betreuungseinrichtungen ausgeglichen werden und Fürsorgearbeit, sowohl bezahlte als auch unbezahlte, muss Wertschätzung erfahren. Jane Lewis stellt die Hypothese auf, dass letzteres der Fall sein würde, wenn mehr Männer die Fürsorgearbeit übernehmen bzw. sich an ihr beteiligen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Problem, welches von beiden Geschlechtern gleichermaßen ausgefochten werden muss. [24] In dem Maße, wie die Erwerbsarbeit zu einer Sache der Frauen wird, muss auch die Fürsorgearbeit eine Sache der Männer werden. Des Weiteren fordern Gerhard, Knijn und Weckwert, dass die Pflege- und Fürsorgearbeit, die noch heute als private Angelegenheit und aufgrund der traditionellen Spaltung von öffentlich und männlich einerseits und privat und weiblich andererseits als weiblicher Aufgabenbereich betrachtet wird, zu einer Säule der Wohlfahrtsstaaten wird. [25]
Bedeutungsverlust der Familie als Institution
Neben der Doppelbelastung der Frauen ist ein weiterer Trend zu beobachten, welcher u. a. mit der Erwerbstätigkeit von Frauen zusammenhängt: Aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Frauen verlieren die traditionelle Ehe und die Familie an Einfluss und Bedeutung. Dies manifestiert sich in hohen Scheidungsraten, sinkenden Geburtenraten, der steigenden Anzahl an unehelich geborenen Kindern, einem geringeren Zeitaufwand, für die Hausarbeitstätigkeiten, dem vermehrten Verschieben des Kinderwunsches,[26] dem steigenden Heiratsalter, dem gesellschaftlichen Stellenwert sowie der Häufigkeit nichtehelicher Lebensgemeinschaften, dem Zuwachs an allein erziehenden Müttern und Vätern, kinderlosen Ehen, Patchworkfamilien etc. pp., was mit dem Stichwort „Pluralisierung der Lebensformen“[27] gekennzeichnet werden kann. [28] Darüber hinaus hat die Institution „Familie“ - v. a. bei jungen Müttern – zunehmend als Versorgungseinheit an Bedeutung verloren, da ihnen vom Sozialstaat mittels Transferzahlungen und Dienstleistungen zumeist ein Mindestmaß an sozialer Sicherung zukommt und die Erwerbstätigenquote der Frauen und Mütter steigt. Des Weiteren reicht ein Einkommen immer häufiger nicht aus, um den Ansprüchen an die Lebensqualität gerecht zu werden. [29]
Ein Erklärungsversuch für die sinkenden Geburtenzahlen ist die Theorie vom demografisch-ökonomischen Paradoxon, welche besagt, dass je größer der Wohlstand einer Nation ist, desto weniger Kinder geboren werden. Dies wird wiederum mit der steigenden Frauenerwerbstätigkeit erklärt: Durch hohe Frauenerwerbsquoten und hohe berufliche Qualifikation steigen die Opportunitätskosten eigener Kinder, d. h. es steigt der Nutzen, den man ohne Kinder hat. Bis in die 70er und 80er Jahre hinein lässt sich das demografisch-ökonomische Paradox bestätigen. Da Opportunitätskosten von politischen und gesellschaftlichen Institutionen entscheidend beeinflusst werden können, hat sich dieser Zusammenhang im Laufe der Zeit umgekehrt: Je weiter eine Nation sozioökonomisch entwickelt ist, desto höher sind ihre Geburtenzahlen. Reichere Länder Westeuropas, gemessen am BIP pro Einwohner, haben höhere Geburtenziffern aufzuweisen als ärmere. Je früher sich ein Staat modernisiert hat - in Bezug auf die Wirtschaft, die Geschlechterverhältnisse, Religion und Tradition – desto eher hat er eine hohe Geburtenziffer. [30]
Eine andere Erklärung ist der oben angeführte Wertewandel. Während einige diese Entwicklung als Zerfall von Recht und Ordnung interpretieren, bedeutet dies für andere Individualisierung und den Übergang „von der Notgemeinschaft zur Wahlverwandtschaft“[31]. In den Ländern, in denen die Familien große öffentliche Unterstützung erfahren, scheint die Familie nicht mehr so privat zu sein, wie früher. Sozialisations- und Erziehungsaufgaben, Kranken- und Altenpflege, welche traditionell als Aufgaben von (Groß-)Familien, ehrenamtlichen Organisationen oder lokalen Gemeinschaften betrachtet wurden, werden (zumindest in Skandinavien) heute vermehrt vom öffentlichen Sektor übernommen. Der Bedeutungsverlust der Familie als wirtschaftliche Versorgungseinheit geht mit der Intimisierung der Familie einher, welche zunehmend als emotionaler Rückzugsort angesehen wird. [32] „Als Reaktion auf Sicherheitsverlust und zum Teil Orientierungslosigkeit übernimmt die Familie eine Ausgleichsfunktion für weggefallene traditionale Bindungen und erfährt gleichsam ihre Überhöhung.“[33] Schon die Trennung der Haus- und Erwerbsarbeit während der Industrialisierung veränderte den Stellenwert des Nachwuchses, indem sie dazu führte, dass Kinder mehr als emotionale Freudenquellen, weniger als kostengünstige Arbeitskräfte und Altersvorsorge betrachtet wurden. [34]