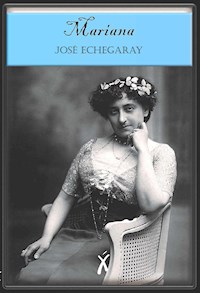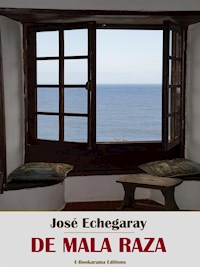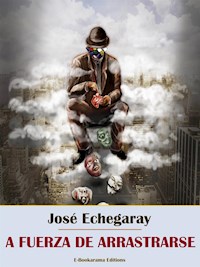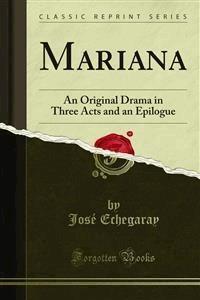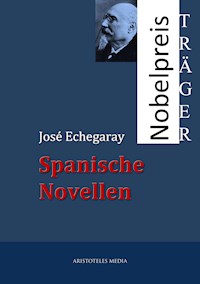
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
José Echegaray y Eizaguirre, spanischer Dramatiker, Politiker und Literaturnobelpreisträger. Der Neuromantiker trug wesentlich zur Weiterentwicklung des spanischen Dramas bei; seine Stücke werden in ganz Europa aufgeführt. In Spanische Novellen ist er nun zugleich Herausgeber und Autor. Die folgenden, sorgsam zusammengetragenen Novellen stammen ferner von Pedro A. de Alarcon, Arturo Campion, Eduardo de Lustono, Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Else Otten, Alfonso Peréz Nieva, Antonio de Valbuena, Luis Taboada, Ernesto Garcia Ladevese: Die beiden Berge, Der Schutzengel, Pedro Mari, Der Taler, Sonnenstich, Manolitas Telephongespräch, Rezept, Lebensabend, Und das alles durch den Dudelsack!, Die Kreolin, Widersprüche, Das erste Kind, Die 'Nona', Der große Kuppler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Echegaray
Spanische Novellen
José Echegaray, Pedro A. de Alarcon, Arturo Campion, Eduardo de Lustono,
Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Else Otten, Alfonso Peréz Nieva,
Antonio de Valbuena, Luis Taboada, Ernesto Garcia Ladevese
Zur Einführung
So seltsam fern entrückt uns das Land der schönen, verschleierten Señoritas erscheint, so fremd wir uns seiner unruhigen inneren Politik gegenüber fühlen, so wenig bekannt ist uns auch – im Gegensatz zu der geradezu vorschriftsmäßigen Kenntnis seiner Klassiker – Spaniens Literatur der Moderne. Und das ist und bleibt bedauerlich; denn möge sie auch, an dem unversiegbaren Born der klassischen Schönheit gemessen, etwas dürftig anmuten, – doch bietet auch sie genug des Typischen und Urwüchsigen, um einen Einblick in die geistige Werkstatt ihrer Vertreter zu lohnen. Eine Reihe kleinerer und größerer Beiträge berühmter und minder berühmter Namen haben wir hier versammelt, und aus jungen Knospen und reifen Blüten ein Kränzlein geflochten, das eine Gruppe volltönender Namen umschließt.
Da ist, räumlich mit der umfangreichsten Erzählung vertreten, die bekannte Gräfin Emilia Pardo-Bazan, die in der Gilde der spanischen Romanschriftsteller (beiderlei Geschlechts) einen allerersten Platz einnimmt. Sie hat außer der in diesem Bändchen enthaltenen Erzählung »Sonnenstich« die durch ihr lebhaftes Lokalkolorit und die äußerst fesselnde Schilderung spanischer Sitten und Gebräuche ein ganz besonderes Interesse erweckt, noch zahlreiche Novellen und Romane geschrieben, von denen ein großer Teil auch bereits ins Deutsche, Englische, Französische und Tschechische übersetzt wurde. Besonderes Aufsehen erregte wohl seinerzeit die Veröffentlichung der beiden Romane »Doña Milagros« (Frau Wunder) und Memorias de un solteron (Memoiren eines Junggesellen), die gleichfalls Sittenschilderungen und Provinzbilder enthalten und sich zum Teil auch mit der Frauenfrage beschäftigen. Auch diese Werke wurden in die vorgenannten Kultursprachen übertragen.
Dieser interessanten Erscheinung reiht sich würdig Arturo Campion an, dessen sympathische, bunte, bewegliche Natur- und Charakterschilderungen aus den baskischen Provinzen besondere Beachtung verdienen. Campion, von Hause aus Rechtsgelehrter, trat zunächst mit philologischen Arbeiten an die Öffentlichkeit, und hat unter anderem eine Grammatik der vier euskarischen Dialekte herausgegeben, der von fachmännischer Seite hohe Anerkennung zuteil wurde. Da er in günstigen Vermögensverhältnissen lebte, konnte er sich völlig seiner Familie, der Politik und dem Studium widmen, bis plötzlich der Künstler in ihm erwachte. Sein Künstlerberuf ist aus reiner, hell auflodernder Begeisterung entstanden; er schildert das Leben der baskischen Provinzen, klagt über die Zügelung ihres wilden Freiheitssinnes, das Verblassen ihrer Traditionen, ihrer alten, klangschönen Sprache. Arturo Campions hervorragende Begabung hatte sich bereits in seinen bedeutenden Novellen gezeigt, sein Roman »Blancos y negros« (Die schwarzen und die Weißen) stellt ihn Spaniens ersten Romanschriftstellern als einen Ebenbürtigen an die Seite. Seine bunten, lebhaften und dabei doch knappen Darstellungen, sein echtes, tiefes Empfinden, seine warme Überzeugungstreue warben und werben ihm allüberall ehrliche Sympathien. Campion gehört keiner Schule an, hat sich keiner Richtung angeschlossen, sondern ist sich selber unverbrüchlich treu geblieben, und das kann, da er die Verkörperung eines gesunden, kraftvollen und poetischen Künstlers darstellt, nicht freudig genug begrüßt werden.
Und außer den größeren Erzählungen dieser beiden Erstgenannten geben wir noch eine ganze Reihe kleinerer Skizzen und Novelletten, – von denen gleichfalls manche mit bekannten Namen, wie zum Beispiel José Echegaray, Juan Valera und so weiter gezeichnet sind, – die in ihrer naiven Eigenart, mit ihrer oft primitiven, ja sogar fast elementaren Ausdrucksweise und Kompositionstechnik als die typischen Merkmale für die besondere Eigenart eines jener romanischen Völker gelten können, die unter den Strahlen einer heißeren Sonne, angesichts einer üppigeren Vegetation und den auserlesensten Naturschönheiten sich frei zu halten wußten von den vielfach naturfeindlich wirkenden Einflüssen der Länder des kalten Nordens.
Die beiden Berge
José Echegaray
1832-1916
Es war ein Land ohne Namen und ohne bekannte geographische Lage, eines von jenen Ländern, wie sie in den Gedanken der Dichter und Träumer leben. Eine Ebene ohne Grenze, und inmitten dieser Ebene zwei hohe Berge, von denen einer den anderen bei weitem überragte. Der kleinere Berg war ein Wunder an Schönheit und Anmut; und hätten sein Inneres nicht wilde Leidenschaften durchtobt, gleich denen, die das Herz der Menschen vergiften, so hätte er sehr glücklich sein können, denn er war schön wie das Paradies. Von seinem Gipfel senkten sich eine Menge lieblicher, malerischer Abhänge, die wie grüne Flüßchen in die weite Ebene mündeten.
Da waren kristallklare Bächlein, blaue Seen und schäumende Wasserfälle und Blumen und Vögel, so daß es durch das Murmeln der Quellen und den Gesang der Vögel scheinen wollte, als lachte und jubelte der ganze Berg, als seien die hochroten Blumen mit ihren glühenden Farben die Lippen, die sich dem Gesang und der Freude öffneten, und die blauen Blümelein unzählige Augen, die gen Himmel blickten. Der Berg war die lebendige Freude, verkörpert durch grüne Blätter, durch weißen Schaum, durch Duft und Farben.
Wie die Freude, die in den Zweigen tanzt, die im Walde zwischen dem Schatten und dem Licht Verstecken spielt und zu den Wipfeln der Bäume und den Gipfeln der Berge aufsteigt, um die Unendlichkeit zu schauen. Sturm und Getöse ließen von Zeit zu Zeit die Blumen, das Laub und das Wasser erzittern.
Der Berg hätte sehr glücklich sein können. Er war ganz von Liebe durchtränkt. In allen Bäumen saßen versteckte Nester. Auf allen Blüten tummelten sich Schmetterlinge, und sogar in den Kelchen der Blumen baute sich die Liebe ein Heim.
Das Leben pulsierte überall, und während das Wasser leicht und schäumend dahinfloß, durchrieselte der Saft die Stämme der Bäume wie der Strom des Lebens. Weder auf den Felsen, noch in dem Boden, noch in den Pflanzen, noch in den Flüssen, noch in der ganzen Luft war auch nur ein Stäubchen, das nicht köstliche Wärme atmete.
Der Berg hätte also wahrlich sehr glücklich sein müssen und schien es auch zu sein. Keine Klage, kein Schmerzensseufzer, und keine von jenen Pflanzen, deren Schatten tötet.
Aber das alles war nur Schein. Im Innern dieses Berges glühte ein Feuer, versteckt, verräterisch, zerstörend, ein Feuer ohne Flamme, ein Feuer ohne Licht: das Feuer des Neides.
Der kleine Berg war neidisch auf den großen, und während er äußerlich glücklich und lachend erschien durch das Rauschen seiner Wasser und das Zwitschern seiner Vögel, verzehrte er sich innerlich vor Neid. Und warum war er neidisch auf den größeren Berg? Nur weil der höher war als er! Er war nicht schöner, er war nicht fröhlicher, er war nicht glücklicher, aber er war höher.
Er hatte dunkle Wälder, so dunkel, daß sie Furcht einflößten. Er hatte breite Flüsse, so breit, daß sie zuweilen aus ihren Ufern traten und alles zerstörten. Von Zeit zu Zeit umkreisten Adler seinen Gipfel. Aber dafür beherbergte er auch viel weniger Singvögel und Schmetterlinge, als der kleine Berg, und auf dem Rasen seiner Abhänge und zwischen dem Laub seiner Wälder schlichen gefährliche Reptilien umher.
Aber das alles konnte man von weitem, vom kleinen Berge aus nicht sehen. Von dort aus sah man nur, daß er höher war und daß Adler über seinen Gipfeln Kreise zogen, die sich wie herrlich leuchtende Bogen vom Himmel abhoben. So wenigstens erschienen sie den Augen des Neides.
Und die blauen und roten Blumen des kleinen Berges wurden gelb.
Und mit jedem Tage wuchs der Neid des kleinen Berges. Seine unterirdischen Feuer flossen über und drangen bis zum Mittelpunkt der Erde und baten den Genius der Vulkane, er möge dem Berge helfen, daß er größer werde. Und der Genius half ihm und trieb ihn in die Höhe. So wurde der kleine Berg größer und größer, aber noch immer war er nicht zufrieden. Mit seiner Größe wuchs sein Neid mit jedem Tage.
Denn wenn die Gipfel des Berges vor ihm noch längst in Gold getaucht, war er selbst schon in tiefe Nacht gehüllt. Stets deckte der Schatten des großen Berges den kleinen, und das war für diesen eine unerträgliche Demütigung.
Und er wollte wachsen, und er wuchs und wuchs und wurde endlich noch höher als der große Berg. Aber was für Mühen und was für Schmerzen kostete es ihn, so hoch zu werden! Wie wurden seine Abhänge zerklüftet, seine Täler aus den Fugen gerissen, seine Wälder zerstückelt, seine Flüßchen in stürzende Bäche verwandelt!
Jetzt floß das Wasser nicht mehr sanft dahin, sondern brauste so jäh zu Tal, daß der Gipfel des Berges bald ganz dürr und trocken war.
Seine Blumen, die der Neid schon gelb gefärbt, welkten völlig dahin; die Schmetterlinge entflohen. Die Nester fielen aus den Bäumen; die Vögel flogen fort und mit ihnen die Lieder. Kein fröhliches Gezwitscher mehr, nur noch das heisere Krächzen der Raubvögel. Der Berg wurde immer größer, aber auch immer schroffer, und je höher er in den Äther hineinragte, desto jäher floh das Leben in die Abgründe, die die Riesenspalten der verdorrten Klüfte bildeten.
Von weitem sah er viel gewaltiger aus; dafür aber in der Nähe betrachtet unendlich traurig; statt der Täler wilde Bäche, statt der lieblichen Hügel jähe Abhänge.
Die Adler begannen nun auch, seinen Gipfel zu umkreisen, aber dafür mieden all die andern Vögel seine Nähe. Und noch immer war der Neid nicht gesättigt, denn für den Neid gibt es keine Sättigung. Der kleine Berg war jetzt der größere geworden. Wohl überragte er den anderen bei weitem, aber er hatte noch immer nicht genug. Und der neidische Berg – er kann jetzt nicht mehr der kleine heißen, da er riesengroß geworden – wollte noch höher werden und wurde noch höher. Er wurde riesenhaft, ragte in die Wolken, und fast sah es aus, als wolle er den Himmel erklimmen. Aber war er nun glücklicher als damals, da er noch klein war? Nein, er war es nicht.
Seine Gipfel waren nicht mehr freundlich und lachend, nicht mehr, wie einst, von einem grünen Mantel umhüllt, sondern von harten, spitzen Eisnadeln, und seine Abhänge waren mit Schnee bedeckt. Auf den warmen Hauch des Lebens war die kalte Starre des Todes gefolgt.
Er hatte keine lieblichen Täler mehr. In den rauhen Klüften konnte nichts gedeihen. Sie waren wie tiefe Risse, die durch die Klauen eines Ungeheuers entstanden. Es waren in Wahrheit die Tatzenhiebe des Neides.
Keine Wasserfälle, keine Flüsse, lauter Eis. Und da der Fluß sehr groß und breit gewesen, vermochte die Sonne all das Eis nicht zu schmelzen und der Fluß blieb trocken, so daß jedes Wachstum erstarb.
Dürre, Eis, Trockenheit und Schroffheit, ringsumher. Die Blumen waren verwelkt, es flohen die Schmetterlinge, es flohen die Bienen, und der Berg hatte keinen Honig mehr. Die Bäume waren verdorrt, und da die Vögel keine Nester mehr bauen konnten, flogen sie auf und davon; und da war kein Zwitschern mehr.
Nicht einmal die Adler wollten mehr zu den Gipfeln aufsteigen, wozu auch? Um dort oben vor Kälte elend umzukommen? So wurde jener Koloß zu einem eisigen Leichnam, aber noch immer brannte in seinem Innern das verzehrende Feuer ohne Flamme, ohne Licht, das Feuer des Neides, das seine Nahrung stets in sich selber findet und doch niemals gesättigt wird.
Jetzt vermißte der große Berg schmerzlich alles das, was er verloren, und neidete sich selber seinen einstigen Besitz: Täler, Wälder, Schatten und Frische, kristallklare Flüßchen, schäumende Bäche, Blumen, Schmetterlinge, Nester, das süße Gezwitscher der Vögel und die wohlige Wärme. Alles, alles dahin!
Auf den Höhen gibt es keinen Schatten. Der Gesichtskreis erweitert sich, aber die Kälte wird unerträglich.
Die Mächtigsten sind nicht immer die Glücklichsten.
Der Schutzengel
Pedro A. de Alarcon
1833-1891
I.
»Am 1. Mai kommen die Schwalben,« so sagt man in Spanien, so lange die Welt besteht. Aber was bisher noch niemand gesagt hat und was ich aus voller Überzeugung bestätigen kann, ist, daß die Schwalben noch niemals an einem schöneren Tage ihre Nester wieder aufgesucht haben, als am 1. Mai des Jahres 1814.
Das tiefblaue, friedliche Meer erschien wie der Anfang der Ewigkeit und des Unendlichen. Lächelnd empfingen Felder und Wiesen den zärtlichen Kuß der Sonne und dankten ihr durch herrliches Blühen und das Verheißen kommender Früchte. Die ganze Atmosphäre hauchte Liebe und Leben, und ein sanfter Zephyr trug den Duft des Frühlings mit sich.
Aber dieses herrliche Frühlingsweben war nicht das einzige an diesem unvergeßlichen Tage. Auch den Städter erfüllten beim Gedanken an die Wiederkehr der Zugvögel und den Beginn des Blumenmonats große, erhabene, patriotische Empfindungen, die ihm von Auferstehung und neuer Blüte sprachen. Seit kaum vierzehn Tagen herrschte nach sechsjährigem, wütendem Kampfe Frieden in Spanien. Der Freiheitskrieg, dessen Helden unsere Väter waren, hatte sein Ende erreicht. Napoleons Generäle waren mit ihren Truppen geflohen, um dem Beherrscher so vieler Nationen zu sagen, daß es ein Wahnsinn sei, an die Eroberung Spaniens zu denken. Schon gab es auf der ganzen Halbinsel nicht einen einzigen fremden Soldaten mehr. Unser armes, erschöpftes Vaterland ruhte aus wie ein Genesender, der nach langem Leiden zum erstenmal wieder das Bett verläßt. Ein melancholischer und doch erhabener Augenblick! Von neuem riefen die Glocken der halbverbrannten und zerstörten Kirchen zum Gebet, von neuem stiegen friedliche Rauchwolken in die ruhig-heitere Atmosphäre empor, und der Sang fröhlicher Stimmen klang zum Himmel. Der erschöpfte Bürger warf die Waffen fort und kehrte zu seiner Arbeit zurück, Trost suchend für den Kummer um verlorene Lieben, in dem Gedanken, sich den eigenen Boden erhalten zu haben. Von St. Sebastian bis nach Cadiz, von der Coronna bis Gerona herrschte sanfte Trauer, tiefer Friede. Ringsum hörte man von den Heldentaten dieser oder jener Provinz, dieser oder jener Stadt, dieses oder jenes Fleckens, von den Bestrebungen, das fremde Joch abzustreifen; ringsum schickte man fromme Dankgebete gen Himmel, gedachte man voller Pietät der Verstorbenen; ringsum begann man Häuser und Städte wieder aufzubauen, in der frohen Hoffnung, glücklichere Tage darin zu verleben, als die heroischen Märtyrer des Vaterlandes.
II.
An jenem Tage traten ein hübscher Bursche und ein schönes Mädchen in einfacher, aber geschmackvoller Kleidung aus der Kirche von St. Domingo in Tarragona, wo sie soeben getraut worden waren.
Der Priester, der ihnen den Segen erteilt hatte, begleitete sie und schritt so froh und glücklich zwischen den beiden einher, als ob sie ihm ihr Glück zu danken hätten.
Und sie verdankten ihm wahrlich viel. Klara und Manuel, so hießen die jungen Leute, hatten beide ihre Angehörigen am 28. Juni 1811 verloren, an jenem Tage, da der General Suchet Tarragona im Sturm genommen hatte. Beim Ausgang des 1813er Feldzuges zog er durch dieselbe Stadt und nahm von ihren Befestigungen und einigen Häusern Besitz. Eines derselben, sowie das ganze Vermögen Manuels, der sich damals mit Klara und deren Mutter auf der Flucht befand, wurde zu jener Zeit vom Erzähler dieser Geschichte verwaltet. In diesen Tagen war mehr als die Hälfte der Bewohner von Tarragona umgekommen, so daß der arme Verwaiste, der zurückgekehrt war, um sein Haus und seine Güter zu suchen und sie den armen unglücklichen Frauen anzubieten, nicht genügend legitimiert werden konnte, um sein Recht auf die Erbschaft seiner Väter geltend zu machen.
In der zerstörten Stadt erschien damals jener ehrbare Priester, mit dem wir Manuel hier wiederfinden, und den er seit seiner Geburt kannte, denn er war seit vielen Jahren Priester dieser Gemeinde, hatte Manuel getauft und ihm den ersten Unterricht erteilt. Dank seiner glaubwürdigen Aussage wurde der Jüngling, welcher beinahe zum Bettler geworden wäre, am nächsten Tage ein reicher Mann.
Wenige Wochen später vollzog sich seine Ehe mit Klara.
III.
»Wohin wollt ihr, Kinder? Sagt mir, um was es sich handelt,« sagte der Priester an der Kirchentür.
»Wir haben Ihnen ein Geheimnis mitzuteilen,« sagte Klara niedergeschlagen.
»Ein Geheimnis – mir? ... Warum habt ihr es mir denn nicht heute morgen gebeichtet?«
»Aber, Herr Pfarrer,« entgegnete Manuel tiefernst, »unser Geheimnis ist keine Sünde.«
»So, so, das ist etwas anderes.«
»Wenigstens ist unsere Sünde ...« stammelte die Neuvermählte.
»Laßt mich hören. Was gibt es?«
»Sprich du,« sagte Klara zu ihrem Gatten.
Dieser beschränkte sich darauf, hinzuzufügen:
»Ach nein, kommen Sie nur, wir wollen bei diesem herrlichen Wetter einen Spaziergang machen, und an dem Ort selbst werde ich Ihnen erzählen, was sich zugetragen hat.«
»An welchem Ort?«
»Kommen Sie nur,« sagte Klara, ihn am Arm fortziehend.
Der Pfarrer beeilte sich, dem Wunsche der beiden zu entsprechen, und so wanderten sie zusammen zu den Toren der Stadt hinaus.
Nachdem sie einige tausend Schritt zurückgelegt und an die Ufer des Francoli gelangt waren, blieb Manuel stehen und sagte:
»Hier war es!«
»Nein, nein,« erwiderte Klara, »noch weiter.«
»Ja, wirklich, es war in jener Bucht, wo jetzt eine Frau zusammengekauert sitzt.«
»O still, jene Frau ist meine Mutter.«
»Wie, deine Mutter?«
»Gewiß ... es ist kein Zweifel! Sie ging auch heute wieder morgens aus dem Hause, ohne zu erlauben, daß man sie begleite, und seht nur, wie weit es mit der Armen gekommen ist. ... Sie wundern sich wohl nicht darüber, Herr Pfarrer, denn Sie wissen, daß die Unglückliche wahnsinnig ist. In jener entsetzlichen Nacht hat sie ihren Verstand verloren.«
Inzwischen hatten sich die drei Personen jener Frau genähert, welche am Ufer des Flusses hockte, die Augen starr auf das Wasser gerichtet.
Sie war eine ehrwürdige Matrone mit ernsten, abgehärmten Zügen, schwarzen Augen und weißem, wallendem Haar, eine echte Katalonierin.
»Was für ein schöner Tag, Mutter,« sagte Klara, sie umarmend.
»O Kind, was für eine entsetzliche Nacht,« antwortete die arme Wahnsinnige.
»Und nun hören Sie, Herr Pfarrer, wie sich alles zugetragen hat,« sagte Manuel, wahrend er sich mit dem Geistlichen von den beiden Frauen entfernte.
IV.
»Hier,« fuhr Manuel fort, während er auf den Fluß zeigte, »in diesen Wellen, welche seit fünf Jahren so viel Blut hinweggespült haben, ruht ein fünfzehn Monate altes Opfer der spanischen Unabhängigkeit ... dem diese beiden Herzen, welche Sie für immer vereint haben, Leben und Glück verdanken. Von Klaras Mutter spreche ich dabei nicht, trotzdem auch sie diesem heiligen Kinde ihr Leben verdankt, – denn es wäre besser gewesen, sie wäre mit ihm umgekommen. Und nun hören Sie, wie sich das Unglück zugetragen.
Sie werden sich darüber wundern, heiliger Vater, wie ein unschuldiges Geschöpf von fünfzehn Monaten einer ganzen Familie eine solche Wohltat erweisen konnte.«
Bei diesen Worten zeigte Manuel dem Pfarrer die rechte, durch eine große und tiefe Wunde entstellte Hand.
»Mit fünfzehn Monaten, ja! er starb mit fünfzehn Monaten, und dennoch war sein Leben nicht unnütz!
Sie wissen, Herr Pfarrer, was für ein trauriger Tag der 28. Juni 1811 für Tarragona war, trotzdem Sie selbst Gefangener waren und das Elend in der Stadt nicht sahen. Sie sahen nicht, wie fünftausend Spanier in zehn Stunden starben, wie Häuser und Kirchen in Flammen aufgingen, wie schwache und hilflose Frauen gemordet und ehrbare Jungfrauen und Nonnen geschändet wurden! Sie sahen nicht, wie Raub und Trunkenheit, Leidenschaft und Gemetzel aufeinander folgten. Sie sahen nicht eine der größten Heldentaten des Welteroberers, des Halbgottes Napoleon!
Ich sah das alles! Ich sah, wie diese Totkranken sich von ihrem Sterbelager erhoben und das Leichentuch mit dem Säbel vertauschten, um von der Hand fremder Krieger zu fallen. Ich sah in dieser nämlichen Straße ein geköpftes Weib, den Säugling noch an der Brust, und laut weinende Kinder die umher irrten. O, verflucht seien die fremden Waffen!
Mein Vater und meine Brüder kamen an jenem entsetzlichen Tage um. Glücklich sind sie!
An der rechten Hand verwundet und daher kampfunfähig, floh ich in das Haus von Klaras Mutter.
Klara stand, ängstlich um mein Leben besorgt, bleich und zitternd auf dem Balkon, und jauchzte auf, als sie mich auf der Straße erblickte.
Ich trat ein; aber schon hatten meine Verfolger sie gesehen. – Und sie war so schön!
Mit rohem Gelächter und brutalem Geschrei begrüßten sie die Schöne.
Einen Augenblick später stürzte unsere Tür laut krachend unter den Axthieben der Feinde zusammen. Wir waren verloren!
Klaras Mutter, welche das unglückliche Kind in ihren Armen hielt, das nun sanft im Bette dieses Flusses schlummert, floh mit uns in die Cisterne des Hauses, welche sehr tief, und da es schon seit Monaten nicht mehr geregnet hatte, völlig trocken war. – Jene Cisterne, welche etwa acht Quadratmeter Flächeninhalt hatte und nach oben hin immer enger wurde, vertiefte sich in unterirdischen Abstufungen und bildete so eine Art Brunnenröhre, welche ungefähr in der Mitte des Hofes mündete, wo an ihrem Geländer ein eiserner Flaschenzug hing, vermittelst dessen das Wasser mit zwei Gefäßen ausgeschöpft wurde.
Miguel, so hieß das kleine Kind, war ein Bruder Klaras und der jüngste Sohn der Unglücklichen, welche die Franzosen zur Witwe gemacht hatten.
In jener Cisterne konnten wir uns alle vier bequem bergen, und so waren wir gerettet. – Kein Mensch konnte ahnen, daß wir uns an diesem Ort versteckt hatten, noch auch, daß dieser Ort überhaupt existiere! Von oben gesehen, erschien die Cisterne wie ein einfacher Brunnen. Die Franzosen glaubten, daß wir über das Dach des Hauses geflüchtet seien.
Ja ... wir waren gerettet! Klara verband meine Wunde, während die Mutter ihrem Säugling die Brust gab, und trotzdem meine Wunde furchtbar schmerzte, fühlte ich mich glücklich und lächelte ...
Da hörten wir plötzlich, wie die Franzosen, halb verdurstet, versuchten, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen, in dem wir uns befanden.
Sie werden sich denken können, Herr Pfarrer, in welch furchtbarer Todesangst wir in jenem Augenblick schwebten!
Wir drückten uns alle in eine Ecke, während sie das Gefäß so tief hinunter ließen, daß es auf den Boden stieß ...
Wir wagten kaum zu atmen.
Der Eimer schnellte wieder hinauf. »Der Brunnen ist trocken!« riefen die Franzosen aus.
»Weiter oben wird's Wasser geben!« fügte ein anderer hinzu.
»Nun gehen sie!« dachten Klara, ihre Mutter und ich.
»Wenn sie mal hier unten wären!« rief einer in katalanischer Sprache. ...
»Es war ein Überläufer, Herr Pfarrer, ein Spanier verriet uns!«
»Wie dumm!« antwortete der Franzose, »sie hätten sich unmöglich so rasch herunterlassen können.«
»Du hast recht,« sagte der Überläufer.
Sie wußten nicht, daß zu dieser Cisterne ein unterirdischer Gang führte, dessen Falltür durch den Boden eines entfernt gelegenen Weinkellers verdeckt und infolgedessen schwer aufzufinden war.
Wir hatten die Dummheit begangen, die Verbindungstür zwischen der Cisterne und dem Keller zu verschließen, und konnten sie nun nicht öffnen, ohne großen Lärm zu machen.
Nun stellen Sie sich unser entsetzliches Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung vor, während wir dies Gespräch hörten. Von den Winkeln aus, in denen wir uns versteckt hielten, sahen wir die Schatten ihrer Köpfe in dem hellen Schein, den die Brunnenöffnung in den Keller warf, hin und her huschen. Jede Sekunde erschien uns wie ein Jahrhundert.
In diesem Augenblick fing Miguel an zu weinen.
Aber kaum hatte er den ersten Schrei ausgestoßen, als seine Mutter die Stimme, welche uns verraten sollte, auch schon dadurch zu ersticken versuchte, daß sie das zarte Kind fest gegen ihre Brust drückte.
»Habt ihr's gehört?« schrie einer dort oben.
»Nein!« erwiderte ein anderer.
»Laßt uns horchen,« sagte der Überläufer.
So vergingen drei furchtbare Minuten.
Miguel kämpfte noch mit dem Weinen ... und je fester seine Mutter es drückte, desto unruhiger wurde das Kind.
Aber man hörte auch nicht den leisesten Schrei mehr.
»Es wird das Echo gewesen sein!« riefen die Franzosen aus, sich langsam entfernend.
»Das kann sein,« bestätigte der Überläufer.
Sie gingen dem Ausgang des Hofes zu, während das Klirren ihrer Säbel und das Lärmen ihrer Tritte noch lange widerhallte.
Die Gefahr war vorüber!
Aber zu spät wurde uns das Glück zuteil!
Miguel weinte nicht mehr. ...
Er war tot!
V.
»Herr Pfarrer, Herr Pfarrer!« schrie Klaras Mutter, Manuel unterbrechend, plötzlich auf. »Sagen Sie, daß es nicht wahr ist! Ich habe mein Kind nicht getötet, sie haben es umgebracht. Ich erwürgte es, um sie zu befreien. Ach, Herr Pfarrer, vergeben sie mir, ich bin keine schlechte Mutter, ich bin wahnsinnig geworden um mein Kind, um meinen Sohn! Ich bin keine schlechte Mutter!«
»Herr Pfarrer!« sagte Klara; »wir haben Sie hierher geführt, damit Sie das Wasser segnen, welches den Leichnam meines kleinen Bruders birgt. Die Gefahr ließ uns keine Zeit, ihn zu begraben.«
»Nicht wahr, Herr Pfarrer, Miguel wird doch im Himmel sein?« fragte Manuel mit tränenerstickter Stimme.
»Ja, meine Kinder,« sagte der Priester, »ich gebe euch die Versicherung im Namen Gottes und des Vaterlandes! Und du, meine Schwester, weine nicht mehr!« fuhr er fort, sich zu der alten Mutter wendend, »Gott segne das Martyrium, welches du erleidest, wie ich jetzt dies unschuldige Kind segne, das es dir auferlegte. Im Himmel wirst du dein Kind wiederfinden, und mit ihm wird sich deine Seele freuen; und ihr, die ihr euch liebet, vergeßt nicht, daß ihr euer Glück erkauft habt mit der Qual anderer. Seid hilfsbereit für eure Nächsten!«
So sprach der Pfarrer, im Glanz der Frühlingssonne, inmitten blühender Blumen, beim fröhlichen Sang der Vögel, und segnete die Fluten des Francoli, in denen das unglückliche Kind, der kleine Schutzengel der Familie, ruhte.
Pedro Mari
Arturo Campion
1854-1936
I
Er mochte gehen, wohin er wollte: das letzte Band, das ihn noch an die alte Hütte fesselte, war zerrissen: die Großmutter lag dort unten auf dem Kirchhof von Errazu.
Er würde sich die Stirne nun nicht mehr im Schatten der Kastanienbäume kühlen, würde das Plätschern des Wassers und den fröhlichen Sang der Bauerndirnen nicht mehr hören, nie mehr die erhitzten Köpfchen der spielenden Kinder und das glückliche Lächeln der Mutter sehen.
Er war allem, ganz allein in der verräucherten Hütte, durch deren kleine Scheiben man hinter den Zweigen des Kastanienbaumes das tiefe Tal erspähte.
Seine vier Schwestern waren in verschiedenen Ortschaften verheiratet; die älteste in Berrueta, zwei in Arizcun und die jüngste in Errazu. Mit knapper Mitgift versehen, hatten sie das heimatliche Haus verlassen.
Pedro Mari, der Erbe des Hofes, wollte ledig bleiben, nicht, weil er keine passende Frau finden konnte, sondern nur, weil er seit seiner frühesten Jugendzeit eine bestimmte Idee, einen bestimmten Plan hegte.
In dem Kopfe dieses Jünglings mit den stahlblauen Augen, dem maisfarbenen Teint und den lächelnden Zügen, der schlank wie eine Tanne und stark wie eine Eiche war, lebte ein Gedanke, der ihn völlig beherrschte: er wollte nach Amerika auswandern, und sich dort, wie viele seiner Landsleute, bereichern.
Wie? darüber war er sich nicht klar. Er wußte nichts und glaubte doch genug zu wissen. In Amerika werden die Leute reich, das genügte ihm.
Nach dem Tode der Großmutter verkaufte er die Schafherde und das Hausgerät an seine Schwester Leocadi, die in Errazu lebte und die reicher, oder besser gesagt, weniger arm war als die andern.
Die heimatliche Hütte behielt er selbst, um einst mit gefüllten Taschen dorthin zurückkehren zu können.
Veranlassung zum Auswandern fand sich bald. Man sprach viel von dem nahe bevorstehenden Krieg zwischen Spanien und Frankreich. Die Hütte lag hart an der Grenze, und daher würde er wohl Soldat werden und in französische Lande eindringen müssen ...
Und Pedro Mari haßte den Krieg, mehr noch den Dienst, die Disziplin und die Kaserne. Das Leben in den Bergen hatte in seiner Seele die Liebe zur ländlichen Ruhe, seine Herkunft die Liebe zur persönlichen Freiheit erweckt, weder der Hirt noch der Baske in ihm konnte sich mit dem Militärdienst befreunden.
II.
Er hatte seine Reise auf den folgenden Tag festgesetzt: eine weite beschwerliche Fußwanderung bis zu dem einzigen andalusischen Hafen, wo er sich einschiffen konnte, ohne andere Hilfsmittel als ein wenig Geld, ohne andere Aussichten als das Empfehlungsschreiben des Herrn Pfarrers an einen verwandten in Valparaiso.
Nach einem frugalen Mittagessen schlug er gegen Abend freudigen Herzens den Pfad nach Izpegi ein. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt, von jenen blauen Gipfeln aus den letzten Blick auf das Tal zu werfen, warum gerade nördlich von Izpegi an den Apfelbäumen entlang, auf dem schönen, grünen Rasen, von dem sich wie reine, frisch zum Trocknen aufgehängte Wäsche, das Häuschen von Eyaraldea abhebt? Dort wohnte Katalin. die schöne und lustige Bäuerin, die beinahe Pedro Maris abenteuerliche Pläne gekreuzt hätte. Und vielleicht lebte, ihm unbewußt, in der Tiefe seines Herzens die Erinnerung an seine einzige Liebe fort: wie die glühende Asche auch in der kältesten Nacht im ausgebrannten Herdfeuer fortglüht.
Es war im Monat März eines Jahres, in dem es nur wenig Schnee und Eis gegeben hatte. Die milde, feuchte Witterung hatte schon früh alles zur Blüte gebracht; hinter frischen Blättchen im Gebüsch waren die jungen Nester der piependen Vögel versteckt. Ab und zu zeigte der Frühling sein lachendes Gesicht, um ebenso rasch wieder hinter Wolken zu verschwinden; aber wohin man sah, in Feld und Wald, überall leuchtete der Saum seines vielfarbigen Gewandes.
Pedro Mari setzte sich auf einen Stein. Der Himmel wechselte fast unmerklich seine Farbe: dort ein mattes Blau, hier kristallner Glanz. Im fernen Westen schwebte ein Wölkchen langsam dahin, wie eine schwimmende, von Goldadern durchzogene Insel. Der wundervolle Wasserfall verlieh den hohen Felsen und den Hügeln von Astate und Arieta einen seltsamen Glanz; rückwärts zogen sich die Berge hin, deren höchste, immer umwölkte Gipfel beinahe in den Himmel ragten. Ihnen zu Füßen erstreckten sich rechts und links die Täler von Baztan und Baigorri mit ihren Dörfern, Hütten, Flüssen, Wäldern und selben Saatfeldern, die einen güldenen Glanz über die grünlichen Schattierungen breiteten. Fröhliche Vogelstimmen erfüllten die Luft, und es rauschten die Bächlein, die wie tanzende Bauernburschen über Bergabhänge ins Tal hinuntereilten.
Mit dem Lärmen in der Natur vereinte sich das Echo ferner Gesänge: weibliche Stimmen mischten sich mit dem lieblichen Geläute der Schafherden und dem Rauschen der schnellfließenden Bäche, ohne es zu übertönen. Pedro Mari begann den Abhang hinunterzusteigen. Ihn lockte die Hütte Katalins mehr als der Gesang. Auf den an die ersten Hütten stoßenden Feldern war ungefähr ein Dutzend Bauernmädchen mit dem Jäten beschäftigt. Hell beschien die Sonne ihre roten Röcke, ihre bunten Kopftücher. Die Mädchen sangen:
»Ich spinn und spinn Und sinn und sinn Und meine Tränen fließen.«
Die fröhliche und tändelnde Melodie, in der doch eine leichte Melancholie lag, stimmte merkwürdig gut zu Pedro Maris Empfindungen.
Die Bauerndirnen bemerkten ihn sofort und lächelten ihm freundlich zu, mit ihren schrillen Stimmen singend und nach jeder Strophe in lautes Gelächter ausbrechend.
»Schwestern, wollt ihr einen Mann, Geht hinab zur Mauer, Für fünf Sous man finden kann Achte auf der Lauer.«
Pedro Mari legte die Hand an den Mund und antwortete mit folgender Strophe:
»Männer, wollt ihr eine Frau, Geht hinab zum Garten, Dort findet ihr im Abendtau Achtzehn auf euch warten.«
Während seines Gesanges tanzte und hüpfte eine etwa sechzehnjährige Bäuerin, klein und behende wie ein Eichhörnchen, auf dem Felde herum.
»Für 'ne gute Tänzerin gibt's kein schlechtes Tamburin, – nicht wahr?« rief ihm eine hübsche, rothaarige Bäuerin mit schwarzen Augen entgegen, die mit herausforderndem Lächeln auf ihn zukam.
»Komm mir nicht nahe, Kind!«
»Warum?«
»Du kennst doch das Sprichwort:
»Manches, was von weitem schön, Darf man nicht genau besehn!«
»Ich kann auch Verse machen; mich nennen sie die Dichterin.«
»Sage mir einen; in deinem Munde werden sie süß sein wie Honig.« –
»In dem kleinen Dorf Baztan Sieht viel große Esel man.«
Lautes Gerächter erscholl darauf und klang von Berg zu Berg, bis es in dem Rauschen der Bäche erstarb.
Pedro Mari war zu dumm, zu schwerfällig und zu denkfaul, um einem Dutzend scherzender Frauen antworten zu können. Ihr Gelächter brachte ihn aus der Fassung.
Er errötete, machte kehrt und verschwand in den nahen Wäldern, tief betrübt, Katalin nicht gesehen zu haben. Spottend klang der Gesang der Bäuerin hinter ihm her:
»Verliebte sehen schrecklich aus, Bleich wie der Tod, ein wahrer Graus.«
III.
Als er seine Schritte in andere Richtung lenkte, kamen ihm drei Burschen entgegen, – einen von ihnen kannte er, Martin aus Zamukegi.
Dieser antwortete ihm auf seine Fragen:
»Meine beiden Kameraden sind aus Bidarray – wir gehen nach Elizondo, um Vieh zu kaufen, was du wohl wissen wirst, wir wandern aus, kehren Frankreich den Rücken und wollen in Pamplona bleiben, bis alles vorüber ist. Ich fürchte, wenn wir zurückkommen, werden die Bäume ihre Wurzeln in den Himmel und ihre Zweige in die Erde strecken. Die Aufwiegler sind in das Tal gedrungen, haben die Kirchen gestürmt, mit Heu gefüllt, die Kelche, die heiligen Gefäße und die Monstranzen geraubt und einen Baum aufgepflanzt, um den sie, Gotteslästerungen heulend, einen wüsten Tanz aufführen. Unter ihnen sind viele abtrünnige Priester, Schweinehunde! – die gern heiraten wollen und dem Teufel die Hand bieten.«
Pedro Mari bekreuzigte sich.
»In Wirtshäusern und Hütten verkünden sie, das heilige Gefäß in der Hand, neue Lehren und erwarten, daß wir alle dieser Republik zujauchzen, die sie auf den Königsthron setzen wollen. Sie sagen, daß sie die Republik auch in Madrid verkünden werden, und daß es von nun an in ganz Spanien weder Mönch noch Inquisitor mehr geben soll. Manch einem rauben sie das klare Urteil. Sie bilden ein Heer von Freiwilligen, und da sich zu wenige melden, fangen sie jetzt an, die Burschen gewaltsam einzuziehen, heute werfen sie ihre Netze nach uns aus, und so werden wir von den Gendarmen mit gezücktem Säbel durchs Gebirge verfolgt! So geht es in Spanien zu. Mag da dienen, wem es gefällt, und rufen, es lebe die Freiheit! wir sind frei, frei in Pamplona!«
Martin wandte sein Gesicht gen Frankreich und stieß einen jubelnden Ruf aus, der kräftig widerhallte.
Beim Abschied trat er an Pedro Mari heran und flüsterte ihm zu:
»Weißt du schon das neueste? Katarin von Eyaraldea heiratet Miguel Elorga, das heißt, wenn sie ihn nicht zum Soldaten machen.«
Wenige Augenblicke darauf waren die drei Burschen im Schatten der Bäume verschwunden. Pedro Mari verharrte unbeweglich und nachdenklich, bis ihn ein leises Geräusch aufschreckte. Ein Vogel pickte mit seinem schwarzen Schnabel an einem dürren Ast. Er hob den Kopf. Die ersten Sterne breiteten einen matten, goldigen Schein über das Laub der Bäume. Der melancholische Ruf des Kuckucks übertönte das leise Murmeln der Quellen und Bäche. Langsam senkten sich die Nebel über das Tal.
IV.
Kaum drang der Strahl der ersten Morgendämmerung durch die schlecht schließenden Fenster der Hütte, als Pedro Mari, der nur wenig geschlafen hatte, sich von seinem Lager erhob. Er kleidete sich an, schnallte den Gurt mit dem Geldbeutel um, ergriff den Stock, an dem sein Bündel, der Korb mit Lebensmitteln und seine Stiefel hingen, und trat, nachdem er einen flüchtigen Abschiedsblick auf das Haus geworfen, hinaus. Den Schlüssel legte er so nahe an die Tür, daß man ihn von außen bequem erreichen konnte; gerade als beabsichtige er, bald zurückzukehren.
Ihn dürstete, und er nahm einen Schluck Wasser aus der Quelle. Der Morgen war frisch, aber schön, ein Junitag im März: die Luft rein, der Himmel klar, die Berge rosig und die Wälder ruhig.
Freudige Hoffnung verdrängte bald die Traurigkeit, die jeder Abschied mit sich bringt. Die gesunde Bewegung erhöhte sein Wohlbefinden; weit ausschreitend, schlug Pedro Mari den beschwerlichen Weg zum Hafen ein. Unweit der Schenke von Ulzama stieß er auf einen Trupp Soldaten und später auf zwei Regimenter und zahlreiche, kostbar gekleidete Reiter. Sie erzählten ihm, daß der Vizekönig ernannt und Frankreich der Krieg erklärt worden sei.
Um allen neugierigen Fragen aus dem Wege zu gehen, hielt er sich von den Dörfern fern und suchte die abgelegensten einsamsten Schenken auf.
Auf seiner Wanderung durch Pamplona, das öder und weniger bebaut ist, schien es ihm durch die Ähnlichkeit der Trachten, Sitten und Sprache dennoch, als habe er Baztan nicht verlassen. Trotz des lachenden Himmels und der fruchtbaren Erde lag über den Bergen, der hügeligen Ebene ohne Flüsse, Wiesen, Schaf- und Kuhherden etwas wie düstere Trauer.
Bald erreichte er Altkastilien und bemerkte zu seinem Ärger, daß trotz des klaren Himmels die Gegend immer reizloser wurde; kahle Gebirgszüge, schroffe Felsblöcke, düstere Engpässe, dürftige Pinien und unweit davon die endlose, staubige, braune Steppe, begrenzt von den Bergen, die wie von großen Riesenmaulwürfen aufgeworfene Erdhügel aussahen. Unter der goldigen Lichtflut der Sonne machten die elenden Dörfchen, die Lehmhütten, die zitronengelben, mageren, zerlumpten Männer und Weiber einen besonders jämmerlichen Eindruck. Und auf den ärmlichen Gehöften verkündete weder Lachen noch Gesang den Anbruch des Feierabends. Mürrisch und schweigsam wie die Lastesel traten sie den Heimweg an.
Nach langen, anstrengenden Tagesmärschen bat ihm die Nacht in schmutzigen, unordentlichen Schenken, deren Boden niemals ein Besen berührte, nur wenig Erholung. Als einziger Hausrat hing ein irdenes Trinkgefäß zum allgemeinen Gebrauch an der Wand, und oft bestand der ganze Proviant nur aus ein wenig Brennholz, Wein und Öl, so daß jeder, der nicht mit leerem Magen zu Bett gehen wollte, gezwungen war, sich sein kärgliches Mahl selbst mitzubringen. Unfreundliche Wirte, zerlumpte und liederliche Kellnerinnen mit schmutzigem Mieder und zerrissenem Flanellrock, abends kein Gast in der Schankstube, nur einzelne Passanten und zuweilen ein paar lustige Maultiertreiber aus der Nachbarschaft, das Bett ohne Decke und die Unterhaltung karg.
Unzählige Male kam Pedro Mari das Bild alter Freunde und ein Lied seiner Heimat in den Sinn, und so summte er es, sich auf seinem Strohsack ausstreckend, leise vor sich hin.
Jeden Morgen trat er von neuem und mit größerer Sehnsucht seinen Marsch an, sich über jede Strecke freuend, die ihn dem andalusischen Hafen näher brachte, in dem er sich nach Chile einschiffen wollte.
V.
Eines Abends, als seine Vorräte erschöpft waren, trat er in eine kleine Dorfschenke und setzte sich an einen Tisch. Zwei Männer näherten sich ihm, höflich grüßend, sie sahen nicht allzu vertrauenerweckend aus, aber als Pedro Mari an seinen verbrannten Teint, seinen verschossenen Anzug, das schmutzige Hemd, die zerrissene Jacke und die geflickte Hose dachte, gab er sich zufrieden. Einer der beiden war groß, der andere klein, der eine sah aus wie ein Hamster, der andere gelb und dürr wie ein Tamburin; Stirn und Wangen mit Narben bedeckt.
Ihr Aussehen und ihre Tracht brachten Pedro Mari auf den Gedanken, daß sie keine Bauern seien, sie kamen aus dem nahe gelegenen Madrid und begannen sogleich ein Gespräch. Der größere war Soldat gewesen und hatte die Bestürmung von San Sebastian mitgemacht. Er sprach baskisch und Pedro Mari kastilianisch, so daß sie sich sehr gut verständigen konnten. Sie ließen Wein kommen aus Freude über die vornehme Bekanntschaft, wurden aber während ihres Hin- und Herredens plötzlich durch den Lärm von der Straße aufgeschreckt.
Die beiden Freunde stürzten hinaus; auch die übrigen Gäste verschwanden durch die Hintertür. Nur Pedro Mari blieb allein zurück und verzehrte sein Mahl mit der größten Seelenruhe.
Dann erhob er sich, um zu bezahlen, leichter und behender denn je, so leicht, daß er das Empfinden hatte, er habe ein Gewicht, eine hindernde Last abgestreift. Unwillkürlich griff er nach seinem Beutel: das Geld war verschwunden. Blaß und verstört stieß Pedro Mari, am ganzen Leibe zitternd, ängstliche Hilferufe aus.
Von seinem Schanktische aus beobachtete der Wirt ihn scharf und fragte kurz:
»Was ist los, Brüderchen? Seid Ihr verrückt geworden? Hört auf mit dem Kauderwelsch und dem Geschrei.«
Schreck und Bestürzung hatten Pedro Mari derartig in Aufregung versetzt, daß er kein einziges kastilianisches Wort herauszubringen vermochte. Endlich stieß er jammernd hervor:
»Sie haben mich bestohlen! Sie haben mich bestohlen!« Der Wirt schnitt eine Grimasse. »Das macht einem andern weis! Solche Finten nützen hier nichts, Brüderchen. Ich bin ein armer, alter Mann und lasse mich nicht von Schmarotzern aussaugen. Entweder Ihr bezahlt, oder ich hole die Polizei.«
Pedro Mari verstand ihn nicht, holte aus der Westentasche das Geld, das er zum täglichen Gebrauch dort eingesteckt hatte, und rief noch wütender: »Sie haben mir mein Geld gestohlen, hier, hier haben sie mir mein Geld gestohlen!«
Diese Worte brachten den Wirt zur Raserei.
»Verdammt!« rief er aus. »Das fehlte mir nur noch, daß solch ein Gauner einen armen, ehrlichen Christen wie mich ins Verderben stürzt!«
Der Streit wurde immer heftiger, und Pedro Mari wiederholte immer lauter: »Sie haben mir mein Geld gestohlen!«, während der Wirt ihn mit Vorwürfen und Drohungen überhäufte, sie schrien so laut, daß sie den Eintritt mehrerer Soldaten ganz überhört hatten und ihre Gegenwart erst bemerkten, als der Sergeant Pedro Mari die Hand auf die Schulter legte mit den Worten:
»Soldat Seiner Majestät!«
Pedro Mari, erschreckt durch den Anblick der Gewehre und Bajonetts, begann zornig den Hergang der Geschichte zu erzählen und versuchte sich schreiend loszumachen.
»Mir hat man mein Geld gestohlen, und nun soll ich ins Gefängnis?«
Niemand hörte auf ihn. Die Soldaten banden ihm die Hände und trieben ihn unter Stoßen und Schlagen auf die Straße.
»Herr Sergeant!« schrie der Wirt hinter ihm herlaufend, »dieser Schurke hat noch nicht bezahlt!«
»Wer dem König dient, kann sich doch wenigstens umsonst satt essen,« lautete die lakonische Antwort.
Pedro Mari wurde einem Trupp zerlumpter, wüster Gesellen zugeteilt, die unter der Aufsicht einer Kompagnie Soldaten vor der Tür standen. Man rührte die Trommel, und nach Aufstellung der Truppe verlas ein Offizier mit lauter Stimme einen Erlaß seiner katholischen Majestät, des Königs D. Karlos IV., und darauf einen anderen von dessen Vorgänger D. Karlos III. vom 11. September 1773, der unter dem Vorwand eines Krieges zwischen Spanien und der französischen Republik die militärische Einberufung aller Müßigen in Madrid und den umliegenden Ortschaften befahl.
VI.
Nun befreiten die Soldaten Pedro Mari von seinen Fesseln, denn er war für sie nicht der Dieb, als welchen der böse Wirt ihn bezeichnet hatte. Sie wollten ihn zum Soldaten machen. Vergebenes Bemühen! Von der kastilianischen Aushebung befreiten ihn sowohl seine navarrische Herkunft als auch sein Grundbesitz in Baztan. Wie aber das hier beweisen? Für den Augenblick war es unmöglich, denn die Soldaten hörten auf keinen, und sobald einer laut sprach, schlugen sie ihn... aber über kurz oder lang würde sich wohl Gelegenheit dazu bieten.
Er beschloß, sie ruhig abzuwarten; inzwischen hatte er reichlich Zeit, über sein Mißgeschick zu grübeln. Man hatte ihn bestohlen! Seine Ersparnisse waren verschwunden, und ihm war die Möglichkeit benommen, den Spuren der beiden Diebe zu folgen. Als er die Schenke betrat, hatte er das Geld noch, das wußte er genau. O, über diese verdammten Freunde! Zweifellos hatten sie ihn bestohlen. Würde er mit dem bißchen Geld, das ihm geblieben war, den fernen Hafen erreichen und die teure Überfahrt bezahlen können? Vielleicht, wenn er sich alle nur denkbaren Entbehrungen auferlegte... Aber wovon sollte er die erste Zeit in Amerika leben? Wäre es nicht besser, wenn er einfach umkehrte und seinen Plan ganz aufgäbe? Aber ohne Geld, ohne Vermögen nach Baztan zurückkehren, das war unmöglich!
Eine schöne Reise! Er konnte sich dann als Hirt oder als Knecht verdingen. Und der Hohn der Freunde, der Verwandten, der Nachbarn! Mit Spottliedern würden ihn die Mädchen am Brunnen empfangen. Nein, tausendmal nein! Lieber betteln gehen, lieber beim Militär dienen, als das ertragen!
Diese Gedanken durchkreuzten sein Hirn, als er während des ganzen Abends und der halben Nacht über die öden, ausgedörrten Felder marschierte. Endlich erreichten sie eine Stadt, Alcala, und wurden nun in einen niederen Stall geführt, der nichts anderes enthielt, als eine Pritsche. Man brachte ihnen einen großen Kessel mit Essen, das Pedro Mari lebhaft an das Schweinefutter in Baztan erinnerte. Ein Hauptmann, gefolgt von vier Unteroffizieren, machte die Runde, untersuchte die Taschen der Ausgehobenen und nahm ihnen das Geld ab. Pedro Mari widersetzte sich ihm, und nach derben Faustschlägen drohte man ihm sogar mit Gefängnis. Nun begann er sich bitterlich zu beklagen und mit leidenschaftlichen Worten und Gebärden sein unglückseliges Geschick zu verwünschen. Niemand hatte Mitleid mit ihm, sogar seine Schicksalsgenossen machten sich über ihn lustig und verhöhnten ihn. So fügte er sich denn schweigend, flüchtete in einen Winkel und verbrachte die Nacht wachend, ohne einen Bissen zu sich genommen zu haben. Bald verfiel er in völlige Ermattung; ihm war es klar geworden, daß er in eine Falle geraten, aus der es keinen Ausweg gab.
Die ersten Strahlen der Morgensonne drangen durch das schmale Fenster. Die Hitze war drückend, die Luft schwer, die Atmosphäre verdorben.
Hier schnarchte der Auswurf der menschlichen Gesellschaft, ein Haufen zerlumpter, blasser Gesellen, den Stempel von Elend und Laster auf den Zügen.
Und zu derselben Zeit ging die Sonne in ihrer strahlenden, goldenen Schönheit über den baztanesischen Bergen auf.
Die Gefangenschaft dauerte noch den größten Teil des folgenden Tages. Die schlechte Luft verursachte ihm Übelkeiten. Pedro Mari schmerzte der Kopf so heftig, als drücke ein eiserner Ring auf seine Schläfen. Vergebens war die Bitte um Nahrung und frische Luft; die Türen blieben hermetisch verschlossen. Zuweilen ließ sich der Schritt der auf- und abgehenden Schildwache vernehmen. Die Reste des Essens wurden unter häßlichen Streitigkeiten verschlungen. Pedro Mari ekelte sich davor, und wäre lieber Hungers gestorben, als daß er auch nur einen Bissen zu sich genommen hätte, heftiger Durst quälte ihn, und so entschloß er sich, einen Schluck von dem warmen, schlecht schmeckenden Wasser zu trinken, das am Boden stand. Um vier Uhr nachmittags wurde die Tür geöffnet, und wie losgelassene Stiere stürzten alle hinaus in die frische Luft.
Ein Hof mit hohen, kahlen Mauern; zwei Reihen Soldaten mit gezücktem Bajonett; in der Mitte eine Gruppe von Offizieren in den verschiedensten Uniformen, die lachend und scherzend ihre Pfeife rauchten.
Sie befahlen den Ausgehobenen, sich aufzustellen, und begannen die Reihen zu inspizieren.
»Teufel auch! das ist ja das reine Gesindel!« rief ein Reiteroffizier von aristokratischem Aussehen und in prächtiger Uniform, mit verächtlicher Gebärde aus. »Die sehen aus wie entlaufene Sträflinge, nicht wie Bauern. Ist das ein Pack!«
»Mit Ausnahmen, Pepita!« entgegnete ein Hauptmann der Infanterie, »hier ist ein Bursche, groß und schlank wie eine Tanne, den stecken wir zu den Grenadieren. Er sieht anständig aus und scheint ein Fremder zu sein. Wie zum Teufel kommt Ihr zu dem?«
Die Soldaten wurden in kleine Trupps geteilt, und Pedro Mari dem kleinsten zugewiesen.
Als der Hauptmann sich näherte, um dem Sergeanten seine Befehle zu erteilen, grüßte Pedro Mari respektvoll und äußerte verlegen und demütig seine Wünsche.
Dieser hörte ihn geduldig und mit wohlwollender Miene an.
»Wem sagst du das, mein Sohn? Der König befiehlt und« ... militärisch grüßend setzte er hinzu: »auch du mußt gehorchen. Und ich glaube kaum, daß die Bewohner von Navarra den Wunsch hegen, daheim still am Herd zu sitzen, während sich die übrigen Spanier mit den Franzosen schlagen. Dort oder hier, das bleibt sich gleich.«
Pedro Mari wollte noch etwas erwidern, aber der Hauptmann schnitt ihm mit strenger Miene das Wort ab.
»Schweig' oder ich laß dich Spießruten laufen.« Mit diesen Worten drehte er sich kurz auf dem Absatz herum.
Einer der Offiziere, der den Vorgang beobachtet hatte, rief wütend aus:
»Diese Hunde haben immer eine Ausrede, wenn es gilt, dem König zu dienen, wenn mir so einer in die Hände fällt, soll's ihm schlecht ergehen, Herr Hauptmann!«
VII.
Es war unnütz, absolut unnütz, sich aufzulehnen. Das wurde Pedro Mari bald klar. Nachdem er einmal zwischen die Räder der militärischen Maschine geraten, sah er keinen Ausweg mehr.
So ergab er sich denn geduldig in sein Schicksal, mit der schwachen Hoffnung auf bessere Zeiten. Wie oder wann würde das sein? Jeder Mensch, auch der verzweifeltste, hegt noch unbestimmte Hoffnungen.