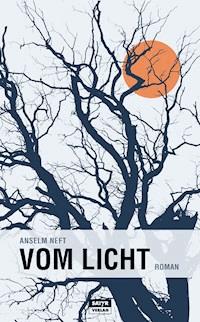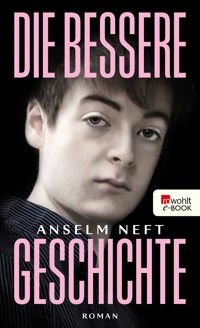9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kluger, trauriger und Trost spendender Roman über den Schmerz, der Familie heißt. Die Zwillinge Sophia und Thomas waren sich immer nah, so unterschiedlich sie auch sind. Die treusorgende Mutter und Gattin eines Kunsthändlers Sophia erfüllt das bürgerliche Ideal der Eltern. Thomas, der Unangepasste, schlägt sich als freier Journalist durch. Der cholerische Vater ist seit Jahren tot. Als auch die Mutter stirbt, treffen sich die Zwillinge im Elternhaus, und beide haben Neuigkeiten: Thomas hat sich von seiner Freundin getrennt, die neue ist viel jünger als er. Und Sophia ist unheilbar an Krebs erkrankt; ihr bleiben nur Monate. Mehr als der nahende Tod quält sie die Frage: Habe ich überhaupt gelebt? Beim Sichten des Nachlasses werden die Zwillinge von Erinnerungen heimgesucht. Sie streiten, verletzen einander und steigen tief ein in die Geschichte ihrer Familie. Sophia beschließt, ihr Leben zu regeln. Dazu gehört eine letzte Reise mit Tochter und Bruder. Doch unterwegs eskaliert die Stimmung. Und wieder müssen die Geschwister den Blick ganz weit zurück wagen, um nach vorne schauen und das letzte Stück des Weges gemeinsam gehen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anselm Neft
Späte Kinder
Roman
Über dieses Buch
Ein kluger, trauriger und Trost spendender Roman über den Schmerz, der Familie heißt.
Die Zwillinge Laura und Thomas waren sich immer nah, so unterschiedlich sie auch sind. Die treusorgende Mutter und Gattin eines Kunsthändlers Laura erfüllt das bürgerliche Ideal der Eltern. Thomas, der Unangepasste, schlägt sich als freier Journalist durch. Der cholerische Vater ist seit Jahren tot. Als auch die Mutter stirbt, treffen sich die Zwillinge im Elternhaus, und beide haben Neuigkeiten: Thomas hat sich von seiner Freundin getrennt, die neue ist viel jünger als er. Und Laura ist unheilbar an Krebs erkrankt; ihr bleiben nur Monate. Mehr als der nahende Tod quält sie die Frage: Habe ich überhaupt gelebt?
Beim Sichten des Nachlasses werden die Zwillinge von Erinnerungen heimgesucht. Sie streiten, verletzen einander und steigen tief ein in die Geschichte ihrer Familie. Laura beschließt, ihr Leben zu regeln. Dazu gehört eine letzte Reise mit Tochter und Bruder. Doch unterwegs eskaliert die Stimmung. Und wieder müssen die Geschwister den Blick ganz weit zurück wagen, um nach vorne schauen und das letzte Stück des Weges gemeinsam gehen zu können.
Vita
Anselm Neft, geboren 1973 in Bonn, studierte Vergleichende Religionswissenschaft, Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde sowie Philosophie. Danach arbeitete er als Tellerwäscher, Unternehmensberater und Deutschlehrer und tourte für zwei Jahre mit einer Mittelalter-Rockband. Er publiziert u.a. in der «ZEIT» und hat zuletzt den Roman «Vom Licht» veröffentlicht. Seit 2016 lebt er in Hamburg, wo er Mitglied der Lesebühne «Liebe für alle» ist. 2018 las er auf Einladung von Nora Gomringer bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tom Barrett on Unsplash
ISBN 978-3-644-00940-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
August
1. Kapitel
Sie fühlt sich leicht. Ein warmer Wind hüllt sie ein, trägt sie und lässt ihre Füße durch das Gras am Ufer des Flusses gleiten. Auf der anderen Seite warten ihre Leute. Und hier ist der Tiger. Sie ist ein Kind, nackt und glücklich. Sie krallt sich in das gestreifte Fell und fühlt die Muskeln. Er ist ihr Freund. Er wird sie hinübertragen. Es ist schön hier unter der Sonne und über dem Wasser. Das ist sie. Das sind ihre Beine, mit denen sie sich auf den starken Rücken schwingt, das ist ihre Haut, die in der Sonne leuchtet, das sind ihre Leute, die drüben auf sie warten, und das ist ihr Lachen, das der Wind in die Welt trägt.
Sie liegt in einem Bett und spürt immer noch, wie Leichtigkeit ihre Brust füllt, ihre Beine und Füße. Sie könnte ewig hier liegen und sich ohne Gier satt atmen. Sie könnte weiteratmen oder damit aufhören. In diesem Moment wird sie schwerer. Noch bevor ihr der Gedanke bewusst wird, fühlt sie, wie sich ihre Brust zusammenschnürt: Du hörst bald auf zu atmen. Du wirst sterben.
Schon früher hat Sophia manchmal diesen Gedanken gehabt, nachts. Der Tod. Wie kann das sein? Jetzt aber ist aus einem flüchtigen Bekannten ein Begleiter geworden, der im Laufe des Tages immer wieder schwer die Arme um sie legt, ihr die Luft abpresst, bis sich die Gedanken in Panik verengen, und dann plötzlich den Griff lockert, nur um die nächste Umarmung vorzubereiten.
Sie hat die Diagnose vor sechzehn Tagen bekommen. Unfassbar, dass es so etwas gibt, dass die Medizin nichts tun kann, nichts, außer betreten gucken und leise sagen, in diesem fortgeschrittenen Stadium seien das bestenfalls noch neun Monate.
Neun Monate, eine Schwangerschaft lang hat sie Zeit, um sich auf ihr Ende vorzubereiten. Bestenfalls. Sie denkt an Julika, und in die Schwere mischen sich heillose Trauer und das Gefühl, nicht zu genügen, nicht genügt zu haben und in Zukunft erst recht nicht mehr genügen zu können. Was kann eine Mutter ihrem Kind Schlimmeres antun, als zu sterben? Sophia kann sich wieder und wieder sagen, dass es nicht ihre Schuld ist, wenn Zellen bösartig in ihr wuchern. Aber die Schuldgefühle hören nicht auf Sophia. Sie denkt an den Traum zurück, das freie, schwebende Gefühl, ein Kind zu sein, keine Frau sein zu müssen.
Erst jetzt nimmt sie den Körper neben sich wahr: Marcel, der selbst im Schlaf nicht schutzbedürftig, sondern zufrieden wirkt. Natürlich hätte sie ihm gleich von der Diagnose berichten müssen, jeden Tag denkt sie mehrmals daran, aber sie hat ihm ja noch nicht einmal erzählt, dass sie zum Arzt geht. Neulich hat er im Plauderton bemerkt, sie sehe in der letzten Zeit ein wenig gelbstichig aus, ein richtiges Rembrandt-Gelb sei das, ob sie anders esse, andere Kosmetik benutze, oder ob es nur das Licht sei, sicher sei es nur das Licht.
Da liegt er und atmet und träumt wahrscheinlich von Dingen, die ihn stärker und erfolgreicher machen. Sophia denkt, dass sie sich gerade jetzt ein bisschen mehr an Marcel orientieren sollte, an seinem Glauben, durch und durch berechtigt zu sein und das Beste verdient zu haben. Aber es gelingt ihr immer weniger. Zunehmend blickt sie auf ihr Leben wie auf einen lange Zeit kaum beachteten Raum, in dem nun plötzlich zum ersten Mal das Licht brennt. Jetzt zeigen sich Einrichtungsgegenstände, von denen sie sich die wenigsten ausgesucht hat. Manche sind nichts als Gerümpel, das andere hier gelagert haben.
Seine Hand tastet nach ihr. Julika übernachtet bei Emily. Sophia wird nervös. Die Hand tastet nicht fragend, sondern zielstrebig, sie tastet vom Oberschenkel zur Hüfte, von dort zum Bauch, kurz oberhalb der Scham. Dann wandert die Hand tiefer und verharrt zwischen ihren Beinen. Sophia weiß, wie es weitergehen wird, und sie überlegt, ob sie die Kraft hat, sein Drängen abzuwehren und die Schuldgefühle danach zu ertragen. Je früher sie «nein» sagt, desto besser, weiß Sophia, aber sie ist noch zu sehr gefangen zwischen der Leichtigkeit ihres Traums und der Schwere ihrer wachen Gedanken. Und sie hat schon so viele Kompromisse gemacht, dass es auf einen mehr nicht ankommt.
Er dreht sie zu sich und streichelt mit der anderen Hand ihren Rücken, großflächig und fest. Es ist neun Uhr morgens, er hat eine Erektion und lächelt sie an. Sie fragt sich, ob sie sich auch freuen sollte. In der Regel hat Marcel keine Lust mehr, vielleicht weil sie älter und nun obendrein auch gelb wird und die Geschichte ihrer gemeinsamen Lust zu Ende erzählt ist.
Sophia ist so sehr damit beschäftigt, sich zu fragen, warum sie nicht «nein» sagen kann, dass sie nicht «nein» sagen kann. Die Phase des Küssens hält sie kurz, indem sie Marcel zu ihren Brüsten lenkt. Sein Kneten ist nicht unangenehm. Sie stöhnt zweimal ermunternd. Ansonsten macht sie ab jetzt nicht mehr viel. Das ist für ihn völlig in Ordnung, er weiß schließlich, was er will, er hat ein Konzept, das kennt sie und es beruhigt sie, denn darauf ist Verlass. Im weiteren Verlauf fühlt sie sich durch sein Begehren ein wenig erregt. Seine Lust hilft ihr dabei, von ihrem eigenen Körper angetan zu sein – ein schönes Gefühl. Und wie viele Paare haben nach siebzehn Jahren noch Sex? Was sie nicht mag, ist der Part, bei dem sie sich in die Augen sehen. Sie vermutet, dass ihm dieser Blickkontakt wichtig ist, um auszudrücken, dass er es persönlich meint, du und ich, das soll dieser Blick sagen, und das stört sie. Weil sie nicht weiß, was sie sonst tun soll, lächelt sie, er lächelt zurück. Sie schließt die Augen und stöhnt genießerisch. Sie versucht, sich hinzugeben, dabei muss sie beinahe lachen, so absurd erscheint ihr die Situation in einem grellen, aber sofort wieder verblassenden Augenblick. Das in ihrem Inneren sprudelnde Lachen versiegt, bevor es wirklich aufsteigen konnte, und sie fragt sich jetzt wieder einmal, warum sie es Marcel nicht sagt. Je länger sie es aufschiebt, desto weniger kann sie sich vorstellen, mit ihm ein Gespräch über ihr Ende zu führen. Auch Thomas hat sie bisher nichts gesagt, auch wenn er der Mensch ist, dem sie sich neben Julika am nächsten fühlt. Kaum jemand kennt sie so gut wie ihr Zwillingsbruder. Heute Abend wird sie ihn sehen, und sie wird versuchen, von sich zu erzählen. Sie muss ihn um etwas bitten, das ihr gleichzeitig anmaßend und richtig erscheint. Auch wenn niemand in Thomas einen guten Vater vermuten würde – am wenigsten er selbst: Sophia will, dass er sich nach ihrem Tod das Sorgerecht mit Marcel teilt. Schließlich ist da auch noch Katrin. Vielleicht wird Thomas sie dann endlich heiraten. Ein solches Arrangement würde allen guttun. Auf keinen Fall kann sie Julika Marcel allein überlassen. Er würde es zwar nie so sehen, aber Vaterschaft ist für ihn auch nach neun Jahren noch etwas Abstraktes, eine Behauptung. Und seine Eltern sind erst recht keine Alternative. Julika soll nicht bei ihnen aufwachsen. Den Gedanken erträgt Sophia kaum.
Ein klatschendes Geräusch reißt sie aus ihrem entrückten Zustand. Marcel hat ihr mit der Hand locker auf die rechte Hüfte geschlagen. Jetzt ist es an der Zeit, sich umzudrehen.
Ein paar Minuten später küsst er sie auf die Stirn. Er liegt noch ein wenig neben ihr, und sie fragt sich, ob er das als eine romantische Schuldigkeit betrachtet, während seine Gedanken schon bei der Arbeit sind, dann fragt sie sich, ob sie sich das zum ersten Mal fragt oder ob sie schon früher solche Gedanken zugelassen hat.
«Ich muss mal langsam los», sagt er in die Stille. «Du kannst den Audi nehmen.»
«Danke», sagt sie, weil sie weiß, dass es für Marcel ein Opfer bedeutet, in den nächsten Tagen mit ihrem Mini Cooper zu fahren, dem «Mädchenauto».
Kurz darauf hört sie Wasser aus dem Duschkopf auf seinen verschwitzten, gebräunten Körper aufschlagen. Er hat die Tür zum Bad offen gelassen. Er pfeift.
Erst ist Sophia erleichtert, als Marcel die Haustür hinter sich schließt. Dann merkt sie, dass er sie abgelenkt hat. Es wäre tatsächlich einfacher für sie, gleich jetzt noch einmal mit ihm Sex zu haben, als mit ihrem neuen Begleiter allein zu sein. Sie hat Angst vor der langen Autofahrt, stillsitzend und allem ausgeliefert, was in ihr aufsteigt.
Sophia ballt eine Hand zur Faust. Sie muss sich jetzt zusammenreißen. Sie muss taktisch durch den Tag gehen, ihn in kleine, überschaubare Einheiten unterteilen, sich auf den jeweils nächsten Schritt fokussieren, als würde sie auf einem sehr langen, schmalen Brett über einen Abgrund balancieren. Wenn sie eine Eigenschaft an sich schätzt, dann ist es ihre Disziplin. Bisher hat sie es immer geschafft, zu tun, was getan werden muss.
Der Hamburger Verkehr fordert ihre Aufmerksamkeit ausreichend, als sie aber schließlich über das gerade Band der Autobahn fährt, beginnen ihre Gedanken wieder zu kreisen. In ihrem Magen und ihrer Brust zieht sich etwas zusammen. Sie weiß, dass sie tief atmen muss, um es nicht schlimmer werden zu lassen. «Reiß dich zusammen», sagt sie und stellt fest, dass sie die drei Worte tatsächlich laut ausgesprochen hat. Sie passen gut zu dem Gefühl in ihren Eingeweiden und in ihrer Brustmitte. Ihre Gedanken ziehen die immer gleichen Schleifen um Julika. Natürlich ist die ein eigenständiger, von ihr getrennter Mensch, aber irgendwie ist sie das auch nicht, es gibt eine Verbindung zwischen ihnen, die sie am ehesten mit ihrer Verbindung zu Thomas vergleichen kann, früher, als sie noch Kinder gewesen sind: zwei Körper, aber eine Identität, die versucht, sich zu teilen, und doch immer wieder zusammenfließt. Was den einen Zwilling betrifft, betrifft auch den anderen, ein gemeinsamer Organismus erlebt die Schmerzen und Freuden, die Triumphe und Niederlagen. Sophia hat es an ihrer Mutter gehasst, dass sie das Leiden ihrer Kinder immer nur zum Anlass genommen hat, ihr eigenes Leiden zu spüren, und auf deren Leistungen stolz war, als hätte sie selbst etwas geleistet. Aber war das wirklich etwas anderes gewesen als die Verflechtung, die sie zwischen sich und Julika wahrnimmt?
Das Aufblenden einer Lichthupe holt sie zurück in den Sitz ihres Autos. Der Wagen hinter ihr fährt dicht auf. Der Fahrer wischt mit einer Hand vor seinem Gesicht, dann schlägt er sich gegen die Stirn. Sie fährt schon länger mit 100 auf der mittleren Spur. Das ist zu langsam. Sie muss rüber nach rechts zu den lahmen Enten, obwohl sie in einem Audi A8 sitzt. Sie betätigt den Blinker, aber noch bevor sie die Spur wechseln kann, zieht der Wagen hinter ihr in einem ruppigen Manöver nach links und braust an ihr vorbei. Der Fahrer guckt zu ihr herüber, sein Gesichtsausdruck wirkt plötzlich weniger wütend.
Sophia fühlt sich wie aufgeweckt. Für einen Moment kommt es ihr so vor, als sähe sie die Fahrbahnen wie aus der Draufsicht, ganz dreidimensional. Es ist, als enthüllte sich ihr die Autobahn zum ersten Mal als soziale Plastik.
Dann muss sie wieder an Julika denken. Sophia wird es nicht erleben, dass ihre Tochter den Führerschein macht, sie wird nicht auf dem Beifahrersitz sitzen und sich von ihr fahren lassen. Sie wird nicht dabei sein, wie Julika ihr Abitur besteht, volljährig wird, eine große Party zu ihrem achtzehnten Geburtstag feiert, vielleicht für eine Zeit ins Ausland geht. Es ist so, als ob Julika sterben würde, nicht sie, das macht aus Sophias Perspektive in diesem Augenblick keinen Unterschied.
Nun muss sie doch rechts ranfahren, die Blinkanlage anstellen. Jemand hupt. Sie hat wieder etwas falsch gemacht. Sie sitzt, krümmt sich und umklammert das Lenkrad. Der Druck in ihrer Brust lockert sich, ihr Magen wird weit. Das Weinen tut gut, danach ist sie ausgelaugt. Sie ist noch nicht einmal bei Bremen und möchte nur noch schlafen, Arm in Arm mit Julika, egal, wer wen mehr braucht, egal, ob sie eine gute Mutter ist oder nur ein trauriger, bedürftiger Mensch.
Sie fährt zur nächsten Autobahnraststätte, parkt und wählt die Nummer von Marcels Eltern. Es tutet dreimal an ihrem Ohr, dann hört sie ganz unvermittelt und sonderbar nah die Stimme von Marcels Mutter, ein fragendes «Hövermann?».
«Hier ist Sophia.»
Marcels Mutter schweigt kurz, so als sei sie verblüfft, dann redet sie viel. Ob Sophia schon in Bonn sei? Sie habe ja erst heute Nachmittag mit ihrem Anruf gerechnet. Ob etwas passiert sei, bei ihnen sei alles gut, sie müsse sich keine Sorgen machen, und vielleicht sei es gar nicht so gut, wenn sie Julika jetzt aufscheuche, sie lebe sich ja gerade ein. Das Mädchen sei mit seinen Gedanken doch ganz im Hier und Jetzt, da müsse man es nicht gleich aufscheuchen, Julika neige ja leider zu Heimweh und einer für das Alter ganz untypischen Anhänglichkeit an die Mutter. Umso schlimmer, wenn sie dann aufgescheucht werde.
Sophia konzentriert sich darauf, die aufwallenden Gefühle in sich zu verschließen und weder geräuschvoll auszuatmen noch zu stöhnen oder laut zu werden. Wenn Marcels Mutter noch einmal das Wort «aufscheuchen» benutzt, wird sie sich vielleicht nicht mehr zusammenreißen können.
«Ich habe Sehnsucht nach Julika», sagt sie und ärgert sich sofort über ihre Ehrlichkeit.
«Ich will dir ja nicht reinreden, aber du solltest sie jetzt mal lassen.»
«Da hast du recht», sagt Sophia. «Gibst du sie mir jetzt?»
«Ich weiß ja gar nicht, wo sie ist. Bist du denn schon in Bonn? Willst du denn nicht erst mal nach Bonn fahren?»
«Ruf sie doch mal.»
«Also», Marcels Mutter räuspert sich. «Ich brülle hier jetzt nicht durchs ganze Haus. Sicher ist sie im Garten. Wenn es so wichtig ist, gehe ich gerne die Treppen runter und über die Terrasse in den Garten und hole sie.»
«Ja, das wäre ganz lieb.» Sophia massiert sich mit der freien Hand eine Schläfe.
«Ist denn etwas passiert?»
«Nein, Christa, alles in Ordnung.»
«Dann weiß ich wirklich nicht … Aber bitte, ich gehe sie holen. Kann jetzt nur etwas dauern.»
«Kein Problem.»
Sophia hört Marcels Mutter in langsamen, rhythmisch versetzten Schritten die Treppenstufen hinuntergehen, das tragbare Telefon scheint gegen ihr Bein zu schlagen, dennoch kann Sophia auch das Schnaufen der alten Frau hören. Sophia fragt sich, ob ihre Schwiegermutter sie immer schon derart angestrengt hat und sie es jetzt bloß zum ersten Mal so richtig bemerkt. Gleich nach dem ersten Besuch muss Sophia einen Filter über ihre eigene Wahrnehmung gelegt haben.
Es dauert ewig, bis Christa im Garten ist und Julika das Telefon gibt mit den Worten «Deine Mutter will dich unbedingt sprechen».
«Hallo Mama», ruft Julika aufgedreht ins Telefon. Ihr geht es gut.
«Ich will dich nur mal kurz aufscheuchen», sagt Sophia. Julika macht ein glucksendes Geräusch und erzählt dann ansatzlos davon, wie sie mit dem Opa eine Tränke für Igel und Eichhörnchen gebaut und ganz dicke Pflaumen geerntet hat. Die seien rund, die länglichen Dinger hießen Zwetschgen. Ob sie das überhaupt wüsste?
Ich liebe dich, denkt Sophia, dann ermahnt sie sich, nicht sentimental zu werden. Sie lässt sich alles ganz genau von Julika erzählen und verspricht, dass sie ihr aus dem Haus in Bonn etwas mitbringen wird, eine Überraschung, ein Einhorn werde es aber wohl nicht sein, Einhörner habe die Bonner Oma nicht im Sortiment gehabt.
«Vielleicht schaust du mal im Garten?», sagt Julika. «Man kann nie wissen!»
Sophia möchte genau so ein Gespräch weiterführen, aber plötzlich dringt wieder die kratzige Stimme von Marcels Mutter an ihr Ohr: «So, hier gibt es jetzt gleich Mittagessen. Ruf doch noch mal kurz durch, wenn du hoffentlich heil angekommen bist.»
«Ja, ich ruf durch!», sagt Sophia und weiß, dass Marcels Mutter die Persiflage nicht versteht. Julika ruft laut im Hintergrund: «Ich hab dich lieb, Mama.»
«Jaja, deine Mama dich auch», sagt Christa und beschließt mit einem «also dann» das Gespräch.
Sophia fühlt sich plötzlich sehr dünn. Sie fährt ein Stück weiter, parkt den Audi erneut und geht dann, obwohl sie keinen Hunger hat, die Stufen zu einer McDonald’s-Filiale hinauf. Am Verkaufstresen drängt sich ihr der Gedanke auf, neben Pommes frites und Cola auch einen Big Mac zu bestellen, aber als sie angesprochen wird, fragt sie nach einem veganen Burger. Seit zwanzig Jahren hat sie kein Fleisch gegessen, noch nicht einmal bei den Hövermanns, obwohl es Marcels Mutter jahrelang große Schwierigkeiten bereitet hat, für Sophia das Fleisch und den Speck wegzulassen aus den Soßen, Suppen, Salaten. Jahrelang wurde Sophia vor den Mahlzeiten gefragt: «Bist du immer noch vegetarisch?» Und Marcel hat verlässlich den Witz wiederholt: «Nein, Sophia ist aus Fleisch. Sie isst es nur nicht.»
Sie kann sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal bei McDonald’s gewesen ist, diesem bunten Proletenbistro, für das sich Julika erfreulicherweise nie interessiert hat. Die Inneneinrichtung wirkt moderner, als Sophia gedacht hätte, die Tische, Stühle und Lampen könnten von Ikea sein, generische Kopien hochwertigen skandinavischen Designs. Sie setzt sich mit ihrem Tablett an einen freien Tisch, als wäre sie ein Tier, das Beute in Sicherheit bringt. Nicht weit von ihr hocken eine sehr dicke junge Frau und ein sehr dünner junger Mann in rundum schwarzer Kleidung und essen still und mit ausdruckslosen Gesichtern. Die Frau nimmt jede Pommesstange einzeln zwischen Daumen und Zeigefinger und knabbert damenhaft daran. Der Mann beißt kraftvoll und über das Tablett gebeugt in seinen Burger. Sophia versucht, ihren Burger ebenfalls damenhaft zu essen, aber es macht keinen Spaß, man muss ihn mit beiden Händen halten wie der dünne Mann, sich vorbeugen und voll reinbeißen. Das Ding schmeckt trotzdem nicht besonders gut.
Es ist bescheuert: Da frisst ihr der Krebs die Energie aus dem Leib, aber sie hat keinerlei Antrieb, sich jetzt erst recht mit Nahrung zu stärken. Auch Alkohol schmeckt ihr nicht mehr, ihr wird schon von kleinen Mengen übel. Nach der Hälfte des Burgers klumpt der süßliche Brei unangenehm in ihrem Mund. Sie zwingt sich noch zu einem weiteren Bissen, einer Handvoll Pommes frites und zwei Schlucken Cola, dann trägt sie das Tablett zur Ablage. Mit dem Gefühl einer Niederlage verlässt sie das Schnellrestaurant.
Schließlich, am Ende einer anstrengenden, sich mehr und mehr hinziehenden Fahrt durch gleichförmige Landschaften und extreme, die Zeit dehnende Gefühle, fährt sie die Kurven zum Venusberg hinauf. Es ist heiß, sie hat Durst, und plötzlich muss sie an die letzten Tage ihrer Mutter denken: den heißen Mai, die Fahrten zum Krankenhaus und zurück zum Haus der Eltern, diese Straße hier hinab und hinauf. Die Gespräche mit ihren Brüdern, das Schreiben Dutzender Karten an das gesamte Adressbuch der Mutter, die Absprachen mit dem Bestattungsinstitut, die verantwortungsbewusste, umsichtige Tochter, die immer das Passende tut und sagt und dennoch von ihrer Mutter mit weniger Zuwendung bedacht wird als Lorenz, der auch während dieser Zeit des Abschieds nur halb anwesend wirkte, und Thomas, der sich kaum blicken ließ und der Mutter bei seinen seltenen Besuchen im Krankenhaus noch als Fragen verkleidete Vorwürfe machte: Warum sie sich nicht von dem Alkoholiker getrennt, warum sie ihre Kinder dieser Bedrohung ausgesetzt habe, was eine Frau eigentlich dazu bewegt, den größten Teil ihres Lebens mit einem solchen Mann zu verbringen?
Während Sophia die Mutter nach solchen Attacken tröstete, ihr vorlas und still und fleißig im Hintergrund alles Nötige organisierte, beschwerte Thomas sich noch bei ihr, wie sehr die Mutter ihn mit ihrer Pseudoliebe zu erpressen versuche. «Ich habe dich sehr lieb» – das habe sie doch nur gesagt, damit er es erwidere, aber so laufe das nicht. Sophia sagte nichts zu diesen Tiraden, sie sah Thomas nur stumm an und spürte einen sich unter der linken Brust ausbreitenden Schmerz. Was hat Thomas besser gemacht als sie? Wie kann es sein, dass er so viel bekommt und so wenig gibt?
Der Blick auf die große Wiese und den nahen Wald beruhigt sie auch diesmal. Sie parkt den Audi unmittelbar vor der Garage. Das Innere des Hauses hingegen kommt ihr seit dem Tod ihrer Mutter noch bedrückender und gespenstischer vor: so viele dunkle Möbel, halb verstellte Räume, Ansammlungen von überflüssigen Gegenständen, eine schwere, volle, braunstichige Atmosphäre, der beengende Geschmack der Kriegsgeneration, die materialisierte Sehnsucht nach Trutzburgen voller Vorräte und Verstecke. Sophia geht von einem Zimmer zum anderen und sieht die weißen Post-it-Zettel, die Lorenz an Bücher, Möbel oder Bilder geklebt hat. Auf dem Esstisch liegt eine handschriftliche Nachricht von ihm:
Hätte gerne die markierten Objekte. Was mit dem Rest passiert, entscheidet bitte ihr. Bin in den nächsten Tagen voll eingespannt: Sommergeschäft läuft auf Hochtouren.
Gruß
Lorenz
Amüsiert registriert Sophia, dass Lorenz vor allem die Objekte beklebt hat, die einen gewissen Marktwert ausstrahlen: zwei kleine bronzene Jugendstilstatuetten, das Midcentury-Modern-Sideboard aus Teakholz, die alte Goethe-Gesamtausgabe, der Deckenleuchter im Wohnzimmer mit den acht weißen Lampenschirmen, die wie überdimensionierte Teelichter aussehen. Tatsächlich hat Lorenz auch einen Zettel auf den Blüthner-Flügel geklebt, obwohl er selbst gerade mal ein Jahr Klavierunterricht durchstand, bevor die Eltern ein Einsehen mit dem Jungen hatten. Sophia hingegen hat jahrelang Unterricht genommen und spielt auch heute noch manchmal auf dem Klavier in ihrem Haus in Harvestehude, genau wie Julika, die sicher mehr Talent hat als Lorenz und allein deshalb mehr mit dem Flügel anfangen könnte. Was Lorenz braucht, ist jede Menge Geld, damit er seinen Plan oder eher noch den seiner Frau umsetzen und als neuer Eigentümer ins Elternhaus ziehen kann. Ersten Schätzungen zufolge sind Haus und Grundstück rund 750000 wert. Wenn Lorenz Thomas und sie ausbezahlen will, müsste er ihnen jeweils etwa 250000 Euro geben. Da wird er wohl mit seinen Post-it-Objekten nicht hinkommen, denkt Sophia.
Die Sommerhitze staut sich in den Räumen. Staubkörner schweben durch das Zwielicht. Sophia macht sich einen Salat und trinkt eine Apfelschorle. Es ist still. Sie vermisst Julika. Sie wartet auf ihren Bruder. Das Alleinsein bedrückt sie. Als sie den Fernseher anschaltet, erhält sie eine Nachricht von Thomas. Sie hätte es sich denken können: Er kommt mal wieder später.
2. Kapitel
Thomas steigt aus dem Zug. Die Leute im gelbstichigen Ambiente des Provinzbahnhofs erscheinen ihm wie die Figuren eines Computerspiels. Gereizt bewegt er sich durch den Parcours aus menschlichen Hindernissen. Seine abgewetzte schwarze Reisetasche trägt er über der linken Schulter. Ein kleiner, breiter Typ mit Baseballkappe spielt das «Ich weiche keinen Zentimeter zur Seite»-Spiel. Thomas rempelt gegen seine Schulter, hört das mehr verblüffte als wütende «Ey, du Wichser», überlegt kurz, ob er sich umdrehen soll, sagt dann aber nur mit halb gedrehtem Kopf: «Oh, sorry!», und geht weiter, während das Blut heißer und schneller durch seine Adern rauscht.
Wenige Meter von ihm entfernt bewegt sich eine hagere, langhaarige Frau wie ein großer Vogel in zugleich eckigen und hüpfenden Bewegungen über den Bahnsteig. Sie trägt einen kleinen, schlaffen Rucksack, an dem eine Stoffmaus baumelt, als hätte die sich dort erhängt. Die Frau bleibt vor einem Mann stehen, spricht ihn an und federt dabei unruhig in den Knien. Der Mann dreht den Kopf kurz nach links und wieder zurück, und schon geht die Frau weiter.
Thomas bleibt stehen. Das heiße Gefühl im Nacken, die Vorstellung, dass der Typ mit der Baseballkappe von hinten angreift, ist verschwunden. Vor ein paar Monaten hat Thomas einen Artikel über die Verbreitung von Crystal Meth in der ostdeutschen Grenzregion zu Tschechien geschrieben. Natürlich bringen Geschäftsleute das Produkt längst auch nach Bonn. Thomas fühlt sich zwischen Gefühlen eingeklemmt: Die Frau tut ihm leid, und sie widert ihn an. Er zieht sein Portemonnaie aus der Tasche, gleich wird sie bei ihm sein. Er nickt ihr freundlich zu, schaut in seine Brieftasche, blickt wieder hoch zu ihr: Ihr Alter ist schwer einzuschätzen, unter vierzig wahrscheinlich. Ihr Blick ist vertrocknet, die Mundwinkel wirken wie ins graue Fleisch geschnitzt.
«Hast du mal ’n kleine Spende?», leiert sie. Thomas nickt, nimmt ein Zwei-Euro-Stück aus seinem Portemonnaie, kleiner hat er es nicht, und ärgert sich kurz darüber. Dann entscheidet er sich für ein aufmunterndes Lächeln und gibt der Frau das Geldstück. Sie bemüht sich, nicht zu hastig danach zu greifen. Er sieht in ihre Augen, aber der Blick der Frau gleitet ab.
«Danke», sagt sie wie ein Kind, das gerade Danke sagen lernt, und geht in ihrem sonderbar federnden Gang weiter. Thomas fühlt sich schuldig. Er fragt sich, ob er nur Geld gibt, um sich etwas weniger schuldig zu fühlen. Er hält es nicht für normal, dass Menschen um ihn herum in Not sind und er weitergeht, als ob nichts wäre, als ob ihn das nichts anginge. Geht es ihn etwas an? Man müsste die Frau packen und in ein Krankenhaus bringen. Sie bräuchte einen stationären Entzug, vier Wochen lang, und danach ein verlässliches Umfeld. Sie bräuchte jahrelang Zuwendung, Struktur und Aufrichtigkeit, so lange, bis neue Pfade in ihrem Gehirn entstanden sind und die Sucht zu einem bösen Traum aus der Vergangenheit verblasst. Und selbst dann bliebe sie wahrscheinlich weiterhin labil, verletzbar, leicht zu verunsichern und voller Bedürftigkeit. Aber es wird sich ohnehin niemand darum kümmern. Warum fühlt er sich zuständig und gleichzeitig abgestoßen? Er weiß, dass die Antwort nichts mit der Frau zu tun hat, die er bald vergessen haben wird.
Thomas denkt an seine Mutter, an ihr bettelndes «Ich habe dich sehr lieb!» vor drei Monaten auf dem Krankenbett, das kurz darauf zu ihrem Totenbett wurde. Er denkt an die weiße Mutterhand, über deren Rücken sich violette Adern ziehen.
Er tritt aus dem Bahnhofsgebäude und geht über die Straße in die Fußgängerzone. Das Stadtbild wirkt enger als früher, irgendwie verbaut. Die gleichen Läden wie überall: Back-Factory, Starbucks, H&M, O2, Burger King. Und das Volk auf der Straße sieht bei jedem Besuch in der alten Heimat prolliger aus. Er registriert die vielen Dunkelhäutigen. Menschen mit Migrationshintergrund, denkt er. Ihm sind seine Gedanken peinlich. Schon lange, bevor er einen Begriff wie «politische Korrektheit» kannte, hat er sich beim Denken beobachtet. Neu ist dieser Gedanke: Es sind tatsächlich so viele Menschen hier zu sehen, die erkennbar nicht aus seinem Kulturkreis stammen, und es ist ihm nicht gleichgültig. Natürlich sieht er sich weiterhin als links, er hat auch noch Sympathien für linksradikale Gedanken und steht zu seiner Zeit bei der Antifa. Aber jetzt in diesem Augenblick, aufgeraut durch Schuldgefühle, das Gesicht der Süchtigen und eine zermürbende Zugfahrt von Berlin nach Bonn, während deren er ständig auf sein Smartphone geguckt hat, ohne dass eine einzige Nachricht von Rabea gekommen wäre, jetzt empfindet er die vielen anders aussehenden Menschen tatsächlich als befremdlich.
Er ist wirklich in keiner guten Verfassung. So sollte er nicht zum Haus fahren, seiner Schwester gegenübertreten, sich dieser ganzen Familienenergie aussetzen. Er geht, bis er vor einer Trinker-Kneipe stehen bleibt. Auf dem Weg hat er mehrmals dem Drang widerstanden, auf sein Smartphone zu sehen, mehrmals hat er ihm allerdings auch nachgegeben. Keine Nachricht von Rabea.
Die Zwischenstation kommt ihm gerade recht. Zwei, drei Bier, und es wird ihm besser gehen. Er tritt in das halbdunkle, muffige Innere und atmet einmal tief ein. Hier wird tatsächlich noch geraucht. Es ist kurz vor acht, aber der Ort gibt ihm sofort das Gefühl, es könnte auch elf Uhr morgens oder um drei in der Nacht sein. Aus den Boxen einer silbernen Kompaktanlage mit rot leuchtenden Lämpchen tönt leise ein Song der späten Scorpions, irgendetwas mit Streichern. Weiter hinten im Raum sitzt ein Mann in Lederjacke auf einem Hocker vor einem Spielautomaten, raucht und drückt auf Tasten.
Thomas setzt sich an das kurze Ende des Tresens, der in seiner Form ein U mit sehr kurzen Aufwärtsbögen darstellt. An der Längsseite stehen zwei Männer neben ihren Hockern und sprechen in der lauten Dringlichkeit der frisch Berauschten. Vermutlich sind sie nur unwesentlich älter als er, und doch gehören sie für ihn mit ihren Oberhemden und bequemen Herrenschuhen in eine ganz andere Generation. Hinter dem Tresen steht eine braunhaarige Frau von vielleicht Mitte dreißig in einem schwarzen T-Shirt, ihre Arme sind braun und muskulös. Sie lächelt ihn an, als müsse sie sich vor ihm für die Kneipe und ihre Gäste entschuldigen. Dankbar für diesen Moment wortloser Übereinkunft lächelt Thomas zurück und bestellt ein Bier. Die Männer beäugen ihn kurz, dann unterhalten sie sich weiter. Sie sprechen darüber, warum noch immer Menschen im Mittelmeer ertrinken.
Thomas lauscht dem Gespräch, während er auf sein Smartphone guckt und den ersten Schluck des frisch gezapften Bieres nimmt, der kühl durch den knisternden Schaum schwappt. Ihn fasziniert, wie die Männer es schaffen, immer einer Meinung zu sein und gleichzeitig die Atmosphäre eines gewichtigen Konfliktes zu erzeugen. Er kennt das aus den Redaktionen. Man sitzt im Büro und verfasst Artikel über das Pro und Contra der privaten Seenotrettung, dann geht man in die Kantine und isst Tilapia mit Wokgemüse. Vielleicht regt man sich dort noch ein wenig über einen Kollegen auf, der es anders sieht als man selbst, aber eigentlich ist es Entertainment. In manchen Momenten träumt man davon, wirklich etwas zu tun und mit einem Rettungsschiff in See zu stechen oder in Afrika irgendetwas Bleibendes aufzubauen, so wie man als Junge davon geträumt hat, Robin Hood zu sein.
«Noch ein Bier?», fragt die Frau hinter der Theke, als Thomas gerade sein leer getrunkenes Glas abstellt. Sie hat einen slawischen Akzent. Ihre Augen sind grün. Zwischen den Fingern hält sie eine brennende Zigarette. Thomas nickt. Er beginnt, sich wohlzufühlen, zündet sich selbst eine Zigarette an, lässt sie dann aber zur Hälfte im Aschenbecher abbrennen, weil er seinen Facebook-Account checkt und dort immerhin ein Like von Rabea findet, das noch keine zwei Stunden alt ist. Er hat den langen Artikel eines senegalesischen Intellektuellen über die «Krise der Menschenrechte» gepostet. Für derartige Textmengen gibt es erfahrungsgemäß nicht allzu viele hochgereckte Daumen, aber Rabea likt solche Postings nicht nur, sie liest sie auch komplett und gründlich und teilt sie, wenn sie mit dem Inhalt übereinstimmt. So etwas hat Katrin nie getan. Sie fand seine journalistische Arbeit gut und wichtig, so wie er es gut und wichtig findet, dass irgendjemand Sanitäranlagen baut. Details will er deswegen aber in der Regel nicht wissen.
Er bemerkt, dass ihn die Thekenfrau ansieht. Seit seine Mutter gestorben ist, scheint er eine stärkere Wirkung auf Frauen zu haben. Vielleicht, weil sich attraktive Frauen mehr für ihn interessieren, wenn er durch Fragen vereinnahmt ist, die nichts mit attraktiven Frauen zu tun haben. Aber natürlich ist das nur ein versponnener Biergedanke, denn tatsächlich wartet er ja ängstlich darauf, dass Rabea endlich zurückschreibt.
«Du kommst nicht aus Bonn, oder?» Die Thekenfrau steht plötzlich ziemlich dicht vor ihm. Ihre Augen blicken intelligent aus dem gebräunten, irgendwie ein wenig schiefen Gesicht.
«Nein, Berlin», sagt er sachlich.
«Sieht man irgendwie.»
Jetzt sollte er etwas Schlagfertiges sagen.
«Ich komme aber ursprünglich von hier», sagt er humorlos. «Bonn-Röttgen.» Die Frau nickt.
«Und du?», fragt er in einem Tonfall, als ob es ihn eigentlich gar nicht interessieren würde.
«Bulgarien.»
«Von wo genau?»
«Aus der Nähe von Varna», sagt die Frau ruhig und freundlich. «Das ist …»
«Am Schwarzen Meer.»
«Genau.» Sie lächelt. «Sehr schön da. Dann habe ich einen Deutschen geheiratet.»
«Kann ja mal vorkommen», sagt er und fragt sich, ob er einen Ehering an der Hand der Frau gesehen hat. Als ob der Gedanke in Leuchtschrift auf seiner Stirn zu lesen stünde, stützt sich die Frau mit beiden ringlosen Händen auf der Theke ab und sieht ihn an.
«Nimmst du noch eins?», fragt sie. Er nickt. Kurz darauf betrachtet er ihre ringlose Hand, die den Zapfhahn sanft, aber bestimmt zu sich heranzieht. Thomas stellt sich vor, mit der Frau zu schlafen, ihre muskulösen Beine umklammern seinen unteren Rücken, ihre Fersen drücken sich in seine Pobacken, ihre Zunge schmeckt nach Rauch. Er denkt: Wenn ich Rabea wirklich lieben würde, dann hätte ich nicht solche Phantasien. Dann denkt er: So ein Quatsch. Die Gedanken, die immer gleichen Zweifel strengen ihn an.
«Hast du noch Familie hier?» Die Thekenfrau stellt das Glas vor ihm ab.
«Einen Bruder», sagt er. Dann erzählt er, dass neulich seine Mutter gestorben und neben seinem Vater beigesetzt worden ist. Er erzählt von dem Haus am Waldrand, das verkauft werden soll, von all den Sachen, die vorher aufgeteilt, verramscht, verschenkt oder weggeschmissen werden müssen. Deswegen komme heute auch seine Schwester aus Hamburg, seine Zwillingsschwester. Genau genommen sei sie längst da, und er müsse ihr jetzt mal schreiben.
Er nimmt sein Smartphone in die Hand und sieht, dass Rabea zwei Nachrichten geschickt hat:
Danke, OWM, kann deine Aufmunterung gut gebrauchen. Rock jetzt Röttgen!
Die zweite Nachricht besteht nur aus einem Emoji, das völlig verstrahlt lächelt. Kein «Kuss», nichts Verbindliches. Das mit dem «OWM», dem Old White Man, meint Rabea nur halb im Spaß, und sie weiß, dass es ihn ärgert. Er unterdrückt den Impuls, ihr sofort zu antworten, und textet stattdessen seiner Schwester, dass es später wird. Brauchst nicht auf mich zu warten.
«Und dein Bruder kommt auch?», fragt die Thekenfrau und schiebt sofort hinterher: «Ich bin sehr neugierig, ich weiß.»
«Mein Bruder ist ein Fall für sich», sagt er und merkt, dass er die Bulgarin nun tatsächlich neugierig gemacht hat. Sie sieht ihn mit einem intensiven, fast ein wenig unangenehmen Blick an, und er erzählt gerade so viel, dass es seinem Bruder gegenüber fair bleibt und Diskretion und Informationsgehalt eine stimmige Balance finden.
«Und in Berlin?», fragt die Thekenfrau schließlich. Sie scheint tatsächlich an ihm interessiert zu sein. Er schaut noch einmal auf ihre braunen Arme und die Brüste, die sich unter ihrem T-Shirt abzeichnen. Noch bevor er bewusst eine Antwort überlegt hat, hört er sich sagen: «Ich habe mich von meiner Freundin getrennt.» Jetzt könnte er hinzufügen, dass er es für eine andere getan hat und dass er sich davor fürchtet, es seiner Schwester zu sagen, weil die Exfreundin in den Augen seiner Schwester das Beste ist, was jemandem wie ihm passieren konnte, und weil die beiden Frauen miteinander befreundet sind und er sich ohnehin denken kann, was seine Schwester zu einer Neuen sagen wird, die achtzehn Jahre jünger ist. Damit würde er dem durchaus als Flirt zu verstehenden Gespräch allerdings eine Kummerkasten-Wendung verleihen. Er sagt also nur: «Nach fünf Jahren.»
Die Thekenfrau stemmt eine Hand in die Hüfte und zieht an ihrer Zigarette.
«Kinder?», fragt sie.
«Nein.» Er greift nach seinem Glas und trinkt einen langen Schluck. «Was ist mit dir?», fragt er, um nicht nur von sich zu reden, und bemerkt, wie das Leuchten in den Augen der Thekenfrau herunterdimmt. Vermutlich gehört es hier nicht zum Programm, dass die Gäste ihr Fragen stellen und sie über sich erzählt.
Sie wendet sich den beiden anderen Männern am Tresen zu und fragt, ob die «noch eins» wollen. Dann kommt sie zu ihm zurück, nimmt ihre Zigarette aus dem Aschenbecher und stützt sich mit den Ellbogen auf dem dunklen Holz des Tresens ab: «Also, ich arbeite in einer Kneipe.» Sie lächelt, beugt sich noch ein Stück weiter zu ihm und flüstert: «Ist manchmal ein bisschen langweilig.»
«Wann hast du denn heute Schluss?», fragt er.
«Um eins. Und dann muss ich noch sauber machen.»
Thomas hört aus diesen Worten weder eine Ermunterung noch eine Abwehr heraus. Es handelt sich einfach um eine Feststellung. Was er damit macht, muss er jetzt selbst entscheiden. In einer Fernsehserie gäbe es jetzt einen Schnitt, und man sähe zwei Menschen auf einem Bett ineinander verkeilt. In der Realität aber müsste er jetzt über vier Stunden hier ausharren und darauf achten, weder zu betrunken noch zu nüchtern zu werden. Anstatt etwas zu sagen, nimmt Thomas einen weiteren Schluck von seinem Bier. Die Thekenfrau wendet sich einem Neuankömmling zu, einem jungen Mann in Trainingsjacke, der nur Zigaretten kaufen will. Thomas nutzt den Moment, um eine Nachricht an Rabea