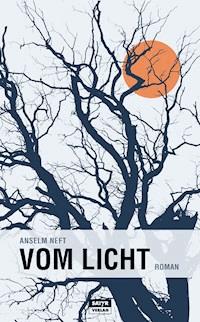
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aussteigerroman, radikale Reflexion und verstörende Familiengeschichte: "Vom Licht" ist eine literarische Herausforderung, die lange nachwirkt. In seinem neuen Roman gewährt Anselm Neft einen tiefen Einblick in fundamentalistisches Denken und den radikalen Kern des Christentums. Brisanter Stoff und exzellente Prosa. Adam ist 21 und ganz allein. In der Dachkammer eines entlegenen und verwilderten Selbstversorgerhofes im österreichischen Voralpenland schreibt er über sein bisheriges Leben: das abgeschottete Landleben ohne Schulbesuch, die religiöse Heimerziehung durch seine Zieheltern und seine innig geliebte, drei Jahre ältere Stiefschwester Manda. Durch seine Notizen versucht Adam zu verstehen, was mit seiner Familie geschehen ist, wie er der wurde, der er ist, und was er tun kann, um trotzdem weiterzuleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANSELM NEFT
VOM LICHT
ROMAN
ANSELM NEFT
schrieb bereits Hunderte von Satiren, Nachrufen, Kolumnen, Kurzgeschichten und Essays unter anderem für taz, Tagesspiegel, Welt, Titanic, Eulenspiegel, Das Magazin und Christ & Welt.
Er studierte Vergleichende Religionswissenschaften, schrieb seine Abschlussarbeit über zeitgenössischen Satanismus und legt mit »Vom Licht« nach »Hell« seinen zweiten Roman bei Satyr vor.
Weitere Veröffentlichungen: »Die Lebern der Anderen« (Ullstein: 2010) und »Helden in Schnabelschuhen« (Knaus: 2014).
Neft lebt in Hamburg, schreibt an seinem nächsten Roman und tritt monatlich mit der Lesebühne »Liebe für alle« auf.
E-Book-Ausgabe September 2016
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2016www.satyr-verlag.de
Cover: Maren Kaschner (www.goldenolivedesign.de)Korrektorat: Jan Freunscht
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbarüber: http://dnb.d-nb.de
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
eISBN: 978-3-944035-78-9
INHALT
Der Garten
Das Haus
Das Dorf
Das Unterrichtszimmer
Der See
Die Fabrik
Das Schlafzimmer
Die Sterne
1DER GARTEN
Ich begann in der äußersten nordöstlichen Ecke. Auf dem Weg von diesem Ausgangspunkt zu dem damit identischen Endpunkt wollte ich alle meine Schritte zählen, musste aber bald feststellen, dass ich nicht so weit zählen wie gehen konnte. Deshalb fragte ich Manda, ob sie mich begleiten und für mich zählen könne, und sie lachte und begleitete das Kind, das ich war. Mir steht das Sonnenlicht auf den Gartengewächsen vor Augen, ein Marienkäfer auf einem Blatt, Mandas braune Arme, meine dunkelroten Sandalen, in denen ich sorgsam die für mich riesige Fläche abschritt. Manda zählte laut mit. Irgendwann ließ sie mich stehen, um einen Block zu holen, auf dem sie Zwischenergebnisse notieren konnte. Das Weiß des Papiers strahlte weiß im Licht der Sonne.
Später erzählten wir Norea stolz, dass der Umfang unseres Gartens 422 Schritte betrage und wir Forscher seien. Norea sagte, dass sich Materie verändere. Nicht nur die Pflanzen seien einem ständigen Wandel unterworfen, sondern der ganze Garten und die Körper darin. Sie zeigte auf mich. Dann sagte sie, dass auch meine Schritte nicht immer von gleicher Länge seien. Wäre ich ein Forscher, so erklärte sie mir, dann würde ich ein möglichst exaktes Messinstrument nutzen und den Garten oft abgehen, vielleicht zwanzig oder dreißig Mal. Am Ende müsse ich den Durchschnitt aller notierten Zahlen ermitteln und hätte damit eine neue Zahl, die in den Augen eines Forschers dem tatsächlichen Umfang des Gartens am nächsten käme.
Ich wollte mich als Forscher betätigen und den Garten einunddreißig Mal abgehen. Manda hatte keine Lust mehr, mich zu begleiten, half mir aber dabei, meine Schritte zu vereinheitlichen, damit sie von möglichst gleicher Länge waren. Zunächst riet sie mir, Ferse an Fußspitze zu setzen, aber dafür fehlte mir der Gleichgewichtssinn. Die Idee, Stöcke als Stützen zu nutzen, kam uns ebenso wenig wie die, von vorneherein den Garten mit einem Stock oder Maßband abzumessen. Dabei hätten mir solche Gerätschaften bei einigen Hindernissen des Weges von Nutzen sein können: An einer Stelle musste ich behutsam den schmalen Raum zwischen Hecke und Bienenstöcken nutzen, an anderen hielten mich die Dornen der Brombeerhecken, und zweimal musste ich über das Gatter der Kuhweide steigen. Vermutlich hatte ich mir das anfängliche Abschreiten derart in den Kopf gesetzt, dass mir die naheliegende Idee, ein passenderes Messinstrument zu nutzen, einfach nicht in den Sinn kommen wollte, und womöglich hätte ich eher eine Schnur von Knöchel zu Knöchel gespannt, um meinen Schritt auf die stets gleiche Länge fixieren zu können, als von dem einmal gefassten Plan abzuweichen. Tatsächlich aber entwickelte ich mit Mandas Hilfe einen »Durchschnittsschritt«, den ich einübte und von dessen Genauigkeit wir beide zunehmend überzeugt waren.
Schließlich legte ich die Zahlen aller 31 Gartenumrundungen Valentin vor, und er half mir, den Durchschnittswert zu finden. Norea stand daneben und sagte, dass auf ähnliche Weise ein Großteil des Forscherwissens über die Materie gewonnen werde. Das Forscherwissen sei in der Regel ein aus der Erfahrung gewonnenes und dann durch Wiederholung oder Abgleich mit anderen Erfahrungen überprüftes Wissen. Damals verstand ich nicht, worauf sie hinauswollte, und freute mich über meine Beharrlichkeit und den herausgefundenen Durchschnitt von 423,5 Schritten, einer Zahl, die für mich damals nicht lediglich so nahe an der Realität lag wie möglich, sondern den wahren Umfang des Gartens exakt wiedergab.
Es muss kurz danach gewesen sein, als ich anfing, Worte in ihre Silben zu zerlegen. Besonders hatten es mir dabei die Bezeichnungen der Kräuter angetan, die in einem Beet in der Nähe des Eingangstors wuchsen. Als ich einmal mit Manda dort stand – vermutlich waren wir zum Ernten dieser und jener Kräuter geschickt worden –, rupfte ich die Bezeichnungen auseinander: »Boh-nen-kraut« und »Ba-si-li-kum« sagte ich immer wieder. Schließlich riefen wir auf übertriebene Weise »Senf« und »Küm-mel«, »Es-tra-gon«, »Knob-lauch« und »Peter-si-lie«, wobei mir Mandas beschwörendes »Sal-bei« und das alberne »Pim-pi-nel-le« besonderes Vergnügen bereiteten. Während Manda bald den Spaß an diesen Wiederholungen verlor, ging ich noch tagelang im Garten oder Haus herum und probierte Silben durch, bis ich Angst bekam, mit dem »Rosma-rin«- und »Sau-er-amp-fer«- und »Schnitt-lauch«- und »Thy-mi-an«- und »Meer-ret-tich«- und »Zi-tro-nen-me-lis-se«-Unsinn nicht mehr aufhören zu können.
Bis heute stehen in der südöstlichen Ecke und einem etwa zehn Meter langen Stück der Südseite unseres Grundstücks Sträucher, die im Sommer Brombeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren tragen, und obwohl mir Manda schon bald sagte, es sei nicht mehr lustig, musste ich bald auch diese Worte aufsagen, bis jedes einzelne davon seine Bedeutung verloren hatte. Allerdings tat ich es im Stillen oder wenn niemand in der Nähe zu sein schien, bis mich Manda einmal dabei ertappte, wie ich im Gras saß und »Halm, Halm, Halm« vor mich hin sagte.
»Jetzt ist aber Schluss«, sagte sie und nahm mich in die Arme und wiegte mich hin und her wie eine kaputte Standuhr, die auf diese Weise repariert werden konnte. Das Wiegen brachte Ruhe in mein Denken, ähnlich wie die Arbeiten in den Beeten und im Gewächshaus, im engen, dunklen Stall und an den Obstbäumen. Diese Arbeiten wiederholten sich durch die Jahreszeiten: langweilig und mühevoll, aber auch beruhigend und angenehm ermüdend. Den Unterricht hingegen erlebte ich als interessant und anstrengend, aber auch als beunruhigend und auf unangenehme Weise ermüdend. Nach der Arbeit im Garten schmeckte das Essen anders als nach den Stunden im Unterrichtszimmer. Ich schlief ruhiger und weniger traumzersetzt. Die Gedanken glitten langsamer und bedeutungsärmer vorüber. Manchmal sah ich von einem Beet hoch, das ich harkte, und sah ein Wolkengebilde oder einen kreisenden Raubvogel und fühlte mich behaglich und friedlich und so, als stimme alles auf eine gute Weise miteinander überein.
Die Beete, in denen ich so oft stand und rupfte oder harkte oder säte oder Erde festtrampelte, hatten wir zwischen den Beerensträuchern und unserem Haus angelegt: Aus einem streckte der blassrote Rhabarber seinen Schopf. Eine Weile hatten wir es in diesem Beet auch mit Erdbeeren versucht, damit aber wenig Glück gehabt. In den anderen Beeten zogen und ernteten wir Kopf- und Ackersalat, Chicorée, Rote Bete, Porree und Sellerie. Es gab eine Parzelle für Brokkoli und eine für Schwarzwurzeln. Tomaten gediehen an Stöcken im Freien und beizeiten im Gewächshaus, in dem wir auch Gurken wachsen ließen, die besser schmeckten als die Freilandgurken.
Ich mochte, auch wenn ich derlei Vorlieben nicht entwickeln sollte, geschmacklich vor allen Dingen den Grünkohl, wenn wir ihn im Winter mit Kartoffeln mischten. Vom Aussehen her erfreuten mich die Rosenkohlgewächse. Wie seltsame Männlein lugten sie aus der Erde, die kleinen Knollen zu einem langen, schlanken Leib verwachsen, aus dem an der oberen Hälfte eingerollte Blätter wie eine wilde Mähne sprossen. Damit die Röschen besonders fest wurden, mussten wir dort, wo der Rosenkohl gepflanzt werden sollte, den Boden nach Leibeskräften festtrampeln. Ich bildete mir dabei ein, dass je fester ich trampelte, der Rosenkohl umso fester und schmackhafter würde, und war enttäuscht, wenn nicht ich, sondern jemand anders die Erde festtrat. Dem Rosenkohl galt meine besondere Aufmerksamkeit: Ich versuchte nicht nur, derjenige zu sein, der den Boden für ihn vorbereitete, sondern auch derjenige, der die Pflanzen ins Anzuchtbeet säte, von dort ins Frühbeet setzte, sie schließlich, wenn sie lang wie eine Hand aus der Erde ragten, noch einmal ins Anzuchtbeet und von dort wieder zurück brachte. Ich häufelte die Erde rund um die Rosenkohlgewächse auf, ich rupfte sorgsam das Unkraut, ich schichtete Mulch um die Stängel, ich zupfte die unteren Blätter ab, sobald sie auch nur einen leichten Stich ins Gelbe zeigten. Und schließlich versuchte ich, möglichst unauffällig, immer derjenige oder zumindest einer derjenigen zu sein, der die Röschen vom Stiel erntete, wobei die untersten zuerst reif wurden.
Manda mochte vor allem die Erbsen und Bohnen, die sich in der südwestlichen Ecke des Grundstücks an Gerüsten rankten. In kleinen Büschen daneben standen die Saubohnen und die grünen Bohnen, neben die wir Kapuzinerkresse und Minze gepflanzt hatten, um Schädlinge fernzuhalten. Auf dem Weg von dort zur nordwestlichen Ecke versperrte mir bei meinen Umrundungen der Zaun der Kuhweide den Weg. Hatte ich ihn überwunden, musste ich mich zusammennehmen, um meine Scheu vor dem großen Tier dahinter nicht in Angst ausarten zu lassen. Tagsüber graste unsere einzige Kuh, nachts und im Winter kam sie in den Stall. Manchmal sah ich zu, wie Manda sie molk, lernte es selbst aber nicht mehr, bevor wir die Kuh verkauften.
Auf dem Gras östlich neben der Weide stehen bis heute unsere Obstbäume: Äpfel, Birnen, Zwetschgen und ein Baum, der sommers Mirabellen trug. Noch weiter östlich und auf der Nordseite unseres Hauses liegen die Ackerstreifen, auf deren ersten wir Zwiebeln und Möhren zogen – die Zwiebeln säten wir zwischen den Möhren, denn die Möhren hielten die Zwiebelfliege, die Zwiebeln die Möhrenfliege fern. Es folgten Blumenkohl und Weißkohl, ein breiter Streifen Kartoffeln, ein Abschnitt für Mangold, in dem später auch Artischocken wuchsen, ein Maisfeld und zuletzt der Kürbisacker, der den Anfangsund Endpunkt meiner Umrundungen bildete.
Vergessen habe ich noch die ganz früher benutzte Komposttoilette neben dem Komposthaufen auf der einen Seite des Hauses sowie den Heuschober und den Brunnen auf der anderen Seite. Vergessen habe ich auch die Hühner: Wir hielten die Vögel in einem großen Drahtkäfig, den wir über das Gras zwischen den Obstbäumen bewegen konnten. Manchmal hängten wir ihnen die abgeernteten Rosenkohlstrünke hinein. Wir aßen ihre Eier, schlachteten sie jedoch nur dann, wenn Manda oder ich krank wurden. Dann gab es eine Hühnerbrühe, in der das weiße Fleisch in Streifen schwamm. Da ich viel öfter krank wurde als Manda, wurden wegen mir mehr Hühner getötet. Tatsächlich bedrückte mich der Tod der Tiere, vermutlich weil Valentin jedes Mal nachdenklich wurde, wenn ein Huhn geköpft und gerupft werden sollte. Bereits das Essen der Eier glich für ihn einem Akt der Gewalt. Die Hühnersuppe im Krankheitsfalle, die wohl auf Norea zurückging, hielt er für unnötig und grausam und verunreinigend. So sehr ich ihn verstand, so sehr schmeckte mir die Suppe und vor allem das Fleisch, und heute glaube ich, dass ein Grund für meine häufigen Krankheiten, wenn auch nicht der einzige, darin zu sehen ist, dass ich auf diese Weise in den Genuss der Hühner kam.
Es waren jedoch nicht allein die Hühner, sondern der gesamte Garten und die darin gezüchtete Nahrung, über die Valentin und Norea ab einem gewissen Zeitpunkt in meiner Kindheit uneins wurden. Bis zum Tag der Rettung konnten ihre Auffassungen nicht miteinander versöhnt werden. Norea erwies sich als hartnäckiger, Valentin fand zusehends weniger die Kraft, für seine Ansicht einzustehen, gab auf und beugte sich ohne Überzeugung. Gebe ich diese Meinungsverschiedenheit heute wieder, so verdichte ich viele Bemerkungen und Streitgespräche zu einer einzigen Auseinandersetzung, deren Inhalt ich als Kind zwar aufschnappte, aber nur zum Teil verstand.
Es muss während der großen Kosmologieunterweisung gewesen sein, also mitten im Winter, in dem wir kaum im Garten zu arbeiten hatten, als Norea Valentin mitteilte, dass zu viel Aufmerksamkeit in den Garten gehe. Der Garten werde mehr und mehr zu einem Tempel, die Pflanzen darin zu Heiligen, die Arbeit in ihm zur Religion. Der Garten mit seinen widerlichen Gewächsen entziehe so viel Zeit und Kraft und Aufmerksamkeit, dass für den Unterricht kaum Zeit bleibe. Am Morgen gehe es um den Garten, am Mittag gehe es um den Garten, und auch am Nachmittag und Abend gehe es um den Garten. Im Frühling wie im Sommer wie im Herbst wie im Winter. Er nenne es die reine Nahrung, sie nenne es den Kult der Hyle, den Tanz um das goldene Kalb der Materie. Valentin entgegnete, dass es von Anfang an der Plan gewesen sei, sich selbst zu versorgen, und das nicht bloß deshalb, weil die selbst angebaute Nahrung den Geist weniger träge mache und langfristig gesehen weniger koste, sondern vor allem, weil die Arbeit im Garten ein wichtiger Teil des Unterrichts sei. Bei rechter Anweisung öffne das Gärtnern um der Nahrung willen uns Kindern am ehesten die Augen für die materielle Welt.
Norea spottete, wenn das Wort »Selbstversorgung« fiel. Einmal, als sie glaubte, dass Manda und ich es nicht hörten, sagte sie Valentin, dass er hinter seinen Argumenten geheime Ansichten verstecke. Sie nannte ihn ein Opfer jener Lüge, die Zurück-zur-Natur-Romantiker verbreiteten: dass es eine gute, unverfälschte und eine schlechte, verfälschte Nahrung gäbe, dass also die von Menschenhand veränderte Materie übler wäre als die ursprüngliche, dass es tatsächlich so etwas gäbe wie »natürlich« und »künstlich«, wo doch alles nur eines sei – »vergänglich«. Dinge des Leibes hätten uns nichts anzugehen. Materie wirke nur auf Materie. Wenn er sage, die falsche Nahrung mache den Geist träge, so meine er doch wohl, sie mache den Leib träge, oder er stelle bedenkliche Beziehungen zwischen dem Bösen und dem Guten her.
Ich weiß noch, wie verblüfft sich Valentin über diese Entgegnungen zeigte und wie seine Verblüffung auf Manda und mich überging, wenn auch wohl aus anderem Grund. Bisher waren uns Norea und Valentin als Einheit erschienen, es gab eine Wahrheit, und so konnte es keine zwei Meinungen geben. Tatsächlich wurde der Streit auch weitgehend im Verborgenen ausgetragen, aber wir Kinder entwickelten Ohren, die manchmal nur noch für Worte dieses Streits existierten, sogar für solche, die nicht ausgesprochen wurden. Was mir entging, erfasste Manda, was Manda entging, erfasste ich, wir setzten die Teile zusammen, besprachen das Ganze und gerieten schließlich darüber selbst in Streit.
Valentin versuchte, eine vermittelnde Position einzunehmen. Er gab sich besonnen, und wenn er glaubte, Noreas Auffassung genug Gehör geschenkt zu haben, erwähnte er, dass sie doch ursprünglich eines Sinnes gewesen seien: möglichst unabhängig zu sein von den Fleischmenschen und ihren Erzeugnissen, und auch, dass es wichtig sei, die Kinder den Mühen der Nahrungserzeugung auszusetzen. Norea entgegnete, dass das einmal richtig gewesen sei, nun aber nicht mehr. Die Kinder hätten im Garten genug gelernt, und die Unabhängigkeit von den Fleischmenschen sei ohnehin nur eine fadenscheinige, weil ja doch immer wieder alles Mögliche dazugekauft werden müsse. Nahrungsherstellung und -zubereitung und -aufnahme sei immer etwas Besudelndes, die Feinheiten der Unterschiede seien ihr dabei weniger wichtig als das grob ins Gesicht springende Gemeinsame. Sein Argument könne doch nur sein, dass die Pflanzen aus dem Supermarkt weniger Licht enthielten, das durch Verzehr befreit werde, aber sie halte die ganze Gemüse-Licht-Idee bestenfalls für eine Metapher und eher noch für bedenkliche Schwärmerei.
Bevor Valentin etwas auf diese Vorwürfe erwidern konnte, kam Norea auf das Geld zu sprechen. Die sogenannte Selbstversorgung sei doch nachweislich viel teurer, als in den Billigmärkten der Umgebung einzukaufen. Als Beispiel nannte sie die Bienen. So nützlich sie zu ihrer Zeit als Anschauungsobjekte gewesen seien, so überflüssig und kostspielig seien sie nun. Alleine für die Gewinnung einiger lächerlicher Gläser Honig sei umfangreiches Material vonnöten: Neben den Magazinbeuten nannte Norea den Wabendraht aus Edelstahl, die Zanderrahmen, Mittelwände, Absperrgitter, Streckmetallgitter, Futterzargen, die Zange, um die Königin fangen zu können, Besen und Stockmeißel, Sirup und Füttergefäß, die Imkerkleidung, Varroagitter, Sprühflaschen, Ätznatron, Milch- und Ameisensäure, Magazinkästen, Räuchergerätschaften, das Entdeckungsgeschirr, Siebe, Schleudern, Abfülleimer, Trichter und schließlich Gläser für den Honig. Ganz zu schweigen von der Zeit, die in wiederkehrende und meistenteils stumpfsinnige Arbeit zu stecken sei. Valentin behauptete daraufhin, dass er Berechnungen angestellt habe und belegen könne, dass auf lange Sicht die Selbstversorgung durchaus Geld spare. Den Ausdruck »auf lange Sicht« wiederholte Norea mehrmals und warf Valentin vor, dass er sich offenbar dauerhaft im Kadaver einrichten wolle, anstatt sich so bald wie möglich daraus zu befreien. Das erkläre auch, warum er die Nahrung überbewerte und vergesse, dass es nicht entscheidend sei, was in den Mund hineingehe, sondern was aus ihm herauskomme.
Valentin wollte daraufhin von Norea wissen, ob sie den Unterricht nicht überbewerte: Er spreche den Verstand an, den auch die Tiere hätten, er spreche die Vernunft an, die auch die Fleischmenschen hätten, aber ob daraus die Erkenntnis entspringe, sei keinesfalls gesichert. Vielleicht richte sie sich ja in einem jahrelangen Unterrichten ein, ohne dass die Kinder dadurch der Erkenntnis und somit der freiwilligen Entscheidung heimzukehren einen Schritt näher kämen. Genau betrachtet sei doch alles sinnlos: der Garten, der Unterricht, das Warten darauf, dass die Kinder erlöst würden. Von ihm aus könne noch heute der Spuk aufhören.
An diesem Punkt war es Norea, die einen Schritt auf Valentin zuging, um dann doch eine andere Richtung einzuschlagen: Der Unterricht sei in der Tat kein Garant für Erkenntnis. Er spreche jedoch nicht nur den Verstand und die Vernunft, sondern auch die Sehnsucht an, und die Sehnsucht sei notwendig, wenn auch nicht hinreichend, um heimzukehren. Und natürlich sehe sie es wie er: Auch von ihr aus könne schon heute das Gefängnis verlassen werden. Vielleicht sei es überflüssig, die Kinder zu fragen, vielleicht sei es gar nicht wichtig, ob diese freiwillig mitgingen. Sie vertraue da ihm. Wenn er die Entscheidung für alle treffen wolle, dann würde sie ihm nicht im Wege stehen. Valentin erwiderte daraufhin nichts mehr.
Die Kuh wurde verkauft. Nach und nach verwahrlosten einige Beete. Die Ackerfläche bestellten wir nur noch zur Hälfte. Der Unterricht für Manda und mich wurde intensiviert.
Wenn ich heute im Geiste die Umrundungen noch einmal nachvollziehe, dann beginne ich dort, wo ich damals begonnen habe: in der nordöstlichen Ecke, am äußersten Rand des Kürbisfeldes, im Rücken die Hecke, vor Augen den Acker, aus dem die breiten Blätter und gelben Blüten und prallen Früchte wuchsen. Jahr um Jahr ernteten wir beim ersten Frost einige Kürbisse, um sie später als Suppen und Pasten und im Ofen gebackene Stücke und schließlich als sauer oder süß eingelegte Würfel oder Marmelade zu essen. Wir aßen Kürbiskuchen und Kürbismus, Kürbisgulasch und mit Zwiebeln und Lauch oder Brot und Käse gefüllte Kürbisse. Wir aßen Kürbisstreifen, gebraten oder als Salat. Wir aßen Kürbisstrudel und Kürbisauflauf und Kürbissoufflé. Erst als Manda mir anvertraute, dass sie Kürbis nicht mehr sehen, dass sie Kürbis nicht leiden könne, wurde mir bewusst, dass auch ich Kürbis nicht mochte. Vielleicht, so denke ich heute, mochten auch Valentin und Norea keinen Kürbis, aber sie sprachen nicht darüber. Niemand von uns sprach darüber, ob etwas schmeckte oder nicht, bis Manda mir sagte, dass sie keinen Kürbis mochte.
Die Kürbisse erinnere ich allerdings nicht nur als eine besonders häufige Speise, sondern auch als einen seltsamen Anblick: Wenn sie im Herbst als orangefarbene Bälle auf dem Acker lagen, schien es mir, als ob sie nur aufgrund einer geheimen Verabredung unbeweglich blieben, während unergründliche Absichten in ihnen nisteten. Besonders befremdlich fand ich das Kürbisfeld in der Nacht, wenn die Bälle im Licht des Mondes gleichzeitig echter und unechter wirkten und beinahe unerträglich gegenwärtig. Eine einzige Pflanze bestand aus einem viele Meter langen, sich gerade über den Acker streckenden Stängel, von dem Seitentriebe abzweigten, die ihrerseits wieder Triebe bildeten. An den Seitentrieben zeigten sich im späten Frühling die Blüten: gelb und, wenn sie sich öffneten, von gierigem Aussehen. Tief in den Kelchen wuchsen die Stempel, an deren verwachsenen Wülsten die Pollen hafteten.
Norea sprach von »männlichen« und »weiblichen« Blüten. Die weiblich genannten Blüten konnten leicht erkannt werden: Unterhalb der Blütenblätter zeigte sich früh eine grüne Kugel, ein Miniaturkürbis mitten im Stängel des Seitentriebes. Norea erklärte mir, dass sich fast alle Lebewesen in »männlich« und »weiblich« spalteten. In dieser Welt existiere diese Spaltung, um aus Materie weitere Materie zu erzeugen. »Männlich« nenne man das zeugende, »weiblich« das empfangende Prinzip, womit nicht mehr gemeint sei, als dass das eine Geschlecht mit seinem Samen den Samen des anderen befruchte, sodass das befruchtete Geschlecht eine Frucht hervorbringe, die bald Obst, bald Tier, bald Mensch heiße und entweder als empfangendes oder befruchtendes Geschlecht und selten als Mischform geboren werde. Am Kürbis könne ich alles Grundlegende beobachten, was das Geschlechtliche angehe. Die Zuschreibungen, die die Menschen mit den Begriffen »männlich« und »weiblich« in Verbindung brächten, dem Gesetz der Materie gemäß in immer komplexeren und abwegigeren Formen, seien nichts als phantastische Wucherungen und könnten, wie das allermeiste, auf simple Grundformen heruntergebrochen werden. Das Wesentliche im Menschen sei weder Mann noch Frau. Ich solle diesem Unterschied also keine Aufmerksamkeit widmen und kein Aufhebens um ihn machen wie die Fleischmenschen, die wie um alle unwichtigen Unterschiede gerade um diesen viel Aufhebens machten und ganze Spiele von Herrschaft und Unterwerfung darauf gründeten.
Bei den Kürbissen sei es nun so, dass der Pollen der männlichen Blüte auf die weibliche Blüte gelangen müsse, damit diese aus dem Fruchtknoten eine Frucht ausbilden könne. Anders als bei Menschen oder Tieren oder den Pflanzen, die sich mittels Wind, mittels Wasser, gegenseitig oder selbst befruchteten, seien hierfür Tiere wie die Bienen nötig, die sich vom Pollen der Kürbisblüten nährten und Teile davon an ihren Haaren von der einen Pflanze zu den Narben der anderen brächten. So führte die Kürbisunterweisung zur Bienenunterweisung und ist für mich mit ihr in der Erinnerung eng verknüpft. Seit ich denken kann, standen in unserem Garten zwei Bienenstöcke, in denen im Laufe der Jahre mehrere Völker lebten. Norea und Valentin nannten das jeweilige Volk in seinem Stock »der Bien«, was sie damit erklärten, dass Volk und Stock zusammen einen Organismus bildeten. Die einzelnen Bienen seien wie Zellen des Ganzen und unterteilten sich in drei »Bienenwesen«: Arbeiterin, Königin und Drohn. Die meiste Zeit des Jahres existierten nur die Arbeiterinnen und jeweils eine Königin. Während die Arbeiterinnen in den ersten drei Wochen nach dem Schlupf im Stock putzten, Waben bauten und die Brut pflegten und bewachten, flogen sie danach bis zu ihrem Lebensende zu den Blüten und Stämmen der Pflanzen und Bäume, um Pollen und Harz zu sammeln. Im Sommer lagerten sie Honig ein, vor dem Winter starben sie. Was sie taten, taten sie also nicht für sich, sondern für das Ganze. So verhielt es sich auch mit den Drohnen, den »männlichen« Bienen, die nur dafür existierten, die Königin zu befruchten. Dazu gab es Drohnensammelplätze, an denen zu bestimmten Zeiten im Jahr Jungköniginnen von Hunderten von Drohnen umflogen und begattet wurden. Am Ende des Sommers fanden sich dann die toten oder fast toten Drohnen unterhalb des Fluglochs vor den Eingängen der Stöcke: Die Arbeiterinnen hatten sie herausgedrängt und verhungern lassen.
Einmal hatte ich aus einem der beiden Stöcke einen gespenstischen Laut vernommen und kurz darauf einen anderen, noch unheimlicheren. Der erste hell und surrend, der zweite dumpf und klagend. Valentin hatte mir erklärt, dass die Königin durch Zusammenpressen von Luft und ein Vibrieren ihrer Flügel einen Klang erzeuge, der frage, ob in den sogenannten Weiselzellen eine Nachfolgerin herangewachsen sei. Der dumpfe Ton sei die Antwort: Eine noch nicht geschlüpfte, aber schlupfbereite Weisel antworte der Königin, die daraufhin mit einem Teil des Volkes den Stock verlasse, wenn wir nicht vorher eingriffen und einen künstlichen Ableger in einem von uns beherrschten Stock oder zumindest einigen Magazinbeuten bildeten.
Die Geräusche verfolgten mich lange. Etwas zutiefst Trauriges, Getriebenes, aber auch Widerwärtiges klang für mich sowohl in der Frage der alten Königin als auch in der Antwort der künftigen. Ich fragte, wie eine Biene zur Königin werde, und erhielt zur Antwort, dass die Arbeiterinnen einige wenige Larven anders behandelten. So bekämen die künftigen Königinnen während ihrer gesamten Aufzucht aus den Drüsen der Bienenköpfe ein Sekret verabreicht, das königlicher Gelee genannt werde. Ich formulierte daraufhin, dass also alle Bienen Arbeiterinnen seien, aber einige wenige durch eine bessere Ernährung zur größeren Königin herangezüchtet würden. Norea erklärte mir, dass es so aussähe, man aber genauso gut formulieren könne, dass alle Bienen Königinnen seien und bei der Mehrheit die schlechtere Ernährung das Heranreifen zur Königin verhindere. Vergleichbar wirke ein anderer Stoff: die sogenannte Königinnensubstanz. Die Königin sprühe mit diesem Botenstoff die Arbeiterinnen ein, was das Reifen der Eier in ihren ohnehin verkrüppelten Eierstöcken vollständig verhindere. Die Verkrüppelung der vielen werde in Kauf genommen, weil sie dem Bien diene. Das Leiden der einzelnen Biene spiele keine Rolle, denn das Wesen des Bien achte das Einzelne nur als Mittel, nicht als Zweck. Auch außerhalb des Bien seien die Lebewesen immer nur Mittel zu einem Zweck, der darin bestehe, die Wesenheiten und damit ihr bloßes Mittel-Sein und damit ihr Leiden zu vervielfältigen. Oft werde verkündet, das Ganze sei mehr wert als seine Teile, ohne dass die Verkünder dieser Lehrer sagen könnten, wozu das Ganze überhaupt existiere und wie es gut sein könne, wenn seine Teile leiden müssten.
Die ganze materielle Welt gleiche dem Bien. Kosmos heiße Ordnung, und Ordnung heiße die Herrschaft eines gnadenlosen Prinzips, das in allen Wesen hause und sie zu Erhalt und Vermehrung antreibe, was ich Gier nennen solle. Danach strebe alles, in dem die Gier hause: mehr zu werden und mehr und mehr, ohne dass es dabei ein anderes Ziel als dieses Mehrwerden gebe, wobei das Mehrwerden jedoch nicht den gierigen Einzelwesen nutze, sondern allein der Materie, die in einem Reigen aus Vermehrung und Zerstörung ihre Herrschaft behaupte und sich durch die Zeit erhalte.
Wie bei den Begriffen »männlich« und »weiblich« habe der Mensch auch die Gier verkompliziert und vor sich selbst unter einem Wust aus anderen Begriffen zu verstecken gesucht, die sich grob in die sieben Kategorien Geld, Macht, Ruhm, Liebe, Religion, Kunst und Familie beziehungsweise Gemeinschaft beziehungsweise Volk beziehungsweise Staat einteilen ließen. Der nicht erkennende Mensch diene Götzen dieser Kategorien und denke, er täte es freiwillig und zu seinem persönlichen Nutzen, dabei diene er nur der Materie, und indem er verzweifelt versuche zu tun, was er wolle, vergesse er, dass es nicht sein Wille sei, dem er folge. Indem sich die Menschen als einzigartig und ihre Wünsche als ihre ganz persönlichen erlebten, vergäßen sie, dass diese Wünsche nur Ausformungen des einen Willens seien, der allein das Ziel der Materievermehrung kenne und sich nicht im Geringsten für ihre Sehnsüchte und Nöte und eingebildete Einzigartigkeit interessiere.
Diese Unterweisung gab mir Norea zwei oder drei Jahre, nachdem ich versucht hatte, die Größe des Gartens durch Abschreiten zu ergründen. Wenn ich heute daran denke, drohen sich Noreas Ausführungen und meine Erinnerungen an den damaligen Garten und meine frischen Eindrücke des jetzigen Gartens zu einem Knäuel zu verschlingen, in dem neue Bedeutungen entstehen, so als gäbe es männliche und weibliche Begriffe, die wieder neue Begriffe zeugen, die ich aber nicht festhalten will, weil ich ahne, dass aus diesen Bedeutungen wieder neue und daraus wieder neue hervorgingen, bis ich mich gänzlich darin verloren haben würde. Um das, was ich anhand des Gartens schildern will, nicht ins Chaotische wuchern zu lassen, ist es nötig, wie bei der Gartenarbeit die überflüssigen Triebe abzuschneiden, obwohl ich Mühe habe zu sagen, was überflüssig ist und was fruchtbringend, zumal es ja möglich ist, dass ich meinem Ziel – der Erkenntnis, wenn vielleicht auch nicht in Noreas Sinne – genauso gut oder besser nahekäme, wenn ich an einer Stelle, also in diesem Falle bei der Betrachtung der Kürbisse, so weit wie möglich in die Tiefe ginge, anstatt den Garten aufs Geratewohl in Bereiche zu teilen, zu denen ich dann jeweils ein paar erste Eingebungen festhalte. Da ich jedoch nicht entscheiden kann, welche Vorgehensweise die bessere ist, folge ich meinem ersten Vorsatz und arbeite in die Fläche und nur dann in die Tiefe, wenn aus dieser etwas mit Macht an mir zieht. So geht es mir mit dem Schuppen. Über den Schuppen komme ich zum Eingang, über den Eingang zu den Besuchen. In dem Schuppen lagerten wir Holz, vor allem von Fichten, manches gekauft, manches geschlagen oder gesammelt. Als Kind beschäftigte mich oft, ob wir genug Holz hatten, und ich grübelte manchmal winters im Bett, wie lange wir mit den Vorräten heizen konnten, deren Menge ich wieder und wieder abschätzte. Bis heute finde ich den Gedanken beruhigend, genug Holz zu haben.
Weitaus häufiger pflegte ich jedoch eine andere anheimelnde Vorstellung. Den Garten, in dem unser Haus steht, umgibt eine Wiese. Steht man ungefähr dort, wo sich früher der Durchgang durch einen heute zerstörten Zaun befunden hat, kann man sich besonders gut einen Eindruck von der Umgebung verschaffen. Blickt man nach Norden, schaut man zum Traunstein empor, einem Berg von fast 1700 Metern Höhe. Blickt man nach Osten oder Westen, sieht man nichts als Fichten. Im Süden, wo die Seiten des Wiesendreiecks in dessen Spitze auslaufen, erkennt man in der Ferne ein paar grüne Hügel und, je nach Standort, drei oder fünf fremde Höfe, ebenfalls höher gelegen und fast vier Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Tals, durch das sich die Landstraße windet. Ich stellte mir gerne vor, dass die Grenzen des Dreiecks, in dem sich die Wiese, in der sich der Garten, in dem sich unser Haus befindet, nur von innen durchlässig wären, von außen aber verzaubert, sodass niemand hineinkönnte, der nicht die geheimen Worte wüsste. Vielleicht, so stellte ich mir irgendwann vor, sollte der Zauber auch so beschaffen sein, dass Außenstehende noch nicht einmal wahrnehmen könnten, dass sich hinter dem Wald eine riesige Wiese, in der Wiese ein sehr großer Garten und in dem Garten unser Haus befände. Diese Phantasie nährte ich als Kind jedoch nicht öfter als eine zweite, entgegengesetzte, nämlich dass schöne, freundliche Menschen kamen, um uns zu besuchen und Geschichten aus fernen Gegenden zu erzählen. In meiner Vorstellung ließ ich alle möglichen Erscheinungen durch das Zaungatter nur wenige Schritte südlich des Holzschuppens spazieren, oft erfreut über ihr Aussehen, manchmal erschrocken, vor allem in den Augenblicken, da mir meine Einbildungen wie Einsichten erschienen.
Die Menschen, die tatsächlich durch diesen Eingang zu uns kamen, wurden im Laufe der Jahre stetig weniger, ohne je zahlreich gewesen zu sein. Nur selten halfen Handwerker oder Bauern, wenn Norea und Valentin nicht weiterwussten. Auch tauschten die Menschen der Gegend hin und wieder etwas, das sie angebaut oder gekauft hatten, gegen etwas, das wir angebaut hatten, mussten dazu aber so gut wie nie auf unser Grundstück. Fünfmal zählte ich einen Postboten, der Pakete brachte, die er nicht in den Briefkasten stecken konnte, der bis heute Hunderte von Metern unterhalb unseres Grundstückes an einem befahrbaren Weg aufgestellt steht.
Zweimal tauchten Menschen auf, die Norea Pädagogen nannte, die sich selbst aber als Sozialarbeiterinnen bezeichneten. An die erste kann ich mich nicht erinnern, weiß von dieser Frau also nur durch Manda, die mir erst nach dem Besuch der zweiten von ihr erzählte, mit den Worten, etwas Ähnliches habe sich schon einmal abgespielt, wenn auch die Pädagogin ganz anders, viel fleischiger und viel desinteressierter gewesen sei. Die zweite hieß Christina, wollte aber Tina genannt werden. Sie ging und stand und saß sehr dünn und mit leicht hochgezogenen Schultern und wirkte jünger als Norea und Valentin und auch viel schwächer. Die braunen Augen blickten wie aus einem Eichhorn, und sie lächelte, als ob sie sich für etwas entschuldigen müsste, was mich an Noreas Worte erinnerte, Menschen würden zu uns kommen und uns etwas vormachen, woraufhin wir ihnen etwas vormachen sollten. Sie würden Fragen stellen mit der verborgenen Absicht, Antwort auf ganz andere Fragen zu erhalten, und wir sollten ihnen sagen, was Norea mit uns vorher festgelegt hatte, so als gehe es um ein Spiel.
Tina sah sich den Garten an und schüttelte mehrmals den Kopf. »Wahnsinn«, sagte sie, meinte damit aber nicht »Wahnsinn«, sondern »sehr gut«. Sie fragte Norea und Valentin nach der Arbeit im Garten, dem Ertrag, unserer Ernährung und was wir denn überhaupt noch einkauften. Ich erinnere mich, dass bei diesem Gespräch alle sehr freundlich und interessiert wirkten und Valentin Dinge aufzählte wie Salz, Zucker, Reis, Mehl, Glühbirnen, Zahnpasta, Toilettenpapier, Saatgut oder Hefte und Stifte. Die dünne Frau sagte daraufhin, dass sie am liebsten auch so leben würde, was das Essen anginge. Im Supermarkt könne man ja fast nichts mehr kaufen. Nicht nur wegen der Gesundheit, auch wegen der Umwelt und der Ausbeutung, was ich nicht verstand, aber Valentin und Norea verstanden und bekräftigten es und nickten. Ich wusste nicht, was das Reden über Gartenarbeit und Supermärkte sollte, weil ich dachte, eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt müsse über soziale Arbeit und die Jugend reden, aber es passte schließlich dazu, was Norea uns beigebracht hatte: Das, worüber die Menschen reden, ist nicht das, worum es ihnen geht, und die Fragen, die sie stellen, sind oft nur zum Schein gestellt.
Tina fragte, womit Valentin und Norea ihr Geld verdienten, und Valentin sagte, dass er von seinem Vater eine Summe geerbt habe, die es ermöglicht habe, dieses Haus zu kaufen, umzubauen, den Garten anzulegen, die Photovoltaikplatten am Dach anbringen zu lassen und ein Leben in der Natur zu führen, das überwiegend aus Selbstversorgung bestehe. Tina sagte einmal mehr »Wahnsinn«, fügte dann hinzu, dass das ja sicher auch genug Arbeit sei, veränderte plötzlich für einen Augenblick ihren Gesichtsausdruck und fragte, noch immer etwas seltsam lächelnd, ob wir religiös seien.
Norea lächelte ebenfalls seltsam und antwortete »spirituell«, und offenbar machte diese Antwort die Frau sehr zufrieden. Sie wurde fast aufgeregt und redete viel. Darüber, dass die Kirche ja etwas Seltsames sei, ein Machtapparat, der sich zwischen Mensch und Gott oder – wie sie sage – das Göttliche schalte. Dabei könnten wir ja selbst den Zugang zu dieser Energie, also Kraft, finden, in uns selbst nämlich, und Norea nickte und sagte, dass sie das so ähnlich sehe, während Manda mir einen Blick zuwarf, als wolle sie mir bedeuten, die Frau habe mit Sicherheit keine Ahnung, worüber sie sprach.
Weitere Fragen und Antworten, an die ich mich erinnere, hatten Herkunft und Ausbildung von Valentin und Norea zum Gegenstand. Es wurden Städte genannt, unter denen ich mir jedoch nur Tübingen merken konnte. Dort wollten sich die beiden kennengelernt haben, an einer Universität, wobei Norea Psychologie und Philosophie, Valentin hingegen Politik und Geoökologie und beide Vergleichende Religionswissenschaften studiert hatten. Tina schien auch mit diesen Antworten, ob der Wahrheit entsprechend oder ausgedacht, zufrieden und gab lediglich zu bedenken, dass es in Deutschland doch auch schön sei und man dort sicher bessere Gegenden fände, einen Garten wie den unseren anzulegen, als im bergzerklüfteten und von Frost und Unwetter heimgesuchten Oberösterreich. Valentin stimmte ihr zu: Die Gegend hier sei für Selbstversorger eine Herausforderung. Andererseits übe sie auf ihn eine unerklärliche Anziehungskraft aus. Norea fügte hinzu, Österreich biete den Vorteil, dass man seine Kinder nicht zur Schule schicken müsse, sondern selbst zu Hause unterrichten könne. Tina wisse ja sicher längst, dass wir, Manda und Adam, nur unsere jährlichen Prüfungen in der Volksschule St. Konrad absolvierten, ansonsten aber daheim unterrichtet würden. Tina sagte dazu nichts, fragte aber auf eine Weise nach einem Kaffee und ob man nun nicht einmal ins Haus gehen solle, dass Manda und ich noch wachsamer wurden.
Dass es keinen Kaffee, sondern einen Kräutertee gab, fand Tina offenbar nicht bedenklich, machte sich aber Sorgen, ob uns Kindern denn nicht das fehlen würde, was sie Klassenkameraden nannte, und ob viele verschiedene Lehrer nicht besser seien als wenige, noch dazu die eigenen Eltern oder besser gesagt Zieheltern. Nun war die Zeit gekommen zu sagen, was uns Norea beigebracht hatte. Manda machte den Anfang, indem sie meinte, sie wolle nicht in die Schule. Ich folgte mit dem Satz, dass ich genug Spielkameraden hätte. Meine Schwester und die Kinder der Gegend.
Norea saß da und sagte: »Was wollen Sie da machen? Die Kinder wollen nun einmal den Heimunterricht.«
Wenige Minuten später wollte Tina mit uns Kindern alleine sprechen. Zuerst musste ich mit ihr in mein Zimmer gehen, in dem sie sich wunderte, dass ich kein Spielzeug hatte. Ich erklärte ihr, dass der ganze Garten mein Spielzeug sei und die Tiere und Pflanzen darin meine Spielgefährten.
»Und bei Regen?«, fragte Tina, und ich erklärte ihr ein Spiel, das ich manchmal bei Regen spielte und für das ich nur einen Handspiegel aus dem Badezimmer benötigte. Ich hielt den Spiegel mit der spiegelnden Fläche zur Decke vor mir ausgestreckt und schaute in ihn hinein und lief durchs Haus. Solange ich in den Spiegel sah, lief ich an der Decke, fiel der Blick auf den Boden, lief ich auf dem Boden, so lange, bis oben und unten durcheinanderwirbelten.
Ich spürte nicht, was Tina über das Spiel dachte. Sie ging nicht darauf ein, sondern fragte, ob ich wirklich nicht in die Schule wolle, ihr könne ich es sagen, sie würde auch nichts den anderen verraten. Sie saß fremdartig auf meinem Bett, ich daneben, noch fremdartiger, sie zu Fragen genötigt, ich zu Antworten, ohne dass die einen oder die anderen Sinn ergaben. Ich sagte, mir gehe es gut. Ich sagte, dass ich manchmal an die Schule denke und mir auch ausmale, was ich dort vielleicht verpasse, dann aber immer zu dem Schluss komme, dass das Gute der Schule nicht das Schlechte der Schule aufwiege und mir ja durch meine Fahrten zu den Prüfungen bekannt sei, dass es viele laute, gewalttätige und dumme Schüler gebe. Tina sagte, dass aber doch mehrere Lehrer vielleicht besser wären als zwei, die dann noch dazu meine Zieheltern seien. Ich erwiderte, ich sehe es genau andersherum, ohne dass ich einen Grund dafür angab, und fügte dann hinzu, ich sei froh, zu Hause so viele Fragen stellen zu können und von bösen Kindern in Ruhe gelassen zu werden.





























