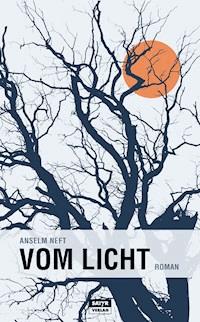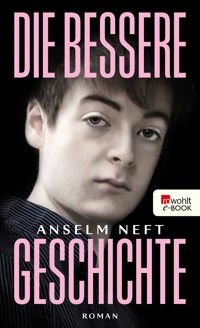
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Internatsroman. Eine tragische Liebesgeschichte. Eine packende Story über Führung und Verführung. Der sensible Tilman Weber ist 13, als er auf ein Internat an der Ostsee kommt. Erst fühlt Tilman sich sehr allein in der "Freien Schule Schwanhagen". Dann aber verliebt er sich in Ella und findet Aufnahme in ihrer Schülergruppe. Die wird geleitet von dem sehr unkonventionellen Lehrerpaar Wieland. Als er sich schließlich zwischen Ella und der "Familie" entscheiden muss, kommt es zur Katastrophe. 27 Jahre später. Der bekannte Schriftsteller Tilman Weber erhält einen Telefonanruf. Es ist Ella, die ihn zur Beerdigung einer Mitschülerin einlädt. Bei dem Treffen will Ella die sexuelle Gewalt von damals öffentlich machen. Tilman will das auf keinen Fall…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Anselm Neft
Die bessere Geschichte
Roman
Über dieses Buch
Ein Internatsroman. Eine tragische Liebesgeschichte. Eine packende Story über Führung und Verführung. Der sensible Tilman Weber ist 13, als er auf ein Internat an der Ostsee kommt. Erst fühlt Tilman sich sehr allein in der «Freien Schule Schwanhagen». Dann aber verliebt er sich in Ella und findet Aufnahme in ihrer Schülergruppe. Die wird geleitet von dem sehr unkonventionellen Lehrerpaar Wieland. Als er sich schließlich zwischen Ella und der «Familie» entscheiden muss, kommt es zur Katastrophe.
27 Jahre später. Der bekannte Schriftsteller Tilman Weber erhält einen Telefonanruf. Es ist Ella, die ihn zur Beerdigung einer Mitschülerin einlädt. Bei dem Treffen will Ella die sexuelle Gewalt von damals öffentlich machen. Tilman will das auf keinen Fall …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Sarah Jarrett/Arcangel
ISBN 978-3-644-00257-9
Hinweis: Seitenverweise beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«And thus, joy sudddenly faded into horror, and the most beautiful became the most hideous, as Hinnom became Ge-Henna.»
(Edgar Allan Poe, Morella)
Erster Teil
Erstes Kapitel
So weit ich auch zurückdenke: Mein Vater war immer schon alt und meine Mutter immer schon tot. Als man sie in ihr Grab hinabsenkte, hatte ich gerade mein zweites Lebensjahr erreicht, und natürlich kann ich mich weder an meinen Geburtstag noch an ihre Totenfeier erinnern, aber auf den Fotos, die ich von ihr habe, sieht sie wunderschön aus: eine fast unwirkliche Erscheinung mit hohen Wangenknochen, hellblonden Haaren, wissendem Blick, gerader Haltung – die Würde einer Königin, die Entrücktheit eines Feenwesens. Es beruhigt und verstört mich, dass ich einmal aus dem Bauch dieser Frau geborgen worden bin, auch deshalb, weil ich ihr tatsächlich ähnlich sehe, selbst heute noch, als erwachsener Mann. Vermutlich ist es Einbildung, aber bisweilen meine ich mich an ihren Geruch zu erinnern, an ihr Gesicht über mir, die Wärme ihrer Arme und die Fülle ihrer Brust. Es gibt Fotos, auf denen sie mich eng an sich gedrückt hält, auf traumverlorene Weise lächelnd oder in die Ferne schauend. Und so seltsam es klingen mag: Ich bin froh, diese schöne Frau kennengelernt zu haben, wenn auch nur für eine kurze, intensive Phase in meinem Leben, die dem Bewusstsein nicht mehr zugänglich ist. Ein Psychoanalytiker könnte mir sicher ebenso interessante wie fragwürdig herbeiassoziierte Zusammenhänge zwischen meiner vergnügten Mutterlosigkeit und der Entwicklung meiner charakterlichen Anomalie aufzeigen, auch wenn übergroße Zartheit und wie aus der Welt gefallene Empfindsamkeit weitaus häufiger mit der Abwesenheit eines Vaters erklärt werden.
Zu meinem Vater drängt sich mir als erster dieser Satz auf: Ein froher Mensch ist er nie gewesen. Auf Fotos, die ihn als 35-jährigen Bräutigam zeigen, wirkt er wie ein ernster, ausgemergelter Mann von Mitte vierzig. Früh zogen sich links und rechts seiner Nase steile Falten herab. Heute glaube ich, mein Vater hat ein Laster mit sich herumgetragen, es aber nicht ins Leben treten lassen: Der Kampf gegen sich selbst zehrte ihn aus, vertiefte die Falten, raubte den Lippen Fleisch und Farbe.
Schon als Kindergartenkind wusste ich, dass ich ihn überforderte. Mein Vater ertrug starke Gefühle nicht, ganz gleich, ob sie eine dunkle oder lichte Färbung hatten. Folglich versuchte ich mich ausschließlich im mittleren Spektrum zu präsentieren. Oft gab ich mich gefasster, als ich mich fühlte, und irgendwann wurde mir klar, dass es mein Vater nicht anders hielt. Manchmal, wenn ich nachts zur Toilette ging, hörte ich ihn hinter der verschlossenen Tür seines Arbeitszimmers weinen. Ich lauschte lange mit pochendem Herzen und berührte mit meiner Hand das Holz der Tür.
Alles Laute, Grobe und Gemeine empfand ich als Zumutung, oft auch als Bedrohung. Meinen ersten Tag im Kindergarten erlebte ich im Schock. Der Lärm machte mich halb irrsinnig. Ich versuchte, mich in eine Ecke oder unter Tische zurückzuziehen, alleine zu sein, wie ich es von zu Hause kannte, ein Spiel in Ruhe und auf meine Weise zu spielen, aber ständig wurde ich gestört. Ich hatte keinen Platz. Ein Junge hielt mir ein Brot vor die Nase und sagte: «Das ist vergiftet. Wenn du das isst, stirbst du.» Das mag drollig klingen, als Kind aber kam mir dieser Satz derart widerwärtig vor, dass ich sofort Bauchschmerzen bekam und nach Hause gebracht werden wollte. Warum sagte der Junge so etwas? Warum bedrohte er mich mit seinem Giftbrot?
Am liebsten hätte ich dem Kindergarten nach diesem ersten Tag für immer den Rücken gekehrt, aber mein Vater ließ das nicht zu. Bliebe ich dem Kindergarten fern, würde ich nur noch weicher werden. Genau wie die verregneten Urlaube an der Nordsee sollte mich der Kindergarten abhärten. Fragte ich meinen Vater, was gut daran sei, abgehärtet zu sein, sagte er, die Welt sei eben, wie sie sei, wer darin leben wolle, müsse ihr gewachsen sein.
Trotz meiner Erschütterbarkeit war ich wohl ein glückliches Kind. Ich konnte mich auf mein Kindermädchen Anja verlassen, ich konnte mich auf meinen Vater verlassen, mehr verlangte ich nicht. Ich erlebte mein Leben als stimmig, nahm mich selbst, wie ich mich vorfand, und es gab nichts Grundlegendes zu hinterfragen. Ich liebte Anja, auch wenn ich das nicht so gesagt hätte. Ich war auf sie angewiesen, fühlte mich aber nicht im Geringsten abhängig von ihr. Ich fand sie schön, ohne sagen zu können, warum. Mein Blick zerfiel nicht in gierige Splitter, hob keine Details hervor und saugte sich nicht an Besonderheiten fest. Aber – und warum hätte es mir anders ergehen sollen als all den anderen Menschenkindern seit unseren Urahnen im Paradies – mein Bewusstsein entrollte sich wie eine Schlange, ich wurde meiner selbst gewahr, indem ich mich durch die Augen anderer sah, nach und nach verlor ich mein einheitliches, schuldloses, stimmiges Ich und stülpte meinem jungen, fließenden Menschsein eine Maske über.
Als ich eingeschult wurde, konnte ich bereits lesen und schreiben. Mein Vater hatte es mir beigebracht; wie mir schien, ohne dass er oder ich es darauf angelegt hätten, es hatte sich einfach so ergeben, und da mir auch das Rechnen nicht schwerfiel, übersprang ich bald eine Klasse und verwandelte mich von einem Tag auf den anderen zum Kleinsten unter meinen Mitschülern. Meine Unfähigkeit zu jeder Art von Grausamkeit, Härte, Spott, Kampflust erschien nun noch mehr wie ein Makel. Ich regte mich bei den geringsten Ungerechtigkeiten furchtbar auf – noch stärker, wenn sie nicht mich, sondern andere zum Opfer machten. Häufig bekam ich Kopfschmerzen, weil mir die anderen zu nah, zu laut, zu stark riechend oder zu hässlich erschienen. Ich musste den Unterricht oft frühzeitig verlassen oder blieb gleich ganz zu Hause. Mich verfolgten Geschichten, die die älteren Jungen erzählten, nicht allein wegen ihres Inhalts (zum Beispiel wie ein Mädchen aus der Gegend versucht habe, sich umzubringen, aber zu doof dazu gewesen sei und sich beim Sprung von einem Turm nur Arm und Bein gebrochen habe), sondern mehr noch wegen der Häme, mit der sie erzählt wurden. Mich irritierte die gehässige Weise, in der über weibliche und männliche Geschlechtsteile gesprochen wurde, als seien sie ein Grund, sich zu schämen. Auch Zuneigung zwischen Jungen und Mädchen schien zunehmend etwas zu sein, wofür man sich schämen musste. Es galt als peinlich, jemandem nahe sein zu wollen, gleichzeitig galt es als äußerst erstrebenswert. Vieles ergab einfach keinen Sinn. So nannten mich beispielsweise zwei Jungen «Schwuli». Von Anja erfuhr ich, dass Schwule statt Mädchen andere Jungen liebten, und nichts hätte falscher sein können. In der Regel widerten mich Jungen an. Immer wollten sie Löwen, Tiger, Wölfe oder andere Raubtiere sein, wild und gefährlich und am obersten Ende der Nahrungskette. Ihre Angeberei, ihr Gebrüll, ihre ungelenken Bewegungen, ihre ständigen Versuche, besonders abgehärtet zu erscheinen, stießen mich ab. Ich hielt mich fast nur unter Mädchen auf, am liebsten unter jüngeren, sanften, klugen, die die Grausamkeit der Jungen genauso argwöhnisch verfolgten wie ich.
Ich weinte viel und wurde deswegen ausgelacht. Einmal brüllte ein Mann auf dem Schulweg seinen Hund an und schlug ihn dann mit der Leine. Ich stand wie erstarrt, dann kamen mir die Tränen: vor Wut und Mitgefühl und Ohnmacht. Drei Jungen, die mich beobachtet hatten, äfften mich nach. Einer fragte, ob sie meine Mutti rufen sollten. Ein anderer sagte, das sei doch nur ein dummer Hund. Ich verstand sie nicht, sie verstanden mich nicht. Sie sagten auf dem Pausenhof: «Deine Mutter ist tot, deine Mutter ist tot.»
Nachts lag ich wach und fragte mich, was mit mir nicht stimmte. Ich hatte mich mit mir selbst entzweit. Nun empfand ich den Gedanken, nicht richtig zu sein, als bedrückend, konnte ihn aber weitaus leichter ertragen als die Vorstellung, in einer falschen Welt zu leben, die von lauten, grausamen Halbaffen beherrscht wurde. Mir dämmerte, dass es auf eine Entscheidung hinauslief: die Welt und ihre Bewohner zu akzeptieren, zu lernen, mich anzupassen und abzuhärten, also ein wenig so zu werden wie sie, oder zur Welt auf Distanz zu gehen, wenn vielleicht auch nicht auf so extreme Weise wie meine Mutter. Eine Lösung für diesen Konflikt glaubte ich erst viel später bei den Wielands gefunden zu haben.
Mein Elternteilhaus stand in einem Vorort von Köln, in einer Straße am Rande des Forstbotanischen Gartens. Hier sorgte seit meinem fünften Lebensjahr während des Tages Anja für mich. Sie hatte sich meinem Vater und mir als kaugummikauender, redseliger Teenager vorgestellt, der nach der mittleren Reife keine beruflichen Ambitionen entwickelt hatte. Ich mochte sie sofort, und mein Vater ließ mir meinen Willen. Anja kam mir damals groß und erwachsen vor mit ihren schwarz lackierten Fingernägeln und der schwarzen, hochtoupierten Frisur. Wir bauten Höhlen aus Stühlen und Bettdecken, trommelten auf Töpfen und leeren bis halbvollen Waschpulverkartons. Anja brachte mir auch bei, welche Kräuter und Pilze man essen kann und woran man die giftigen erkennt. Einmal verdarb ich mir beim Verzehr solcher Wald-und-Wiesen-Kost den Magen, und Anja versorgte mich so angenehm mit Cola und Salzstangen, dass ich bald darauf sagte, ich würde gerne mal wieder einen «falschen Pilz» essen. In der Folge dieses Erlebnisses wurde ich tatsächlich häufiger krank, um zu Hause bleiben und von Anja versorgt werden zu können.
Manchmal, wenn es mit ihnen besonders gut oder besonders schlecht lief, erzählte mir Anja von ihren «Typen». Redete sie sich in einen Rausch, und das konnte schnell geschehen, dann wollte sie zwischendurch rauchen. Dazu musste sie auf Anweisung meines Vaters auf die Terrasse gehen, obwohl der Hausherr selbst in allen Räumen eine Pfeife an der anderen ansteckte, was ihm zufolge etwas ganz anderes, nämlich «Genussrauchen» war. Anja hatte aber ohnehin nichts gegen Aufenthalte auf der Terrasse. Ohne zu murren, schob sie die gläserne Schiebetür zur Seite und trat ins Freie. Wenn sie weitererzählen wollte, kam ich mit nach draußen, und da standen wir dann, sie rauchend, ich im Bademantel oder Anorak, manchmal unter einem Schirm, manchmal schlotternd vor Kälte, aber froh, in der Nähe des Kindermädchens zu sein, mit dem es mir nicht langweilig wurde. Ich fand es spannend, wenn auch nicht explizit erregend, dass sie mir beispielsweise einmal ihre Brüste zeigte und lachend fragte, ob sie mir gefielen und ob ich sie einmal anfassen wolle. Sie gefielen mir, und ich fasste sie an. Manchmal badeten wir zusammen, und ich wunderte mich über das dichte, krause Haar zwischen ihren Beinen.
Wir tanzten im Wohnzimmer zu Radiomusik, das mochte ich besonders. Dabei ging ich aus mir heraus. Und das war etwas, das ich laut der Direktorin unserer Grundschule lernen sollte: aus mir herauszugehen. Anja brachte auch Musikkassetten mit, von ihr zusammengestellte «Mixtapes», die «fetzten». Einmal sagte sie zu meinem Vater, ich sei ein Super-Tänzer. Mein Vater erwiderte verwirrenderweise, Anja könne ruhig ein bisschen «höhere Maßstäbe» anlegen, zum Beispiel beim Kochen. Dabei fand ich ihr Essen ausgezeichnet. Es gab Kartoffelbrei und Rahmspinat, Spaghetti Napoli, Maultaschen mit Gemüsefüllung und Pizza Tonno. Kam mein Vater schon zum Mittagessen nach Hause, tischte Anja verlässlich Fleisch auf, etwas, das ich nicht essen wollte, seit ich wusste, dass Tiere dafür gezüchtet, eingesperrt und getötet wurden. Bei Fischen sah ich es anders, und den Zusammenhang zwischen Milch und getöteten Kälbern verstand ich damals noch nicht. Anja und mein Vater aßen Fleisch. Aber während es Anja völlig in Ordnung fand, dass ich mich davor ekelte, und mir eben andere Speisen zubereitete, bestand mein Vater immer wieder darauf, dass ich es versuchte.
«Ein Junge, der keine Würstchen mag», sagte er und sah Anja an, aber sie lächelte nur und sagte: «Ist auch ein Junge.»
Denke ich an meinen Vater, sehe ich ihn fast immer in Dunkelheit oder Dämmerung vor mir. Als Gymnasialdirektor kam er nicht selten schon tagsüber nach Hause, verschwand dann aber in der Regel gleich in seinem Zimmer. Mir war das recht, denn so konnte ich weiter mit Anja spielen, was meinen Vater nicht störte, obwohl er dafür vermutlich extra bezahlen musste. Zum Abendessen oder einem sogenannten Fünf-Uhr-Tee ließ er sich dann blicken und zeigte sich nicht unfreundlich. War Anja schließlich gegangen, veränderte sich die Atmosphäre des Hauses. Es wurde stiller, die Möbel erschienen dichter, ich wurde langsamer und schwerer.
Ich erzählte meinem Vater nie, wie es mir unter den Gröberen der Schulkinder erging. Ich verschwieg auch die Albträume, die grässliche Angst, die ich nachts hatte. Bei dieser Verschwiegenheit half mir, dass ich die Schule vergaß, wenn ich mich zu Hause aufhielt, und die Angst der Nächte nicht mehr greifen konnte, wenn das Licht des Tages schien. Aber obwohl ich meinem Vater das Abbild eines halbwegs normalen Jungen präsentierte, ahnte er meine Probleme und versuchte, mir auf seine stille Weise zu helfen. So sagte er einmal, als ich mit gequälter Miene einer immer wieder gegen die Glasscheibe stoßenden Fliege zusah: «Das Leben ist eine Komödie für den Denkenden und eine Tragödie für die, welche fühlen.» Ich wusste nicht recht, worin der Unterschied zwischen Denken und Fühlen bestehen sollte – führte nicht das eine zwangsläufig zum anderen und vermischte sich sogar damit? –, aber mein Vater wollte mir ein Mittel gegen die Verzweiflung in die Hand geben, ein Antidot gegen Gefühlsaufwallungen und Ängste: die Möglichkeit, sich der Welt als Wissbegieriger zu nähern. An manchen Abenden oder Wochenendnachmittagen saß ich neben ihm an seinem Schreibtisch und versank in dieser Welt, die mir Anja nicht hätte zeigen können. Der – in meinen Augen – alte Mann mit der gebogenen Nase las mir Märchen vor, später dicke Bände von Karl May oder Geschichten von Wilhelm Hauff. Er studierte mit mir große Bildbände, die Werke von Dürer, Rembrandt, Goya oder Picasso auf ganzen Seiten und in kräftigen Farben präsentierten. Er fragte mich nach meiner Meinung zu den Bildern, erklärte mir den goldenen Schnitt, verschiedene Maltechniken, Merkmale bestimmter Epochen sowie die Bedeutung wiederkehrender Symbole. Er hielt mich dazu an, auf Details zu achten und der Frage nachzugehen, warum der Maler dieses oder jenes genau so und nicht anders dargestellt hatte.
Ich konnte meinem Vater jede Frage stellen, immer hatte er Geduld mit mir, ich musste mich nie dumm fühlen. Wenn wir beide etwas nicht wussten, es aber wissen wollten, suchte er in Büchern nach einer Antwort oder rief jemanden an. Die Leidenschaft meines Vaters für Wissen erlebte ich nicht als hoch aufleuchtendes, schnell in sich zusammensackendes Feuer, sondern als konstant glühende Flamme. Er hatte Zeit. Er musste niemandem etwas beweisen.
Aber es wurde nicht besser mit mir. Ich ging bereits aufs Gymnasium und litt mehr denn je an Albträumen und Eindrücken, die mich verfolgten. Realistische Darstellungen von Krieg, Folter und der Erniedrigung von Frauen suchten mich ebenso heim wie beispielsweise das schlecht gezeichnete Titelblatt eines Gruselheftes. Es zeigte einen Mann mit zweigeteiltem Gesicht: die eine Hälfte menschlich und schmerzverzerrt, die andere eine Wolfsfratze. Tagelang sah ich das Bild vor mir, es teilte mir etwas mit, das ich nicht wahrhaben wollte. Vor allem nachts füllten solche Bilder meine Vorstellung wie ein Gift, das in der Dunkelheit seine volle Wirkung entfaltete. Wie ein Fieber stieg die Angst in mir auf und setzte meine leicht entzündliche Phantasie in Brand, bis sich mein Denken auf das verengte, was es fürchtete.
Dann, von einem Tag auf den anderen, verließ mich Anja, laut meinem Vater, weil ich zu alt und sie außerdem schwanger geworden war. Sie verabschiedete sich nicht von mir, sondern kam einfach nicht mehr. Ich weinte wochenlang. Später sah ich sie einmal mit einem «Typen» und einem Kinderwagen auf der Straße. Sie wuschelte mir durch die Haare, und es gefiel mir nicht.
Mein Vater veränderte sich in diesen Tagen. Manchmal wurde er seltsam redselig, auf eine überschäumende, unpassende Weise. Etwas stimmte dann nicht mit seinen Augen und seiner Stimme. Er redete von «neuen Konzepten», die er an seiner Schule umzusetzen gedenke, einem «anderen Lernen», einer «fundamentalen Veränderung des Bewusstseins». In manchen Nächten streifte er im Haus umher und kam nicht zur Ruhe. Er trank Rotwein aus Wassergläsern und ließ sie im Haus herumstehen. Ohne Anja fehlte es uns an Ordnung und Struktur.
Es war in diesen Tagen, als mein Vater mit mir während einer unserer gemeinsamen Lektüren an einem Frühlingsabend ein Gemälde aus einem Bildband betrachtete, auf dem nackte Frauen aus einem Teich auftauchen und einen Mann anstarren, der sich zu ihnen hinabbeugt. Mein Vater hielt sich nicht lange mit einer nüchternen Analyse des Gemäldes auf. Er erzählte mir auf sonderbar euphorische Weise von den Nymphen. Das seien keine Menschen, auch wenn sie so aussähen. Naturgeister seien sie, wie Sylphen, Gnome, Salamander und Nixen. Mein Vater sog schmatzend an seiner Pfeife, blies langsam Rauch aus und sagte: «Deine Mutter war eine Nixe.» Seine Stimme klang fremd. Er sprach sonst nie über meine Mutter. Wenn wir zum Friedhof gingen und das Grab pflegten, ersparte mein Vater mir (und sich) jegliche Erinnerungen. Jetzt aber geriet er ins Reden: Eine Mahrtenehe sei das gewesen, eine Hochzeit zwischen einem Sterblichen und einem überirdischen Wesen.
«Aus dem Wasser ist sie gekommen, ins Wasser ist sie wieder gegangen», sagte er und lächelte. «Sie hat es mir vor unserer ersten Nacht gesagt. Und dann noch einmal in der Nacht vor der Hochzeit: Ich bin kein Mensch. Das sieht nur so aus. Ich habe keine Seele.»
Ich zeigte auf das Bild und bat meinen Vater, doch lieber etwas über den Mann darauf zu sagen, aber er hörte mich nicht und redete weiter.
«In Wirklichkeit war sie eine Nixe. Verstehst du, was das bedeutet?», sagte er. Ich schüttelte den Kopf. Ein schwarzes Haar ragte aus dem rechten Nasenloch meines Vaters, als taste ein Krebsfühler aus einer Muschel.
«Ein Teil von dir ist nicht menschlich.» Er lachte und wiegte den eckigen Kopf. «Du hast Nixenblut in dir. Du bist ihr manchmal so unheimlich ähnlich. Das hat Vor- und Nachteile, mein Junge. Du wirst sehen.» Während er das sagte, sah er mich unverwandt an, so wie er es sonst nie tat, und seine Pupillen schimmerten schwarz und feucht und so groß, dass sie seine Regenbogenhäute fast zur Gänze füllten.
In dieser Nacht träumte ich kristallklar, farbig und mit der Fähigkeit, Klänge zu hören: Ich finde mich in dem dunkelgrün gekachelten Badezimmer, in dem sich meine Mutter getötet hat. Dort sitzt sie im schaumgekrönten Wasser der Wanne. Ihr Gesicht strahlt hell und schön. Sie streckt mir eine Hand entgegen. Aus dem Schaum am unteren Ende der Badewanne ragt ihr silbern schillernder und sich sanft schlängelnder Fischschwanz, er wächst mir entgegen, wickelt mich ein und zieht mich ins Wasser. Die Wanne ist bodenlos. Unter ihr ist das Meer. Ich sinke, ich gefriere, doch mein Herz schlägt laut und fest wie ein metallener Klöppel in einem Gehäuse aus Eis.
Nass von Schweiß wachte ich auf und spürte noch den Druck auf der Brust, in der das Herz so fest schlug, dass ich Angst bekam, es könne kaputtgehen. Ich spürte den Fischschwanz auf der Haut. Ich fürchtete mich nicht nur vor ihm und dem Meer, sondern auch vor mir selbst. Etwas stimmte mit mir nicht. Das konnte ich nicht mit mir selbst ausmachen. Also wagte ich mich aus meinem Bett, nahm Decke und Kissen und ging zum Schlafzimmer meines Vaters. Lange blieb ich vor der Tür stehen, weil ich mich schämte und Zurückweisung fürchtete. Aber ich konnte nicht zurück in mein Zimmer. Ich konnte diese Nacht nicht alleine ertragen. Ich legte mein Ohr an die Tür. Ich wartete darauf, dass mir jemand die Entscheidung abnahm. Als mir kalt wurde, klopfte ich und hörte sofort ein Räuspern, dann ein belegtes «Ja?». Ich öffnete die Tür und sah im Schein einer Nachttischlampe das Doppelbett. Mein Vater saß darin wie ein Schiffbrüchiger auf einem Floß. Während er mich ansah, wurde mir bewusst, dass er eine Pfeife in der Hand hielt, also noch nicht geschlafen hatte. Er nickte mir zu, brillenlos und fremd, und ich richtete mich ohne ein Wort neben ihm auf dem großen Bett ein. Peinlich laut raschelte mein kindlich und lächerlich wirkendes Bettzeug. Dann lag ich da und fühlte mich unwohl: Der Rauch biss mir in Lunge und Augen, ich schämte mich für meine Bedürftigkeit, die Situation erschien mir zu körperlich. Mein Vater war kein Mensch, neben den man sich ins Bett legte. Er beugte sich zu mir und berührte meine Schulter. Während er sie lange und auf gleichzeitig verhaltene wie fordernde Weise streichelte, sah ich zum ersten Mal bewusst seine Hand. Ich sah die kurzen, flachen, irgendwie schief erscheinenden Daumennägel, die Adern, die seinen Handrücken wie Wälle aus aufgeschüttetem Fleisch überzogen, die geriffelte Haut über seinen Fingergelenken. Dann löschte er das Licht. Der Schalter klickte viel lauter als gewöhnlich. Seine Hand kehrte zurück.
Ich hätte mich meinem Vater nicht aufdrängen dürfen. Ich übernachtete nie wieder in seinem Zimmer. Seine Unnahbarkeit war ganz plötzlich, wenn auch nur für kurze Zeit, von ihm abgefallen und dauerhaft auf mich übergegangen. Kurz nach dieser Übernachtung und lange bevor ich in die Familie der Wielands aufgenommen wurde, zeigte sich meine Fähigkeit, mir selbst gegenüber so unberührbar zu sein, dass ich mich wie betäubt fühlte, ein Zustand, der mir ungeheure Möglichkeiten eröffnete. Ich rollte keineswegs als ungeprägte Rohmünze in die Freie Schule Schwanhagen, sondern als jugendliche Verkörperung eines Charakters, der – ich weiß, dass viele das anders sehen – bereits in der Zeugung in mir angelegt und im Laufe der Jahre lediglich deutlicher wurde, vergleichbar mit einem Bild auf dem Grund eines Sees, das man immer genauer erkennt, je länger man durch das Wasser blickt.
Im gleichen Frühling – ich war mittlerweile dreizehn Jahre alt – leiteten zwei Ereignisse den entscheidenden Wechsel in meinem Leben ein: Mein Vater lernte eine Frau kennen, oder sie ihn. In kürzester Zeit verlor er das Interesse daran, mich in seinem Arbeitszimmer privat zu unterrichten, Bildbände mit mir zu betrachten, aus Büchern vorzulesen oder gemeinsam großen und umfassenden Fragen nachzugehen. Und mir war es ganz recht, da ich mich nicht nach der Nähe meines Vaters sehnte. Kam es doch noch einmal zu einer solchen Sitzung, erlebte ich ihn als wenig konzentriert und unterschwellig gereizt, weil auch ich nicht recht bei der Sache zu sein schien. Ich kann nicht sagen, dass mich sein Verhalten störte, in gewisser Weise nahm ich es als folgerichtig wahr. Auch ich veränderte mich und wollte weder ewig der Lehrling meines Vaters bleiben, noch wusste ich, welche Rolle ich stattdessen einnehmen sollte. Ich fühlte mich nicht wirklich unwohl auf dem Gymnasium, auf das ich ging. Mein Vater unterrichtete an einem anderen. Rückblickend würde ich sagen: Ich fühlte mich so gut wie gar nicht. Ein dumpfer Schleier hatte sich über meine intensiven Empfindungen gelegt, die mein Wesen nur noch manchmal erschütterten, dann jedoch heftig und als hätten sie sich über einen längeren Zeitraum aufgestaut. Anstelle starker Empfindungen beherrschten mich nun häufiger grelle Phantasien, die um Abseitiges, Grausames und Abgründiges kreisten und mich geradewegs zum zweiten wichtigen Ereignis führten: Eines Nachmittags stöberte ich in der Stadtteilbibliothek unseres Viertels und entdeckte einen Band, den eine dekolletierte Frauenbüste mit geschmücktem Haar vor schwarzem Hintergrund zierte. Anstelle des Gesichts hatte die Erscheinung einen Totenkopf, dessen leere Augenhöhlen in mein Innerstes zu glotzen schienen. Das Buch trug den Titel «Geschichten des Grauens» und enthielt ausgewählte Erzählungen von Edgar Allan Poe. Ich wollte es unbedingt haben. Ich, der Furchtsame, ich, der Dünnhäutige, wollte dieses Buch besitzen wie ein magisches Objekt, das mir Stärke verleihen musste. Die Bibliothekarin hielt mich für zu jung, also lieh mein Vater, der mir in derlei Dingen nie einen Wunsch ausschlug, den Band für mich. Ich las ihn und fand meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. In Geschichten wie «Hopp Frosch», «Der Doppelmord in der Rue Morgue» oder «Das verräterische Herz» war von Grausamkeiten die Rede, wie ich sie bisher so präzise noch nicht geschildert gefunden und folglich auch nicht gedacht und gefühlt hatte. Ich verstand nicht jedes Wort, doch das erhöhte nur den Reiz. Ich las wie im Rausch und lief danach mit mir selbst redend durch die nun verändert wirkenden Straßen unseres Viertels. In der Art, wie der Autor sich dem Grauen näherte, fand ich – zunächst mehr als Ahnung denn als klare Idee – einen Weg für mich, mit den Schrecken der Welt umzugehen: Ich würde ihnen nicht mehr ausweichen, und ich würde nicht ihr dummes Werkzeug werden. Ich würde mich weder auf die eine noch auf die andere Weise als ihr Opfer fühlen. Vielmehr würde ich sie erforschen und ihr unbestechlicher Chronist werden, mit nicht nachlassender Neugier und ohne zu werten. Ich würde in lichtlose Abgründe steigen, tiefer als all die angeblich abgehärteten Jungen mit ihrem dummen Gerede.
Von meiner Faszination für Poe erzählte ich nur einem anderen Menschen. Johanna ging in meine Klasse. Sie trug eine Zahnspange, und fettige Haare hingen ihr ins verpickelte Gesicht. Sie galt als uncool, wer sich mit ihr abgab, galt ebenfalls sofort als uncool. Nichts an ihr stimmte. Sie sagte wenig, ließ die Schultern hängen, trug die falsche Kleidung und wirkte eigentlich immer verletzt. Ich mochte sie. In meinen Augen erschien sie still und sanft und tief. Anders als die meisten ging sie mir nicht auf die Nerven. Und sie hörte zu, wenn ich von meinen Erlebnissen mit Poe erzählte, von meiner Liebe für Dupin, den Meisterdetektiv, und seine atemberaubende Methode der Schlussfolgerung. Wegen Johanna bekam ich allerdings bald noch mehr Probleme in der Schule, als ich sie ohnehin schon hatte.
Der Unterricht fiel mir entweder ermüdend leicht, oder ich konnte ihm nicht folgen und verlor den Anschluss. Letzteres betraf vor allem das Fach Chemie, aber auch Physik, Mathematik und Biologie. Es kam mir vor, als solle ich genötigt werden, ein Phantasiesystem aus willkürlichen Bezeichnungen und Zahlen zu erlernen, das mir keinerlei Vergnügen oder Nutzen bescherte. Mir war es gleichgültig, wie viele Protonen sich im Kern des Wasserstoffatoms befanden. Genauso gut hätte man mir auftragen können, ich solle die Namen sämtlicher Handballtorwarte der tschechischen Regionalliga von 1950 an auswendig lernen und auf Wunsch rückwärts aufsagen. Natürlich spiegelte sich mein Desinteresse bald in meinen Noten wider. Die Lehrer reagierten verständnislos auf mein Schweigen und meine wachsende Lustlosigkeit. Sie hielten Johanna und mich für hoffnungslose Fälle.
Johanna war Einzelkind wie ich; sie verriet mir, dass ihr Vater und ihre Mutter täglich Alkohol tranken und danach stritten. Sie habe ihre Mutter immer wieder gebeten, das Trinken zu lassen, und ihre Mutter habe es ihr versprochen, sich dann aber nicht daran gehalten. Manchmal, sagte Johanna, glaube sie, sie würde verrückt. Sie sagte es beiläufig und so, als hätte es nichts mit ihr zu tun, aber ich war erschüttert. Ich versuchte sie zu ermuntern, bei anderen Erwachsenen Hilfe zu suchen, doch sie sagte, das hätte sie schon vergeblich getan. Ich erzählte es meinem Vater, der meinte, es gebe eben solche traurigen Schicksale, wir könnten daran nichts ändern.
Einmal machten sich zwei Jungen kurz vor der Schulstunde in einer Regenpause im Klassenzimmer über Johanna lustig. Sie sei flach wie ein Brett, und ihre Eltern seien asozial. Mir falle das wohl nur nicht auf, weil ich so ein Homo sei. Der eine Junge machte Johannas Mutter nach, wie sie lallend mit seiner Mutter gesprochen habe. Dafür könne Johanna doch nichts, sagte ich. Meine Stimme zitterte. Der Junge sah mich grinsend an: «Du bist so ein Schwächling. Oder warum hältst du sonst zu dem Müllmädchen?»
Ich fühlte mich sonderbar ruhig, als ich den Zirkel nahm und mit der Spitze in das Gesicht des Jungen stach. Anschließend gab es wegen mir eine Lehrerkonferenz. Es hieß, ich hätte dem Jungen ein Auge ausstechen können. Ich musste mich bei ihm entschuldigen, auch wenn er das gar nicht wollte. Außerdem musste ich mit einer Psychologin reden, die mich nicht mochte. Man überlegte, ob ich nicht in einer Sonderschule besser aufgehoben wäre. Mein Vater schlug vor, dass ich besser auf eine alternative Schule wechseln sollte. Tatsächlich hatte er schon eine ganz bestimmte «Lehranstalt» im Sinn: die Freie Schule Schwanhagen. Dort gebe es keine Zensuren, sondern ein «Lernen vom Kinde aus», also einen «ressourcenorientierten Ansatz», dem zufolge ich nicht als Mängelwesen zugerichtet, sondern als Individuum mit einzigartigen Fähigkeiten gefördert werden solle. Die blassen Worte und die blutleere Begeisterung meines Vaters erzeugten bei mir blitzartig Müdigkeit.
Wie sich bald zeigte, stammte die Idee, mich auf diese freiste aller Freien Schulen zu schicken, von der neuen Frau (Konstanze Schallmeyer: blonde Haare, schwarzer Kajal, grüne Augen, dunkle Kleidung, Silberschmuck). Mein Vater lud sie und mich zu einem Abendessen in einem italienischen Restaurant ein, damit wir uns einmal besser kennenlernen konnten. Frau Schallmeyer unterrichtete Französisch und Philosophie am Gymnasium meines Vaters, interessierte sich sehr für Pädagogik, vor allem in ihren progressiven Ansätzen, und sie kannte ein Paar, dessen Tochter seit einem Jahr «mit großem Erfolg» die Freie Schule Schwanhagen besuchte. Es handele sich um eine ganz neue, alternative Einrichtung, entstanden aus einer privaten Initiative. Das Ganze sei so neu und so alternativ, es gebe noch nicht einmal einen Prospekt. Alles laufe derzeit über persönliche Empfehlungen.
«Für einen intelligenten jungen Mann wie dich ist das sicher ein ausgesprochen gedeihliches Umfeld», sagte sie zu mir. «Gedeihlich» – mit solchen Ausdrücken konnte man mich in diesem Lebensabschnitt tatsächlich für sich und seine Pläne einnehmen. Ich fühlte mich geschmeichelt und zugleich verunsichert. Zu meiner Verunsicherung trug bei, dass es sich bei Frau Schallmeyer eindeutig um ein sexuelles Wesen handelte. Als ich an diesem Abend einmal aufstand, um auf die Toilette zu gehen, sah ich ihre ausgiebig beringte Hand auf dem cordumhüllten Oberschenkel meines Vaters liegen. Schlimmer als diese besitzergreifende Hand fand ich die seit Wochen stattfindende Verwandlung meines Vaters: Er zeigte mittlerweile ebenfalls verstörende Anflüge von Sinnlichkeit, lächelte manchmal völlig untypisch, um nicht zu sagen: dämlich, und ließ sich tatsächlich von Madame Schallmeyer zu Mundküssen vor aller Augen hinreißen. Obendrein sprach er in ihrer Gegenwart mit einer weicheren, höheren Stimme. All das verstärkte die Abneigung, die ich ihm gegenüber zunehmend empfand.
Im Laufe des Gesprächs kam ans Licht, dass es sich bei der Freien Schule Schwanhagen um ein Internat an der Ostsee handelte, in der ehemaligen DDR, gut 600 Kilometer von meinem Heimatort entfernt.
«Das scheint mir sehr weit weg», sagte ich.
«Das hat Julia am Anfang auch gesagt», erwiderte Frau Schallmeyer. «Mittlerweile hat sie so viele Freunde gefunden, dass sie es fast schade findet, wenn Ferien sind und sie nach Hause fährt.»
«Das klingt, als ob sie dort eine zweite Heimat gefunden hätte», assistierte mein Vater weit unter seinem Niveau.
«Aha», sagte ich. Frau Schallmeyer lächelte mich an und spießte dann ein Stück Kalbfleisch auf die Zinken ihrer Gabel.
«Sie wohnen dort in Familien», sagte sie. «Immer sechs bis elf Schüler und zwei Pädagogen.»
«Ich finde, das klingt interessant», sagte mein Vater.
«Was findest du daran interessant?», fragte ich.
«So ein Umfeld bietet doch ganz andere und vielfältigere Einflüsse als ein fast leeres Haus mit einem einzigen Lehrervater.»
Ich sagte nichts und wühlte mit der Gabel in meinen Spaghetti Vongole, einem Gericht, das ich aufgrund seines exotisch klingenden Namens ausgewählt hatte.
«Tilman», sagte mein Vater fast feierlich, «du bist mittlerweile zu alt, als dass ich dir noch geben könnte, was du brauchst.»
Ich wollte fragen, was genau ich denn brauchte, wusste aber schon die Antwort: ganz andere und vielfältigere Einflüsse.
«Ich habe die Gründer der Schule kennengelernt», sagte Frau Schallmeyer. «Beeindruckende Persönlichkeiten.»
«Und was ist an diesen Persönlichkeiten so beeindruckend?», fragte ich.
«Sie sind wirklich frei und lassen anderen ihre Freiheit. Ihr Motto ist: ‹Werde, der du bist.› Sie möchten den Heranwachsenden helfen, zu tun und zu lassen, was sie aus sich heraus wollen. Allerdings glaube ich, dass das nicht für jeden etwas ist.»
«Wie meinst du das?», fragte mein Vater. Mich störte, dass er Frau Schallmeyer duzte.
«Ehrlich gesagt gibt es auch Jugendliche, die die FSS nach wenigen Monaten wieder verlassen. Manche Menschen brauchen Vorschriften und bevorzugen die Sicherheit, die ein Dasein als Befehlsempfänger mit sich bringt. Sie quälen sich lieber jahrelang durch Fächer, deren Sinn sie nicht verstehen, als selbst zu bestimmen, was sie lernen wollen.»
«Ich kann an dieser Schule selbst bestimmen, was ich lernen will?», fragte ich.
«Ja», sagte mein Vater. «Ich habe dir doch von dem Prinzip erzählt: Bildung vom Kinde aus. Oder in deinem Falle: vom jungen Mann aus.»
«Tatsächlich ist die Schule umstritten. Die Wielands sind es sowieso», warf Frau Schallmeyer ein. «Manche konservativen Pädagogen wittern da geradezu eine Art Terrorzelle.»
«Wieso denn das?», fragte ich.
«Die Wielands und ihre Ideen haben schon was Wildes», sagte Frau Schallmeyer, nun fast so, als habe sie schon genug gesagt.
«Was heißt das?» Ich sah abwechselnd Frau Schallmeyer und meinen Vater an.
«Das kann ich jetzt nicht erklären», sagte Frau Schallmeyer. «Zumindest muss deren Familie einfach spitze sein. Und sehr speziell. Aber natürlich ist nicht gesagt, dass du dort hineinkämst. Genau genommen ist gar nicht sicher, dass du überhaupt an der FSS genommen wirst.»
«Ich kann mir die Schule ja einmal ansehen», sagte ich und fand mich dabei recht erwachsen.
Zweites Kapitel
Am Morgen, bevor mein Vater mit mir die weite Fahrt zu dem fortschrittlichen Internat an der Ostsee unternehmen wollte, litt ich plötzlich an Halskratzen, verstopfter Nase, Mattigkeit und Kopfdruck. Ich bat meinen Vater, die Tour zu verschieben. Er zeigte sich erstaunlich gleichgültig und meinte, das sei meine Entscheidung. Ich wurde wankelmütig, fühlte mich nach einem ans Bett gebrachten Becher Tee und einer Dusche schon frischer und stimmte der weiten Fahrt schließlich doch zu.
So fuhren wir mit unserem schwarzen Saab Hunderte von Kilometern und weiter, als ich es mir hatte vorstellen können, nach Schwanhagen bei Wismar, in eine Gegend, die noch vor wenigen Jahren zur DDR gehört hatte und nun als so etwas wie der wilde Osten der Bundesrepublik angesehen wurde, ein fremdes Land. Wir fuhren und fuhren und schwiegen die meiste Zeit. Wir hörten Radio (Klassiksender, später Deutschlandfunk) und zwei Hörspiele (die Sherlock-Holmes-Geschichte Eine Studie in Scharlachrot und Poes Der Untergang des Hauses Usher), die ich eigens für die Fahrt von CD auf Kassette überspielt hatte. Neben der Schweigsamkeit und dem Fahren bei gleichförmigem Tempo durch gleichförmige Landschaften lullte mich die aufziehende Erkältung ein. Irgendwann hielt mein Vater mir aus dem Nichts einen Vortrag, der sich mir tief ins Gedächtnis grub, vermutlich, weil er so gut zu meiner neuen Ausrichtung als Erforscher der Finsternis passte. Er erklärte mir, dass es in Bezug auf Wissen drei Arten von Menschen gebe, wobei sich natürlich in jede Art etwas von den anderen mischen könne. Der erste Menschenschlag interessiere sich für Wissen nur, wenn es seinen Zwecken nutze, und habe auch kein Problem damit, sich die Dinge so zurechtzubiegen, wie es den eigenen Bedürfnissen entspreche. Dem zweiten Menschenschlag fehle diese rücksichtslose Entschlossenheit, aber ebenso die Energie, sich für Zusammenhänge und Hintergründe zu interessieren. Dieser Typus wolle vor allem seine Ruhe haben, dabei aber vor sich und anderen als durchaus interessiert und verantwortungsbewusst dastehen. Daher orientiere er sich an den Meinungen der Mehrheit, die wiederum auf anerkannte Experten höre, sofern es ihr nachvollziehbar und genehm sei. Der dritte Menschenschlag interessiere sich mehr für das Wissen als für sich selbst. Etwas wirklich zu verstehen sei ihm tiefster Antrieb, ein Streben, in dem der Wunsch aufschimmere, sich selbst durch das Eingehen in etwas Größeres zu überwinden. Solchen Menschen gehe es nicht darum, recht zu bekommen oder Macht-, Geld- und Anerkennungsgelüste zu befriedigen, vielmehr verschaffe ihnen das Wissen selbst die größte Lust. Allerdings müsse auch der wirklich Wissbegierige darauf achten, dass sich seiner Absicht, die Erkenntnis zu mehren, nicht doch andere Absichten beigesellten, unter denen die Eitelkeit die häufigste und heimtückischste sei. Ich solle es mir so vorstellen: Man müsse still werden wie ein Bergsee, in dessen glatter Oberfläche sich umso besser der Himmel spiegele, je weniger Bewegung im Wasser sei.
Ich fand mich ganz versunken in Gedanken über die Worte meines Vaters, als wir uns dem Ziel allmählich näherten: Die Sonne schien aus frühlingsblauem Himmel auf eine Landschaft, der ich die Meeresnähe anzusehen glaubte, und überzog die Gegend mit einem ganz eigenen Glanz, in dem Büsche und Bäume wie fein ziselierte Messingarbeiten wirkten. Der Himmel, die Wiesen, die Felder und die Dörfer mit ihren buckligen Kopfsteinpflastern, Storchennestern und Kirchtürmen entrückten mich in ein Mittelalter, ein Sagenland, kein unpassendes Umfeld für einen wie mich, und während ich mich fragte, was diese Umgebung mit mir und aus mir machen würde, vergaß ich meine anschwellende Erkältung und den Ärger darüber, dass mein Vater ohne Rücksicht darauf Pfeife rauchte.
Als wir Schwanhagen etwa eine halbe Stunde später erreichten, schlug das Wetter um. Über dem Ort mit seinen wenigen Straßenzügen und einigen wahllos in die Wiesen gewürfelten Häusern trieben jetzt schwarze Wolken durch einen dunkelblau-violetten Himmel. Die Internatsgebäude, die ich vom Parkplatz aus sah, erschienen mir in diesem plötzlich veränderten Licht wie die letzte Zuflucht nach einer Endzeit: Ringsherum ist alles wüst und leer, liegen verwaiste Felder, stehen uralte Jagdsitze, verkrüppelte Weiden, Totendörfer, Ruinen, die als riesige Grabmale den Strand überschatten. Die letzten Überlebenden hausen in den Bauten, die den rechteckigen Platz einschließen, auf dem ich klein und matt stehe: geradeaus das ehemalige Gutshaus mit dem Turm einer Sternwarte (wie mein Vater wusste), links fünf kastenförmige, dreistöckige Neubauten, rechts das sogenannte Gesindehaus aus rotem Backstein und renovierte Stallungen.
Ich weiß nicht, wie ich mir das Internat vorgestellt hatte, aber sicher anders, vor allen Dingen weniger entlegen. Als ich wenige Minuten später bei Keksen und Kakao in einem typischen Schulbüro saß, zu dem wir durch typische Schulkorridore gelangt waren – Selbstgemaltes, Klassenfotos auf bunten Pappen, maschinengetippte Aushänge –, fühlte ich mich wieder auf vertrautem Terrain und gleichzeitig – aufgrund des abrupten Szenenwechsels und eines zunehmend dumpfen Schädels – wie weggetreten. Zähe Masse verklebte meine Atemwege und trübte meine Wahrnehmung, ich interessierte mich kaum für die Schule und die freundliche Frau mit den rot gefärbten Haaren und dem bunten Halstuch, die enthusiastisch auf mich und meinen Vater einredete. Ich bemerkte seine Gereiztheit (Wieso stellt der Junge keine Fragen? Wieso zeigt er kein Interesse? Und warum präsentiert man ihm ausgerechnet diese Frau, die keine gute Werbung für ihre Schule ist?), aber was sollte ich gegen meine Willenlosigkeit und das Gerede der Lehrerin tun?
Ich wurde durch die Anlage geführt und fühlte mich derart unter Druck gesetzt, begeistert oder zumindest interessiert zu wirken, dass ich kaum etwas mitbekam. Schau doch mal, wie freundlich der Speisesaal aussieht! Wie nah das Meer ist! Was es für tolle Werkstätten gibt! Ach, und erst der Fußball- und der Grillplatz! Ist das etwa nichts? Das ist doch etwas! So klein sind die Zweier-Zimmer gar nicht!
Das Areal wirkte auf unserem Rundgang sonderbar leer, so als wäre es eigentlich unbewohnt und eigens für mich vorübergehend mit ein paar jugendlichen und erwachsenen Darstellern bevölkert, die lieb lächelnd und aufmerksam schauend unseren Weg kreuzten und dabei sanft wie Rehe blickten. Nicht nur ich schien in Watte gepackt, sondern auch das Gelände und alle, die darin wandelten.
Aus meiner Halb-Trance tauchte ich erst auf, als die rothaarige Lehrerin – Frau Kastner – auf dem Weg zurück ins Hauptgebäude auf die Wielands zu sprechen kam, das Ehepaar, das diese Schule gegründet hatte und das nun mit mehreren Jugendlichen in dem ehemaligen Gesindehaus aus rotem Backstein lebte. Ich weiß nicht mehr, was genau sie sagte, aber in ihrer Stimme schwang etwas mit, das mich neugierig machte. Gerne hätte ich endlich das freiheitsliebende Paar gesehen, über das ich nach Frau Schallmeyers Andeutungen bereits allerlei, wenn auch verschwommene Vorstellungen entwickelte hatte: die Wielands, Herz, Kopf und Seele der Freien Schule Schwanhagen. Aber «leider, leider» befanden sich die beiden mit «ihrer Familie» auf einem Ausflug. Dabei hätten sie mich laut Frau Kastner doch so gerne kennengelernt. Mein Vater runzelte die Stirn. Vermutlich hätte er den Schulleiter und seine Frau auch gerne kennengelernt, nachdem er mich fast sieben Stunden durch die Republik kutschiert hatte.
«Es tut mir wirklich leid», sagte Frau Kastner. «Hier ist immer so viel los, da kann es schon einmal zu einem Missverständnis kommen.»
«Schon gut», sagte mein Vater und zog seine Pfeife aus der Jackettasche. «Wir fahren heute sicher nicht noch einmal über 600 Kilometer. Wir übernachten in der Nähe und kommen morgen Vormittag wieder.»
«Ah», sagte Frau Kastner verlegen. «Dann wird es sicher klappen.» Dabei klang das «sicher» aus ihrem Mund reichlich unsicher, und ich bemerkte, dass mein Vater kurz davor stand, laut zu werden.
«War das hier eigentlich schon immer eine Schule?», fragte ich schnell und ohne dass es mich interessiert hätte.
Mein Vater und Frau Kastner sahen mich an. Dann sagte die Lehrerin: «Nein. Ganz früher war es ein Gutshof, das ist so eine Art Bauernhof mit einem adeligen Besitzer, weißt du?»
Ich nickte brav.
«Dann hat hier ein reicher Kaufmann gewohnt. Ich glaube, er hatte etwas mit Wertheim in Stralsund zu tun, also diesem Kaufhaus-Konzern, der heute Karstadt gehört. Karstadt kennst du sicher.»
Ich nickte wieder.
«Ich weiß jetzt aber nicht, ob er selbst ein Wertheim war. Vermutlich nutzte er die Gebäude nur als Sommerresidenz, also als Haus für die Ferien. Tja und dann …»
«Kamen die Nazis», unterbrach ich. Das war zwar neunmalklug, aber ich hatte keine Lust darauf, die Geschichte in kindgerechter Sprache vorgesetzt zu bekommen.
«Genau. Die haben dem Kaufmann den Gutshof abgenommen.»
«Und was haben sie damit gemacht?», fragte ich, nun doch interessiert. Die Lehrerin sah ratlos aus.
«Vermutlich haben sie ihn auch als Sommerresidenz genutzt.»
«Auch Nazis brauchten mal Ferien», sagte mein Vater.
«Und dann kam die Rote Armee, also russische Soldaten», fuhr Frau Kastner unbeirrt fort. «Die haben die Nazis vertrieben, und später, ich glaube, da war das hier schon DDR, also später war dann hier ein Kinderheim. Das musste geschlossen werden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wieso. Ein schlimmer Unfall oder …»
In diesem Moment hörte ich hinter mir ein Geräusch und fuhr herum. Die Tür des Lehrerzimmers stand plötzlich offen, herein kam ein Mann, der wie das genaue Gegenteil meines Vaters wirkte. Salvador Wieland strotzte vor Frische und Kraft. Seine Augen brannten bernsteinfarben in einem Gesicht, das vielleicht deshalb so groß erschien, weil der restliche Mann so klein und schlank war. Wieland trug ein weißes Hemd, dessen obere Knöpfe offenstanden und den Blick auf üppig sprießendes Brusthaar erlaubten. Einem Mann von dieser Erscheinung hätte man viele Rollen zuschreiben können: vom Abenteurer, der nur selten lange an einem Ort blieb, über den undurchsichtigen Zirkusdirektor bis zu einem jenseits der Konventionen forschenden Wissenschaftler, der lächelnd monströse Entdeckungen erläutert. Auf einer seiner Expeditionen oder in einer Stadt, in der der Zirkus Station machte, vielleicht aber auch in einem entlegenen Forschungslabor musste er die Frau kennengelernt haben, die mit ihm in den Raum trat: Sie trug ihre rotblonden Haare in einer jungenhaften, auf mich sehr mondän wirkenden Frisur, überragte Salvador Wieland um einen Kopf und erinnerte mich mit ihren scharf konturierten Gesichtszügen sofort an einen Fuchs. Ihr dunkelblaues Kleid fand ich schicker als alles, was ich bisher gesehen hatte. Neben Salvador Wieland wirkte sie zugleich wie seine groß geratene Tochter und wie seine erfahrene Betreuerin. So sehen Lehrer nicht aus, dachte ich.
«Ach», sagte Frau Kastner. Salvador Wieland lächelte, kam mit entschlossenen Schritten auf mich zu und gab mir mit kräftigem Druck eine kleine, harte Hand.
«Du bist Tilman», sagte er, und etwas von seiner Lebenskraft ging auf mich über. «Herzlich willkommen in Schwanhagen.»
Die rotblonde Frau musterte mich interessiert und überhaupt nicht so, als ob ich ein Kind wäre. Schlagartig fühlte ich mich nicht mehr krank.
«Na», sagte sie mit einer leicht hochgezogenen Augenbraue, «hast du dich schon umgesehen?»
Ich nickte und wollte etwas Geistreiches antworten, kam aber nicht dazu, weil die Frau nun meinem Vater die Hand gab, als kenne sie ihn längst.
Salvador Wieland schlug die Hände zusammen und sagte laut: «Schön. Irgendwelche Fragen bis hierher?»
Ich weiß nicht genau, was wir im Folgenden besprachen, erinnere mich aber deutlich daran, dass es um mich ging. Man befragte mich nach meinen Interessen, meinen Eindrücken, meinen Vorlieben und Abneigungen. Ich fühlte mich gut. Diese schönen, energiegeladenen Menschen gaben mir das Gefühl, vollkommen in Ordnung zu sein. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich sofort als neuer Schüler in das Internat eingeschrieben. Die Erwachsenen aber meinten, eine Entscheidung von dieser Tragweite müsse man überschlafen. Mein Vater sagte in unglaubwürdiger Strenge: «Wenn du erst einmal angemeldet bist, musst du wenigstens ein Schuljahr lang hierbleiben. Alles andere wäre unnötiger Aufwand und viel zu kompliziert.»
Valerie Wieland nickte, wobei ich ihrem Lächeln ansah, dass sie meinen Vater in diesem Moment nicht anders wahrnahm als ich.
«Du hast gesagt, du liest gerne.» Sie neigte sich in meine Richtung. «Hast du denn schon die Bibliothek gesehen?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Na, komm. Ich zeig sie dir.» Sie stand auf und nahm mich bei der Hand. Die Berührung geschah ganz selbstverständlich, meine Finger glitten in ihre, und ich kam mir dabei gar nicht kindlich vor. Valerie Wieland ließ meine Hand auch nicht los, als wir durch einen langen Schulkorridor gingen.
«Was liest du denn gerne?»
«Poe», sagte ich, weil ich glaubte, damit den meisten Eindruck zu schinden.
«Cool. Gibt es eine Geschichte von ihm, die dir besonders gefällt?»
Mir fiel als Erstes «Der Untergang des Hauses Usher» ein, da ich die Geschichte noch frisch in Erinnerung hatte. Dann aber sagte ich, ohne weiter nachzudenken: «Das verräterische Herz.»
«Oh ja, die ist ganz großartig!» Valerie Wieland schien ernsthaft begeistert. «Was gefällt dir daran besonders?»
«Alles», sagte ich gedankenlos, dann fügte ich hinzu: «Dass man nicht weiß, wer der alte Mann eigentlich ist und warum er ihn umbringt.»
«Na, wegen des Auges», sagte Valerie. «Ich dachte, er bringt den alten Mann um, weil er sein Auge so hässlich findet.»
Ich schwieg kurz und wurde mir wieder der warmen Frauenhand bewusst, die sich immer noch mit meiner zu einem Fleisch verband.
«Aber deswegen bringt man doch niemanden um», sagte ich.
«Auch wenn du glaubst, dass dich das Auge eines Menschen verhexen kann?», fragte Valerie Wieland in einem ebenfalls vorsichtigen Tonfall.
«Ja, dann vielleicht», sagte ich. «Aber vor so etwas sollte ein erwachsener Mann doch keine Angst haben.»
«Wer sagt dir denn, dass der Mörder kein Jugendlicher ist?»
Ich fühlte mich verwirrt. Stillschweigend war ich davon ausgegangen, dass es sich bei dem Icherzähler wie beim Autor um einen Erwachsenen handelte.
«Und der alte Mann ist vielleicht der Vater», fügte Valerie Wieland hinzu.
Ich sagte nichts. Diese Deutung hatte mir die Sprache verschlagen. Wir stiegen eine Treppe hinauf, passierten einen weiteren Korridor und traten schließlich durch eine helle Holztür in einen hohen, großen Raum, in dessen Halbdunkel Regale voller Bücher standen, wie Riesen, die sich tot stellten. Mein Blick fiel durch das Spalier dieser Riesen und dann durch ein großes Fenster in das Zwielicht dort draußen. Valerie Wieland ließ meine Hand los und schaltete das Licht an. Das vom Fenster gerahmte Bild veränderte sich. Plötzlich wurde das Drinnen gespiegelt, vor allem der Schein der Lampen, deren weiße Schirme wie große umgedrehte Tulpenköpfe an langen, schwarzen Kabeln von der Decke hingen. Vor der gegenüberliegenden Fensterfront erkannte ich nun schlichte Holztische und -stühle, klösterlich strenge Studierplätze, die meine Phantasie entzündeten: Hier wollte ich sitzen und in alten Büchern lesen, während draußen vor dem Fenster die Flocken einer Winternacht wirbelten.
Ich spürte etwas in meinem Gesicht. Valerie Wieland hatte mit zwei Fingern die Lippen meines weit offen stehenden Mundes geschlossen. Dann schaltete sie das Licht wieder aus. Eine Weile standen wir dunkel und still wie die Riesen.
Ich schlief schlecht in dieser Nacht. Mein Lager in der Pension bestand aus einem durchgelegenen Beistellbett (ein Kindermöbel, eigentlich schon zu klein für mich). Im Zimmer war es zu dunkel. Mein Vater roch nach Rauch. Draußen rief ein Käuzchen. Ich schwitzte. Mein Körper kribbelte vor Aufregung. In eine kaum auszuhaltende erwartungsfrohe Spannung mischte sich eine Ahnung von Furcht, wie ein ungebetener, unheimlicher Gast auf eine ausgelassene Feier.
In den Sommerferien, bevor ich auf die FSS wechselte, fuhr ich zum letzten Mal mit meinem Vater in den Urlaub. Wir hatten uns auf Mallorca geeinigt und darauf, dass Frau Schallmeyer nicht mitkommen sollte. In den Urlaubstagen bemerkte ich, dass sich mein Vater oder zumindest mein Blick auf ihn endgültig verändert hatte. Er erschien mir kleinlicher, weniger souverän, eigentlich überfordert von den einfachsten Dingen (Formulare beim Mietwagenservice ausfüllen, ein Restaurant aussuchen, sich in Palma zurechtfinden). Jeder Tag bestand aus Gereiztheiten, Phasen des Schweigens, Phasen der Annäherung, symbolischen Entschuldigungen und neuen Gereiztheiten. Wir benahmen uns wie ein Paar, das den Zenit seiner gemeinsamen Zeit längst hinter sich gelassen hatte.
Am vorletzten Tag besuchten wir eine Kunstgalerie im Nordosten der Insel. Es handelte sich um eine große weiße Villa in einem riesigen Garten an der Küste. Sie lag am Ende eines sehr langen Schotterwegs, über den mein Vater den kleinen Mietwagen angestrengt hatte holpern lassen. Die Anlage gehörte einem Künstlerpaar, das die zahlreichen Räume und den Garten mit eigenen und fremden Bildern, Statuen, Installationen und Design-Möbeln angefüllt hatte. Mein Vater und ich wurden von einer deutsch sprechenden Führerin durch die Sammlung geführt und gelangten am Ende in kühle, dunkle Räume, in denen sich Kinderdarstellungen aus früheren Jahrhunderten befanden. Wir schritten über schwarzen Marmor und betrachteten die Ölgemälde, die ausnahmslos Adelssprösslinge zeigten, wie uns die Frau erklärte. Man habe die Kinder sehr früh mit Hilfe dieser Bilder zur Heirat angeboten. Sie erläuterte uns verschiedene Symbole, Hunde, Affen oder Kreuze, die vermitteln sollten, dass es sich um besonders treue, kluge oder fromme Kinder handelte. Sie zeigte auf eine Halskette und sagte, das Schmuckstück sei ein Symbol für eine große Mitgift. In meinem Alter hatten viele der Abgebildeten ihr Elternhaus längst verlassen, lebten und lernten bei Verwandten, der Familie ihres Ehepartners oder in katholischen Internaten. Ich betrachtete interessiert die steifen Leiber und alten Gesichter.
Auf einem Bild sah ich drei Kinder, bei denen das Geschlecht nicht deutlich zu bestimmen war, und die Frau erklärte meinem Vater und mir, man habe Jungen aufgrund ihrer weitaus höheren Sterblichkeit in der frühen Neuzeit oft bis zum siebten Lebensjahr in Mädchenkleider gesteckt, um so Tod und Teufel zu überlisten.
Je länger ich die Bilder ansah und den Ausführungen der Museumsführerin lauschte, desto mehr fühlte ich mich von einer bisher unvertrauten Stimmung durchdrungen. Und als ich schließlich vor der Abbildung eines vielleicht dreizehnjährigen Mädchens stand, verdichtete sich diese Stimmung zu einem mein Innerstes zerwühlenden Wunsch. Ich wollte nicht von dem Bild weggehen: von diesen wunderschönen, klugen, neugierigen, in ihrem erwachten Selbstbewusstsein vielleicht auch ein wenig spöttisch schauenden braunen Augen einer Heranwachsenden namens Marie-Anne. Sie trug in der schlanken Hand einen Jagdbogen und schien geradewegs in mich hineinzublicken. Mir kam zum ersten Mal die Einsicht, dass Bilder einen vergänglichen Moment für immer festhalten, über den Tod hinaus. Ich sah Marie-Anne und wollte zu ihr in das Bild steigen. Ich wollte kein sich wandelnder Mensch sein. Ich wollte kein verschrecktes Kind mehr sein und kein hässlicher Erwachsener werden. Ich wollte für immer bei ihr sein, auf ewig an der Seite ihrer Jugend und Schönheit erstarrt.
Drittes Kapitel
An einem Nachmittag im Spätsommer führte Frau Kastner meinen Vater und mich zu den «Eulen» im ersten Stock von «Haus 4». Wir trafen auf einige wenige Jugendliche und ihre Eltern oder Erzieher, grüßten artig und wurden in ein kleines Zweibettzimmer geführt.
«Soll ich dir beim Auspacken helfen?», fragte mein Vater, nachdem er eine von zwei Reisetaschen abgestellt hatte. Ich stand da und schüttelte den Kopf.
«Tja, dann …», sagte er.
Ich nickte. Er kam zwei Schritte auf mich zu und klopfte mir mit der Hand auf den Oberarm: «Du schaffst das. Ruf mich an, wenn was ist.»
«Okay», sagte ich. Dann schloss sich die Tür, und ich hörte ihn den Flur hinuntergehen. Mein Blick fiel auf eine blaue Adidas-Reisetasche, die besitzergreifend auf dem oberen Teil des Etagenbettes stand. Von mir aus konnte der unbekannte Mitbewohner ruhig das obere Bett belegen. In meinen Augen bot das untere Bett mehr Vorteile. Schnell kam man hinein, schnell kam man hinaus, und im Stauraum unter dem Bettrahmen ließ sich beispielsweise ein Stock deponieren oder ein Vorrat an Lebensmitteln. Wenn auf dem Flur etwas Interessantes vor sich ginge, wäre ich lange vor dem Obenschläfer draußen, vielleicht unbemerkt, wenn ich mich leise genug verhielt. Zwar konnte mein Mitbewohner theoretisch zu mir hinabspähen und ich nicht zu ihm hinauf, aber dazu musste es entweder hell im Zimmer sein, oder er brauchte eine Taschenlampe. Auch musste er sich dafür entweder weit über den Rand beugen oder die Matratze anheben, was ihn nicht nur sofort verraten würde, sondern auch wenig nutzte, wenn ich mich genau in der Mitte meines Bettes positionierte.
All das überlegte ich mir, als ich die Reisetasche auf der oberen Matratze stehen sah und meine eigenen Sachen in einen der beiden Spinde räumte. Ich legte gerade meine Socken auf ein Ablagebrett des weißen Metallschranks, als die Zimmertür aufging und ein Junge mit den Worten «Servus, grüezi und hallo» hereinkam.
«Hallo», erwiderte ich wenig schlagfertig und wollte dem Neuankömmling die Hand geben. Er aber spazierte an mir vorbei und stieg die ersten Sprossen der Leiter hinauf, um seine Tasche zu holen.
«Ich heiße Tilman», sagte ich und kam mir ein wenig doof vor.
«Dominik», antwortete der Junge, ohne sich mir zuzuwenden. «Was hat dich hierher verschlagen?»
Ich wusste nicht, was ich auf diese altväterlich vorgetragene Frage antworten sollte. Ging es den Jungen überhaupt etwas an? Hatte man solche Fragen zu beantworten, um sich als ordentlicher Mitbewohner auszuweisen?
Dominik trug seine Tasche zu dem noch freien Spind, der gleich neben meinem stand. Während er seine Kleidung einzuräumen begann, legte ich mich auf die unbezogene Matratze und betrachtete abwechselnd die Unterseite des Bettes über mir und den fremden Jungen im Raum. Dominik hatte ungefähr meine Größe, trug jedoch auf einem ähnlich dürren Gestell eine sonderbare Fettschicht, die ihn speckig machte, ohne dass er deswegen prall, dick oder kräftig hätte genannt werden können. Er gehörte zur seltenen Gruppe der dicklichen Dünnen. Auf seiner Oberlippe stand dunkler Flaum. Die dunkelbraunen Haare trug er zum Zopf gebunden. Seine auffällige randlose Brille mit den dicken, runden Gläsern passte in meinen Augen nicht zu seiner schwarzen Jeans und dem schwarzen T-Shirt, auf dem ein vollmondbeleuchtetes Baum-Monster die Krallen ausstreckte (Band: Iron Maiden, Album: Fear of the Dark).
Nach einer Weile unangenehmen Schweigens sagte der fremde Junge: «Tja, willkommen an der FSS, der Freakschule Schwanhagen. Welche Art von Freak bist du?»
«Keine Ahnung», sagte ich. «Und du?»
«Ich bin einfach nur sehr, sehr intelligent und auf einem alternativen Internat besser aufgehoben. An den Regelschulen regiert das Mittelmaß.» Es klang wie auswendig gelernt. Der Tonfall des Jungen brachte mich gegen ihn auf. Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf und sagte: «Deine Eltern sind bestimmt traurig, dass ihr kluger Sohn jetzt nicht mehr bei ihnen wohnen kann.»
«Sind deine etwa nicht traurig?», gab Dominik zurück.
«Doch», sagte ich, «klar».
«Also: Weswegen bist du hier?» Ich meinte etwas Lauerndes aus seinem Tonfall herauszuhören. Die Frage überforderte mich. Die ganze Situation überforderte mich. Der Gedanke, mit diesem Jungen nicht nur heute Nacht in einem Zimmer zu schlafen, sondern auch all die Nächte, die da noch kommen sollten, presste mir die Brust und den Magen zusammen.
«Du bist nicht so der gesprächige Typ, was?» Dominik wartete keine Antwort ab. «Auch gut. Ist mir egal, solange du dich hier an meine Regeln hältst.»
Ich nickte. Kurz darauf folgte ich ihm zum Abendessen in den Speisesaal. Dabei war ich mir auf peinliche Weise meiner selbst bewusst: ein dünner, auf mädchenhafte Weise hübscher Junge mit blonden Haaren und zarten Wimpern, der unsicher einem Typen mit Brille hinterherlief, weil er nicht wusste, was er sonst hätte tun sollen. Auf dem Weg kamen uns im Flur des Neubaus zwei andere Schüler entgegen, begrüßten meinen Zimmergenossen mit klatschendem Handschlag und nannten ihn «Oertel». Mich musterten sie mit freundlicher Neugier, dann gingen sie mit großen, schnellen Schritten weiter.
Der Speisesaal lag im Erdgeschoss des schlossartigen Hauptgebäudes. Als wir eintraten, fiel das rötliche Licht der sommerlichen Abendsonne durch eine große Fensterfornt. Aus dem unangenehmen Vielklang von Stimmen, über den Boden gezogenen Stühlen sowie klappernden Tabletts und Bestecken stachen spitze Schreie, schrille Lacher oder laute Rufe heraus. Während ich mich mit Dominik an der Essensausgabe einreihte, sah ich immer wieder Jugendliche, die sich kreischend um den Hals fielen (die Mädchen), auf die Schulter boxten (die Jungen) oder sich fröhlich anschrien. Auch «Oertel» wurde noch zweimal begrüßt. Mich sah man an. Inmitten all der Wiedersehensfreude und erwartungsfrohen Ausgelassenheit fühlte ich mich fremd. Von einer Sekunde auf die andere wurde mir bewusst, dass ich hier niemanden kannte und niemand mich, dass ich ein Niemand war. In diesem Moment machte mein Herz einen Sprung: Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren stand mit einem Tablett in der Hand da und sah sich um. Sie trug ein dunkelrotes T-Shirt, das durch die schwarzen Haare besonders rot wirkte. Das Mädchen hielt Ausschau – mit einer Ruhe, die in völligem Gegensatz stand zu dem überdrehten Treiben rings um uns herum. Ihr Blick wanderte ausdruckslos über die Tische und fiel schließlich auf die Schlange, in der ich stand. Ich konnte nicht anders, als sie anzustarren. Für einen Moment schaute sie mir direkt in die Augen. Dann wanderte ihr Blick weiter. Aber ich wusste, dass sie mich wahrgenommen hatte, wenn auch nur wie einen neuen Gegenstand in einem vertrauten Zimmer.
Ich wählte irgendein Essen aus und ließ mir von einer ungesund aussehenden Frau in schmutzig weißem Kittel einen Teller mit Sülze und Bratkartoffeln geben. Dominik Oertel stieß mich in die Seite, damit ich nicht vergaß, mir Nachtisch zu nehmen. Ich griff die Quarkspeise von der Ablage neben der Theke und folgte meinem Zimmergenossen. Kurz darauf fand ich mich in einer Gruppe wieder, stellte mich vor, erfuhr Namen, die ich sofort wieder vergaß, und schaute mich immer wieder um, ohne die Schwarzhaarige noch einmal zu Gesicht zu bekommen.
In der Nacht lag ich auf meiner Matratze, hellwach. Die Bettwäsche fühlte sich seltsam an und roch fremdartig, so wie das ganze Zimmer einen leicht sauren Geruch verströmte, den ich in meiner Phantasie mit Dominik Oertel verknüpfte. Dominik Oertel – der Name schien die wortgewordene Essenz des Namensträgers, mit seinem ins Auge springenden Kontrast zwischen dem herrischen «Dominik» und dem nach eingeschlafenen Füßen, Genöle und Bettnässerei klingenden Nachnamen.
Ich dachte an das Mädchen im roten T-Shirt. Ich sah sie genau vor mir, rückte ihr Gesicht näher an mich heran, ihre wilden, ruhigen Schlittenhund-Augen. Ich fragte mich, was sie von Oertel halten würde und was sie über mich dächte, wenn sie wüsste, dass ich mit ihm ein Zimmer teilte. Und ganz unabhängig von Oertel: Was würde sie von mir halten, einem Menschen, der sich zwar nicht normal fühlte, der aber vermutlich ängstlich und einschläfernd langweilig wirkte? Mir kam ein tröstlicher Gedanke: Niemand hier kannte mich. Ich konnte ganz von vorne anfangen. Ich konnte jemand anders sein. Ich wusste nur noch nicht, wer.
Die größte Veränderung in meinem Leben ist wahrscheinlich meine Geburt gewesen: raus aus der schwebenden Dunkelheit und nährenden Wärme einer Mutter-Kind-Verwachsung und hinein in eine grelle Welt des Kampfes, für immer abgeschnitten. Die zweitgrößte Veränderung geschah, als ich Schüler der FSS