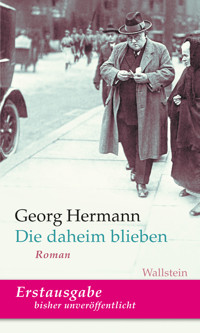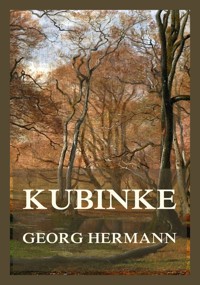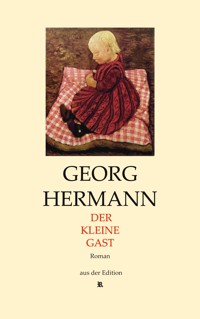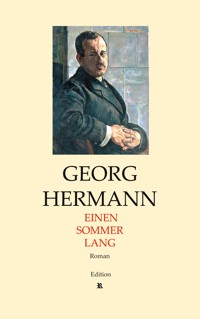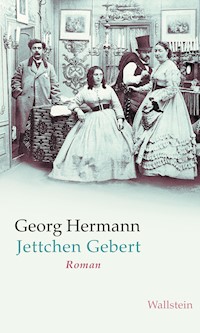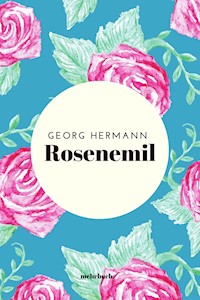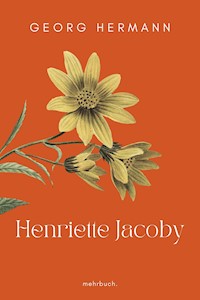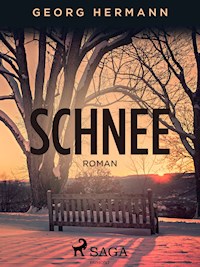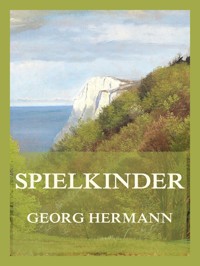
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georg Hermanns Erstlingswerk spielt im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts und trägt stark autobiographische Züge. Hermann führt dem Leser höchst unerquickliche und zumeist traurige, ja sogar tragische Verhältnisse vor Augen, als sich ein Familienvater mitsamt seinen Lieben aufgrund von Immobiliengeschäften in den Ruin stürzt. Einzelne Gestalten wie die der "Lies" werden mit großer psychologischer Finesse geschildert, andere dafür bewusst übertrieben und sogar karikiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Spielkinder
GEORG HERMANN
Spielkinder, G. Hermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682109
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I1
II6
III7
IV.. 11
V.. 12
VI21
VII24
VIII28
IX.. 34
X.. 38
XI61
XII76
XIII79
XIV.. 81
XV.. 87
XVI131
XVII133
XVIII135
XIX.. 137
XX.. 163
Nachwort164
I
Vor mehr als zwanzig Jahren saßen im Berliner Börsencafé zwei Männer. Der eine von ihnen, klein und untersetzt, hatte den Kopf mit dem fleischigen, faltigen Nacken zwischen die Schultern gezogen. Er mochte fünfzig Jahre alt sein. Sein starres, volles Haar war grau meliert, sein Bart kurz und am Kinn ausrasiert. Auf den ersten Blick konnte der Ausdruck seines Gesichts sogar für gutmütig gelten, aber wer ihn genauer beobachtete, bekam bald heraus, dass dem nicht so war. Die Nase war bis an den Rand der Lippen heruntergezogen, die grauen Augen klein und beinahe freundlich, aber wenn er sich unbeachtet glaubte und Zahlen auf Zahlen in sein Notizbuch kritzelte, nahmen die Augen einen so niederträchtigen, gaunerischen Ausdruck an, wollten sie sagen: „Wen unser Herr in die Hände kommt, den lässt er nicht locker, den saugt er aus auf den letzten Blutstropfen."
Der andere war ein fünfzigjähriger Jüngling, geschniegelt und gebügelt, kein Stäubchen an ihm. Er trug ganz enge Beinkleider, ein kurzes, bis an die Lenden reichendes gelbes Paletötchen: auf seinem feisten Gesicht gähnte die adeligste Langeweile, auf der hohen, wulstigen Stirn thronte eine erhabene Gedankenlosigkeit und Selbstzufriedenheit, wie sie nur die wahre Aristokratie zur Schau trägt. Oh, er war auch gebildet! war in Rom, Neapel, Paris gewesen, hatte überall in den ersten Hotels gewohnt und er erweiterte sogar noch seine umfangreichen Kenntnisse! So hatte er zu Haus beim Zeitungslesen stets das Fremdwörterbuch neben sich liegen, in dem er alle ihm unbekannten Ausdrücke nachschlug. Er protegierte auch als Mäzen einen Maler, indem er seine Bilder billig kaufte und hielt, natürlich nur der Protektion halber, eine junge, ebenso hübsche wie leichtsinnige und talentlose Schauspielerin aus.
„Meinen Se, der Kerl kommt?"
„Ich glaub's, Geiger ist ein Mann von Wort," sagte gelangweilt der Aristokrat und legte auch sein linkes Bein auf das rote Peluchesofa. „Piccolo, eine Limonade!"
„Und wenn uns der Geiger doch durch de Finger geht?" sagte Rewald, indem er den Aristokraten von der Seite anblinzelte.
„Ich sage Ihnen, er kommt — sehen Sie, da ist er schon!"
Er wies auf einen zirka fünfundvierzigjährigen Herrn mit schwarzem Vollbart. Es war ein hübscher Mensch, der dort kam: groß, kräftig gebaut, ruhige, klare, ebenmäßige Züge, braune, ehrliche Augen, die Nase gerade, wenn auch für eine Mannsperson etwas zu klein, die Stirn hoch und stark gewölbt. In seinem Gesicht lag der Ausdruck einer rückhaltlosen, fast groben Offenheit und Ehrlichkeit. Die ganze Gestalt schien überhaupt zu sagen: Seht, das bin ich! Mit nichts habe ich angefangen, und heut' hab ich hier eines der besten Geschäfte, bin fast Millionär; durch meine eigene ehrliche Arbeit bin ich es geworden, durch eigene ehrliche Arbeit!
Rewald erhob sich und drückte den Kopf noch mehr wie sonst nach vorn, selbst der Aristokrat winkte gnädig mit seiner behandschuhten Rechten, dann erhob auch er sich und klopfte dem Ankömmling vertraulich auf die Schulter.
„Nun, lieber Geiger, es ist nett, dass Du kommst!" — Er hatte das Recht ihn zu duzen, denn er war sein Schwager.
Rewald nickte dem Aristokraten zu, als wollte er sagen: Kitzle Du nur erst das Schäfchen unter dem Hals, damit's hübsch stillhält, ich werde schon im geeigneten Augenblicke zustoßen. Nicht einen Muck mehr soll's tun, das Schäfchen!
„Piccolo, einen Sherry Cobler für den Herrn!"
„Aber Herr Rewald, ich trinke vormittags nie etwas; ich kann es nicht vertragen, vormittags etwas zu trinken."
„Herr Geiger, Se werden mir doch gestatten, dass . . ." sagte Rewald im liebenswürdigsten Ton seines Registers.
Der Aristokrat unterbrach ihn.
„Nun, wie gehts Annchen, wie geht's den Kinderchen? Den jüngsten müssten Sie wirklich mal sehen, Herr Rewald — ein kluger Junge — sag ich Ihnen — ein hübscher Junge — sag ich Ihnen!"
„Das hat er nur vom Vater, so etwas vererbt sich stets." Rewald lachte.
Der Sherry Cobler kam. Man sprach über die politische Lage, über Bismarck, über Strausberg, über die Bochumer, Norddeutsche Lloyd, Differenzgeschäfte und ihre Unmoral, Familienangelegenheiten, Stadtklatsch, ja sogar auch über die Oper und die Kunstausstellung, für welche beide der Aristokrat ein scharfsinniges Urteil und ein tiefes Verständnis zeigte. Besonders lobte er jene herrliche, ja herrliche Oper, wie hieß sie doch gleich? Ja, der Freischütz von Meyerbeer und pfiff sogar nicht ohne Gehör aus ihr mehrere besonders schöne Stellen, welche sicher gepasst hätten, wenn sie nicht aus dem Troubadour gewesen wären. Dann sprach er noch über Kaulbach und über die Bildhauerei der italienischen Renaissance, die besonders unter Dante, Petrarca und Claude Lorrain geblüht hätte. Und die andern, die wirklich blutwenig von derartigen Dingen verstanden, hörten diesem Wortschwall zu, mit Gesichtern, auf denen deutlich zu lesen war: Ja, ein kluger Mensch! Ja! Ein gebildeter Mensch! Und welche rednerische Begabung! Der wird es doch noch bis zum Stadtverordneten bringen!
Plötzlich kam Rewald ganz unvermittelt auf Geschäfte zu sprechen; dass doch jetzt der Grund und Boden so billig sei und man leicht so viel — so viel verdienen könne, und — :
„Ich habe Ihnen ein Geschäft, ein Geschäft —" er spitzte die Lippen wie ein Weintrinker, legte den Kopf auf die Tischplatte und schlug die Arme zurück, dass er wirklich in diesem Augenblick an einen auffliegenden Geier gemahnte.
„Verdienen, verdienen könnten Se daran vierzigtausend Mark, sag' ich Ihnen, fünfzigtausend Mark, sag' ich Ihnen, hunderttausend Mark, sag' ich Ihnen!"
Und er wies mit Zahlen haarscharf nach, welchen ungeheuren Vorteil man nur mit einem verhältnismäßig geringen Anlagekapital aus diesem Unternehmen ziehen könnte.
„Das wär ä Geschäft! Das wär ä Geschäft!" schloss er wieder lippenspitzend seine Rede.
„Nun, Herr Rewald, weshalb machen Sie es dann nicht?"
„Warum? Warum? Nu, weil Sie's machen sollen, lieber Geiger!" Er klopfte ihm vertraulich auf die Schulter. „Sehen Se, diese beiden Häuser lassen Se einfach niederreißen und bauen darauf ein neues, großes Haus auf —"
„Sie wissen, Herr Rewald, so gut wie ich, dass ich mich auf derartiges nicht einlassen kann, ich habe schon die anderen Häuser. Meinem Geschäft, wenn es sich auch ganz gut rentiert, kann man nicht so viel zumuten."
„Ich sag' Ihnen, es wird Ihnen leid tun, greifen Se zu, greifen Se zu, eh's zu spät ist. 'S wird Ihnen leid tun, sag' ich Ihnen, und warum sollen Se's nicht nehmen, warum nicht? Ä junger Mann muss Glück im Leben haben! Was haben Se dabei zu riskieren?! Hä — so ä reicher Mann wie Sie — hä — nachher werden Se sagen, der Rewald, das ist einer, der meint's noch gut mit mir."
„Herr Rewald, Ihr Reden nützt augenblicklich gar nichts, ich werde darüber einmal mit meiner Frau sprechen!"
„Mit Ihrer Frau?" schrie Rewald, lachte, als ob jener einen ausgezeichneten Witz gemacht habe und schlug mit der Hand auf den Tisch.
„Entschuldigen Se, lieber Herr, aber das hätt' ich Ihnen doch wirklich nicht zugetraut. Ein Mann soll mit seiner Frau von Geschäften sprechen!"
Er hielt sich den Bauch vor Lachen.
„Kostbar, kostbar! Das beste, was ich seit langem gehört habe! Kostbar! Kellner, noch einen Sherry Cobler! Nun gut, ich will Sie ja nicht dazu bestimmen, was hab' ich für'n Nutzen oder Schaden davon? Aber ich sag' Ihnen, Se schneiden sich in Ihr eigenes Fleisch, wenn Se das Geschäft nicht machen! Piccolo, ein paar Zigarren!"
Und wieder begann das Gespräch.
Man stritt über die Größe Bismarcks, sprach über die Bedeutung des Krieges von siebzig - einundsiebzig, über Moltke, Roon, Mac Mahon, Napoleon, Eugenie, Rochefort. Der Aristokrat hielt eine feurige Ansprache, lobte das energische Vorgehen Bismarcks, welchen er persönlich zu kennen vorgab, sprach von Beziehungen Deutschlands mit denen des Auslands, besonders mit Zentral- und Südamerika — dann von der Zukunft der Wissenschaft im Dienste der Industrie, und dieses alles mit einer so wichtigen Miene, als ob jedes Wort der Nachwelt überliefert werden müsste, dieses alles mit einem liebenswürdigen, gezierten Lächeln, das einer Primadonna Ehre gemacht hätte, dieses alles mit einer solchen stolzen Bestimmtheit, als ob er, er, der Aristokrat und niemand anders, die Fäden des Weltgetriebes leite.
Grade wie ein Blutegel, den man einmal abgestreift, von neuem lautlos auf sein Opfer losschießt und sich festzusaugen versucht, so begann Rewald plötzlich unvermittelt wieder von Geschäften zu reden. Wie der Grund und Boden so billig, so billig sei, und wie man jetzt auf so leichte und anständige Art und Weise, — dies betonte er besonders — viel, viel, sehr viel Geld verdienen könne, erging sogar noch einen Schritt weiter:
„Und sehen Se, hier habe ich die Pläne. Diese günstige Lage, kein Winkelchen, kein Eckchen, direkt beim Rathaus. Ä Million, ä Million ist damit zu verdienen, und als ob fünfhunderttausend Mark für ä Millionär wie Sie," — er wusste nur zu genau, dass jener es nicht war — „Geld ist! Hunderttausend Mark zahlen Sie an, die erste Hypothek dreihunderttausend, die zweite hunderttausend. Vier Prozent sechzehntausend Mark, als ob sechzehntausend Mark für Sie ä Geld ist! Für's Baugeld lassen Sie mich nur sorgen. Und wenn's sich nicht rentiert — es ist nur ein Fall, den ich hier annehme, verkaufen Sie's wieder. Riskieren tun Se keinesfalls etwas — verlieren können Se nischt dran, es ist unmöglich — unmöglich sag' ich Ihnen!"
„Ich will mit meiner Frau darüber sprechen!"
„Aber lieber Geiger, ein Mann soll nicht einmal so viel Urteilskraft haben, allein ohne seine Frau etwas beschließen zu können? Ich begreife Se nicht, Se sind doch sonst so'n verständiger, gescheiter Mensch!"
„Herr Rewald, ich werde erst mit meiner Frau sprechen."
„Nu, sprechen Sie mit Ihrer Frau," sagte Rewald in einem Ton, als ob ihn diese ganze Sache nichts anginge.
„Piccolo, drei Echte!"
„Aber Herr Rewald, Sie wissen —"
„Aber Herr Geiger, Sie werden mir doch gestatten, ich nehme es Ihnen wirklich übel, wenn Sie mir — Sie können sich ja immer wieder revanchieren."
Und wieder begann das Gespräch. Der Aristokrat zeigte erstaunliche landwirtschaftliche Kenntnisse, sprach über die Bereitung des Rohzuckers aus Mohrrüben, über die Angoraschafzucht in Spanien, Australien und der Lüneburger Heide, dann über die Victoria Regia, die er — was schadet es — mit der Königin der Nacht verwechselte, den Peloponnesischen Krieg, den er in das sechste Jahrhundert vor Christi legte, versicherte den anderen mit ausgezeichneter Liebenswürdigkeit, dass er, er persönlich, gegen den Grafen Arnim gar nichts hätte, und dass derselbe sogar ein sehr lieber, anständiger Mensch sei — er hätte früher einmal das Vergnügen gehabt, seine intimere Bekanntschaft zu machen —. Dann ließ er sich, leider nur etwas zu orakelhaft über die Zukunft der deutschen Textil-Branche aus, die mit der finanziellen Lage Australiens aufs engste zusammenhinge.
„Herr Geiger, wir gehen."
Man wollte zahlen.
„Aber bitte, bitte, bemühen Sie sich nicht, meine Herren, wir können es ja ein anderes Mal regulieren. Ich werde mir gestatten —"
„Adieu, Schwager, adieu Herr Rewald!"
„Aber Herr Geiger, Sie werden doch noch nicht nach Hause gehen. Kommen Sie, Herr Geiger, wir wollen uns einmal das Haus ansehen, kommen Sie!"
„Herr Rewald, ein anderes Mal, meine Frau wartet mit dem Mittag."
„Sie kommen doch so wie so schon zu spät. Sie essen doch sonst immer um halb drei und jetzt ist es schon ein Viertel auf vier."
„Eben deswegen muss ich schnell nach Haus."
„Ach, sie werden doch auch zu Hause einmal ohne Sie fertig werden. Kommen Sie nur, wir sind ja gleich dort."
„Ja," setzte der Aristokrat hinzu, „ansehen können wir es uns ja!"
Geiger gab nach.
II
Als er endlich am Spätnachmittag heimkam, fühlte er einen eigentümlichen, dumpfen Druck zwischen den Augen, und die Geschehnisse begannen sich in seinem Kopf zu verwirren. Er wusste nur, er war noch irgendwo gewesen, hatte sich irgendetwas angesehen, und irgendetwas so halb und halb zugesagt: was es aber war, um was es sich handelte, darauf konnte er sich trotz aller Anstrengung nicht besinnen. Als er die Treppe hinaufstieg, versagten die Füße, er begann zu taumeln und wäre sicher gefallen, hätte er nicht noch schnell das Geländer umklammert. Dann schloss er auf und wankte, indem er sich bemühte möglichst leise aufzutreten, den Flur entlang zum Schlafzimmer. Dort fiel er angezogen, wie er war auf das Bett, wühlte sich in die grüne Steppdecke und das weiße Kantentuch und lag nun da mit großen, offenen Augen, nachsinnend, was eigentlich mit ihm passiert sei.
„Was war denn das nur? Was war denn das nur?"
Seine Frau, die ihn hatte kommen hören, trat zu ihm. Als sie die verglasten, stieren Blicke sah, als der scharfe Bier- und Weindunst, den er ausatmete, ihr entgegenschlug, da wurde es ihr klar.
Ihr Mann, zu dem sie aufblickte wie zu einem Heiligen, der ihr ein und ihr alles war, betrunken, betrunken wie ein Arbeiter, der Sonnabend seinen Wochenlohn bekommen! Wenn das die Mädchen erführen! Wenn das die Kinder sähen! Die Schande, die Schande!
Was blieb ihr anders übrig, sie musste ihren Mann ausziehen, zu Bett bringen wie ein Baby. Es war ein schweres Stück Arbeit, und wie sie das anekelte!
Als sie endlich damit fertig war, setzte sie sich ans Bett, hörte auf sein ruhiges, tiefes Schnarchen und das erste Mal in ihrer Ehe, das erste Mal seit acht Jahren weinte sie, sie schämte sich für ihren Mann. Er, der sonst so enthaltsam, war betrunken!
Die Geburt ihrer drei Kinder hatte ihr nicht solchen Schmerz bereitet, wie das. Ihr Mann, ihr Heiliger — ihr — ihr — ihr — ein und ihr — alles betrunken — Pfui!
III
Wir Kinder wurden heut früher zu Bett gebracht und wunderten uns, dass wir nicht wie sonst den Gutenachtkuss bekamen. Mutter, die kleine, dicke, lustige Frau war überhaupt in der letzten Zeit für uns wenig zu sprechen gewesen, ja es war sogar uns aufgefallen, dass sie schlecht aussah und dicke, verschwollene, rotgeweinte Augenlider hatte. Heute Abend hatte sie in allen Fächern ihres Mahagoni-Spindes umhergekramt und war dann mit einem Paket weggegangen. Wohin? Das wusste selbst Luise Lademann nicht — selbst Luise Lademann! Das musste etwas ganz Außergewöhnliches sein.
Auch in der Küche war alles wie umgewechselt. Ulrike, die mich sonst immer auf den Schoß nahm und sich sogar noch freute, wenn ich sie in die Nase kniff, hatte mich heute gar nicht beachtet, trotz all meiner Anstrengungen, mich bemerkbar zu machen, und mich endlich sogar wieder zu meiner Luise hinaufgeschickt, und die brachte mich einfach ins Bett.
Ins Bett — aber — ich war ja noch gar nicht müde?!
„So Georg, jetzt legst Du Dich auf die andere Seite und schläfst!" Und ich zog die Decke über das eine Ohr, lag mäuschenstill, tat als ob ich schlief, stupste nur manchmal den großen Zeh vom linken Fuß gegen das Bettende, um zu prüfen, ob ich noch wach wäre.
Nach einer halben Stunde hörte ich draußen eine Tür gehen. Luise ging hinaus. Ich horchte scharf auf, man sprach ziemlich laut im Nebenzimmer, aber trotzdem konnte ich nicht verstehen, um was es sich handelte. Ich hörte nur deutlich Luises Sttmme:
„Madame, Sie wollen mir wohl beleidigen?! Ich nehme et nicht, det könnnen Sie doch nu besser brauchen! Ne, un ich nehme et nicht!"
„Aber Luise, Du siehst doch, wir müssen uns jetzt aufs Äußerste einschränken, ich kann unmöglich zwei Mädchen halten."
„Un ich nehme et nicht! Un glauben Sie vielleicht, Frau Geiger, ich werd hier wegjehn, wo ich mir hier so an die Kinder jewöhnt habe? Ne!"
„Aber Luise, Du musst doch selbst einsehen –– "
„Un ich sage Ihnen, ich nehme et nicht! Ne, det wär' ja wirklich —, wo ich mir so an die Kinder gewöhnt habe" –– –– –– mehrkonnte ich nicht verstehen.
Luise kam wieder herein, setzte sich vor mein Bett und weinte.
„Sie wollte mir beleidigen! Uh! Sie wollte mir beleidigen, uh — und wo ich dabei so gut zu die Kinder bin — uh — sie wollte mir beleidigen — uh —"
Luise Lademann, unsere Luise weinte! Aus drei Betten erklang plötzlich ein Jammergeheul.
„Na, stille, schlaft man weiter. — Uh! Sie wollte mir beleidigen!"
Aber ich konnte nicht einschlafen.
Nach einiger Zeit hörte ich vorne meinen Vater sehr heftig sprechen.
„Diese Lumpen! Ich schlage ihn über'n Kopf! Nicht wert sind sie von mir — — die — –– mit dreißigtausend ist die Sache noch zu machen — er hat's genau gewusst, wie ich mich da hereinreite. — Red' nicht, Frau, genau hat er's gewusst, der Lump!! Ich halt's nicht aus, ich halt's nicht aus! Ich glaube, ich werde verrückt — nein — nein — nein — ich halt's nicht aus!
„Mit dreißigtausend wär alles zu retten gewesen. Du weißt, wie ich mich gemüht habe, wie ich gearbeitet habe, mein Lebtag!"
„Annchen, ich kann's nicht mehr, ich halt's nicht aus! Ängstige Dich nicht, ich werde ja wieder ruhig werden. Hab' keine Angst Kind, ich bin nur augenblicklich so erregt, — dieser — dieser, dieser Lump, dieser Gauner!"
Leises Weinen. — — — — Von da an wurde das Gespräch gedämpft geführt. Ich lauschte, lauschte, aber ich verstand nichts mehr und schlief ein. —
Nach einigen Stunden saß mein Vater allein vorn im Arbeitszimmer, vor ihm ein Blatt Papier, über und über mit Zahlen bekritzelt. Da war multipliziert und dividiert, addiert und subtrahiert und immer, immer das Defizit, wie es gedreht und gewendet, welche Möglichkeit auch angenommen, immer, immer das unregulierbare Defizit auf dem Grundstückkonto. Unabwendbar!
Und da lagen sie nun vor ihm, die letzten zwei Jahre, und mit einem Blick übersah er sie, als ob sie eine Seite seines Hauptbuchs wären. Seit jenem Tag, seit jenem unglückseligen Hauskauf, keine ruhige Stunde mehr.
Der plötzliche Umschlag: Grund und Boden verlieren den Wert, niemand wagt mehr ihn zu beleihen, und an Käufer ist gar nicht zu denken.
Woher Geld nehmen? Das, was noch geblieben, reichte nicht aus. Es musste vermehrt werden. Er beteiligte sich an Gründungen und verlor, er spekulierte in scheinbar sicheren Papieren und verlor.
Gutwillig opferte der Aristokrat hunderttausend. Sie wurden verschlungen.
Gutwillig gaben Freunde und Verwandte, was in ihren Kräften stand. Es verrauchte im Augenblick, wie Wassertropfen, die auf einen heißen Stein fallen.
Aber er konnte nicht mehr zurück, es war für ihn zur Existenzfrage geworden; es müssten ja auch bessere Zeiten kommen, und dann wäre ja alles gerettet, dann könnte er ja an dem Haus wieder zum reichen Mann werden.
In seiner Herzensangst hatte er sich an Rewald gewandt, trotzdem er vor ihm ein geheimes Grauen hatte, und Rewald hatte ihm wider Erwarten drei Mal mit kleinen Summen ausgeholfen –– aber dann war auch diese Quelle versiegt.
Oh — wie war er umhergelaufen in den letzten Tagen von einem zum andern; fast überall buchstäblich verschlossene Türen, und die wenigen, die ihn vorließen, zuckten mitleidig die Achseln. — Ja, wenn sie ihm helfen könnten, sie würden es ja gern tun — und hundert Gründe.
Mit dem Aristokraten war er auf's heftigste zusammengeraten — er konnte ihn retten und warum tat er's nicht! — und er bedachte gar nicht, dass jener schon ein Vermögen an ihn gewandt hatte, sondern ging in seinem Jähzorn so weit, handgreiflich zu werden Der Aristokrat verwies ihn, schäumend vor Wut, aus der Wohnung.
Überall verschlossene Türen! Überall verschlossene Herzen!
Und dann hörte er, dass Rewald einen Teil der Forderungen an sich gebracht habe, um als Hauptgläubiger gegen ihn aufzutreten. Er stürzte zu ihm — Rewald wäre verreist, hieß es.
Unabwendbar bankrott! Was nun? Was nun?
Vielleicht ist doch noch die Möglichkeit, es zu regulieren, und wenn auch nur für einige Tage.
Er rechnet, rechnet wieder und wieder, immer das Defizit. — Er öffnet den eisernen Schrank. Fast leer! Nur ein Zahlbrett, eine Mappe, das Geheimbuch! Er schlägt es auf. Per Kassa-Konto an Grundstück-Konto: immense Summen. Er rechnet und rechnet. Der Schweiß steht ihm auf der Stirn, keine Möglichkeit — das Defizit!
Er zerknittert wütend das Blatt, reißt es in Fetzen, wirft sie zur Erde und stampft mit dem Fuß darauf. Umsonst! Das Defizit bleibt. Wo er hinsieht Zahlen, Zahlen, nichts wie Zahlen. Das Defizit!!!
— Was nun?
„Gott, ich hab' ja mein Leben gearbeitet, wie'n Hund, und jetzt — — — — — Wozu? Wozu? Alles zunichte!!"
— Was nun? —
Er sieht in das obere Fach des Spindes. Leer die Tasche, wo sonst die Wechsel darin waren, alle schon zu Geld gemacht! Nicht einen Pfennig! — Da in der Ecke der Revolver!
„Was hab' ich denn noch zu verlieren? Aber so wie ein Dieb sich fortstehlen, ohne Abschied zu nehmen?"
Er schreibt:
„Da ich geistig und körperlich zu sehr angestrengt und eine gefährlich ausgehende Krankheit befürchte, so ist es das Beste, wenn ich so von Euch gehe. Wenn Ihr diese Zeilen lest, meine Lieben, bedauert mich nicht, wenigstens nicht meinen frühen Tod. Ich habe furchtbare Sorgen bei Tag und bei Nacht gehabt, und manche schlaflose Nacht verbracht, doch eine solche wie die vergangene noch nie, die wünsche ich dem niedrigsten Verbrecher nicht. — Lebt wohl, meine Lieben! Du vor allem, mein liebes, gutes Annchen! Wenn ich Dich manchmal gekränkt, verzeih mir, ich war stets gut und aufopfernd für Dich und unsere Kinder.
„Was vermag nicht Sorge?! Adieu! Ich wünsche mehr Frohsinn und Heiterkeit allen, die mir lieb und teuer sind!!!
Hermann Geiger."
Plötzlich schien es ihm, als stände hinter ihm eine graue, vermummte Gestalt und reiche ihm die Waffe über die Schulter. Er wandte sich um, seine Frau stand hinter ihm.
Sie sagte kein Wort, aber dem Gesicht sah man es an, dass sie es wusste, um was es sich hier handelte. Und seit langer Zeit wieder das erste Mal beugte sie sich über ihren Mann und küsste ihn.
IV
Ja, er war mit einem Schlag eine traurige Berühmtheit geworden, der große Geiger!
Das Geschäft, das wäre ja überhaupt niemals zu ruinieren gewesen, aber da musste sich dieser Mann natürlich in großartige Spekulationen einlassen, Grundstücke kaufen, Häuser bauen, ausbauen, sich an faulen Aktiengesellschaften beteiligen, ein großes Haus führen, ja, ja, lieber Geiger, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, dafür ist gesorgt!
Sogar die Börse, die doch damit gar nichts zu tun hatte, war darüber in Aufregung.
„Wissen Sie schon, der Geiger ist pleite!"
„So? Der hübsche?"
„Ja!"
Rewald trat herzu.
„Er hat sich in verfehlte Spekulationen eingelassen, mit dem Haus da bekauft. Wissen Se, was hab' ich mit ihm gered't! Geiger, hab' ich gesagt, Geiger lassen Se sich nicht auf sowas ein, Geiger, Se ruinieren sich, Se ruinieren Ihre Familie! Er hat nicht auf mich hören wollen. Nu hat er's!"
„Ich denke, er hat wohlhabende Anverwandte, konnten die ihm denn nicht mehr helfen?"
„Was glauben Sie, haben die schon verloren?!"
„Aber, ich denke, es ist nur ein geringes Defizit von fünfzigtausend?"
„Fünfzigtausend?! Ich sag Ihnen zwei mal hunderttausend reichen nicht."
Rewald ging achselzuckend weiter. Die beiden anderen blickten ihm nach.
„Ich möcht darauf schwören, der alte Lump hat wieder seine Hand im Spiel. Er ist nicht der erste, den er auf dem Gewissen hat, dieser Gurgelabschneider!"
*
Bei der Subhastation erstand Rewald das Haus um einen Spottpreis, da außer ihm fast niemand zu bieten wagte.
V
Einige Wochen gingen so hin. Man versuchte mir klarzumachen, dass ich einmal ein tüchtiger, das heißt reicher Mann werden müsse, dass ich es von jetzt an nicht mehr so haben könnte wie früher, und dass ich nicht weinen sollte, wenn ich nicht jeden Morgen meinen Kakao bekäme. — Ein reicher Mann wollte ich gern werden, denn dann brauchte ich ja nichts zu tun!
Luise war freundlich wie immer, aber Ulrike hantierte mürrisch in der Küche umher. All meinen Annäherungsversuchen gegenüber verhielt sie sich ablehnend, nur einmal orakelte sie.
„Siehst Du, kleiner Lumpenprinz, so geht's: erst will man auf Gummirädern fahren und nachher freut man sich noch, wenn man auf Stroh liegen kann. Das ist so im Leben wie in 'ne russische Schaukel, ruff — — und denn wieder runter!"
Zu uns kam auch jetzt öfter ein großer, hübscher Mann, in braunem Rock und blauer Mütze, mit dem Mutter lange sprach. Er zeigte weitgehendes Interesse für unsere Möbel, die er alle — nun mal seine Eigentümlichkeit — hinten mit blauen Stückchen Papier beklebte. Sonst war er sehr höflich und freundlich, und besonders unterhielt er sich mit mir und sagte, dass er auch solchen Jungen hätte wie ich wäre, mit dem ich einmal spielen könnte.
Vater war wenig zu Haus, und wenn er es war, entweder entsetzlich erregt, oder er saß mäuschenstill und brütete vor sich hin. Wir trauten uns schon gar nicht mehr zu ihm. Jedes Geräusch erbitterte ihn, und er schrie uns an, dass wir laut heulend aus dem Zimmer liefen. Mutter war freundlich wie sonst, küsste uns viel und kümmerte sich überhaupt mehr um uns, zog uns manchmal sogar an, da das Kinderfräulein, eine hochnäsige Gans, die viel an mir herumerzogen, mich oft in die Ecke gestellt, gestupst und geschlagen hatte, entlassen war.
Indessen wurde es immer ungemütlicher bei uns. Papa kam spät nach Hause, und dann war er entsetzlich matt und abgespannt. Sowie Mutter etwas zu ihm sagte, wurde er aufgebracht und fasste jedes Wort als einen Vorwurf auf.
„Ja, ja, ich weiß ja, dass ich alles verbracht und verliedert habe, lass mich zufrieden, ich weiß es ja schon, ich weiß es ja schon'.“
Besonders einmal, — ich erinnere mich noch, wie wenn es heute gewesen wäre, — wurde er furchtbar erregt, als er des Abends hungrig heimkam und noch nichts zum Essen vorfand. Er brüllte wie ein wildes Tier und schlug mit dem Spazierstock derart auf den Tisch, dass er den Griff in der Hand behielt. Mutter redete ihm gut zu, überhaupt wurde sie umso ruhiger je ausgeregter Vater wurde.
Ich war hinter die Sofalehne gekrochen und saß dort zitternd, mit angehaltenem Atem. Endlich ging Vater wieder fort, um anderwärts etwas zu essen, wie er sagte, nicht ohne sich vorher von Mutter, — Gott allein weiß, wo sie damals das Geld her bekommen hatte — eine Mark dafür geben zu lassen.
Als er fort war, sank Mutter, die bis dahin die Ruhe und Liebenswürdigkeit selbst gewesen, weinend auf das Sofa.
Nicht, armes kleines Frauchen, das hättest Du Dir nicht träumen lassen, das war Dir nicht an der Wiege gesungen worden! Du hattest nie gedarbt. Es war Dir stets das Leben so glatt wie ein gestrichenes Butterbrot, und jetzt die paar Pfennige zum Teufel! Alles zum Teufel! Die eheliche Liebe, die verwandtschaftliche Zuneigung, die Freunde! Alles! Alles!
Nicht, armes kleines Frauchen, das ist ein trauriges Dasein!! Endlich jedoch, als ich mich vollkommen sicher glaubte, kroch ich aus meinem Versteck hervor. Mutter bemerkte mich und nahm mich auf den Schoß.
„Du hast Dich wohl sehr geängstigt?"
„Ja!"
„Du fürchtest Dich Wohl jetzt vor Papa?"
„Warum denn? Er ist doch kein böses Tier!"
„Nein, Du darfst Dich auch nicht vor Deinem Papa fürchten, er ist ein seelensguter Mann und hat sein kleines Uschchen sehr lieb. Er ist nur jetzt sehr unglücklich, weil er durch böse Menschen sein ganzes Geld verloren hat."
„Da sind wir wohl jetzt ganz arm?"
„Ja, ganz arm!"
„So arm, wie unten die Kinder von Frau Dornack, denen Du mein rotes Kleid geschenkt hast?"
„Ja, mein Uschchen."
„Uh, dann werde ich wohl keinen Kakao mehr bekommen, Mama?"
„Ja, Kakao sollst Du bekommen und auch ein neues Wiegenpferd und Zinnsoldaten, denke nur, denen man ordentlich die Arme bewegen kann! Und einen großen, großen Hampelmann, größer wie das ganze Uschchen!"
„Bekomme ich den morgen?"
„Ja! –– –– Soll ich Dir etwas erzählen, Uschchen?"
„Ach ja, ach ja, ach ja!"
„Du musst aber stille sein! Also Onkel Ferdinand, Du kennst doch Onkel Ferdinand? Der taube Onkel, der immer mit Papa Schach gespielt hat —, der war, als er noch jünger war, Seesoldat, und da war er auch in Indien, wo es so heiß ist, dass die Menschen ganz braun aussehen, und da fährt er nun Mittags mit seinem Freund auf die Jagd — —, solch leichtes Wägelchen, so eins wie der Hauptmann drüben auch hat. Das Pferdchen läuft so hübsch im Trab durch den schönsten Wald, lauter schlanke, hohe Palmen und so große bunte Blumen und prachtvolle handgroße Schmetterlinge, wie meine türkische Morgenhaube so bunt. Und die Vögel fliegen so von Ast zu Ast, grüne und goldene, mit langen, roten Schwänzen und blauen Schnäbeln. Und die Affen, die spielen Zeck oben!"
„Ei'."
„Und das ist alles so hübsch und so lustig — Aber mit einem Mal, da zieht dahinten solche dicke, schwarze Wolke auf — — und es wird ganz dunkel –– uiih — — uiih –– geht der Wind durch die Bäume — — da –– ein Blitz zuckt quer übern Himmel, knatteraderadat, ein mächtiger Donnerschlag!"
„Mutter, ich muss doch zu Bett, ich bin so sehr müde!"
„Und da brüllt links im Gebüsch ein Löwe und springt mit einem mächtigen Satz quer über den Weg. –– ––"
Länger hielt ich's nicht aus. Ich sprang von Mutters Schoß, lief heulend zu meiner Luise und drückte meinen Kopf an ihre Schürze.
*
Den nächsten Morgen war niemand zu finden, der mich anziehen wollte. Alles lief draußen in großer Aufregung durcheinander. Türen wurden aufgerissen, zugeworfen, wieder aufgerissen. Ulrike rief fortwährend „man" möchte doch Kaffee trinken, ehe „man" ihn kalt werden ließe, denn kalter Kaffee wäre gesundheitsschädlich und schwäche die Sehkraft, wie „man" ihr von ärztlicher Seite mitgeteilt hätte.
Meine Schwestern mussten zur Schule. Da waren Arbeiten noch nicht gemacht, Bücher verlegt, Schuhknöpfer verworfen. Frühstück gab's nicht, sie könnten schon einmal bis Mittag so aushalten! Endlich stürzten sie fort. Luise setzte sich nun, anstatt mich anzuziehen vor mein Bett und jammerte.
„So'n Unglück! So'n Unglück! Die arme Frau, die arme Frau."
„Luise!"
„Ja?"
„Wer ist denn die arme Frau?"
„Das verstehst Du nicht!"
„Ich weiß es ja!"
„Soo?"
„Die Waschfrau von unten aus dem Haus!"
„Die meint' ich auch, Usche. So'n Unglück! So'n Unglück! Die arme Frau!"
„Luise?"
„Ja?"
„Hast Du auch Geschwister? Machen die auch ihre Schularbeiten nicht?"
„Fünf Brüder und fünf Schwestern! Die eine muss ich sogar mal ansuchen, die ist hier mit 'nem Schlosser verheiratet. Sie hat mir früher immer angepumpt, und ich glaube, sie wird mir wohl wieder anpumpen wollen, deswegen bin ich auch noch nicht zu ihr hingegangen."
*
Am Vormittag spielte ich auf dem holprigen, spitz-steinigen Hinterhof mit den Kindern der „armen Frau" und hielt ihnen gerade eine naturwissenschaftliche Vorlesung mit Demonstrationen über ein Spatzengerippe, das ich in der Ecke unter dem Balkon gefunden, als Luise mich heraufholte und sagte, sie müsse mich fein anziehen — die Samtjacke mit den goldigen Ankerknöpfen, — ich sollte mit Papa und Mama mitfahren. Droschke würden wir fahren! Ulrike wäre schon fort eine zu holen, eine niegel-, nagelneue mit 'nem Vorreiter! —
Papa wartete schon mit einem kleinen Handkoffer auf uns. Er war ruhiger wie sonst, ja sogar, was in der ganzen letzten Zeil nicht vorgekommen war, freundlich zu mir, klopfte mir mit der Hand auf den Kopf und sagte, ich sollte ein braver Mensch werden und viel in späteren Jahren an ihn denken.
Ich begriff durchaus nicht den Sinn dieser Worte. Es war doch ganz selbstverständlich, dass ich an ihn denken würde, da ich doch alle Abende für ihn mitbetete und ihn dann auch alle Tage zu sehen bekam.
Als Mutter kam, wurde Papa plötzlich ernster, sprach nichts mehr, sein Blick wurde scheu und er vermied es ängstlich, Mama anzusehen.
Draußen hielt schon die Droschke: auf dem Bock der alte, weißköpfige Kutscher, den ich wie einen Dreier kannte.
„Wohin, Herr Geiger?"
„Schlesischer Bahnhof."
Und wir fahren. Es ist sonntäglich still auf den Straßen, greller Frühjahrssonnenschein, weißblauer Himmel, die Scheiben blinken. In den Vorgärten gucken die Hyazinthen neugierig aus den schwarzen Beeten hervor; einige überwinterte Gelblinge haben sich bis in die Straßen verirrt. Kinder, die aus der Schule kommen, jagen ihnen nach und werfen jubelnd die Mützen nach ihnen.
Wir schweigen.
Trotz des frohen Sonnenscheins wird mir so beklommen zumute. Erst traue ich mich kaum aufzublicken. Papa sitzt ganz steif und sieht nach der anderen Seite hinaus. Ich sehe Mama an. Sie ist sehr blass, die Augen sind heftig gerötet, dicke Tränen rennen ihr fortwährend über die Backen.
Wir fahren, fahren; keiner spricht ein Wort. Papa blickt scheu aus den Wagen, Mama schluchzt still vor sich hin, ich blicke abwechselnd beide an. Ach — ich habe solche Angst! Was ist denn nur los? — Ich habe solche Angst — solche — solche — solche Angst.
Plötzlich wendet sich Papa um.
„Diese Lumpen! Ich bin doch wahrlich mein Lebtag ein ehrlicher Mensch gewesen, mein Lebtag! Du weißt, wie ich gearbeitet habe, um meinen Kindern mal eine gesicherte Existenz zu schaffen — und nun kann ich wieder von vorne anfangen! Alles — alles zum Teufel! — Aber — wir halten noch 'mal Abrechnung!"
„Und was soll hier aus uns werden?"
„Du hast reiche Verwandte, die werden sich Deiner annehmen. Ich muss fort, ich halt's hier nicht länger aus, ich werd' sonst wirklich noch verrückt! Ich kann nicht zusehen, wie mir abgepfändet wird, was ich mir mühsam Stück für Stück zusammengekauft habe! Ich werde dabei verrückt –– ich werde dabei verrückt!"
„Und was soll hier aus uns werden, aus mir und Deinen drei Kindern?"
„Gott wird für euch sorgen!"
Das klang nicht schön.
„Ich halt's nicht mehr hier aus. Die Leute weichen mir ja auf der Straße aus, als ob ich geächtet wäre — ich will meinen ehrlichen Namen wieder haben, den sie mir genommen haben. Meinen ehrlichen Namen —" brüllte er, verstummte aber plötzlich, vermied es uns anzusehen und blickte starr und steif auf die Straße, als ob er Löcher ins Pflaster gucken wollte. Mutter weinte. Ihre Nase war jetzt auch rot geworden; die grauen Äugelchen kniff sie ein; ich weiß, es machte auf mich einen sehr putzigen Eindruck und trotzdem weinte ich auch, aber ich gab mir Mühe, es zu unterdrücken, denn ich schämte mich vor Kindern, die dort lärmend auf einem Sandhaufen spielten. Ich dachte, alle Leute sähen mich an und ich schämte mich, weil ich so ungezogen war und weinte.
Wir stiegen aus. Die kalte, öde Bahnhofshalle gähnte uns an. Verrußte, rauchgeschwärzte Wände.
Zischend, pustend fahren Züge ein und aus. Oben in dem Eisenwerk verfängt sich der Rauch; durch die geweißten Scheiben brechen nur trübe die Sonnenstrahlen.
Mama weint heftiger als vorher, ich weine immer noch. Papa schenkt mir eine Mark — ich sollte den Schwestern auch ja etwas davon abgeben — gibt mir flüchtig einen Kuss, Mama einen längeren. Der Zug fährt ein; hält; Türen werden lärmend auf- und zugeschlagen. „Adieu!" „Adieu!" Ein Pfiff! — fort — ich winke und trockne mir abwechselnd die Augen mit dem Taschentuch. — Und da stehen wir nun beide allein! — Ich klammere mich an Mutters Rock.
„Wo reist denn Vater hin?"
„Komm, Georg."
Bis zum heutigen Tag ist mir sowohl Zweck wie Ziel dieser Reise ein Rätsel geblieben.
Drunten aus der Straße laufen die Menschen durcheinander, stoßen sich mit den Ellenbogen. Alles hat sich heute herausgewagt, selbst Greise und Kranke; tausende von Kindern lungern auf den Straßen, spielen Murmeln, Ball, Zeck, Verstecken. Weiter unten singt ein Kreis von kleinen Mädchen:
„Wir fahren aus der grünen See,
Wo die Fischlein springen,
Freuet sich mein ganzes Herz
Vor lauter Lust und Singen."
Da und da und da –– alles lustig!
„Ich habe Hunger, Mutter!"
Mutter sucht im Portemonnaie, klaubt ihre letzten paar Groschen zusammen und kauft für zehn Pfennige Schrippen und für fünfzehn Pfennige Wurst. Dazu reicht es noch.
„Ach, ich habe solchen Hunger, Mutter!"
Aber auf der Straße darf ich noch nicht essen, das schickt sich nicht für ein anständiges Kind, ich muss noch warten, bis wir in den Tiergarten kommen. —
Weiter! Ein Schaufenster reizt mich besonders! Au — da liegen so hübsche Sachen! Schinken und Wurst und Weintrauben und Apfelsinen kullern aus einem Fass, aber nicht durch die Scheiben. Jetzt kommt ein Dienstmädchen mit einem wohlgefüllten Korb aus der Tür.
„Mütterchen, ich habe solchen furchtbar großen Hunger."
Weiter! Endlich der Tiergarten! So viele Droschken.
„Sieh' mal, Mutter, ich glaube da vorn fährt Onkels Wagen!"