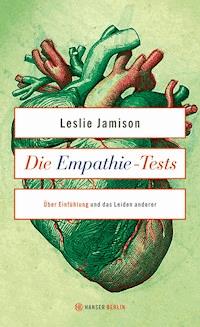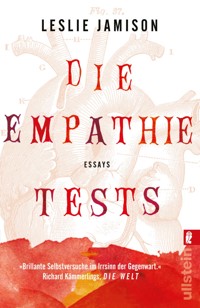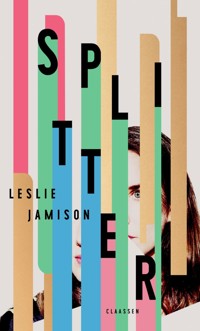
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
*** Der New York Times-Bestseller von der Autorin der Empathie-Tests *** Schonungslos und zutiefst persönlich – eine radikale Erkundung alleinerziehender Mutterschaft In ihrem bisher persönlichsten Buch fragt Leslie Jamison, welche Bereiche unseres Selbst verborgen bleiben, und richtet dabei den Blick auf sich – als Mutter, Ehefrau, Kritikerin und Autorin. Splitter versammelt Erinnerungen, Reflexionen und Geschichten, die sich bis in die tiefsten, noch unerforschten Bereiche des Selbst vortasten. Auf brutal ehrliche und berührend sanfte Weise fügt Jamison die Bruchstücke eines Lebens, die Scherben einer Ehe so zusammen, dass ein Bild der Wirklichkeit entsteht, voller Risse, Ecken und Kanten. Mit der ihr eigenen Sensibilität und Klarheit erzählt sie von der exklusiven Liebe zum Kind und der Suche nach einem Zufluchtsort in der Konfrontation mit Kunst – und zeigt, dass sie zu den genausten Beobachterinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört. »Sie ist eine Erforscherin des Schmerzes. Sie fächert seine Ausdrucksmöglichkeiten auf und sucht darin eine Sprache.« Zeit Online »Brutal ehrlich. Brutal schön. Leslie Jamisons Geschichte ist von einer feinen zärtlichen Gewalt.« Heinz Helle »Selbst in seinen traurigsten Momenten liest man den Text mit einem halb lachenden Auge. Ein schwebend schönes, herzzerreißend kluges Buch.« Daniela Dröscher »Leslie Jamison schreibt Märchen ohne Happy End. Wir brauchen mehr davon.« Jovana Reisinger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Splitter
LESLIE JAMISON, geboren 1983, wuchs in Los Angeles auf und lebt heute in New York, wo sie das Non-Fiction-Programm der Columbia University leitet. Sie schreibt für die New York Times, The Atlantic und Harper’s und hat zahlreiche Romane und Essays veröffentlicht. Ihr 2014 erschienenes Buch Die Empathie-Tests. Über Einfühlung und das Leiden anderer war ein New York Times-Bestseller.
»VIELLEICHT STIRBT DIE LIEBE SO IM GLAUBEN, DIE ANTWORTEN BEREITS ZU KENNEN.« Leslie Jamison führt als Schriftstellerin vor, wie politisch das Persönliche ist.In ihrem neuen Buch fragt sie, welche Bereiche unseres Selbst verborgen bleiben, und richtet dabei den Blick auf die eigene Person – als Mutter und getrennte Ehefrau, als Kritikerin und Autorin. Mit der ihr eigenen Sensibilität und Klarheit umkreist sie die exklusive Liebe zum Kind und die Suche nach einem Zufluchtsort in der Konfrontation mit Kunst – und zeigt, dass sie zu den genausten Beobachterinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gehört.
Leslie Jamison
Splitter
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Splinters im Verlag Little, Brown and Company, Hachette Book Group, New York.
© 2024 by Leslie Jamison© der deutschsprachigen Ausgabe2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Nurten Zeren, zerendesign.comAutorinnenfoto: © Grace Ann LeadbeaterE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3117-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
M I L C H
Als das Baby und ich …
R A U C H
In der ersten Nacht …
F I E B E R
Wie jede Quarantäne begann …
Anhang
Danksagung
Literaturverzeichnis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
M I L C H
M I L C H
Motto
Was ist das für eine Roboter-Eule, die Babys schlafen lässt? Was ist das für eine Puppe mit Herzschlag, die Babys schlafen lässt? Wie heißt die Tausend-Dollar-Wiege, die alles macht, was die Mutter macht? Geht die Hautschürze über der Kaiserschnittnarbe irgendwann weg? Wie viele Abtreibungen hatte Marina Abramović? Warum heißt der Kalte Mond auch Trauermond? Ist eine fliegende Ameise immer eine Königin, die eine neue Kolonie gründen will? Warum will die Ameisenkönigin eine neue Kolonie gründen? Wie hoch ist der durchschnittliche Stundensatz einer Scheidungsanwältin in New York City? Auf welche Weise wird der Wolfsmond mein Leben verändern?Als das Baby und ich …
Als das Baby und ich zur Untermiete in die Wohnung einzogen, hatten wir Müllsäcke voll mit Shampoo und Babykeksen, Haferflocken und Reißverschlussstramplern mit kleinen baumelnden Füßen dabei. Irgendwann waren mir die Koffer ausgegangen.
Wir hatten Windeln, die mit Rührei und Speck gemustert waren. Wer druckt Essen auf Windeln?, hätte ich gefragt, wenn noch ein Erwachsener da gewesen wäre. Aber es war keiner da.
Draußen waren sieben Grad unter null in der Sonne. Wir hatten die kleine schlauchartige Wohnung neben der Feuerwache für einen Monat gemietet. Ich hatte Himbeeren und ein Reisebett gekauft und eine weiße Lichterkette, um die dunklen Räume zum Leuchten zu bringen. Nebenan ging ein Feuerwehrmann mit einer Kettensäge in der einen und einer Schachtel Cheerios in der anderen Hand auf den Feuerwehrwagen zu. Mein Baby beobachtete ihn genau. Was hatte er mit ihren Cornflakes vor?
Erst als ich zu meiner Anwältin sagte: »Sie ist dreizehn Monate alt«, brach meine Stimme. Anscheinend haben Scheidungskanzleien Taschentücher genau wie Psychotherapeuten auf Lager, nur nicht ganz so griffbereit. »Sie müssen hier irgendwo sein«, murmelte meine Anwältin irritiert, als sie von ihrem Drehstuhl aufstand, um sich auf die Suche zu machen. Es hörte sich an wie: Ihre Tränen überraschen uns nicht, aber sie sind nicht unser Job. Fünf Minuten Weinen würde mich fünfzig Dollar kosten.
»Etwas über dreizehn Monate«, korrigierte ich mich, weil ich wollte, dass unsere Ehe länger klang. Immer wieder hatte er mir erklärt: »Unser Baby ist erst ein Jahr alt.« »Geh lieber gleich«, hatte meine beste Freundin gesagt.
Es half nicht, in meinem Kopf mit ihm zu streiten. Das Einzige, was half, war, das Baby so festzuhalten, dass sein runder Bauch die ganze Welt wurde. Und selbst das – na ja, es war ein zweischneidiges Schwert.
Die Wohnung war lang und dunkel. Eine Freundin nannte sie unseren Geburtskanal. Die Eigentümer waren offenbar Künstler; die Einrichtung war nicht sehr kinderfreundlich. Als Couchtisch diente ein stylisches Brett auf zwei Betonziegeln. Das größte Kunstwerk war eine weiße Leinwand, die aussah wie ein Stück Wand an der Wand. Manchmal ließen die Feuerwehrleute nebenan ohne jeden Grund ihre Kettensägen aufheulen. Aber was wusste ich schon? Vielleicht gab es für alles einen Grund.
Unsere Abende verbrachten wir mit Instant-Ramen und Clementinen. Den ganzen Winter rochen meine Finger nach Mandarine. In unseren Räumen pulsierte das flüssige rote Licht der Feuerwehrautos, das in Streifen durch die Jalousien fiel. An der Küchentheke klebten rosa Kuchenteig-Reste und sandfarbene Pancake-Mix-Tropfen. Die Rückstände meiner Kummer-Gelüste.
Tagsüber saß mein Baby mit der Rumbarassel zwischen schweren Kunstbüchern und klopfte die transparenten Seiten der Geschichte eines Blätterhaufens ab: die Weide, die Birke, der verlorene Handschuh, der verlorene Schlüssel und ganz unten ein kleiner Wurm. Mein Baby ging zärtlich mit seinem Plüschelch um und schmiegte die Wange an sein zusammengeflicktes braunes Fell. Das Xylophon dagegen bestrafte sie wie ein alttestamentarischer Gott. Es war ein Wunder, dass es ihre Musik überlebte.
Wir zogen mitten in der Grippesaison aus. Eines Nachts wachte ich auf und hatte den Mund voll süßem Speichel. Ich wankte an dem träumenden Baby vorbei ins Bad und kniete bis zum Morgengrauen über der Toilette. Als das Baby aufwachte, schleppte ich mich auf allen vieren von Zimmer zu Zimmer hinter ihm her, legte mich auf die Dielen und beobachtete es von der Seite. Ich war zu schwach zum Aufstehen, aber ich durfte meine Tochter nicht aus den Augen lassen. Was sie sich alles in den Mund steckte, sprengte meine Fantasie. Ich konnte nur schlotternd und fiebrig in meine graue Decke gewickelt zwischen ihrem Spielzeug liegen. Sie hielt mir ihren Lieblingsstock hin, mit dem sie sonst das Regenbogen-Xylophon bearbeitete. Sie fand ein Cheerio auf dem Boden und schob es mir fürsorglich in den Mund.
Auch ich war ein »Scheidungskind«, wie es heißt, als könnte eine Scheidung Kinder kriegen. Früher dachte ich, die Scheidung wäre eine Zeremonie, genau wie die Hochzeit: Das Scheidungspaar wiederholt die Choreografie vom Altar aus rückwärts; sie lassen ihre Hände los und gehen getrennt zur Kirchentür. Einmal fragte ich eine Freundin meiner Eltern: »Hattet ihr eine schöne Scheidung?«
Ich verliebte mich nicht allmählich in C. Ich verliebte mich Hals über Kopf, umfassend, verzehrend, lebensverändernd. Es war, als würde ich das Innere aus einem frischen Brotlaib reißen und mir in den Mund stopfen. In diesen frühen Tagen war C. ein Mann, der in einer Pariser Dachkammer auf der Kochplatte Wurstscheiben briet und mir dabei einen Heiratsantrag machte. Der mich zum Lachen brachte, bis ich von unserer roten Couch fiel. Der die Smoked Tacos liebte, die wir uns bei einem Imbiss nördlich von Morro Bay holten. Der mir durchs Fenster einer Surfer-Bude die Hühner im Hinterhof zeigte. Der mir die Hand aufs Bein legte, während ich vor dem CT einer geplatzten Eierstockzyste die Kontrastflüssigkeit trank, die wie bitteres Gatorade schmeckte. Der auf unserem Roadtrip die Nitty Gritty Dirt Band spielte und einen zimtbraunen Teddy aufs Armaturenbrett setzte, weil er unser Maskottchen war, unser Leittier. Unser Ding. Wir hatten lauter Dinge, wie alle Paare. Aber unsere gehörten nur uns. Wer findet sie jetzt noch schön?
In diesen frühen Tagen war er ein Mann, der im Golden Nugget beim Zimmerservice Steaks bestellte, nachdem wir um Mitternacht in Las Vegas geheiratet hatten. Er war ein Mann, der beim Fernsehen neben mir lag, wenn wir unsere Lieblings-Parcours-Show sahen, ein Mann, der sich mein Porträt auf den Bizeps tätowieren ließ, ein Mann, der mir auf einer vollen Party ins Ohr flüsterte.
Er ist immer noch dieser Mann. Ich bin immer noch diese Frau. Wir werden diese zarten Menschen immer in uns tragen, selbst wenn wir sie verraten haben.
Zum ersten Kurs im Semester unserer Trennung – als mein Leben aus Wohnungssuche, wütenden Nachrichten und Baby bestand, oder der Fahrt zur Tagesmutter –, kam ich mit pochenden Schläfen und fahrig von zu viel Koffein im Seminarraum an. Mein Herz summte wie ein Bienenstock. Die Studierenden klemmten sich das Haar hinters Ohr und zupften an ihren Nagelhäuten und erzählten mir der Reihe nach, worüber sie schreiben wollten: Labioplastie. Chronische Schmerzen. Wie es ist, in eine Lawine zu geraten. Was sie nicht wussten, war, dass sie alle meine Kinder waren. In meinem Bienenstockherz war genug Liebe für sie alle.
Wenn man eine kaputte Ehe endlich hinter sich gelassen hat, fühlt es sich an, als würde man vor Liebe überlaufen. Jedenfalls war es bei mir so: Meine Liebe war ein riesiger Haufen Badeschaum, der um mich herum immer größer wurde. Ich wollte die ganze Welt damit überschütten. So saß ich in der Badewanne neben der Feuerwache. Ich mit meinem Baby, das in jedem Raum unseres Geburtskanals zu tun hatte. Es musste die Löffel aus dem Besteckkasten nehmen. Es musste die Baby-Jeggings aus der Schublade mit den Baby-Jeggings nehmen. Es musste das Regenbogen-Xylophon verprügeln, als hätte es ihm etwas angetan. Als wollte es mir sagen: Fall auf die Knie. Fall auf die Knie und hör endlich zu.
Wenn ich zusah, wie sie mit ihren kleinen weichen Händchen auf die hölzernen Klangstäbe klatschte, drehte ich mich fast zu dem Phantom ihres Vaters um, damit wir ihr zusammen zusehen konnten – dann bremste ich mich. Würde jeder Moment des Glücks von nun an dieses Gewicht mit sich tragen?
Vor einem Jahr war während eines Schneesturms meine Fruchtblase geplatzt. Die Wehen liefen gut, bis sie nicht mehr gut liefen. Plötzlich war es zwei Uhr früh, und eine Schwester beugte sich über mich und sagte: »Ich brauche noch ein Paar Hände«, immer wieder, bis auf einmal viele Hände da waren, zu viele Hände, die nach Herztönen suchten.
Dann schoben sie mich im Laufschritt zum OP und riefen: »Unter siebzig! Unter sechzig!«, und ich wusste, dass sie von ihrem Herzschlag sprachen.
Sie deckten ein blaues Tuch über die untere Hälfte meines Körpers und kippten das Bett, damit das Narkosemittel schneller in meinen Oberkörper lief. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, warum wir uns auf die Schwerkraft verlassen mussten. Hatte die Wissenschaft keine bessere Methode entwickelt? Aber vor allem wollte ich einfach nur, dass sie dem Baby halfen.
Als sie meine Tochter aus meinem Bauch geschnitten hatten, brachten sie sie in eine Ecke des OPs. Unter der Decke ragte ein unfassbar kleines Beinchen hervor. Die Anästhesistin versuchte, meinen Blutdruck zu messen, aber meine Arme rissen an den Manschetten wie angekettete Hunde. Wen interessierte mein Blutdruck? Mein Baby war klein, es war lila, es lag nicht in meinem Arm. Ich zitterte die ganze Zeit. Die ganze Zeit hielt C. meine Hand.
In meinen Adern tobten Medikamente und Adrenalin. Erst als ich mein Baby halten durfte, wurde ich endlich ruhig.
Beim Stillkurs auf der Wochenstation hielten die anderen Frauen in gestreiften Stillhemden im Matrosenstil ihre friedlich nuckelnden Säuglinge im Arm, während ich im offenen Krankenhausnachthemd dasaß, die nackten Brüste entblößt, an denen kein Baby hing. Meine blaue Netzunterhose war hoch über den Wundverband gezogen. Ich sagte: »Ich heiße Leslie, und mein Baby trinkt nicht«, während meine hungrige Tochter in meinen Armen schrie. Es fühlte sich an, als hätte ich eine offene Weinflasche zum AA-Treffen mitgebracht.
Der Stillkurs erweckte alte Pubertätskomplexe wieder zum Leben – die Überzeugung, dass alle anderen Mädchen die Rituale der Weiblichkeit mühelos beherrschten, während ich mich blamierte. Und genauso falsch lag ich mit der Annahme, dass die Frauen in den gestreiften Hemden nicht ihre eigenen Probleme hätten.
Nachts sah ich das Empire State Building durch das Krankenhausfenster, seine kleinen gelben Quadrate leuchteten hinter dem Dachlabyrinth aus schneebestäubten Schächten und Rohren. Im stummen Fernseher machten Teenager Macarons in einer Show, die offenbar »Amerikas schlimmste Bäcker« hieß. Wenn ich aufs Klo ging, wickelte sich der Infusionsschlauch um die Stange. Ein Blutklumpen fiel aus meinem Körper und landete auf den Fliesen. Er war so groß wie eine kleine Avocado und zitterte wie Wackelpudding.
Die Fensterbank füllte sich mit Snacks von Freunden: Vollkornkekse, Cashewnüsse, Cheddar-Käse, Kokoswasser, Orangen mit kleinen grünen Blättern. Jemand gab mir eine Liste zum Ausfüllen: Wollte ich Knochenbrühe? Plötzlich waren Blumen da: groß blühende Lilien, violette Orchideen, lavendelfarbene Tulpen. Die Krankenhausunterhose aus blauem Netz war die einzige Art Unterwäsche, die ich je wieder tragen wollte. Das gewickelte Baby lag wie eine Gottheit in seinem Acrylglasbett zu meinen Füßen. Manchmal schlug es die Augen auf, und dann blieb die Welt stehen.
Als meine Mutter aus Kalifornien einflog, saß ich auf dem gestärkten Laken und hielt mein Baby, und meine Mutter hielt mich, und ich weinte hemmungslos, weil ich endlich begriff, wie sehr sie mich liebte, eine Gnade, die kaum zu ertragen war.
Um drei Uhr morgens kam eine Krankenschwester und sagte, sie würden mein Baby mitnehmen, um seine Neugeborenengelbsucht mit Blaulicht zu behandeln. Sie nannte es Billy-Licht, weil das Blaulicht den Abbau des erhöhten Bilirubins beschleunigte. Erst als sie sagte: »Keine Angst, das kommt häufig vor«, merkte ich, dass ich weinte. Wie sollte ich es erklären? Ich wusste, dass Neugeborenengelbsucht häufig auftrat. Doch mein Körper konnte einfach nicht ohne ihren Körper sein. Meine Tränen kamen nicht aus dem Kopf. Sie kamen aus einer wortlosen Höhle aus Muskel und Milch. Aus dem Teil von mir, der mein Baby am liebsten verschlungen hätte, damit es wieder in mir war.
Nach einer Weile schob ich mein Infusionsgestell den Gang hinunter und fand mein Kind im Säuglingszimmer, wo es mit nur einer winzigen Windel bekleidet im künstlichen Licht lag – ein Bein angewinkelt wie eine kleine Flitterwöchnerin –, während seine Haut die flüssige kobaltblaue Welt aufsaugte.
Als wir wieder zu Hause waren, öffnete mein Baby eine Naht in der Nacht und zog mich in die Dunkelheit – die stillen Stunden zwischen zwei und sieben, wenn mein Kind an meiner Brust schlief, während ich Reality-TV-Shows über angehende australische Models sah oder im Wohnzimmer hin- und hertigerte, das einzige erleuchtete Fenster draußen anstarrte und mich fragte: Wer? und Warum?. Es war, als wäre ich auf einem fremden Planeten gelandet, der sich die ganze Zeit in einer Falte unserer gewohnten Welt verborgen hatte.
Die Leute erzählten mir, Mutterschaft würde sich wie ein Entzug anfühlen – der Mangel an Zeit, an Schlaf, an Freiheit –, aber ich empfand es eher wie eine plötzliche, überwältigende Fülle. Wenn man nicht schläft, hat der Tag mehr Stunden.
Natürlich hatte ich gehört, dass die meisten Babys nicht durchschlafen. Aber diese Warnung kam mir jetzt wie ein Witz vor. Wie schaffte man es, sie überhaupt zum Schlafen zu bringen? Sobald ich das Baby in sein Körbchen legte, begann es zu weinen und weinen. Ich probierte 16 Puck-Methoden aus, und keine funktionierte. Selbst die Pseudo-Pucksäcke halfen nicht, jedenfalls nicht um drei Uhr morgens. Die Laschen waren mit Klettverschlusslabyrinthen versehen. Was sollte wo kleben bleiben?
Das Baby schlief nur auf dem Arm. Also blieben C. und ich im Schichtdienst wach. Das rote Sofa war mit orangen Dorito-Krümeln und Zuckerkristallen von Sour Patch Kids überzogen, an denen ich mir die Zunge wund schürfte, während ich sie mechanisch, unaufhaltsam und handvollweise in mich hineinstopfte. Das nächtliche Klopfen der Heizungsrohre war so laut, als würde eine Zwergenarmee mit Hämmern gegen ihre Gefangenschaft protestieren. Wenn es losging, biss ich die Zähne zusammen und hoffte, dass sie das Baby nicht weckten.
Jeden Tag versuchte ich, genug Milch für ein Fläschchen abzupumpen, aber ich stillte so viel, dass dazwischen kaum Zeit war, um noch mehr Milch zu produzieren. Nachts verschaffte mir das Fläschchen ein paar Stunden Schlaf. Meistens hielt ich das Baby bis elf oder zwölf, C. übernahm die Stunden bis zwei oder drei, dann wachte ich auf, um sie bis zum Morgen zu halten. Manchmal hörte ich, wie er das Fläschchen früher als erhofft aus der Küche holte, schon kurz nach Mitternacht, und dachte: Nein, nein, nein, weil ich wusste, dass der Countdown lief. Die Uhr tickte, bis mein Körper wieder unersetzlich war.
Vor der Geburt hatte mich ein obsessiver Nestbautrieb gepackt. Man konnte das Elterndasein überleben, wenn man das richtige Zubehör hatte. Man konnte Zeug anhäufen wie Piratenschätze. Aber nichts davon funktionierte! Das weiße Rauschen der Einschlafhilfe war nur die Vertonung einer verzweifelten Hoffnung.
Wenn ich Baby schläft im Kinderbett nicht ein googelte, tauchten nur noch lila Suchergebnisse auf, die ich längst geklickt hatte. Wenn ich morgens um drei Tausend-Dollar-Wiege, die alles macht, was die Mutter macht googelte, fragte ich mich, ob die Verkaufszahlen von Tausend-Dollar-Wiegen zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens in die Höhe schossen.
Die ersten Wochen mit meiner Tochter verbrachte ich in dem grauen Sessel am hinteren Fenster. Im Kühlschrank faulten unsere Ambitionen vor sich hin: die Gurke, die Salat werden sollte und jetzt braune Flüssigkeit absonderte; die vergessenen, aufgeweichten Erdbeeren; die Tomatensoße mit dem Schimmelpelz. Wenn ich meine Tochter stillte, brachte meine Mutter mir unzählige Gläser Wasser. Zu dritt bildeten wir ein hydraulisches System. Mein Blick war immer auf den Kopf meiner Tochter gerichtet, meine Finger streichelten ihre Wange, damit sie wach blieb, wenn sie trank. Sie war drei Wochen zu früh gekommen. Sie war klein.
Alle paar Stunden stellte meine Mutter mir einen Teller auf den Schoß, darauf Cracker mit kleinen Käsequadraten, Ästchen mit Weintrauben, ein Pink-Lady-Apfel in Scheiben gefächert. Sie sagte: »Du musst essen.« Sie hielt meine Tochter im Arm und flüsterte ihr ins Ohr: »Weißt du, wie sehr dich deine Mama liebt? Genauso liebe ich sie.«
Meine Mutter. Nach der Trennung meiner Eltern, als ich elf war, gab es nur noch uns zwei. Am Sonntagabend saßen wir zusammen auf der Couch, aßen Eis und sahen Mord ist ihr Hobby. Sie hatte den Fall immer schon bei der zweiten Werbepause gelöst, weil sie den verlorenen Schirm am Szenenrand entdeckte oder das falsche Alibi durchschaute, wenn der Mörder das falsche Personalpronomen für die Zahnärztin benutzte. »Reines Glück«, sagte sie. Es war natürlich kein Glück. Es war ihr scharfes Auge fürs Detail, die Aufmerksamkeit, mit der sie jeden Arzttermin, jeden beiläufigen Kommentar speicherte, den ich über ein Schulprojekt oder den Streit mit einer Freundin verlor; sie fragte immer nach, wollte wissen, wie es weiterging.
Ihre Haut trug den süßen sauberen Duft ihrer Seife – die blaue Dose mit dem kalten, weißen Pudding, den sie sich kreisend in die hohen Wangenknochen massierte. Sie backte frisches knuspriges Brot und gab mir das Knäuschen, noch ofenwarm.
Sie half mir, mein spiralgebundenes Karteikarten-Kochbuch mit Rezepten zu füllen, damit ich einmal in der Woche für uns kochen konnte: Sloppy Joes mit Soja-Hackfleisch oder Auflauf mit Champignoncremesuppe aus der Dose. Mein Vater war Wirtschaftswissenschaftler und hielt sich meistens am anderen Ende des Landes auf oder in seinem Apartment am anderen Ende der Stadt oder in einem Flugzeug. Es war schwer, den Überblick zu behalten. Einmal im Monat aßen wir zu Abend. Mal mehr, mal weniger. Meine Pilzpastete hat er nie probiert.
Auf vielen Fotos aus meiner Kindheit hält meine Mutter mich fest – einen Arm um meinen Bauch geschlungen, während sie mir etwas zeigt: Schau mal. Über ihre Liebe zu sprechen wäre tautologisch: Sie hat meine Auffassung von Liebe definiert. Genauso sinnlos wäre es zu beschreiben, wie viel mir unsere gewöhnlichen Tage bedeutet haben, denn sie haben mich hervorgebracht. Ich kenne kein Selbst, das unabhängig davon existiert.
Die Dämmerung war die Hexenstunde. Das Baby schrie in einem fort. Stillen half, bis es nicht mehr half, und dann half nichts mehr.
Im Internet stand, Babys brauchen, wenn es dunkel wird, Trost wegen der Urangst, im Dunkeln verlassen zu werden.
»Keine Angst, Baby«, sagte ich zu dem schreienden Bündel in meinem Arm. »Ich lasse dich nicht allein im Dunkeln.« Auch wenn die Idee, einmal ausgesprochen, gar nicht so schlecht klang.
Ihr Geschrei war so penetrant wie ein Juckreiz, den man bis zum Knochen kratzen will. Jedes Aufheulen ein Vorwurf: Du machst es nicht besser. Eines Abends schrie ich zurück: »Was ist denn los?« Sie starrte mich einen Moment entrüstet an, dann schrie sie weiter. Sie war erst elf Tage alt! Ich bot ihr als Friedensangebot meine Brust an, aber sie wollte nichts davon wissen. Ich drückte das Gesicht an ihre heiße rote Wange, rieb meine Haut in ihren kleinen warmen Tränen. Sie musste wissen, dass ich der Mensch war, der sie nie verlassen würde.
Wenn ich sie im Arm hielt, trat ich im Wiegeschritt von einem Fuß auf den anderen. Meine Mutter erzählte mir, dass meine Großmutter, die auf einer Farm nördlich von Saskatoon in der kanadischen Provinz Saskatchewan aufgewachsen war, dieses Schaukeln den Saskatchewan Shuffle nannte. Alle Mütter kennen diesen Wiegeschritt. Alle Mütter haben einen Namen dafür. Manchmal sieht man eine Frau, die ihn reflexhaft macht, mit leeren Armen, weil sie ein fremdes Baby weinen hört.
Wenn sie stundenlang schrie, wenn stundenlang nichts half, begann ich zu verstehen, warum Babys geschüttelt werden. Ich verstand, warum viktorianische Mütter ihren Babys Opiumtinkturen gaben. Irgendwann begann ich, sie weiterhin in den Armen haltend, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Unsere Körper fühlten sich immer noch wie ein Körper an. So tat wenigstens nur meiner weh. Je fester ich mit dem Kopf gegen die Wand schlug, desto sicherer hielt ich sie – in den liebenden Armen einer Frau, die den Verstand verlor. Vielleicht hörte das Baby nie zu weinen auf, aber das war okay, weil ich irgendwann … sterben würde?
Die alten Drogisten hatten den perfekten Namen für ihren Baby-Opium-Saft. Sie nannten ihn »The Quietness« – »Die Stille«.
Wie ging es schließlich weiter? Sie hörte auf zu schreien. Sie schlief. Sie wachte auf. Sie schrie wieder. Sie schlief wieder. Sie trank wieder. Ich fütterte mein Kind. Meine Mutter fütterte mich.
Monate später sagte C. in der Paartherapie: »Ihr drei wart wie eine geschlossene Welt hinten in dem Zimmer. Für mich gab es keinen Platz.«
Es war, als würde ich nichts anderes tun, als stillen oder mit dem Baby vor dem Bauch herumwandern. Das Leben bestand aus wenig mehr als dem dünnen Strom Milch, der meinen Körper mit ihrem verband, gelegentlich unterbrochen von einem Erdnussbuttersandwich.
Meine Mutter hatte für zwei Monate eine Wohnung in der Nähe gemietet. Jeden Morgen wartete ich sehnlich auf ihre Ankunft. Wenn sie da war, konnte ich mich fallen lassen, konnte – ohne zu zögern, ohne mich zu entschuldigen – um alles bitten, was ich brauchte. Hundert Mal am Tag sah ich meine Mutter an – in ihren Rollkragenpullovern, in ihrem pinken Schal, in ihren Wintersachen, die sie in Los Angeles gekauft hatte – und dachte, wenn ich nur halb die Mutter werde, die du warst, ist es genug.
An den meisten Tagen blieben wir im hinteren Teil der Wohnung, in der Nähe der Küche, bei dem grauen Sessel am Fenster. Wenn ich stillte, sah ich den kahlen Ästen zu, die vor der Backsteinmauer mit den dunklen spinnennetzartigen Ranken im Winterwind tanzten.
C. blieb am anderen Ende des langen Flurs, im Wohnzimmer, wo die helle Wintersonne die rote Couch anstrahlte. Er arbeitete. Wir drifteten an entgegengesetzte Enden der Wohnung, als würden unsere Körper – seiner am Laptop, meiner im Stillsessel – den Abstand einhalten, der bereits zwischen uns herrschte.
Es fiel mir leichter, in die Bindung zurückzufallen, die für mich immer die natürlichste gewesen war – Mutter und Tochter. Meine Mutter war der einzige Mensch, zu dem ich offen, ehrlich, unmissverständlich sagen konnte: Bitte hilf mir.
Als Kind schrieb ich gern Märchen ohne Happy End. Der Drache grillte sie alle. Die Prinzessin ließ den Prinzen am Altar stehen und flog mit einem Heißluftballon über das Meer davon. Vielleicht waren es sogar Happy Ends, nur eine andere Sorte. Statt einer Hochzeit Leinen los. Sandsäcke über die Reling. Flackernde Flammen unter Ballonseide.
Als Erwachsene behauptete ich so oft über mich: Als Kind schrieb ich gern Märchen ohne Happy End, dass ich das andere Kind vergaß, das durch die Flure meiner Erinnerung geisterte. Das Mädchen, das im Supermarkt in der Zeitschriftenecke nach Brautmagazinen suchte und sich die Hochglanzfotos der ausgestellten Kleider, herzförmigen Ausschnitte und langen Schleppen ansah, die wie kristallbesetzte Spinnweben auf grünen Wiesen glitzerten. Ich bettelte meine Mutter so lange an, bis sie ihren Widerstand aufgab und mir das Heft kaufte. Dann gehörte es mir, glänzend und nach Parfumproben riechend, dick wie ein Telefonbuch in meinen fünfjährigen Händen.
Das Komische ist, ich erinnere nicht, dass ich das Heft besaß, sondern nur, dass ich es wollte. Sobald das Objekt meiner Begierde schwer in meinen Händen lag, verwandelte sich meine Sehnsucht in etwas Diffuses und Irritierendes, etwas, das schwerer zu erinnern war.
Als ich C. kennenlernte, war ich dreißig Jahre alt. Ich war kein Kind mehr. Aber es gab so viel, das ich noch nicht wusste. Ich hatte nie eine Entscheidung getroffen, die ich nicht rückgängig machen konnte. Ich ertrank in der Umkehrbarkeit meines eigenen Lebens. Ich sehnte mich nach der Beständigkeit von etwas, das man nicht zurücknehmen konnte.
Wir lernten uns in der Gemeinschaftsküche des Writers’ Space in Downtown Manhattan kennen, in dem wir beide arbeiteten, einem Labyrinth von Schreibtischnischen im zweiten Stock gegenüber von einer Party-City-Filiale. Unter uns war eine ehemalige Barkeeperschule, wo ich manchmal telefonierte, wenn ich für meine Reportagen Interviews führte – mit Marinetontechnikern oder den Familien von Kindern mit Erinnerungen aus früheren Leben –, und dabei durch die leeren, mit Teppich ausgelegten Räume und sich schälenden Linoleum-Tresen schritt.
Als C. mich ansprach, fragte er nach meinem Tattoo. Er war nicht der erste Mann, der danach fragte. Aber ich interessierte mich noch mehr für seine Tattoos als er für meine. Er hatte so viele davon: der unscharfe, handgestochene hebräische Buchstabe in seinem Nacken, das Skelett, das auf seiner Schulter Skateboard fuhr; die blühende Lilie auf seinem Unterarm. Ich hatte das Gefühl, am Anfang eines langen Flurs zu stehen, jedes Tattoo eine offene Tür.
Als er sich später mein Gesicht auf den Bizeps stechen ließ, waren wir ein Jahr zusammen und schon verheiratet. Dieser Beweis seiner Hingabe – die Tatsache, dass er mich Teil seines Körpers werden ließ – war berauschend und beängstigend zugleich. Die Tätowierung erinnerte mich daran, dass wir nicht rückgängig machen konnten, was wir getan hatten. Es gab kein Zurück.
An diesem ersten Nachmittag wusste ich sofort, wer er war. Sein Debütroman war hymnisch auf der Titelseite der New York Times Book Review besprochen worden. Auf dem Autorenfoto sah er einschüchternd aus: das dunkle Haar, der durchdringende Blick, die Tätowierungen, die schwarze Kleidung. Er sah nicht aus wie jemand, der dich einfach so anlächelte. Als ich vor ihm stand, spürte ich diese Schroffheit, aber sie existierte – beunruhigend, aufregend – neben Albernheit und Eifer und Neugier. Wenn er lachte, bebte sein ganzer Körper. Man wusste sofort, dass er authentisch war. Sein Gesicht hielt nichts zurück. Jeder Anflug von Missbilligung, Begehren, Wut oder Empörung leuchtete in seinem Gesicht wie ein Blitz am Himmel.
Auf unserem dritten Date fuhren wir für vier Tage mit dem Auto in die Catskills und übernachteten in dem einzigen Motel, das ohne Reservierung noch ein Zimmer frei hatte. Es hieß Beds on Clouds, weil die Decke in jedem Zimmer mit einem anderen Himmel bemalt war. Unser Zimmer hatte noch mehr zu bieten. »Das sind einige Siegfrieds und Roys«, rief C., als wir eintraten. Die Wände waren tapeziert mit mindestens dreißig Fotos der Dompteure, auf denen sie stolz mit ihren Tigern posierten. Wir waren hingerissen.
Morgens frühstückten wir in einem kleinen Diner ein Stück die Straße hinunter. Der Kaffee war mulchig, bitter und heiß, aber ich trank eine Tasse nach der anderen, verbrannte mir die Zunge daran – weil ich wach sein wollte, weil ich reden wollte, weil ich den salzigen Bacon essen wollte, von dem meine aufgesprungenen Lippen brannten; weil ich schnell zum Tisch zurückwollte, wenn ich aus der kleinen Toilettenkabine kam, so viel hatten wir uns zu sagen.
C. hatte so viel mehr erlebt als ich. Nicht nur, weil ich frisch aus den Zwanzigern kam und er schon über vierzig war, sondern auch, weil er eine große Tragödie erlebt hatte: die lange, schreckliche Krankheit und den Tod seiner ersten Frau. Er hatte beide Rückenmarkstransplantationen mit ihr im Krankenhaus verbracht. Er hatte sich den Kopf rasiert, als sie ihren rasierte. Er hatte versucht, sie zum Essen zu überreden, als sie nicht essen konnte. Er hatte mit der Faust ein Loch in die Wand geschlagen, als sich die Krankenversicherung weigerte, die Rechnungen zu bezahlen, nicht zum ersten Mal, sondern zum zwanzigsten Mal. Er sprach mit einer tiefen Bewunderung über sie, die vielschichtig und ehrlich war. Er sagte, ich hätte sie geliebt; sie hätte mich geliebt. Wir wären Freundinnen gewesen.
Als das Baby fünf Wochen alt war, rief der Kinderarzt wegen ihrer Schilddrüse an. Es war das dritte auffällige Testergebnis. Die Erstuntersuchungen waren in Ordnung gewesen, aber jetzt gab es ein paar abweichende Messwerte. Kein Grund zur Besorgnis, sagte der Arzt.
Beim ersten Mal hatte er gesagt: »Ich bin mir sicher, dass alles in Ordnung ist.« Beim zweiten Mal: »Wahrscheinlich ist alles in Ordnung.« Diesmal sagte er, er habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht sei, die Kinder-Endokrinologin an der NYU sei sehr besorgt wegen der Werte meiner Tochter. Die gute Nachricht war, sie hatte Zeit für uns. In einer Stunde sollten wir da sein.
Die Taxifahrt nach Manhattan bot mehr als genug Zeit für obsessives Googeln. Wird eine angeborene Hypothyreose nicht unmittelbar nach der Geburt behandelt, kann sie zu irreversiblen kognitiven Schäden führen. Neben mir im Kindersitz saß das Baby. Auf der anderen Seite meine Mutter.
Im Krankenhaus zapften sie acht Röhrchen Blut aus ihren winzigen Armbeugen. Es war schwer zu glauben, dass es so kleine Tourniquets gab oder dass – nach einer Weile – überhaupt noch Blut übrig war. Nach der ersten durchstochenen Vene – ich konnte es nicht fassen, als sie das sagten, als wäre mein Baby der kleinste Junkie der Welt –, benutzten sie ein spezielles Licht, um das Schattengitter der Venen unter der Haut sichtbar zu machen. Die Ärztin erklärte, es gebe verschiedene Erklärungen für die Messwerte meiner Tochter – eine, die mit Bindeproteinen zu hatte, eine, die mit Kortison zu tun hatte –, aber sie sei sich fast sicher, dass es sich um eine angeborene Hypothyreose handele.
»Aber es ist noch nichts Schlimmes, oder?«, fragte ich die Ärztin mit dem schreckgeweiteten Blick einer obsessiv googelnden Mutter. »Sie hat keinen Hirnschaden, oder?«
Eine lange Pause entstand. Tausend Sekunden oder fünf.
Irgendwann sagte die Ärztin: »Ich kann nichts versprechen. Aber ich glaube …« Wieder zögerte sie und wählte ihre Worte mit Bedacht. »Es gibt eine realistische Chance, dass alles gut wird.«
Ich hörte nur die lange Pause. Ich heulte in den offenen Mund meiner heulenden Tochter. Meine Tränen und mein Rotz tropften ihr ins Gesicht.
Die Ärztin wiederholte, sie sei fast sicher, dass es sich um eine angeborene Unterfunktion handelte. Es komme selten vor, dass der Defekt nicht direkt nach der Geburt erkannt wurde. Es lasse sich nicht sagen, wie weit ihre Gehirnentwicklung bereits betroffen war. »Wenn ich falschliege«, sagte sie, »bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt.«
Als die Ärztin am nächsten Tag anrief, sagte sie nur, sie brauchten mehr Blut. Und dann brauchten sie noch mehr Blut. Bei einem unserer Besuche sagten die Schwestern: »Wir haben noch nie einem so kleinen Kind so viel Blut abgenommen.« Aus dem Nest meiner Arme sah das Baby mit seinen unwirklich blauen Augen zu mir hoch. Warum tat ich ihr das an?
Jeden Tag kamen weitere Blutproben und unschlüssige Ergebnisse, weitere Blutproben und Warten am Telefon, wo ich mir endlose Notizen machte. In der zehnten Klasse hatte Mitschreiben geholfen. Diesmal kritzelte ich hässlichen Schilddrüsen-Code mit: Gesamt-T 4. Freies T 4. T 3 Bindungsindex. TBG. TSH.
Eines Abends versuchte ich, mit C. zu reden. Ich wollte ihm sagen, wie viel Angst ich hatte. Stattdessen klang ich, als machte ich ihm Vorwürfe, als würde ich ihn abfragen: Kannte er den Unterschied zwischen Gesamt-T 4 und freiem T 4? Wusste er, warum der TSH-Spiegel beim Neugeborenen-Screening unauffällig war, obwohl die Schilddrüse keine Hormone produzierte? Sah er auch lila Links auf der Innenseite seiner Lider, wie ich, wenn ich einzuschlafen versuchte, neben mir das schlummernde Baby, das nach Milchatem roch und seine unergründlichen Träume träumte?
Ich wusste nicht, wie ich meine Angst mit ihm teilen sollte. Ich konnte mich nur darin einmauern wie in einem Turm. Ich fragte ihn nicht, ob die Zahlen Erinnerungen in ihm weckten an andere Zahlen, an andere Zeiten in Krankenhäusern. Nicht ob. Natürlich taten sie das.
Nach mehreren Tagen rief endlich die Endokrinologin an und erklärte, es sei keine angeborene Unterfunktion. Es war das bindende Protein – die gute Fehlfunktion, auf die wir gehofft hatten, nicht die böse, die wir befürchtet hatten. Wir mussten keine Angst vor bleibenden Schäden haben.
Ich stand im Wohnzimmer, das Baby vor dem Bauch. Meine Mutter stand in der Tür; C. saß auf der Couch. Ich schrieb alles auf die Rückseite eines Kassenbons: Freies T 4 0,72. TSH 5,2. Gesamt-T 4 3,43. T 3 Bindung 68. Kaum hatte ich aufgelegt, drehte ich mich zu meiner Mutter um.
Monatelang hielt mir C. diesen Moment vor: »Warum hast du dich zuerst zu deiner Mutter umgedreht, um ihr zu sagen, dass unsere Tochter gesund ist? Warum nicht zu mir?«
Manchmal hatte ich das Gefühl, das Baby gehörte mir allein. Manchmal, wenn es neben mir in seinem Bettchen schlief, fuhr ich im Dunkeln mit den Fingerspitzen über meine Narbe: die groben Stiche, der obere Hautlappen wie eine überhängende Klippe. Es war nur ein Schnitt, der zu meinen Eingeweiden führte, aber es fühlte sich an wie das Tor zu einer anderen Welt. Zu dem Ort, von dem sie gekommen war.
Von Anfang an war da eine Güte in ihr. Etwas, von dem ich wusste, dass nicht ich es gemacht hatte.