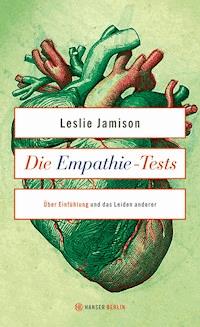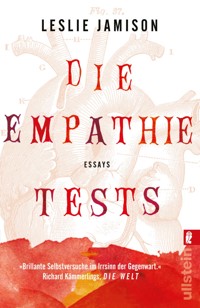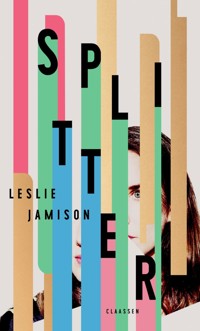Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„So klug und radikal ehrlich: Seit Susan Sontag und Joan Didion hat niemand aufregendere Essays geschrieben als Leslie Jamison.“ Daniel Schreiber Leslie Jamison ist eine der originellsten und couragiertesten Denkerinnen ihrer Generation. In ihrem neuen Buch erkundet sie die Tiefen von Verlangen, Intimität und Obsession und testet dabei auch die Grenzen ihrer eigenen Offenheit und ihres Mitgefühls für andere aus. Wie kann sie empathisch über menschliche Erfahrung schreiben, ohne ihre kritische Distanz zu verlieren? Wie ihr Beteiligtsein verarbeiten, ohne der Selbstbezogenheit zu erliegen? In Essays über so unterschiedliche Themen wie den „einsamsten Wal der Welt“, kindliche Erinnerungen an frühere Leben oder die Erfahrung, eine Stiefmutter zu sein, sucht sie nach neuen, ehrlichen Möglichkeiten erzählerischer Zeugenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»So klug und radikal ehrlich: Seit Susan Sontag und Joan Didion hat niemand aufregendere Essays geschrieben als Leslie Jamison.« Daniel SchreiberLeslie Jamison ist eine der originellsten und couragiertesten Denkerinnen ihrer Generation. In ihrem neuen Buch erkundet sie die Tiefen von Verlangen, Intimität und Obsession und testet dabei auch die Grenzen ihrer eigenen Offenheit und ihres Mitgefühls für andere aus. Wie kann sie empathisch über menschliche Erfahrung schreiben, ohne ihre kritische Distanz zu verlieren? Wie ihr Beteiligtsein verarbeiten, ohne der Selbstbezogenheit zu erliegen? In Essays über so unterschiedliche Themen wie den »einsamsten Wal der Welt«, kindliche Erinnerungen an frühere Leben oder die Erfahrung, eine Stiefmutter zu sein, sucht sie nach neuen, ehrlichen Möglichkeiten erzählerischer Zeugenschaft.
Leslie Jamison
Es muss schreien, es muss brennen
Essays
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz
Hanser Berlin
Inhalt
I. Sehnen
52 Blue
Wir erzählen uns Geschichten, um wieder zu leben
Zwischenstopp
Sim Life
II. SCHAUEN
Hoch nach Jaffna
No Tongue Can Tell
Es muss schreien, es muss brennen
Maximale Belichtung
III. BLEIBEN
Hochzeiten
Die große Fahrt
Echter Rauch
Tochter eines Geists
Museum der gebrochenen Herzen
Purzelbäume
Danksagungen
Quellenverzeichnis
Für meinen Vater Dean Tecumseh Jamison
Wann kennen unsere Sinne etwas so gründlich, wie wenn wir es entbehren?
Marilynne Robinson, Haus ohne Halt
I.
Sehnen
52 Blue
7. Dezember 1992. Whidbey Island, Puget Sound. Die Weltkriege waren vorbei. Die anderen Kriege waren vorbei: Korea, Vietnam. Auch der Kalte Krieg war endlich vorbei. Der Marinefliegerstützpunkt Whidbey Island blieb. Und der Pazifik mit seinen gewaltigen, unergründlichen Tiefen hinter dem Rollfeld, das den Namen eines verschollenen Fliegers trug: William Ault, der bei der Schlacht im Korallenmeer abgestürzt war. So ist das Leben. Der Ozean verschluckt Menschenleiber mit Haut und Haar und macht sie unsterblich. Nach William Ault hieß jetzt eine Piste, die andere Männer in den Himmel schickte.
Auf dem Stützpunkt kam der unendliche Pazifik als endliche Datenmenge an, die von einem am Meeresgrund verteilten Netzwerk von Hydrophonen aufgefangen wurde. Ursprünglich hatten die Hydrophone im Kalten Krieg sowjetische U-Boote belauscht, doch inzwischen waren sie aufs Meer selbst ausgerichtet, um dessen formloses Rauschen in etwas Messbares zu übertragen: meterweise gedruckte Graphen, die aus Spektrogramm-Schreibern rollten.
An besagtem Dezembertag 1992 bemerkte Obermaat Velma Ronquille einen seltsamen Laut. Sie vergrößerte ihn auf einem anderen Spektrogramm, um ihn genauer ansehen zu können. Es war äußerst ungewöhnlich, dass er auf einer Frequenz von 52 Hertz hereinkam. Sie winkte einen der Tontechniker herbei. Dass müsse er sich ansehen, sagte sie. Der Tontechniker kam. Er sah sich den Graphen an. Sein Name war Joe George. Velma sagte: »Ich glaube, das ist ein Wal.«
Joes erster Gedanke war: Heiliger Strohsack. Das konnte nicht sein. Das Lautmuster sah zwar aus wie das eines Blauwals, aber Blauwale erzeugten normalerweise Frequenzen zwischen 15 und 20 Hertz — ein kaum wahrnehmbares Grollen am Rande des menschlichen Gehörspektrums. 52 Hertz lagen in einem völlig anderen Bereich. Und doch war es da, direkt vor ihrer Nase, die Audiosignatur eines Wesens, das mit einem unerhört hohen Lied durch die Tiefen des Pazifiks zog.
Wale singen aus vielerlei Gründen: bei der Navigation, der Futtersuche, der Kommunikation mit Artgenossen. Für manche Wale, darunter Buckel- und Blauwale, spielt der Gesang auch bei der Partnersuche eine Rolle. Männliche Blauwale singen lauter als weibliche, und ihre Lautstärke — über 180 Dezibel — macht sie zu den lautesten Tieren der Welt. Sie klicken und grunzen und trillern und summen und stöhnen. Sie klingen wie Nebelhörner. Ihre Rufe verbreiten sich Tausende von Kilometern weit durch das Meer.
Weil die Frequenz dieses Wals so einzigartig war, verfolgte man ihn in Whidbey jahrelang auf dem Radar, wenn er sich auf seine jährliche Wanderung gen Süden von Alaska nach Mexiko begab. Man nahm an, dass es sich um ein männliches Tier handelte, da nur Bullen in der Paarungszeit singen. Die Route war nicht ungewöhnlich, nur das Lied — und die Tatsache, dass sich nie andere Wale in seiner Nähe zeigten. Er war anscheinend immer allein. Der Wal rief zu hoch, und offenbar hörte ihn niemand — jedenfalls antwortete ihm niemand. Die Tontechniker nannten ihn 52 Blue. Später bestätigte eine wissenschaftliche Studie, dass Walgesang mit ähnlichen Eigenschaften nie aufgezeichnet worden war. »Auch wenn es schwer zu akzeptieren ist«, endete der Bericht, »aber wie es aussieht, ist er in der ungeheuren Weite des Ozeans allein.«
Auf der Fahrt durch den Bundesstaat Washington von Seattle nach Whidbey Island passierte ich die nüchternen Aushängeschilder der dort ansässigen Industrie: riesige Holzstapel, Flüsse, in denen sich Stämme drängten wie Fische in der Reuse, Türme bonbonfarbener Schiffscontainer am Hafen von Skagit und schmutzig weiße Silos vor der Deception Pass Bridge, deren majestätische Stahlkonstruktion sich über den Puget Sound spannte — sechzig Meter über hartfunkelndem Wasser, auf dem Sonnensplitter gleißten. Die Insel am anderen Ende der Brücke wirkte bukolisch, außerweltlich, dabei fast wehrhaft. LITTER AND IT WILL HURT, stand auf einem Schild: Wer Müll hinterlässt, wird büßen. Auf einem anderen: Heizstrahler brauchen Abstand. Whidbey Island nennt sich selbst die längste Insel der USA, aber das stimmt nicht ganz. »Whidbey ist zwar lang«, gab die Seattle Times zu, »aber wir wollen sie nicht länger machen, als sie ist.« Jedenfalls ist die Insel lang genug für ein Drachen-Festival, ein Muschel-Festival, ein Fahrradrennen (die Tour de Whidbey), vier Binnenseen und ein jährlich stattfindendes Krimi-Spiel, bei dem die ganze Gemeinde Langley mit 1035 Einwohnern zum Tatort wird.
Joe George, der Tontechniker, der 52 Blue identifizierte, lebt immer noch in seinem bescheidenen Haus am Hang über der Nordspitze, etwa zehn Kilometer vom Stützpunkt entfernt. Als ich ihn besuchte, öffnete er mir lächelnd die Tür — ein stämmiger Mann mit silbernem Haar, sachlich, aber freundlich. Obwohl er schon seit zwanzig Jahren nicht mehr auf dem Stützpunkt arbeitete, konnten wir mit seinem Navy-Ausweis das Gelände immer noch betreten. Er benutze den Ausweis regelmäßig, um auf dem Stützpunkt seinen Recycling-Müll zu entsorgen, erzählte er. Auf der Holzterrasse vor dem Officers’ Club tranken Männer in Fliegeroveralls Cocktails. Die Küste dahinter war zerklüftet und schön; Wellen brandeten auf den dunklen Sand, der salzige Wind zerrte am Immergrün.
Joe erklärte, als er auf dem Stützpunkt gearbeitet habe, sei sein Team, das für die Verarbeitung der von den Hydrophonen gelieferten Audiodaten zuständig war, aus Sicherheitsgründen vom Rest des Stützpunkts isoliert gewesen. Als wir seine alte Wirkungsstätte erreichten, sah ich, was er meinte. Das Gebäude war von mit Stacheldraht gekrönten Doppelzäunen umgeben. Er sagte, manche Soldaten auf dem Stützpunkt hätten es für eine Art Gefängnis gehalten. Sie erfuhren nie, was dort geschah. Auf die Frage, wofür er die seltsamen Geräusche 1992 gehalten habe, bevor ihm klarwurde, dass es Walgesänge waren, antwortete er: »Kann ich Ihnen nicht sagen. Diese Informationen sind geheim.«
Zu Hause holte Joe einen Stapel Papiere aus der Zeit hervor, als er 52 Blues Spuren folgte. Computer-Landkarten, die fast ein Jahrzehnt seiner Wanderungen dokumentierten, jede Saison in einer anderen Farbe, Gelb, Orange, Lila, die Routen des Wals in der groben Computergrafik der 1990er Jahre. Joe zeigte mir Tabellen mit 52s Liedern und erklärte mir die Linien und Metren, damit ich seine Signatur mit den typischeren Walgesängen vergleichen konnte: mit den tiefen Frequenzen gewöhnlicher Blauwale und den viel höheren Frequenzen der Buckelwale. Die Gesänge der Blauwale enthalten verschiedene Laute — lange Summ- und Stöhnlaute, konstant oder moduliert —, und 52 Blues lautliche Äußerungen zeigten die gleichen charakteristischen Muster, nur eben auf einer völlig anderen Frequenz, knapp über dem tiefsten Ton einer Tuba. Der kurze Audioclip von 52, den Joe mir für das menschliche Gehör beschleunigt vorspielte, hörte sich unheimlich an: ein schriller, pulsierender, bohrender Klang, das akustische Pendant eines trüben Lichtstrahls im dichten Nebel einer Vollmondnacht.
Joe machte es sichtlich Spaß, mir die Karten und Tabellen zu erklären. Anscheinend entsprachen sie seiner Liebe zu Ordnung und Struktur. Als er mir stolz die Früchte seiner verschiedenen und durchaus überraschenden Hobbys zeigte — eine eindrucksvolle Sammlung fleischfressender Pflanzen samt der Bienen, die er als Futter zog, oder die tadellose Muskete, die er für seine Reenactments des Trapperlebens im 19. Jahrhundert aus einem Bausatz angefertigt hatte —, wurde sein Hang zu Akribie und Gewissenhaftigkeit offenbar. Bei allem, was er tat, hatte er ein tiefes Bedürfnis nach Genauigkeit und Gründlichkeit. Er zeigte mir die Kobralilien, seine Lieblingspflanzen, und erläuterte mir — sichtlich beeindruckt von der Effizienz und Tücke des Mechanismus —, wie ihre durchsichtigen Hauben die gefangenen Fliegen täuschten, die bis zur Verausgabung versuchten dem Licht entgegenzufliegen. Dann deckte er die grünen Rücken ihrer gerundeten Hauben behutsam mit einer Frostmatte wieder zu, um sie vor Kälte zu schützen.
Ich spürte, dass Joe sich über die Gelegenheit freute, die alten Walkarten hervorzuholen. Sie erinnerten ihn an die Zeit, als 52s Geschichte ihren Anfang nahm und er mittendrin steckte. Joe erzählte, er sei nach Whidbey gekommen, nachdem er mehrere Jahre auf einem Stützpunkt in Island »Schwerstarbeit« geleistet hatte, so die Dienstbeschreibung, auch wenn er den Dienst in Island nicht als besonders schwer empfunden habe; seine Kinder hatten an der Blauen Lagune Schneemänner gebaut. Damals war er bereits ausgebildeter Tontechniker gewesen und gut vorbereitet auf die Arbeit, die ihn in dem kleinen flachen Bunker hinter dem Stacheldrahtzaun erwartete.
Das Hydrophon-Überwachungssystem, auch bekannt als Sound Surveillance System oder SOSUS, war mehr oder weniger ein Stiefkind, erzählte Joe. Der Kalte Krieg war vorbei, und da keine sowjetischen U-Boote mehr zu belauschen waren, musste die Navy irgendwie davon überzeugt werden, dass sich das teure Hydrophon-Netzwerk noch rentierte. Die Arbeitsfelder, die sich eröffneten, überraschten selbst die, die beteiligt waren. Darel Martin, der als Toningenieur in Whidbey mit Joe zusammengearbeitet hatte, drückte es so aus: »Erst waren wir Experten für Haie aus Stahl, dann belauschten wir lebende, atmende Tiere.« Er sagte: »Es ist einfach uferlos, was man im Ozean alles hören kann.« Heute wird das Geheimnis jenes Wals von einem Mann gehütet, der abgewetzte Ordner auf seinem Küchentisch ausbreitet, um mir die unspektakulär aussehenden Aufzeichnungen seines spektakulären Gesangs zu zeigen.
Juli 2007, Harlem, New York. Leonora wusste, dass sie sterben würde. Nicht irgendwann, sondern bald. Sie litt seit Jahren an Uterusmyomen und Blutungen, manchmal so heftig, dass sie Angst hatte, die Wohnung zu verlassen. Blut wurde zur Zwangsvorstellung: Sie dachte an Blut, sie träumte von Blut, sie schrieb Gedichte über Blut. Sie kündigte ihre Stelle als Fallmanagerin bei der Stadtverwaltung, wo sie über zehn Jahre gearbeitet hatte. Leonora war 48 Jahre alt. Sie hatte immer selbst für sich gesorgt; sie arbeitete, seit sie vierzehn war. Sie hatte nie geheiratet, obwohl es Angebote gab. Sich selbst versorgen zu können, war ihr immer wichtig gewesen. Aber dies war ein neuer Grad der Isolation. Eine Verwandte sagte zu ihr: »Du bist an einem sehr dunklen Ort« — und dass sie sie nicht mehr sehen wolle.
Bis zum Sommer hatte sich ihr Zustand verschlechtert. Leonora fühlte sich ernsthaft krank: Sie litt unter ständiger Übelkeit, akuter Verstopfung, Schmerzen im ganzen Körper. Ihre Handgelenke waren geschwollen, der Bauch gebläht, das Sehvermögen durch gezackte Farbspiralen eingeschränkt. Weil sie im Liegen kaum Luft bekam, schlief sie wenig. Wenn doch, hatte sie seltsame Träume. Eines Nachts sah sie einen von einem Pferd gezogenen Leichenwagen, der im Harlem eines vergangenen Jahrhunderts über das Kopfsteinpflaster ratterte. Sie griff nach den Zügeln, sah dem Pferd in die Augen und wusste, dass es gekommen war, um sie holen. Sie war so überzeugt von ihrem bevorstehenden Tod, dass sie die Wohnungstür nicht mehr abschloss, damit ihre Nachbarn später keine Probleme hätten, ihre Leiche abholen zu lassen. Sie rief ihre Ärztin an, um Bescheid zu geben — Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sterbe —, doch die Ärztin wurde wütend und sagte ihr, dass sie den Notdienst rufen solle, dass sie weiterleben werde.
Als die Sanitäter Leonora schließlich auf der Trage durch den Hausflur rollten, wollte sie doch noch einmal zurückgebracht werden, um ihre Wohnung abzuschließen. Daran merkte sie, dass sie den Glauben an ihr Leben zurückgewonnen hatte. Wenn sie nicht starb, wollte sie auch nicht die Tür auflassen.
Die Bitte, von den Sanitätern zurückgeschoben zu werden, war das letzte, woran Leonora sich erinnerte, bevor zwei Monate der Dunkelheit über sie hereinbrachen. An jenem Abend im Juli begann eine medizinische Odyssee — fünf Tage Operationen, sieben Wochen im Koma, sechs Monate im Krankenhaus —, die Leonora in ihrem eigenen Tempo und auf ihrem eigenen Weg zur Geschichte von 52 Blue führte.
In der Zeit, als Joe George und Darel Martin 52 Blue belauschten, arbeiteten sie unter der Leitung von Bill Watkins, einem Akustikexperten des Woods Hole Oceanographic Institute in Massachusetts, der alle paar Monate von der anderen Küste nach Whidbey Island kam, um sich anzuhören, was sie gefunden hatten. Jeder, der mir von Watkins erzählte, sprach in fast mythischen Begriffen von ihm. Je nach Bericht variierte die Zahl der Fremdsprachen, die er sprach: sechs, zwölf, dreizehn. Zwanzig, behauptete einer seiner früheren Forschungsassistenten. Watkins war als Sohn christlicher Missionare in Guinea zur Welt gekommen, damals Französisch-Westafrika. Als Kind habe er mit seinem Vater Elefanten gejagt, erzählte Darel. »Er konnte zwanzig Hertz hören, was für das menschliche Ohr extrem tief ist. Sie oder ich hören da gar nichts … Aber Bill hörte die Elefanten, wenn sie noch weit weg waren. Und dann sagte er seinem Vater, wo es lang ging.«
Im Laufe seines Lebens entwickelte Watkins viele der technischen und methodologischen Hilfsmittel, die es möglich machten, Walgesänge aufzunehmen und zu analysieren: Peilsender, Unterwasser-Playback-Experimente, Ortungsmethoden. Er baute das erste Tonbandgerät, das Walstimmen aufnehmen konnte.
Für Joe und Darel war 52 Blues ungewöhnliche Frequenz vor allem deswegen interessant, weil er damit leicht zu überwachen war. Er hob sich mit seinem Gesang von den anderen ab, wodurch sie seine Wanderungen gut verfolgen konnten. Weil sich die anderen Wale nur schwer unterscheiden ließen, waren ihre Bewegungsmuster kaum auseinanderzuhalten. Und durch die Möglichkeit, ihn zu identifizieren — als einen bestimmten Wal unter all den Walen —, entstand eine Beziehung zu 52 als Individuum, während die anderen Wale in der anonymen Masse des Kollektivs untergingen.
52s Individualität — und seine scheinbare Isolation — verliehen ihm auch den Glanz einer gewissen Persönlichkeit. »Wir haben immer gelacht, wenn wir auf seiner Fährte waren«, erzählte Darel. »Wir sagten: ›Vielleicht will er nach Baja, weil er Liebeskummer hat.‹« Darel sprach mit der gleichen Vertrautheit und dem liebevollen Spott über den Wal, mit dem Mannschaftskameraden über einen trotteligen Kumpel herziehen, der kein Glück bei den Frauen hat: Wie er sich auch abmühte, 52 kam einfach nicht zum Zug. Mit dem Song konnte 52 nicht landen. Der Wal war mehr als ein Job. In der Zeit, als sie 52 auf der Spur waren, schenkte Darel seiner Frau eine Kette mit einem Wal-Anhänger, den sie heute noch trägt.
Joe beschäftigten andere Aspekte. »Einmal war er über einen Monat verschwunden«, erzählte er, und seine Stimme verriet, dass das Geheimnis ihn immer noch nicht losließ. Als 52 am Ende des Monats endlich wieder auf dem Sonar auftauchte, war er weiter draußen auf dem Pazifik als je zuvor. Wie kam es zu der Auszeit?, fragte Joe sich. Was hatte sich in der Zwischenzeit abgespielt?
Bill Watkins war die treibende Kraft hinter der Walbeobachtung, aber auch er konnte sie nicht ewig laufen lassen. Nach 9/11 wurde der Geldhahn endgültig abgedreht, sagte Joe.
Doch wie sich zeigte, fing die Legende um 52 Blue gerade erst an. Als das Forschungsteam in Woods Hole 2004 die Erkenntnisse über 52 Blue erstmals veröffentlichte — drei Jahre nach Ende der Finanzierung —, wurden sie mit Kommentaren überschwemmt. Bill Watkins war einen Monat nach Abgabe des Artikels verstorben, sodass die Flut der Briefe seine frühere Forschungsassistentin Mary Ann Daher erreichte. Es handelte sich nicht um die übliche wissenschaftliche Korrespondenz. Wie der Journalist Andrew Revkin damals in der New York Times schrieb, kam die Post »von gerührten Wal-Fans, denen die Vorstellung eines einsamen Herzens in der Cetacea-Welt naheging«, oder von Menschen, die sich aus anderen Gründen mit dem Wal identifizierten: weil er so rastlos oder unabhängig war, weil er sein eigenes Lied sang.
Nach Revkins Artikel »Lied des Ozeans, a cappella und nicht erhört«, der in jenem Dezember erschien, trafen immer mehr Briefe in Woods Hole ein. (Vielleicht hatte die Meeresbiologin Kate Stafford, die in dem Bericht zitiert wird, ungewollt Öl ins Feuer gegossen: »Er ruft: ›Hallo, ich bin hier!‹ Aber es ist niemand da, der nach Hause telefoniert.«) Die Briefe kamen von Verlassenen und Gehörlosen; von unglücklich Verliebten und Singles; von gebrannten Kindern und zweimal gebrannten Kindern — von Menschen, die sich mit dem Wal identifizierten oder mit ihm litten oder ihren jeweiligen Kummer auf ihn projizierten. Die Legende war geboren: der einsamste Wal der Welt.
Seither hat 52 Blue, oder 52 Hertz, wie viele seiner Fans ihn nennen, zahlreiche Herzschmerz-Schlagzeilen inspiriert: Von »Der einsamste Wal der Welt« über »Der Wal, dessen seltsames Lied ihn daran hindert, die Liebe zu finden« zu »Das unerhörte Liebeslied eines einsamen Wals« und »Da ist ein Wal, den kein anderer Wal hören kann, und er ist einsam: Die allertraurigste Geschichte, oder Kann die Wissenschaft helfen?«. Es gab fantasievolle Geschichten über einen einsamen Junggesellen, der erfolglos an die mexikanische Riviera reist, um den größten Säugetier-Damen der Welt den Hof zu machen, »während seine musikalischen Lockrufe stundenlang durch die Dunkelheit der Tiefsee hallen … wenn er sein breites Repertoire gefühlvoller Melodien versendet«.
Ein Sänger aus New Mexico, der mit seinem Brotjob als Techniker unglücklich war, widmete 52 ein ganzes Album; ein Musiker aus Michigan schrieb ein Kinderlied über das Los des Wals; im Staat New York schuf eine Künstlerin aus alten Plastikflaschen eine Skulptur, die sie 52 Hertz nannte. Ein Musikproduzent aus Los Angeles begann, auf Flohmärkten alte Kassetten aufzukaufen und sie mit 52s Lied zu überspielen, dem Lied, das mit seinen vielfältigen Suggestionen bald zum sentimentalen Seismografen geworden war: Entschlossenheit und Entfremdung; Sehnsucht und Autonomie; das Versagen der Kommunikation, aber auch eine zähe Beharrlichkeit im Angesicht dieses Versagens. Menschen richteten Twitter-Konten ein, die für ihn sprachen, etwa @52_Hz_Whale, das ziemlich auf den Punkt kommt:
Hallooooooo?! Huuhuuuuu! Ist da draußen jemand? #SadLife
Ich bin so einsam. :’( #lonely #ForeverAlone
Im September wachte Leonora nach sieben Wochen im Koma im St.-Luke’s-Roosevelt-Hospital auf, immer noch am Anfang der medizinischen Odyssee, die sie zu 52 Blue führen würde. Die Ärzte hatten ihr im Lauf von fünf Tagen auf dem OP-Tisch fast einen Meter Darm herausgeschnitten, um das nekrotische Gewebe zu entfernen, das durch einen akuten Darmverschluss entstanden war. Um ihre Genesung zu unterstützen, hatte man sie danach in ein künstliches Koma versetzt. Aber es lag noch ein weiter Weg vor ihr. Leonora konnte nicht mehr laufen. Sie hatte Wortfindungsschwierigkeiten, konnte ohnehin kaum sprechen — von all den Schläuchen, über die sie während des Komas versorgt wurde, war ihre Luftröhre stark vernarbt. Sie konnte nicht weiter als bis zehn zählen. Sie konnte kaum bis zehn zählen. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie behielt es für sich. Sie wollte nicht, dass andere sahen, wie sie kämpfte.
Leonora war unter Kämpfern aufgewachsen, in der Obhut ihrer resoluten, findigen Großmutter, die einen Meter fünfzig klein und an Diabetes erblindet war. Sie war aus Chennai über Trinidad in die USA eingewandert und erzählte Leonora stets, dass die Leute in Indien gedacht hätten, in Amerika wären die Bürgersteige mit Gold gepflastert. Doch in Leonoras Erinnerung herrschte Krieg rund um die Bradhurst Avenue in Harlem, wo sie in den 1970ern aufgewachsen war, die Mordrate war schwindelerregend und es gab eine eigene Police-Taskforce. Als Leonora sich eines Sommers für Fotografie zu interessieren begann, tauften die Leute sie die Todes-Fotografin, weil so viele der von ihr Porträtierten Opfer der Gewalt wurden.
Leonora war fest entschlossen wegzugehen, und als sie als Barkeeperin genug Geld verdient hatte, reiste sie nach Paris, wo sie ein wildes Jahr lang mit einem Korkenzieher in der Hand den Boulevard Saint-Michel auf und ab spazierte; sie machte einen Abstecher nach Capri, lernte mit einer Freundin zwei heißblütige Bademeister kennen, mit denen sie in eine verlassene Villa einbrachen und an einem staubigen Küchentisch Marmeladenbrote aßen. Zurück in New York lernte Leonora den Mann kennen, den sie fast geheiratet hätte, doch auf dem Weg zum Standesamt hatte sie plötzlich so starke Bauchkrämpfe, dass sie aufs Klo stürzte, wo ihr klarwurde, dass ihr Körper ihr etwas zu sagen versuchte: Tu es nicht. Sie hörte auf ihren Bauch. Sie blieb auf der Toilette, bis die Behörde zumachte; dann musste ein Polizist kommen und sie aus der Kabine holen.
Später fand sie einen Job als Case Manager bei der Stadtverwaltung und arbeitete mit Sozialhilfe- und Essensmarkenempfängern, doch privat zog sie sich immer mehr zurück. Als sie im Juli 2007 ins Krankenhaus kam, lebte sie bereits so isoliert, dass der Krankenhausaufenthalt weniger eine abrupte Unterbrechung als die Fortsetzung einer Entwicklung darstellte.
Der schwerste Teil ihrer Genesung war für Leonora die Tatsache, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen konnte, nicht mehr unabhängig war. Als sie ihre Stimme wiederfand, gewöhnte sie sich langsam daran, um Hilfe zu bitten. Sie erzählte mir, wie sie eines Tages im Krankenhaus die Ursache eines üblen Geruchs in ihrem Zimmer ausgemacht hätte — ihr eigenes Haar, das mit Blut verklebt war —, worauf sie einen der Ärzte bat, es ihr abzuschneiden, und am Ende habe es ziemlich gut ausgesehen. Sie hatten gescherzt, dass der Arzt eine zweite Laufbahn als Friseur einschlagen sollte.
Während der sechs Monate im Krankenhaus und in verschiedenen Reha-Einrichtungen fühlte Leonora sich alleingelassen. Sie bekam nicht viel Besuch. Es schien, als hätten die Menschen, mit denen sie vor ihrer Krankheit zu tun gehabt hatte, Reißaus genommen, als verstießen sie Leonora, weil sie ihrem Leiden nicht zu nahe kommen wollten. Leonora nahm an, sie scheuten sich vor ihrer Krankheit, weil diese sie an ihre eigene Sterblichkeit erinnerte. Bei denen, die kamen, spürte Leonora eine dunkle Energie, von der ihr übel wurde. Als ihr Vater sie besuchte, sagte er ihr immer wieder, dass sie wie ihre Mutter aussehe — von der er seit vielen Jahren nicht gesprochen hatte. Es war, als holte Leonoras Zustand lange verdrängte Gefühle von Wut und Verlust in ihm an die Oberfläche.
Sie war sowohl von ihren Mitmenschen als auch von der Welt abgeschnitten. Sie konnte nicht einmal fernsehen, weil sie Kopfschmerzen davon bekam. Eines späten Abends, als sie allein im Internet surfte, stieß sie auf 52 Blue. Inzwischen kursierte die Geschichte des Wals seit einigen Jahren im Internet. Doch sie berührte Leonora mit besonderer Kraft: »Er sprach eine Sprache, die niemand sonst sprach«, sagte sie. »Und ich saß hier und war sprachlos. Ich hatte keine Sprache, um zu beschreiben, was mir passiert war … Ich war wie er. Ich hatte nichts. Niemand kommunizierte mit mir. Niemand hörte mich. Niemand hörte ihn. Und ich dachte: Ich höre dich. Ich wünschte, du könntest mich hören.«
Wie die Stimme des Wals verhallte auch ihre Stimme im Nichts. Sie kämpfte darum, ein Gefühl für das eigene Selbst wiederzufinden, ganz zu schweigen von den Worten, die beschrieben, was sie dachte und fühlte. Die Welt schien sich vor ihr zurückzuziehen, und der Wal war wie ein Echo dieses Phänomens. Sie erinnerte sich an den Gedanken: Ich wünschte, ich würde Walisch sprechen. Doch die Möglichkeit, dass 52 Blue wusste, dass er nicht allein war, gab ihr irgendwie Hoffnung. »Ich dachte: Er ist da. Er spricht. Er sagt etwas. Er singt. Und auch wenn ihn niemand wirklich versteht, hören ihm die Leute zu. Ich wette, er weiß, dass ihm jemand zuhört. Er muss es spüren.«
Um die Jagd nach einem scheuen Wal geht es auch in der berühmtesten Geschichte der amerikanischen Literatur. »Hast du den Weißen Wal gesehen?« Aber Moby-Dick erzählt weniger von der Jagd auf ein Tier oder von Rache als von der Suche nach einer Metapher — von dem Versuch zu verstehen, was nicht zu verstehen ist. Ishmael nennt das Weiß des Wals »eine öde Leere, voller Bedeutung«. Sogar voller verschiedener Bedeutungen: Göttlichkeit und ihre Abwesenheit, ursprüngliche Macht und ihre Verweigerung, die Möglichkeit von Rache und die Möglichkeit von Vernichtung. »Und für all dies war der Albinowal das Symbol«, erklärt Ishmael. »Wundert euch nun noch die feurige Jagd?«
Als ich mich mit der Geschichte von 52 Blue zu beschäftigen begann, schrieb ich in der Hoffnung an Mary Ann Daher in Woods Hole, sie würde mir zu verstehen helfen, weshalb die Geschichte dieses Wals aus dem wissenschaftlichen Rahmen gefallen und zum Massenphänomen geworden war. Dahers Rolle in der Geschichte war kurios. Nur weil ihr Name in einem Artikel auftauchte, der sich auf ein Projekt bezog, bei dem sie vor Jahren wissenschaftliche Assistentin gewesen war, wurde sie nun zur unfreiwilligen Beichtmutter einer wachsenden Herde von Anhängern. »Ich bekomme alle möglichen E-Mails«, hatte sie damals einem Journalisten gesagt, »manche sind sehr berührend — wirklich; es bricht einem das Herz, wenn man sie liest — wenn die Leute fragen, warum wir nicht einfach rausfahren und dem Tier helfen.« Doch mit der Zeit setzte ihr das Medieninteresse zu. »Es war ziemlich unangenehm«, sagte sie 2013 in einem anderen Interview. »Nennen Sie mir ein beliebiges Land, ich habe garantiert Anrufer von dort gehabt, die Informationen wollten. Dabei hatte ich seit 2006 nichts mehr damit zu tun … und … ach Gott, [Watkins] würde sich im Grab umdrehen.«
Ich wollte trotzdem mit Mary Ann Daher sprechen. Ich stellte mir vor, wie wir in Woods Hole am Meer stünden, an der salzigen Luft, unsere Kaffeebecher festhielten und uns in die Augen sahen. Was lösten die Briefe bei ihr aus?, würde ich sie fragen. Und sie würde mir von dem Stich erzählen, den sie jedes Mal spürte, wenn sich ihr Posteingang in einen Beichtstuhl verwandelte. Vielleicht würde sie einen der Briefe, die sie am meisten gerührt hatten, aus dem Gedächtnis zitieren: 52 Blue ist Hoffnung und Verlust zugleich. Ihre Stimme wäre rau, und ich würde mir die Worte notieren. Ich würde auch das Raue ihrer Stimme notieren. Ich würde aufschreiben, wie ihre wissenschaftliche Nüchternheit Risse bekam, gesprengt vom hilflosen Staunen einsamer Fremder.
So hätte es sein können. Vielleicht existiert eine Parallelwelt, in der es so war. Doch in dieser Welt ließ sie meine E-Mails unbeantwortet. Die Presseabteilung des Woods Hole Oceanographic Institute machte sehr deutlich: Mary Ann Daher hatte genug über den Wal gesagt; sie hatte sich oft genug geweigert, Mutmaßungen über den Wal anzustellen, sie hatte die Mutmaßungen anderer oft genug korrigiert. Sie hatte alles gesagt, was sie zu dem Thema zu sagen hatte.
Der letzte, mit dem Daher gesprochen hatte, war der Schriftsteller Kieran Mulvaney. An der Niederschrift ihres Gesprächs lässt sich ablesen, wie misstrauisch und verärgert sie inzwischen war. »Wir wissen einfach nicht, was los ist«, antwortete sie auf die Frage nach dem Grund für 52s merkwürdigen Gesang. »Ist er allein? Keine Ahnung. Die Leute stellen sich immer vor, wie das Tier so einsam da draußen herumschwimmt und vor sich hin singt, ohne dass jemand ihm zuhört. Aber wir wissen es nicht … Hat er sich erfolgreich fortgepflanzt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Keiner kann diese Fragen beantworten. Ist er einsam? Ich hasse es, wenn man Tieren menschliche Gefühle zuschreibt. Kennen Wale Einsamkeit? Ich weiß es nicht. Das Thema will ich gar nicht anfassen.«
Mary Ann Daher wollte nicht mit mir sprechen. Sie wollte mir auch die Briefe nicht überlassen, die sie von all den Menschen, die der Wal berührt hatte, bekommen hatte. Also machte ich mich selbst auf die Suche.
Zuerst waren es nur Stimmen im digitalen Äther: ein polnischer Pressefotograf, die Angestellte einer irischen Bauernkooperative, eine amerikanische Muslima, die 52 Blue mit dem Propheten Yunus assoziierte. Sie versammelten sich auf einer Facebook-Seite, die dem Wal gewidmet war, wo sich die meisten Kommentare um zwei Motive rankten: Mitleid mit 52 Blue und die Suche nach 52 Blue. Eine Denise postete immer wieder dieselbe Nachricht — »findet 52 hertz«: um 8 Uhr 09, 8 Uhr 11, 8 Uhr 14, 8 Uhr 14 (noch einmal) und 8 Uhr 16. Eine Frau namens Jen schrieb: »Ich will ihn einfach mal fest umarmen.«
Die 22-jährige Shorna aus dem englischen Kent erzählte mir, 52s Geschichte helfe ihr, das Gefühl der Isolation zu verstehen, dass sie seit der Ermordung ihres Bruders, als sie dreizehn war, empfand — die feste Überzeugung, dass niemand auf der Welt ihre Trauer verstehen konnte. In ihrer Familie wurde nicht darüber gesprochen. Die Therapeuten wollten ihr vorschreiben, was sie zu fühlen habe. Aber der Wal sagte nicht, was sie fühlen sollte. Er gab nur einem bestimmten Gefühl eine Form, nämlich dass sie »auf einer anderen Wellenlänge war als der Rest der Welt«. Juliana, 19, Englisch-Studentin an der University of Toronto, verstand den Wal als »Inbegriff für jeden, der sich zu seltsam für die Liebe fühlt«. Er repräsentiere alle, sagte sie, die »allein auf der Wanderung sind« oder — sie selbst eingeschlossen — auf der Suche »nach jemandem, der uns für unsere Schwächen und Fehler liebt«.
Zbigniew, 26, Fotoredakteur bei der größten polnischen Boulevardzeitung, ließ sich nach dem Ende einer sechsjährigen Beziehung den Umriss von 52 Blue auf den Rücken tätowieren:
ich hab sie sehr geliebt. aber dann zeigte sich, dass sie mich in unserer Beziehung wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt hat … ich war verzweifelt, weil ich ihr alles gegeben hab, und ich dachte, sie macht dasselbe für mich. {Wegen} ihr habe ich die Verbindung zu wichtigen Freunden verloren. So viel verschwendete Zeit hat mich traurig gemacht … aber die Geschichte vom 52 hz-Wal hat mich froh gemacht. Für mich ist er das Symbol dafür, dass Alleinsein positiv sein kann … er ist ein Statement, dass das Leben auch weitergeht, wenn man allein ist.
Für Zee, wie er sich nennt, wurde 52 zum Symbol für die einsamen Tage nach der Trennung, in denen er mit seinen zwei Katzen Puma und Fuga allein zu Hause traurige Filme ansah. »Lange hab ich auch auf einer anderen Frequenz als alle anderen ›gesungen‹«, schrieb er mir. Aber der Wal stand für ihn auch für Resilienz: »Seit zwei Jahren sieht mein Leben so aus. Ich schwimme langsam durch meinen Teil des Ozeans, versuche Menschen wie mich zu finden, mit Geduld, gehe durchs Leben, und ich weiß, dass ich kein Krüppel bin, sondern nur anders, auf positive Art.«
Mit der Tätowierung zollte Zee dem, was ihm der Wal bedeutet hatte, Respekt und trug diese Bedeutung weiter — auf einer Frequenz singen, die vielleicht eines Tages verstanden wird. Die Tätowierung bedeckte seinen oberen Rücken, die »einzige Stelle an meinem Körper, die groß genug ist, damit er richtig geil aussieht«. Hinter einer detaillierten Darstellung von Moby-Dick, auch ein Idol von Zee, ist ein zweiter Wal zu sehen, ein Geisterwal: Zees nackte Haut als negative Fläche, von schwarzer Tinte umrissen. Statt 52 Blue abzubilden, bildet Zees Tätowierung die Tatsache ab, dass er nie gesehen wurde.
Sakina aus Michigan, 28, die als Patientendarstellerin in medizinischen Ausbildungseinrichtungen jobbte, assoziierte 52 mit einer anderen Art von Verlust — einem mehr spirituellen Kampf. Zum ersten Mal sah ich Sakina mit Hidschab in einem Youtube-Video, wo sie darüber sprach, dass 52 sie an die Geschichte des Propheten Yunus erinnerte, der von einem Wal verschluckt wurde. »Es leuchtet mir ein, dass sich der einsamste Wal einsam fühlt«, sagte sie. »Denn er hatte einmal einen Propheten bei sich, in seinem Inneren, und jetzt hat er ihn nicht mehr.« Ich traf Sakina in einem Café in der Innenstadt von Ann Arbor, wo sie mir erzählte, dass sie 52 Blues Geschichte an bestimmte einsame Phasen ihrer Kindheit erinnerte. (Sie war als Muslima in New Mexico aufgewachsen.) Sakina glaubte nicht, dass der Wal sich nach Liebe sehnte, sondern viel mehr nach einem Sinn — nach einem Propheten, den er verschlucken, einer Prophezeiung, die er erfüllen könnte. Sie fragte: »Sehnt er sich nach der Göttlichkeit zurück?«
David aus Irland, Vater von zwei Kindern, fand sich in 52 Blues Geschichte wieder, als er nach über zwanzig Jahren seinen Job bei Waterford Crystal verlor. In einem Song schrieb er, er »folge dem Kummer wie Wal 52 Hertz«, und dann zog er mit seiner Frau nach Galway, um ein neues Leben anzufangen. »Jeder sagt mir, Galway wäre das Richtige für mich«, erzählte er mir damals. Mit siebenundvierzig schloss er sich einer A-cappella-Band an und begann eine neue Ausbildung. »Die Entdeckung des Wals war für mich das Signal aus der Tiefe, dass auch ich kurz vor der Entdeckung stand … Zu wissen, dass der 52-Hertz-Wal da draußen ist und singt, gibt mir das Gefühl, weniger allein zu sein.«
Sechs Monate später schrieb David mir, dass seine Frau ihn nach fünfundzwanzig Ehejahren verlassen habe. Sie hatten kaum noch miteinander gesprochen. Das Leben in Galway war nicht, was er sich vorgestellt hatte. Die Kapelle hatte keinen Erfolg. Aber der Wal tröstete ihn immer noch. »Ich weiß, dass sie noch da draußen ist«, sagte er, denn er stellte sich das Tier weiblich vor, vielleicht als Seelenverwandte. »Ich sehe andere auf der Suche. Vielleicht bleibe ich nicht mehr lange allein.«
Die natürliche Welt hat sich immer als Fläche für menschliche Projektionen angeboten. Die Romantiker nannten es den pathetischen Irrtum. Ralph Waldo Emerson sprach von der »Vereinigung mit Himmel und Erde«. Wir projizieren unsere Ängste und Sehnsüchte auf alles, was wir nicht sind — auf jedes Tier, auf jeden Berg —, und machen sie uns dadurch zu Verwandten. Es ist ein Akt der Demut, der Sehnsucht, der Besitznahme zugleich. Oft merken wir nicht einmal, dass wir es tun. Jahrzehnte, nachdem der Hobbyastronom Percival Lowell behauptet hatte, er hätte auf dem Mars Kanäle und auf der Venus »speichenartige Schatten« gesehen, die er für Zeichen von Leben hielt, deckte ein Optiker auf, dass die Einstellungen an Lowells Teleskop — die Vergrößerungsrate, die kleine Öffnung — dafür gesorgt hatten, dass er auf den Planeten, die er beobachtete, die Projektion seines Augeninneren sah. Die Speichen der Venus waren die Schatten seiner wegen Bluthochdrucks geweiteten Blutgefäße. Er sah kein außerirdisches Leben; er sah den Abdruck seines eigenen Blicks.
Wenn Emerson sagt: »Jede Erscheinung in der Natur entspricht einem Zustand des Geistes«, sieht er diese Entsprechung als eine Art Vervollständigung. »Alle Tatsachen in der Naturgeschichte sind, für sich betrachtet, wertlos und unfruchtbar, geradeso wie das einzelne Geschlecht«, erklärt er und legt damit nahe, dass erst die menschliche Projektion das Ei befruchte. Und sie bringe nicht nur Bedeutung in den »unfruchtbaren« Körper der Naturgeschichte, so Emerson weiter, sondern nähre auch den Menschen selbst, indem sie »Teil seines täglichen Brots« werde.
Obwohl Emerson diesen Prozess feiert, hinterfragt er seine Implikationen. »So helfen uns natürliche Dinge im Ausdruck der einzelnen Bedeutungen. Welche gewaltige Sprache, und wie bedeutungslos oft die Mitteilungen!«, schreibt er. »Wir sind wie der Reisende, der die heiße Schlacke eines Vulkans benutzt, um darauf Eier zu braten.« Er grübelt, ob wir die natürliche Welt, indem wir sie als Metapher verwenden, ihrer Integrität berauben: »Haben Berge, Wogen und Wellen und der Himmel nur die Bedeutung, die wir ihnen bewusst geben, wenn wir sie als Embleme unserer Gedanken einsetzen?« Sich auf der Schlacke eines Vulkans ein Ei zu braten, ist vielleicht eine passende Beschreibung dafür, was es heißt, einen Wal zur Verkörperung von studentischem Heimweh oder Liebeskummer zu benutzen. Ist er einsam? Ich hasse es, wenn man Tieren menschliche Gefühle zuschreibt.
Früher gab es sogar einen Ausdruck für Menschen, die haarsträubende Tiergeschichten erzählten: Naturfälscher. Teddy Roosevelt prangerte in einem vernichtenden Urteil an, was er die »Klatschpresse der Wälder« nannte. In diesen sentimentalen Naturberichten werde menschliche Logik auf tierisches Verhalten projiziert, etwa wenn von wilden Vögeln die Rede sei, die ihr gebrochenes Bein mit einem Gips aus Lehm schienten, oder von Krähen, die ihre Jungen in die Vogelschule schickten. »Ich weiß, dass ich mich als Präsident aus solchen Debatten heraushalten sollte«, schrieb er, tat aber das Gegenteil. »Der ist kein Student der Natur, der nicht mit scharfem, sondern fälschendem Blick sieht, der interessant, aber unwahr schreibt, und dessen Fantasie die Fakten nicht interpretiert, sondern erfindet.« Besonders entrüstete sich Roosevelt über »Fakten-Blindheit«: die Gefahr, dass uns falsche Geschichten über die Natur blind für die wahren machten. Das ist das Risiko, wenn wir den Wal einsam oder prophetenhungrig machen oder wenn wir von der Ente wollen, dass sie sich das gebrochene Bein eingipst — dass zu viel Hochachtung vor der Natur, die wir erfunden haben, unsere Wertschätzung für die Natur verringert, in der wir leben.
Roosevelts Einwand findet ein seltsam modernes Echo in einem Twitter-Konto namens @52Hurts, dessen Biografie den Wal gegen seinen eigenen symbolischen Status protestieren lässt: »Ich bin weder Metapher noch Symbol. Ich bin nicht die Metaphysik, die sich in dir regt, noch das Double deiner Obsessionen. Ich bin ein Wal.« Viele seiner Tweets sind Nonsens — »Ivdhggv ahijhd ajhlkjhds« —, doch sie wirken gewissermaßen ehrlich. Es sind Tweets eines Wals, der nicht weiß, warum er auf Twitter ist, dessen verworrene Sprache dagegen protestiert, dass Sprache auf ihn projiziert wird. Sein Kauderwelsch will zeigen, was nicht lesbar ist, statt das Unbekannte in falsche Lesbarkeit zu zwingen. Er würdigt die Lücke, nicht die Projektionen, die wir darüberlegen.
Als ich den Kontakt zu Leonora suchte, antwortete sie mir sofort und hieß mich im »großen Schwingungsbecken« der 52-Anhänger willkommen. Wir trafen uns zwischen Winter und Frühling, an einem Nachmittag im März, im Riverbank State Park in Harlem. Der Wind blies kalt vom Hudson herauf. Leonora bewegte sich bedächtig und wählte ihre Worte mit der gleichen Sorgfalt. Anscheinend war Riverbank ein besonderer Ort für sie. Sie erzählte mir begeistert, dass der Park auf dem Dach einer alten Abwasseraufbereitungsanlage gebaut worden war. Offenbar erfüllte es sie mit Stolz, dass man aus einer hässlichen Notwendigkeit eine Möglichkeit gemacht hatte. Der Riverbank Park spielte auch eine große Rolle in ihrem Genesungsprozess. Hier hatte sie nach dem Koma das Gehen geübt. Sie hatte nicht gewollt, dass ihre Pflegerin zu Hause sah, wie sie bei jedem Schritt strauchelte, und war deswegen in den Park gegangen. Der Park verurteilte sie nicht. Er ließ sie einfach üben.
Als wir an ein paar welken Kleingärten vorbeikamen, erzählte mir Leonora, dass sie wegen der Vitamine, die sie nahm, den ganzen Winter keine Erkältung bekommen hatte. Sie futterte sie »fuderweise«, seit sie gestorben war. So bezeichnete sie ihre Krankheit und das Koma: als Prozess des Sterbens und der Rückkehr ins Leben. »Aber an mein Ticket sind Bedingungen geknüpft«, erklärte sie. Sie musste erst wieder lernen, sich selbst zu versorgen — daher die Vitamine, der Malunterricht, der Wunsch, im Frühling ihr eigenes Gemüse zu ziehen. Sie hoffte, dass sie einen der Kleingärten im Park bekam, die jährlich vor dem Sommer versteigert wurden. Die Gartenstücke waren unten beim Sportplatz, stoppelig mit Winterresten: vertrocknete Stängel, verdorrte Blätter, verbogene Stangen, an denen einst Tomaten wuchsen und es wieder tun würden. Leonora sagte, sie wolle Paprika und Petersilie ziehen, eine kleine Ernte oben auf der Abwasseranlage. Es sei eine Art zu sagen: Wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Sie war als Scherbenhaufen aus dem Koma erwacht. Jetzt war sie immer noch dabei, die Scherben zu einem Leben zusammenzusetzen.
Als eine rotbäuchige Wanderdrossel vor uns durch die Gärten hüpfte, traute Leonora ihren Augen kaum. Der Vogel war eigentlich viel zu früh dran. Wir sollten uns unbedingt etwas wünschen, sagte sie. Das gehörte zu ihrer Drei-Tage-Regel: Wenn sie dem Universum eine Frage stellte, bekam sie stets innerhalb von drei Tagen eine Antwort, sei es im Traum oder als Erscheinung — durch ein Tier oder etwas so Unscheinbares wie Lavendelduft. Leonora war offen für Botschaften von überall, jederzeit, selbst in Sprachen, die nicht als Sprache erkennbar waren.
Wir setzten uns in die Snackbar an der Eisbahn, wo eine Grundschulmannschaft Hockey trainierte. Die Squirts. Leonora sagte, dies sei der letzte Ort in New York, wo man noch einen Kaffee für einen Dollar bekam. Sie hatte Heimvorteil. Die Leute hinter der Theke kannten ihre Bestellung schon. Der Mann im Elektrorollstuhl sagte Hallo. Der Mann an der Kasse wollte, dass sie eine Petition für einen Kandidaten der Parkverwaltung unterschrieb.
Nachdem wir uns gesetzt hatten, legte Leonora ein großes Notizbuch auf den Tisch, um mir ein paar ihrer Bleistift- und Kugelschreiberskizzen von 52 Blue zu zeigen. »Ich bin richtig besessen von ihm«, sagte sie. »Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie er aussieht.« Ihre frühen Zeichnungen habe sie »vermasselt«, erzählte sie. Deshalb habe sie sich Fotos von anderen Walen angesehen. »Nur ihn habe ich nicht gefunden. Er ist so scheu.« Trotzdem zeichnete sie weiter. Sie arbeitete an einem Gemälde von 52 für die Abschlussausstellung des Malkurses im Park.
Als sie den Gesang von 52 zum ersten Mal gehört habe, erzählte Leonora, habe sie ihn mindestens fünfzig Mal abgespielt. Einmal hatte sie geträumt, sie würde mit 52 schwimmen: Er war mit einer Herde unterwegs, nicht mehr allein, und Leonora schwamm mit ihnen, mit gefühlten 180 Stundenkilometern — mit riesigem Kopf und einem geschmeidigen, haarlosen Körper. Während ihrer Genesung nach dem Koma träumte sie häufig von Wasser, von Flüssen und Meeren, nicht von Seen oder Teichen. Das Wasser musste in Bewegung sein, es durfte nicht stillstehen. Nach dem Traum von 52 wachte sie verwundert auf. »Ich war tief bewegt«, sagte sie. »Ich konnte nur daliegen und denken: Was war das? Was war das?«
Leonoras Verbundenheit mit 52 hatte immer zwei Ebenen gehabt: die der Kommunikation und die der Autonomie. Er stand für ihre Schwierigkeiten bei der Genesung — ihre stockenden Sprechversuche —, aber auch für den Verlust ihrer Unabhängigkeit. Während andere den Wal für unglücklich hielten, weil er keinen Gefährten fand, war er für Leonora ein Wesen, das niemanden brauchte. Der Wal repräsentierte ihre Fähigkeit, allein zu leben. Diese Fähigkeit war ihr immer wichtig gewesen, und ausgerechnet sie war ihr durch die Krankheit abhandengekommen.
Leonora nervte es, dass viele Menschen das Alleinsein von 52 mit Einsamkeit gleichsetzten. Es nervte sie auch, dass viele Menschen Leonoras Alleinsein mit Einsamkeit gleichsetzten. »Apropos«, fuhr sie fort, »ich hatte seit dem letzten Jahrtausend keine Beziehung mehr. Und kein einziges Date.« Ihre Leute — Freunde, Verwandte — machten sich deswegen ständig Sorgen um sie und versuchten, sie zu verkuppeln. »Es ist, als wäre eine Frau ohne Mann kein ganzer Mensch.« Aber sie hatte kein Problem damit. »Ich fühle mich nie einsam. Ich habe diesen Einsamkeitsfaktor nicht. Ich bin allein. Aber ich bin nicht einsam, okay? Ich kann Freunde besuchen, ich kann Weinkisten bestellen, ich lade Leute ein, ich koche.«
Es war schwer, aus ihren Beteuerungen nicht die Selbstüberredung herauszuhören. Aber ich hörte auch ein Argument dafür, wie wichtig Demut ist: Bilde dir nicht ein, du kannst einem anderen Menschen ins Herz schauen. Bilde dir nicht ein, du kennst seine Wünsche. Bilde dir nicht ein, Alleinsein muss einsam sein. Leonora sagte, sie hoffe, dass 52 nie gefunden wird. »Ich bete, dass sie ihn nicht finden. Aber ich würde mich freuen, wenn ich ihm wieder in meinen Träumen begegne.«
»Ich weiß einfach nicht, was die Leute an dem Wal so fasziniert«, sagte Joe George, als wir an seinem Esstisch saßen. »Für mich ist es reine Naturwissenschaft.« Was die Kekse auf dem Teller zwischen uns noch charmanter machte — in der Form von Walen mit Zuckerguss auf der Schwanzflosse, in Hellgrün und Rosa und Hellblau, und der Zahl »52« in passender Zuckerschrift. Joes Tochter hatte sie für uns gebacken. Er bot sie mir gerne an, auch wenn sie ihm ein bisschen peinlich waren: Die Kekse waren ein Beleg des Phänomens, mit dem er so wenig anfangen konnte.
Er sagte, es sei seltsam gewesen, dass die Finanzierung der Walbeobachtung so plötzlich und unwiderruflich abgestellt worden war — als hätte es nie jemanden interessiert, was sie taten —, und dann, Jahre später, tauchte der Wal plötzlich wieder auf, in dieser seltsamen, gebrochenen Form. Auf einmal interessierten sich alle für ihn, allerdings aus Gründen, die sich Joe entzogen, der lieber gute Arbeit leistete, als sich auf die Suche nach Metaphern zu begeben.
Nebenbei erwähnte Joe, dass 52 Hertz irgendwann aufgehört hatte, auf 52 Hertz zu singen. Auf der letzten Aufnahme lag seine Frequenz eher bei 49,6 Hertz. Vielleicht eine verspätete Pubertät, oder es hatte mit seiner Größe zu tun, vielleicht hatte sein Wachstum seine Stimme in einen tieferen Bereich verschoben.
Noch eine Lektion in Demut — die Möglichkeit, dass ein scheues Lebewesen aufhört, mit seiner bekannten Visitenkarte zu winken, dass das physische Tier all unsere mythischen Projektionen irrelevant macht. Es ist, als hätten wir unser Herz auf einen Sender eingestellt, den es nicht mehr gibt. Was bedeutet, wir können gar nicht finden, wonach wir suchen, sondern wir können nur — vielleicht — herausfinden, was aus dem Tier geworden ist.
Nachdem ich Leonora im Frühling kennengelernt hatte, ging ich zur Abschlussausstellung ihres Malkurses im Riverbank State Park. Es war ein feierlicher Frühsommertag. Unter den riesigen hellbraunen Industrieventilatoren spielte der Keyboard-Anfängerkurs »Oh When the Saints Go Marching In«. Eine Gruppe älterer Damen führte eine Choreografie zu Bubblegum-Pop auf, bei der sie saphirblaue und korallenrote T-Shirts über weißen Caprihosen trugen und mit farblich abgestimmten Fächern schwenkten. Eine Parkmitarbeiterin flüsterte mir ins Ohr: »Das sind unsere Oldies. Sie hotten gern ab.«
Leonora, in lavendelblauer Hose und rosa Zopfband, fotografierte und schob ihre Kunst in einem Einkaufswagen herum. Ihr Bild von 52 Blue hing im Flur: ein mit flächigen Acrylfarben gemalter Wal, der über einen Regenbogen fliegt, darunter der Ozean. Auf dem Wal reitet eine in Decoupage-Technik aufgeklebte Frau — oder fliegt mit ihm, es ist nicht ganz eindeutig —, ein Foto von Leonora, wie sie sagte, vor Jahren aufgenommen, aber sie habe das Gesicht unkenntlich gemacht, damit es jeder sein könnte. Die Frau hält den Kopf dicht an den Wal, als lausche sie ihm. »Ich wurde gefragt: ›Küsst dich der Wal?‹«, sagte Leonora. »Und ich habe gesagt: ›Vielleicht.‹«
Als eine junge Frau im grünen T-Shirt der Parkmitarbeiter vorbeikam, verkündete Leonora: »Das ist 52 Hertz. Genauso habe ich ihn mir vorgestellt.« Als würde jeder den Wal kennen, oder müsste ihn kennen — als müsste das Projekt, uns seine abwesende Gestalt vorzustellen, uns allen geläufig sein.
Während unserer Gespräche in den vergangenen Monaten war mir klargeworden, dass Leonoras Bindung zu dem Wal sich ein Leben lang aufgebaut hatte. Für sie war die gesundheitliche Krise eine Kulmination — der Darmverschluss als Stau der Traumata ihres ganzen Lebens, Erfahrungen, die sie ertragen, aber nie beweint oder besprochen hatte, bis sie ihr Inneres verstopften und sie krank machten —, und der Wal bot ihr eine andere Art der Aufbewahrung: als Gefäß, in dem sie ihre lebenslangen Sehnsüchte sammeln konnte. Sie hatte das tiefe Bedürfnis, ihr Leben als etwas zu verstehen, das in Mustern geordnet und mit Zeichen, Signalen und Stimmen verwoben war. Sie sehnte sich nach einer Logik, die die isolierten Punkte ihrer Erfahrung zu einer lesbaren Konstellation arrangierte. Während eines Gesprächs bemerkte sie, dass sie, wenn sie eine Wanderdrossel sah, immer an mich dachte, weil wir zusammen eine gesehen hatten. Ich erzählte ihr, dass ich nur zwei Wochen nach unserer Begegnung mit der Wanderdrossel den Mann kennengelernt hatte, den ich heiraten wollte. Es waren zwar keine drei Tage, aber immerhin. Es war etwas.
Bei einem unserer Snackbar-Besuche hatte Leonora gesagt, sie glaube, der Wal sei vielleicht der letzte seiner Art — so wie sie die letzte ihrer Art sei, weil sie keine Kinder habe. Aber sie konnte es nicht leiden, wenn die Leute Kinderlosigkeit als Mangel ansahen. Für sie war die Kunst das, was Nachwuchs am nächsten kam, und damit war sie zufrieden. Es war wohl kein Zufall, dass sie Begriffe wie »Auferstehung«, »Wiedergeburt« und »Zweite Geburt« für ihr Koma und die Zeit danach verwendete und dass wir mehrmals auf das Thema Kinder zurückkamen, Kinder haben oder nicht. Es schien auch nicht zufällig, dass Geburt eine große Rolle bei ihrer Interpretation der Ereignisse spielte. Leonora hatte jahrelang geblutet. Und als sie nach all dem Blut vom Tod ins Leben zurückkehrte, war es, als hätte sie sich selbst geboren.
Als ich den Riverbank State Park an jenem letzten Tag verließ, schenkte Leonora mir ein kleines Bild: eine Wanderdrossel mit leuchtend roter Brust, zierlichen Krallen und einem glänzenden Auge. Sie sagte, das Rot der Brust stehe für Aktivierung. Ich dachte an den Mann, den ich nach der Drossel kennengelernt hatte. Ich spürte, wie ansteckend magisches Denken war. Das Leben wurde eine Reihe von Omen. Ich wünschte, sie bedeuteten, dass es so etwas wie einen ordnenden Geist gab, oder dass sie wenigstens eine Geschichte erzeugten.
»Vaya con Dios«, sagte Leonora zu mir. »Du sollst einmal ein Kind bekommen.«
Als Emerson beklagte, die Materie verliere »vor dem Geistigen ihren Rang«, bezog er sich auf die Art, wie wir »die Natur in den Geist versetzt und die Materie wie einen Leichnam abgeworfen« hätten. Der tatsächliche Körper von 52