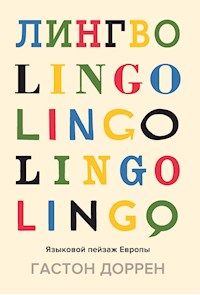14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Warum wir sprechen, was wir sprechen Wieso sind die Holländer wahre Könige des Genderbendings? Warum klingt Spanisch wie ein Maschinengewehr? Was haben Sepp und Ferrari gemeinsam? Und weshalb ist Litauen der beste Ort, um den Ursprung der europäischen Sprachen kennenzulernen? Gaston Dorren ist ein multilinguales Genie. In kurzweiligen Kapiteln geht er den Kuriositäten rund um Europas Sprachen auf den Grund und erzählt, was diese jeweils so einzigartig macht. Dabei beschäftigt er sich nicht nur mit ihrer Herkunft, sondern hebt vor allem verblüffende Besonderheiten hervor. Von der Grammatik bis zur Sprechweise, von der Gesellschaft bis zur Politik greift er die verschiedensten Themen auf. Er nimmt den Leser mit auf eine unterhaltsame Reise voller kluger Beobachtungen und zeichnet so ein neues, spannendes Bild der europäischen Nationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Gaston Dorren ist ein multilinguales Genie. In kurzweiligen Kapiteln geht er den Kuriositäten rund um Europas Sprachen auf den Grund und erzählt, was diese jeweils so einzigartig macht. Dabei beschäftigt er sich nicht nur mit ihrer Herkunft, sondern hebt vor allem verblüffende Besonderheiten hervor – ob man nun erfährt, woraus sich unsere Sprachen entwickelt haben (aus dem PIE) oder wieso einige Sprachen vom Aussterben bedroht sind, während andere eine bescheidene Renaissance erleben durften, und warum manche Sprachen wohl immer die Verlierer der Geschichte bleiben werden. Von der Grammatik bis zur Sprechweise, von der Gesell-schaft bis zur Politik greift Dorren die verschiedensten Themen auf und zeichnet so ein neues, spannen-des Bild der europäischen Nationen.
Der Autor
GastonDorren ist ein holländischer Linguist und Journalist. Er beherrscht zahlreiche europäische Sprachen, hat neben dem Verfassen von mehreren Büchern über Sprachen eine Reiseapp entwickelt und singt leidenschaftlich gerne – natürlich ebenfalls multilingual.
Gaston Dorren
Sprachen
Eine verbale Reise durch Europa
Aus dem Englischen und Niederländischen von Juliane Cromme
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1556-0
© 2014 by Gaston Dorren © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: Rudolf Linn, nach einer Vorlage von ©Keenan Originalfoto: Profile Books Ltd.
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Hinweise zu Schriften und Zeichen im E-Book
Damit im E-Book alle Zeichen und Buchstaben richtig anzeigt werden können, empfiehlt es sich, die eingebettete Schriftart zu verwenden. Diese Schriftart nennt sich Dejavu. Einige Reader bieten zudem die Option an, die verlagsspezifischen Einstellungen zu übernehmen. Bei Unklarheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Gerätes nach.
Zusätzlich wurden einige Zeichen und Buchstaben als Bilddateien eingefügt, da auch die eingebundene Schrift nicht alle Zeichen enthält.
VORWORT
»Die Sprache Europas ist die Übersetzung«, hat der italienische Schriftsteller Umberto Eco bemerkt – oder eigentlich waren seine Worte: »La lengua dell’Europa è la traduzione«. Und so ist es. Die Mehrsprachigkeit der Europäer mag zu wünschen übrig lassen, übersetzt und gedolmetscht wird hier dafür wie nirgendwo sonst. Nicht nur in Brüssel und anderen EU-Sitzen, sondern auf dem ganzen Kontinent.
Das Buch, das Sie gerade in den Händen halten, könnte den Eindruck erwecken, Europa sei ein einziges Stimmengewirr, umfasst es doch ein Sammelsurium an Geschichten über dutzende von Sprachen. Aber tatsächlich widerspricht es Umberto Ecos Bemerkung nicht, sondern illustriert sie vielmehr. Sprachen: Eine verbale Reise durch Europa ist selbst dabei, ganz Europa zu bereisen.
Erstmals veröffentlicht wurde es 2012 auf Niederländisch, unter dem Titel Taaltoerisme – ›Sprachtourismus‹, alliterierend durch die beiden t. Warum in dieser Sprache? Weil sie meine Muttersprache ist – oder genauer gesagt meine erste Schriftsprache (siehe Kapitel 32).
Dann erfolgte der erste Übersetzungsschritt: Die Linguistin Alison Edwards übertrug es, in enger Zusammenarbeit mit mir, ins Englische. 2014 kam die überarbeitete Version als Lingo heraus (und wurde ein britischer Weihnachtshit – hurra!). 2016 erschien das Buch auf Schwedisch und Russisch. 2017: auf Deutsch, Norwegisch und Spanisch. Da haben wir’s: Die Sprache Europas ist die Übersetzung.
Allerdings ist diese deutsche Fassung ein bisschen anders. Mit ihr habe ich mich weit intensiver befasst als mit den meisten anderen, aus einem sentimentalen und einem praktischen Grund: Die deutsche Sprache ist mir lieb (nein, das sage ich nicht zu jeder), und sie ist dem Niederländischen so viel ähnlicher als dem Englischen, dass es stellenweise sinnvoller war, dem ursprünglichen Taaltoerisme zu folgen als Lingo. Außerdem ist dieses Buch hier in mancherlei Hinsicht die bisher reichhaltigste Ausgabe. Es umfasst Kapitel, die es in der englischen Übersetzung, aber nicht im niederländischen Original gibt, z. B. über Manx und Dalmatisch; Kapitel, die es im Original, aber in keiner anderen Übersetzung gibt, z. B. über Aserbaidschanisch und Limburgisch; und dazu noch drei nagelneue Kapitel, über Schweizerdeutsch, Niederdeutsch und die friesischen Sprachen in Deutschland. Sollte ein Student oder eine Studentin einer Übersetzerausbildung daran interessiert sein, die genauen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem deutschen, englischen und niederländischen Text zu untersuchen, dann ist er oder sie hiermit herzlich eingeladen, dies zu tun.
Apropos ›er oder sie‹: Der Autor und die Übersetzerin sind sich dessen bewusst, dass die menschliche Gattung zwei Geschlechter umfasst. Sie halten es aber nicht für erforderlich, dass jeder ›Lehrer‹ von einer ›Lehrerin‹ begleitet wird. Eine ›Person‹ kann auch ein Mann sein, trotz des weiblichen Wortgeschlechts. Und genauso kann ein ›Mensch‹ eine Frau sein, trotz des männlichen. Wir werden den Leser, einschließlich der Leserin, gelegentlich daran erinnern, dass die Menschheit nicht bloß aus Mannsbildern besteht. Aber eben nicht ständig – wir denken, Sie haben dafür Verständnis. Und natürlich sind mit Fahrrädern auch Velos gemeint, und mit Aprikosen wollen wir die Marillen nicht ausschließen. Alle werden hier mit eingebunden.
Sprachen ist weit davon entfernt, eine Enzyklopädie zu sein. Es tut, was der Untertitel verspricht: Es nimmt Sie mit auf eine Reise. In mehr als sechzig Ländern und Landschaften werden Sie eine Geschichte über die Sprache vor Ort erzählt bekommen, die mir bemerkenswert erschien. Meistens von mir natürlich, in einigen Fällen auch von anderen: Die Kapitel über Finnisch, Kornisch, Maltesisch und Russisch sowie das über die Gruppe der keltischen Sprachen wurden von der Linguistin Jenny Audring geschrieben, das übers Manx von der Übersetzerin Frauke Watson.
Wenn Sie ein bisschen so sind wie ich, erhoffen Sie sich von einer Urlaubsfahrt zwei Dinge: sich zu entspannen und von neuen, schönen, interessanten Eindrücken überrascht zu werden. Dieses Buch ist als so ein Urlaub gedacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise!
Amersfoort, im März 2017
Auf www.languagewriter.com (Englisch) und www.taaljournalist.nl (Niederländisch) können Sie mehr von und über Gaston Dorren lesen und ihn gerne persönlich kontaktieren – auch auf Deutsch.
Diese beiden Symbole finden sich im Anschluss an die meisten Kapitel. Sie zeigen, vor allem zum Zweck der Unterhaltung, Lehnwörter und mögliche Lehnwörter an.
weist auf Wörter hin, die das Deutsche aus der betreffenden Sprache entlehnt hat, während
Wörter vorstellt, die es im Deutschen nicht gibt, aber vielleicht geben sollte.
TEIL I
WIE UNS DIE SCHNÄBEL GEWACHSEN SIND
Sprachen und ihre Familien
Die beiden großen Sprachfamilien Europas sind Indoeuropäisch und Finno-ugrisch. Die Abstammung des Finno-ugrischen ist recht überschaubar, ebenso wie seine modernen Varianten (Finnisch und Ungarisch). Der Stammbaum des Indoeuropäischen ist jedoch ein Kuddelmuddel, das sich durch germanische, romanische, slawische und weitere Folgesprachen zieht. In mancherlei Hinsicht kann man seine Geschichte mit einer Familiensaga vergleichen, komplett mit konservativen Patriarchen (Litauisch), zankenden Kindern (Rätoromanisch), Geschwistern, die als Doppelgänger durchgehen könnten (slawische Sprachen), vergessenen Vettern (Ossetisch), Waisen (Rumänisch und andere Balkansprachen) und Kindern, die es schwer haben, sich abzunabeln (Französisch).
KAPITEL 1
Ein bisschen PIE schadet nie
Litauisch
Es war einmal in einem weit entfernten Land (niemand weiß genau wo), vor tausenden von Jahren (niemand weiß genau wann), als die Tiere gerade nicht mehr sprechen konnten und die Menschen es dafür noch nicht allzu lange taten, da gab es eine Sprache, die heute keiner mehr spricht. Ihr Name ist längst vergessen, wenn sie überhaupt je einen hatte. Kinder lernten diese Sprache von ihren Eltern, wie Kinder dies tun, und brachten sie wiederum ihren Kindern bei und so weiter und so fort, von Generation zu Generation. Im Lauf der Jahrhunderte entfernte man sich immer weiter von dieser alten Sprache. Es war ein bisschen wie bei ›Stille Post‹: Der letzte Spieler hört etwas ganz anderes als das, was der erste anfangs gesagt hat. Wir, die Menschen aus der heutigen Zeit, sind diese letzten Spieler.
Das gilt natürlich nicht nur für uns Deutsch Sprechende, sondern ebenso für unsere niederländischen Nachbarn – deren Sprache im Prinzip fast die gleiche ist. Auch Englisch unterscheidet sich nicht groß, genau wie Spanisch, Polnisch oder Griechisch. Denn wer genau hinsieht, erkennt, dass sogar sie Ähnlichkeiten mit dem Deutschen haben. Noch weiter entfernt gibt es Sprachen, wie Armenisch, Kurdisch oder Nepalesisch, bei denen zwar sehr genau hingesehen werden muss, um verwandte Züge zu erkennen, aber sie sind vorhanden. Jede einzelne von ihnen ist aus einer Sprache hervorgegangen, die vor ungefähr sechzig Jahrhunderten von einem Volk gesprochen wurde, dessen Namen wir nicht kennen. Und weil niemand weiß, wie diese Sprache hieß, hat man sich eine Bezeichnung für sie ausgedacht. Im Deutschen wird sie meist Indogermanisch genannt, wir halten uns hier jedoch an die international übliche Bezeichnung Indoeuropäisch oder auch Protoindoeuropäisch, kurz PIE.
Beide Begriffe sind eigentlich nicht ganz zutreffend. Das Wort proto (›erst‹) erweckt den Eindruck, dass es vor dieser Sprache keine andere gegeben hat, was nicht stimmt. Außerdem weist ›Indoeuropäisch‹ auf ein Sprachgebiet von Indien bis Europa hin, ›Indogermanisch‹ auf einen Teil davon. Tatsächlich aber spricht nahezu jeder in Nord- und Südamerika eine Sprache, die von PIE abstammt, während in Indien über 200 Millionen Menschen Sprachen sprechen, die historisch keinerlei Verbindung zu PIE haben. Zutreffend ist, dass über 95 Prozent der heutigen Europäer eine indoeuropäische Sprache sprechen – also eine Sprache, die von PIE abstammt.
PIE und seine Sprecher sind im Nebel der Jahrhunderte verblasst. Sprachwissenschaftler bemühen sich jedoch, diesen Nebel ein wenig aufzuklaren, indem sie rekonstruieren, wie PIE geklungen haben könnte. Dies tun sie vor allem anhand alter Dokumente der Nachfahren PIEs, wie Latein, Griechisch und Sanskrit, aber auch anhand modernerer Sprachen: von altirischen Ogham-Inschriften (4. Jahrhundert) über das Hildebrandslied (9. Jahrhundert) bis hin zu den ältesten geschriebenen Überresten des Albanischen (15. Jahrhundert) und sogar litauischen Dialekten.
Eine Karte europäischer Sprachen (1741) mit den ersten Zeilen des Vaterunsers auf Litauisch. (Quelle: „Europa Polyglotta“ von Gottfried Hensel (1741))
Um etwa das alte PIE-Wort für ›Zunge‹ zu rekonstruieren, nehmen die Linguisten sich zunächst alle Übersetzungen dieses Begriffs in den genannten Folgesprachen vor, wie zum Beispiel lezu, liežuvis, tengae, tunga, dingua, gjuhë, käntu, językŭ und jihva (›Zunge‹ auf Armenisch, Litauisch, Altirisch, Schwedisch, Altlatein, Tocharisch A, Altslawisch und Sanskrit). Auf den ersten Blick haben sie wenig miteinander gemein. Aber wenn man Reihen wie diese systematisch betrachtet, tauchen allerlei Muster auf. Nach und nach kristallisiert sich heraus, dass die eine Sprache PIE konsequent auf eine bestimmte Weise weiterentwickelt hat (›deformiert‹, wenn man so will) und die andere wiederum ganz anders damit umgegangen ist. Wenn man diese Prozesse so weiterverfolgt, kann man sich bis zum ursprünglichen Wort zurückarbeiten.
Durch diese Detektivarbeit konnten viele Informationen gewonnen werden, aber leider sind die Ergebnisse für Nichtlinguisten wenig erhellend. Um beim Beispiel ›Zunge‹ zu bleiben: Das PIE-Wort dafür war allem Anschein nach* dṇģhwéh2s. Das Sternchen (*) wird nicht ausgesprochen, sondern zeigt an, dass das Wort auf der Grundlage nachfolgender Sprachen rekonstruiert worden ist. Die anderen Zeichen stehen jeweils für einen Laut – aber welche Laute dies genau sind, können nur Spezialisten sagen (und sogar ihnen bleiben einige davon ein Rätsel). Kurzum, das Ergebnis ist ziemlich abstrakt und nicht leicht nachvollziehbar.
Gibt es eine Möglichkeit, die Kluft zwischen der Sprache unserer Urahnen und unserer eigenen zu überbrücken? Können wir PIE nicht etwas zugänglicher und seine Sprecher menschlicher machen? Könnten wir die Sprache und das Volk wieder zum Leben erwecken? – Die Antwort lautet: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Und Vilnius, die Hauptstadt Litauens, ist ein guter Ort dafür.
In Vilnius wurde Marija Gimbutas geboren (1921–1994), eine Sprachwissenschaftlerin, die in den fünfziger Jahren die sogenannte Kurgan-Hypothese entwickelte, nach der die Sprecher von PIE in den weiten Steppen nördlich des Schwarzen und des Kaspischen Meers angesiedelt waren (dort, wo sich heute die Ukraine und das südliche Russland befinden), und zwar um 3700 v. Chr. ›Kurgan‹ ist Türkisch für Hügelgrab und verweist auf die vielen alten Grabhügel, die in der gesamten Region gefunden wurden. Gimbutas vermutete, dass die Kultur, die einige der Gräber hervorgebracht hat – eine so weit entwickelte Kultur, dass man Pferde zähmte und sogar in Streitwagen fuhr –, die Quelle des PIE war. Obwohl diese Theorie nicht unumstritten ist, wird sie weitgehend anerkannt.
Wenn Sie PIE persönlich näher kennenlernen möchten, ist Vilnius ein gutes Ziel, denn von allen lebenden Sprachen der Welt ist Litauisch PIE am ähnlichsten. Heutige Litauer könnten sich zwar nicht mit den alten Indoeuropäern verständigen, aber sie könnten sich deren Sprache weitaus schneller aneignen als Griechen oder Nepalesen, ganz zu schweigen von Deutschen. Die Übereinstimmungen sind zahlreich. ›Sohn‹ beispielsweise heißt auf Litauisch sūnus und auf PIE *suh2nus. Esmi heißt auf PIE ›ich bin‹, und das gleiche Wort kommt in einigen litauischen Dialekten vor (in der Standardsprache von Vilnius ist es ›esu‹). Das Litauische hat viele Laute aus PIE beibehalten, während diese sich in den anderen Sprachen abgewandelt haben, im Deutschen zum Beispiel während der Ersten und der Zweiten Lautverschiebung. Nehmen wir das Wort für die Zahl 4. Sowohl das deutsche vier als auch das litauische keturi stammen von *kwetwores ab. Nur ein Experte kann die Verwandtschaft zwischen *kwetwores und dem deutschen vier erkennen, wohingegen die Ähnlichkeit mit dem litauischen keturi auch für Nichtlinguisten offensichtlich ist.
Vielleicht sogar noch auffälliger sind die grammatikalischen Gemeinsamkeiten. PIE hatte acht Fälle, Litauisch hat immerhin noch sieben. In anderen Sprachen wie Polnisch gibt es ebenfalls sieben Fälle, aber nur im Litauischen sind sie ähnlich wie im PIE. Und wie im PIE haben einige litauische Dialekte nicht nur die regulären Singular- und Pluralformen, sondern auch einen eigenen ›Dual‹, der eine Zweizahl von Objekten bezeichnet. Das ist in den heutigen indoeuropäischen Sprachen selten, wobei Slowenisch eine wichtige und stolze Ausnahme bildet. Auch im Bairischen und Jiddischen ist der Dual noch ansatzweise vorhanden.
Verbkonjugationen, Satzbau, Akzentsysteme, Suffixe – viele Elemente des Litauischen bezeugen dessen Abstammung von PIE. Sie alle haben zweihundert Generationen überlebt, und das mit ziemlich wenigen Änderungen. Damit sind die Litauer unbestritten europäische Stille-Post-Meister.
Während PIE in den Wurzeln des Deutschen steckt, hat Litauisch ihm doch so gut wie keine Wörter vererbt. Das Wort Elen, eine veraltete Bezeichnung für ›Elch‹, könnte aus dem Litauischen stammen.
Rudenėja – das litauische Wort für den Herbstbeginn in der Natur.
KAPITEL 2
Die getrennten Geschwister
Finno-ugrische Sprachen
Welche Sprache sprechen finnische Touristen in Ungarn? – ›Englisch‹, werden Sie spontan sagen, und wahrscheinlich haben Sie recht. Finnisch und Ungarisch sind miteinander verwandt (sie gehören zur finno-ugrischen Sprachfamilie, die auch mit dem Namen Uralisch bezeichnet wird), aber sie unterscheiden sich zu sehr, als dass Finnen darauf hoffen könnten, sich in Budapest zu verständigen, wenn sie sich an ihre Muttersprache halten wollen. Dieser linguistische Abstand hat keine geographischen, sondern geschichtliche Gründe. Weit voneinander entfernt zu leben stellt kein Problem dar, wie die Australier und die Engländer beweisen. Eine sehr lange Zeit getrennt voneinander zu verbringen ist jedoch eine andere Sache.
Die Trennung zwischen den Finnen und den Ungarn liegt tatsächlich lange zurück: Die Wege ihrer sprachlichen Vorfahren gingen vor über 4.000 Jahren auseinander. Damals standen die Entwicklungen noch bevor, durch die sich das Deutsche später vom Russischen, Griechischen und Hindi abheben sollte.
Und dennoch werden Sie, wenn Sie ganz genau hinsehen, viele Gemeinsamkeiten zwischen Finnisch und Ungarisch entdecken. Eine davon ist, dass sie einige hundert sogenannte Kognaten (›mitgeborene‹ oder verwandte Wörter) mit demselben Ursprung haben. Ein berühmter Satz, der dies veranschaulicht, ist: »Der lebende Fisch schwimmt unter Wasser.« Die finnische Übersetzung lautet: Elävä kala ui veden alla; auf Ungarisch heißt es: Eleven hal úszkál a víz alatt. Die Verwandtschaft liegt bei manchen anderen Wortpaaren deutlich weniger auf der Hand. Forscher der Historischen Sprachwissenschaft sind sich beispielsweise sicher, dass viisi und öt (›fünf‹) Kognatenpaare sind, wie auch juoda und iszik (›trinken‹), vuode und ágy (›Bett‹) oder sula und olvad (›schmelzen‹). Aber für uns Normalsterbliche ist dies nicht so eindeutig – selbst für einen Finnen oder Ungarn nicht.
Wie also können Sprachwissenschaftler sicher sein, dass hier eine Verbindung besteht? – Nun, es gibt etwa zwanzig andere Sprachen, die gemeinsam eine Brücke über dem Abgrund zwischen Ungarisch und Finnisch bilden. Die meisten von ihnen sind klein und werden im Nordwesten Russlands gesprochen. Das Wort für ›fünf‹ findet sich zum Beispiel in viit (Estnisch), vit (Komi), wet (Khanty) und ät (Mansisch) wieder, eine Reihe, die sich sauber zwischen viisi (Finnisch) und öt (Ungarisch) einfügen lässt.
Das Vokabular ist natürlich nur einer der vielen sprachlichen Aspekte. Betrachten wir die Phonologie (den Klang der Sprachen) und die Grammatik, ist die nahe Verwandtschaft zwischen Ungarisch und Finnisch noch leichter zu erkennen. Klanglich sind beide Sprachen reich an Vokalen, was an sich schon außergewöhnlich ist. Noch auffälliger ist, dass es unter diesen Vokalen zwei gibt, die in den meisten anderen Sprachen nicht vorkommen. Sie entsprechen dem deutschen ö und ü oder dem französischen eu und u. Außerdem unterteilen beide Sprachen ihre Vokale in zwei Gruppen, wobei alle Vokale eines Wortes jeweils derselben Gruppe angehören müssen. Zudem werden alle Wörter auf der ersten Silbe betont.
Die finno-ugrische Welt – ein etwas einsamer und abgelegener Ort, wenn Sie sich zu weit weg von Finnland und Estland verlaufen. (Quelle: Wikipedia)
Finnisch und Ungarisch teilen sich ferner mindestens sechs grammatikalische Merkmale, die in Europa selten sind. Beide ignorieren das Geschlecht in dem Sinne, dass sie nur ein einziges Wort für ›er‹ und ›sie‹ haben (hän auf Finnisch, ő auf Ungarisch). Beide haben mehr als zwölf Fälle. Beide haben Postpositionen statt Präpositionen, also nachgestellte Verhältniswörter statt vorgestellter. Beide haben eine Vorliebe für Suffixe – ein Wort wie ›schicksalhaftigkeitslosester‹, das hauptsächlich aus Suffixen besteht, würde kaum ein müdes Stirnrunzeln hervorrufen. Besitz wird nicht mit einem Verb ausgedrückt, sondern mit einem Suffix; statt ›ich habe es‹ wird sinngemäß ›es ist auf mir‹ gesagt. Und schließlich: Auf Zahlwörter folgt immer ein Singular (›sechs Hund‹ statt ›sechs Hunde‹). Warum sollte man sich auch die Mühe machen, alle Folgewörter anzupassen, wenn die Zahl bereits klar ist?
All diese Ähnlichkeiten sollten doch genügen, um Sie davon zu überzeugen, dass Finnisch und Ungarisch Geschwister sind, oder nicht? Aber es gibt noch eine überraschende Wendung. Beinahe alle phonologischen und grammatikalischen Ähnlichkeiten teilen diese beiden Sprachen auch mit dem Türkischen. Man könnte also meinen, dass es sich hier um ein weiteres Familienmitglied handelt. Genau das glaubten Sprachwissenschaftler lange Zeit, einige tun es selbst heute noch. Die meisten jedoch halten es trotz der Übereinstimmungen für nicht ausreichend belegt. Sie betrachten das Türkische lieber getrennt von den beiden anderen Sprachen und begründen die Gemeinsamkeiten teils mit Zufall, teils mit gegenseitiger Beeinflussung. (Die Ungarn und Türkisch sprechende Nationen haben geschichtliche Verbindungen, die ziemlich weit zurückgehen.)
Und doch wäre es möglich. Es lässt sich nur nicht mit Sicherheit sagen. Gäbe es doch nur Sprachen, egal wie klein oder wie sehr sie vom Aussterben bedroht wären, die die Lücke zwischen Türkisch und Ungarisch schließen könnten. Vielleicht hat es sie gegeben, vielleicht nicht, oder vielleicht sind sie auch einfach nur verschwunden. Wir werden es wohl nie genau wissen.
Siehe für finno-ugrische Lehnwörter und potentielle Lehnwörter die eigenen Kapitel für Estnisch, Finnisch, Ungarisch und Samisch.
KAPITEL 3
Der zerbrochene Krug und seine Scherben
Rätoromanisch
Rätoromanisch, das war doch diese jahrhundertealte kleine Sprache, die in der Schweiz gesprochen wird? Die vierte Landessprache neben Französisch, Italienisch und Schwyzerdütsch? – Ja, lautet die kurze, langweilige und auch nicht ganz korrekte Antwort. Um ausführlicher zu werden, müssen wir auf Zeitreise gehen, so etwa zwanzig Jahrhunderte zurück (wusch … Flashback).
Rom ist auf dem Höhepunkt seiner Macht (Archivbilder in Schwarzweiß: marschierende Legionäre, deklamierende Senatoren). Das Römische Reich erstreckt sich wie ein riesiger Krug um das Mittelmeer herum, mit der Straße von Gibraltar als Öffnung. Aber wie so vieles hat auch Keramik kein ewiges Leben: Im 5. Jahrhundert zerbricht das Reich. Der Osten mit seiner überwiegend griechischen Kultur bleibt als eine große Scherbe intakt und wird in seiner Einheit, obwohl der Zahn der Zeit auch hier nagt und bröckelt, noch viele Jahrhunderte erhalten bleiben. Die westliche Hälfte jedoch zerbirst gänzlich und endgültig. Dadurch zerspringt auch die lateinische Sprache in Scherben. Die verschiedenen Regionen haben untereinander immer weniger Kontakt, und so wächst ihr unterschiedlicher Sprachgebrauch weiter auseinander. Allerlei Stämme, jeder mit einer eigenen Sprache, lassen sich im Gebiet des ehemaligen Römischen Reichs nieder. Manche von ihnen übernehmen das örtliche Latein und versehen es mit einer persönlichen Note.
Diese Scherben des Lateinischen haben sich schließlich zu den großen fünf romanischen Sprachen entwickelt – zumindest endet so die Geschichte in den meisten Erzählungen. Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und, als östlicher Außenseiter, Rumänisch. Aber ganz so stimmt das nicht, denn das Lateinische ist nicht in fünf, sondern in viele dutzende Sprachen auseinandergefallen und in so viele Dialekte, wie Wassertropfen in einen Krug passen. Wer um 1200 durch die römische Welt reiste, begegnete in zwei verschiedenen Städten niemals derselben Sprache. Jedes Kuhdorf hatte sein eigenes Latein.
Erst in den darauffolgenden Jahrhunderten entstand, was wir heute die romanischen Sprachen nennen. Könige wie Dionysius von Portugal, literarische Größen wie Dante Alighieri und Institutionen wie die Académie française halfen dabei, die Scherben der lokalen Dialekte zu Sprachen aneinanderzukleben, die in großflächigen Gebieten gesprochen und zunächst vor allem geschrieben wurden. Die besagten ›Big Five‹ waren dabei am erfolgreichsten: Sie wurden die offiziellen Sprachen ganzer Nationalstaaten, im Fall des Spanischen, Portugiesischen und Französischen sogar von neuen Imperien.
Es gab jedoch weitere romanische Dialektgruppen, die sich zu einer eigenständigen Sprache hocharbeiteten. In Spanien haben heute zwei romanische Minderheitssprachen einen offiziell anerkannten Status: an der Ostküste Katalanisch, im Nordwesten Galicisch. Etwas östlich von der galicischen Ecke bilden Asturisch, Leonesisch und (in Portugal) das kleine Mirandesisch eine Gruppe eng miteinander verwandter Sprachen, die ausschließlich in der eigenen Region eine Rolle spielen. In Frankreich gibt es neben dem Französischen mit all seinen Dialekten auch die Sprachen Okzitanisch, Korsisch und Arpitanisch – egal, was Paris mit seiner Sprachpolitik dazu meint. Auch in Italien, wo jede Mundart der ganze Stolz ihres Heimatgebietes ist, können manche Dialekte für sich beanspruchen, eine eigenständige Sprache zu sein. Das Sardinische oder Sardische zeigt hierfür die besten Qualifikationen, aber auch das Venetische und mindestens zehn weitere Sprachen haben gute Argumente. Es gibt drei aus dem Rumänischen entstandene Varianten, die ihrerseits womöglich den Unabhängigkeitsstatus verdienen: Arumänisch (das in vielen südlichen Balkanländern gesprochen wird), Meglenorumänisch (Griechenland, Mazedonien) und Istrorumänisch, von der kroatischen Halbinsel Istrien, wo es leider so gut wie ausgestorben ist. Außerdem wird auf Istrien noch Istriotisch gesprochen, eine romanische Sprache mit unklaren Familienverhältnissen. Nur ein paar hundert ältere Menschen beherrschen sie noch; wahrscheinlich wird sie also verschwunden sein, bevor die Experten ihre verwandtschaftlichen Zusammenhänge geklärt haben. Es hat noch mehr romanische Sprachen gegeben, die allesamt tot sind. Dalmatisch war Ende des 19. Jahrhunderts der jüngste Sterbefall in der Familie.
Was hat es also nun mit Rätoromanisch auf sich? – Die Schweizer Verfassung erkennt es als eine eigene Sprache an. Etwa 35.000 Einwohner des Kantons Graubünden sprechen es. Nur gibt es den einen oder anderen Haken.
Erster Haken: In Graubünden spricht jedes Tal ein anderes Rätoromanisch. Selbst ein einfaches Wort wie ›ich‹ variiert von eu (wie im Portugiesischen) bis hin zu ja (Russisch!). ›Wie schön‹ heißt im einen Dialekt che bel, im anderen tgei bi. Die 35.000 Rätoromanen verstehen einander folglich nicht ohne weiteres, selbst wenn sie nur wenige Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen sind. Wären all diese Dialekte nicht jahrhundertelang so isoliert gewesen, dann hätten sie sich einfach einer größeren Sprache angeschlossen. Hätten sie eine eigene Stadt gehabt, ein kulturelles Zentrum, dann hätten sie sich zumindest zu einer kleinen Sprache zusammentun können. So aber sind sie bis heute geblieben, was sie all die Zeit auch schon waren: Scherben des zerbrochenen Krugs, der einmal Latein geheißen hat.
Zweiter Haken: Welchen Dialekt erkennen die Schweiz und Graubünden als das Rätoromanisch an? – Bis vor etwa einer Generation hieß es: nicht einen, sondern alle. Schulbücher wurden in fünf verschiedenen Fassungen herausgegeben. Erst 1982 wurden diese Scherben, nachdem es mehrere vergebliche Versuche gegeben hatte, mit einigem Erfolg zu einer uniformen Sprache zusammengeleimt, der Standardsprache Rumantsch Grischun (Graubündner Romanisch). Aus Gründen der Neutralität beauftragte das verantwortliche Gremium, die Lia Rumantscha (Rätoromanische Liga), den deutschsprachigen Linguisten Heinrich Schmid damit. Der Kanton und die eidgenössische Regierung empfingen Schmids Ergebnis mit offenen Armen. Heute werden Gesetzesbücher, Schulbücher und alles mögliche andere in dieser neuen Einheitssprache veröffentlicht, was natürlich vieles einfacher macht. Dennoch, ob neutral oder nicht, hat es diese Standardsprache nicht geschafft, die Herzen der Menschen zu erobern, die die Dialekte sprechen. Die Mehrheit der Graubündner Gemeinden benutzt nach wie vor den jeweils eigenen Dialekt als vorrangige Sprache.
Dritter Haken: Als Rätoromanisch wird auch eine übergeordnete Gruppe dreier regionaler romanischer Sprachen bezeichnet, von denen zwei in Italien gesprochen werden: Ladinisch und Friaulisch (oder Friulanisch oder Furlanisch). Das Ladinische mit seinen 30.000 Sprechern an der Grenze zum deutschen und italienischen Sprachgebiet ist genau so ein hoffnungsloser Fall wie das Schweizer Rätoromanisch: Jeder kleine Flecken hat einige hundert Sprecher, die nur einander wirklich gut verstehen. Friaulisch hingegen ist eine weitgehend standardisierte Sprache. Es hat über eine halbe Million Sprecher im äußersten Nordosten Italiens, zu denen auch Stadtbewohner gehören, und eine eigene Literatur, die weit mehr umfasst als nur Heimatromane und holprige Verse.
Für manche gibt es sogar noch einen vierten Haken: Das sind die Leute, die »Retro-Romanisch« sagen, mit einem extra r. Damit kann nur Latein gemeint sein – der Krug, bevor er zerbrach.
Das einzige rätoromanische Wort, das es ins Deutsche geschafft hat, ist lavina, bei uns bekannt als ›Lawine‹.
Schischuri – das Wirrwarr, das tagtäglich im Kleinen wie im Großen auf der Welt herrscht.
KAPITEL 4
Muttersöhnchen
Französisch
Das moderne Französisch hat eine starke Mutterbindung. Um nicht zu sagen – ach, sprechen wir’s aus: eine ungesunde Mutterfixierung. Dabei sollte man meinen, dass so eine über mehr als tausend Jahre gereifte Sprache längst erwachsen geworden ist. Schließlich hat sie mit anderen Sprachen zusammengewohnt, die Welt bereist und Triumphe gefeiert. Aber nein, man sehe und staune: Franze hängt noch immer am Rockzipfel seiner lateinischen Mutter.
Keine andere Sprache leidet in solchem Maße an diesem Komplex. Russisch, Polnisch, Bulgarisch: Auch sie wissen genau über ihre Herkunft Bescheid. Sie sind Kinder der slawischen Mutter – hу и что? (›Na und?‹) Auch Deutsch, Niederländisch, Englisch: Es lässt sie kalt, wie in ihrem germanischen Elternhaus der Umgangston war. Nur Isländisch hält ebenso zwanghaft an der Vergangenheit fest; aber die Isländer sind wenigstens konsequent, denn sie sprechen mehr oder weniger noch so wie ihre Vorfahren.
Was man von den Franzosen nicht behaupten kann. Ihre Sprache mag ein Kind des Lateinischen sein, aber ein gutes Gespräch mit Julius Cäsar wäre für sie nicht mehr drin. In den anderen romanischen Sprachen, Italienisch, Spanisch usw., wäre das mit viel gutem Willen vielleicht noch möglich, nicht jedoch auf Französisch. Oje! So eine starke Mutterbindung, und dann noch nicht einmal von Mama Latein verstanden werden.
Es war selbiger Cäsar, der den ersten französischen Samen säte. Im ersten Jahrhundert v. Chr. besetzte er mit seinen Legionen Gallien (wie Frankreich damals hieß). Er kam, sprach und siegte: Als die Römer fünfhundert Jahre später wieder abzogen, sprach die Bevölkerung Latein. Das heißt, das Latein der Soldaten und Kaufleute, das auch noch vom Gallischen beeinflusst wurde, der keltischen Sprache, die die Gallier vorher gesprochen hatten. Die Art von Latein, die einen seriösen Althistoriker (wie Gert, Vater meiner Freundin und Kollegin Jenny, der Verfasserin mehrerer Kapitel dieses Buchs) oder einen seriösen Feldherrn (wie Julius Cäsar) nicht glücklich machen würde. Und doch: ein erkennbares, verständliches Latein. Der Keim des Französischen war gelegt.
So wie das Latein von Gert und Julius innerhalb von fünf Jahrhunderten das Keltische vollständig verdrängt hatte, so musste es in den darauffolgenden fünf Jahrhunderten im nördlichen Gallien gegen Germanisch ankämpfen. Genauer gesagt: gegen die Sprache der Franken, der neuen Herrscher. Bekannte mittelalterliche Könige wie Chlodwig, Pippin der Jüngere und Karl der Große beherrschten zwei Sprachen: Ihre Muttersprache war Fränkisch, also eine germanische Sprache, und im klassischen Latein nahmen sie Unterricht. So tat das jeder, der gesellschaftlich oder intellektuell etwas auf sich hielt. Nur das gemeine Volk sprach weiterhin, was es bisher auch gesprochen hatte: schlechtes Latein. So schlecht, dass diese Volkssprache inzwischen sogar lingua romana rustica und vulgaris lingua, rustikales und vulgäres Latein, genannt wurde. Gert und Julius würden erschaudern, wenn sie sich anhören müssten, wie die schöne Sprache verhunzt wurde, die Letzterer einst eingeführt hatte. Auch von den ehemals sechs lateinischen Fällen waren nur noch zwei übrig, sächliche Wörter wurden männlich, verschiedene Verbzeiten wurden unkenntlich gemacht, und zu den dutzenden keltischen Wörtern, die sich bereits eingeschlichen hatten (charrue: ›Pflug‹, mouton: ›Schaf‹), gesellten sich nun noch hunderte fränkische Wörter (auberge: ›Herberge‹, blanc: ›weiß‹, choisir: ›wählen‹).
Wenn ein ganzes Volk eine andere Sprache spricht als seine Herrscher, gibt irgendwann eine der beiden Parteien nach. In diesem Fall waren es die Herrscher: Hugo Capet, Frankenkönig im 10. Jahrhundert, war der erste, der neben seinem in der Schule erworbenen Latein nicht Fränkisch sprach, sondern Volkslatein. So fand die bäuerliche Sprache schließlich ihren Weg in die Häuser der Royals. Die lingua romana rustica war zur lingua romana geworden, oder auch: Romanisch. Wir kennen es heute als Altfranzösisch, aber die Bezeichnung ›Französisch‹ (franceis, françoix, français) kam erst Jahrhunderte später in Mode.
Unser Lateinexperte hat sich bis dahin längst verabschiedet. Ein Französischlehrer aber (wie Charles, mein Vater) beginnt langsam seine geliebte Sprache wiederzuerkennen. Franze ist geboren.
Die Bezeichnung ›Französisch‹ wird allerdings erst zwei Jahrhunderte später Verwendung finden, als die Sprache bereits heftig pubertiert. Brüderchen Fränkisch ist vor die Tür gesetzt worden, und Mutter Latein interessiert Franze nicht – zu diesem Zeitpunkt ist noch keine starke Mutterbindung zu spüren. Jeder in Nordgallien spricht und schreibt franceis so, wie es ihm gefällt.
Und dann bricht die Renaissance aus. Ganz Westeuropa gerät im 15. Jahrhundert in den Bann des klassischen Altertums, alle westeuropäischen Sprachen sind von den Römern und ihrer Sprache besessen. Französisch geht dabei weiter als alle anderen. Es will wie seine Mutter sein, so sehr es eben geht. Wörter nichtlateinischen Ursprungs, vor allem germanische, sind verpönt. Sur (›sauer‹) wird nach und nach vom römischen acide verdrängt. Beaucoup überholt das germanische maint (›mancher‹, ›viel‹).
Schamlos lässt sich das erwachsene Französisch auf einmal wieder von seiner lateinischen Mutter säugen. Längst vergessene Wörter werden klassischen lateinischen Texten entnommen und bekommen neues Leben eingehaucht. Die Wörter célèbre, génie und patriotique mögen ›typisch französisch‹ scheinen, tatsächlich aber wurden sie erst in diesem späteren Entwicklungsstadium direkt aus dem Lateinischen importiert. Cäsar könnte einen heutigen Pariser vielleicht sogar etwas besser verstehen als einen aus dem 10. Jahrhundert.
Französisch geht so weit, dass es Wörter erneut übernimmt. Das lateinische fragilis (›zerbrechlich‹), das übers Volkslateinische zu frêle reduziert worden war, wird nun als fragile noch einmal wiedergeboren. Masticare (›kauen‹, aus dem Griechischen entlehnt), in rustikalen fränkischen Mündern zu macher gekäut, darf als mastiquer noch einmal Einzug halten.
Wer seiner eigenen Mutter ähneln will, muss nicht nur wie sie klingen, sondern auch aussehen wie sie: ihre Kleider tragen, ihren Lippenstift benutzen, das ganze Programm. Zu diesem Ziel schmückt Französisch sich mit zahlreichen stummen Konsonanten, allesamt Erbstücke der lateinischen Mutter. Tausende Exemplare der Buchstaben c, d, f, l, p, r, s, t, x und z finden sich von jetzt an auf Papier wieder, ohne jemals ausgesprochen zu werden. Ein Beispiel: Temps (›Zeit‹, ›Wetter‹) klingt wie ›tã‹ (nasal ausgesprochen, daher die Tilde). Tant (›so viel‹) hört sich genauso an. Aber das eine Wort kommt vom lateinischen tempus, das andere von tantus, daher die zwei Schreibungen. Ein anderes Beispiel: Das Wort homme (›Mann‹, ›Mensch‹) fängt mit h an, was Franzosen bekanntlich nicht immer mühelos aussprechen können. Der Grund dafür ist, dass das lateinische Wort, von dem es abgeleitet ist, homo, ebenfalls mit h beginnt.
Ein geringer Teil dieser stummen Konsonanten wird hörbar, wenn ein Vokal folgt. So klingt prenez (›nehmen Sie‹) wie ›prneh‹, aber prenez-en (›nehmen Sie davon‹) wie ›prnehsã‹. Und im Wörtchen les ist das s normalerweise stumm, in les amis (›die Freunde‹) aber hörbar: ›lesamih‹. Wieder scheint hier das Lateinische durch: Les ist die Fortführung der lateinischen Demonstrativpronomina illos/illas (›jene‹), und das meist stumme Plural-s ist die Fortführung des (ausgesprochenen) Endungs-s dieser lateinischen Wörter.
Die Aussprache ändert sich in dem Moment, wo die Franzosen ihre Sonntagssprache auspacken. Dann sind plötzlich viel mehr dieser unterdrückten Konsonanten zu hören. Dann erscheint in tu as attendu (du hast gewartet) auf einmal auch das stimmhafte s (tüasatãdü). Im normalen Alltag würde ihnen das nicht einfallen, aber es klingt einfach so unwiderstehlich vornehm. Wahrscheinlich, weil es so schwierig ist. Der Redner muss nämlich blitzschnell entscheiden, wo er einen Konsonanten einfügen kann und wo nicht. Er muss seine Worte buchstabiert vor sich sehen, bevor er sie ausspricht. Eigentlich zwingt Franze seine Sprecher also dazu, sich das Bild der lateinischen Mutter ständig vor Augen zu führen. Schließlich hat er sich selbst nach ihrem Vorbild modelliert und in ihre Schreibweise gehüllt.
Wenn das mal keine ungesunde Mutterfixierung ist.
Französisch ist einer der wichtigsten Lehnwort-Spender des Deutschen. Es gibt hunderte, vielleicht tausende, französischstämmige Wörter, von den alltäglichen Beispielen Onkel, doppelt und Orange bis hin zu den schickeren Ouvertüre, Parade und Defätismus.
Terroir – der Ort, an dem Kulturpflanzen angebaut werden und der ihren Ertrag durch seine geographischen, geologischen und klimatischen Eigenschaften einzigartig macht. Meist von Weinkennern verwendet, aber auf jedes andere Genießerprodukt übertragbar.
KAPITEL 5
Sklawenarbeit
Slawische Sprachen
Alle slawischen Sprachen ähneln einander. Wenn Sie eine lernen, lernen Sie viele weitere gleich mit – sehr praktisch.
Nehmen wir das Wort für ›Slawisch‹. Das heißt slavjanski auf Russisch, słowiański auf Polnisch und slavenski auf Serbokroatisch. Und diese Sprachen sind einander noch verhältnismäßig fremd, denn sie gehören verschiedenen Gruppen an: dem Ost-, West- und Südslawischen. Ein anderes gutes Beispiel ist das Wort für ›Wort‹: slovo auf Ukrainisch, slovo auf Slowakisch und slovo auf Bulgarisch – wieder Osten, Westen und Süden.
Diese Ähnlichkeiten können aber auch unpraktisch sein. Zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass das tschechische Wort slovenský – nein, eben nicht ›Slowenisch‹ bedeutet, sondern ›Slowakisch‹. ›Slowenisch‹ ist nämlich slovinský. Also bitte gut aufpassen.
Neben slovinský und slovenský gibt es im Tschechischen auch das Wort slovansky, ›Slawisch‹. Auf Bulgarisch bedeutet slovenski aber ›Slowenisch‹, auf Mazedonisch wiederum ›Slawisch‹. Und mit slovinski meinen die Mazedonier wieder Slowinzisch, einen ausgestorbenen polnischen Dialekt, der auf Tschechisch übrigens … na gut, ich hör schon auf.
Wenn Sie eine slawische Sprache können, können Sie viele weitere gleich dazu, aber Sie wissen oft nicht, welche Sie eigentlich gerade können. War es jetzt noch mal Slowakisch, das sich selbst als slovenčina bezeichnet, und Slowenisch, das sich slovenščina nennt, oder umgekehrt? Man kann es leider nicht mal eben nachschlagen, denn heißt ein slowenisch-slowakisches Wörterbuch auf Slowenisch slovinsko-slovenský slovník und auf Slowakisch slovensko-slovaški slovar – oder doch andersherum? Und in welcher dieser Sprachen bedeutet neben slovinčina und slovenčina auch slowienčina ›slawische Sprache‹? Ganz zu schweigen von den slawischen Sprachen Serbisch und Sorbisch, die auf Slowenisch, äh, Slowakisch beide Srbský heißen.
Alle slawischen Sprachen ähneln einander – sehr praktisch, vor allem für Miroslav, Stanislav, Vladislav und andere -slavs, denn sie lernen viele Sprachen auf einmal. Aber für uns bedeutet es harte Arbeit: Sklawenarbeit eben.
Siehe für slawische Lehnwörter und potentielle Lehnwörter die eigenen Kapitel für Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Serbokroatisch, Sorbisch, Polnisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Russisch, Weißrussisch und Ukrainisch.
KAPITEL 6
Sprachwaisen
Rumänisch
Die Familie macht einen zu dem Menschen, der man ist. Wir erben die Gene unserer Eltern, und die haben sie von ihren Eltern geerbt. Auf diese Weise haben wir Ähnlichkeit mit unseren Vorfahren, sowohl im Aussehen als auch im Verhalten.
Ebenso sind die meisten Sprachen Teil einer Familie, und auch deren Mitglieder haben vererbte Gemeinsamkeiten. Natürlich geht es bei neu entstehenden Sprachen nicht um die Vereinigung zweier elterlicher Sprachen, hier hinkt der Vergleich. Meistens spalten sich Sprachen in verschiedene Teile, wie Amöben, oder bekommen Ableger, wie Erdbeerpflanzen. So haben sich etwa die heutigen romanischen Sprachen (Rumänisch, Französisch, Italienisch usw.) aus dem alten Latein entwickelt. Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebiet ist zum Beispiel Kiezdeutsch eine junge Variante mit eigenen grammatikalischen Regeln, die vom heutigen Standarddeutsch abweichen.
Unsere familiäre Herkunft ist natürlich nicht der einzige Faktor, der bestimmt, wie wir uns als Menschen verhalten, kleiden und ausdrücken. Auch unsere Erfahrungen und die Menschen, denen wir begegnen, machen uns zu denen, die wir sind. Manche Verwandte heben sich dadurch stark von den anderen ab. Das sind die sprichwörtlichen weißen Raben oder, was häufiger vorkommt, schwarzen Schafe.
Auch das funktioniert bei Sprachen genauso. Vor allem in Gebieten, wo verschiedene Sprachfamilien dicht beieinanderleben und über Jahrhunderte in engem Kontakt stehen, können sie einander stark beeinflussen. Nehmen wir die germanischen und romanischen Sprachen. Vor allem im Wortschatz, aber auch in der Grammatik standen die germanischen Sprachen jahrhundertelang unter dem Einfluss des benachbarten Französischen (und des prestigeträchtigen Lateins, der Mutter der romanischen Sprachen). Andersherum wurden die Aussprache, der Wortschatz und die Grammatik des Französischen vom Germanischen beeinflusst: Zunächst weil die germanischen Franken im Nordfrankreich des frühen Mittelalters das Sagen hatten, später durch die Kontakte mit den benachbarten deutschen, niederländischen und englischen Sprachgebieten. Die anderen romanischen Sprachen hatten viel weniger Kontakt mit den germanischen Sprachen. Französisch wurde darum ein Außenseiter in der romanischen Familie.
Diese gegenseitige Beeinflussung wird an Intensität, Verworrenheit und dauerhaftem Einfluss von dem noch in den Schatten gestellt, was auf dem Balkan passiert ist. Diese Region im tiefen Südosten Europas beherbergt ein Kuddelmuddel an Sprachen – Albanisch, Bulgarisch, Griechisch, Mazedonisch, Rumänisch, Romanes, Serbokroatisch, Türkisch – mit der gemeinsamen Eigenschaft, dass sie alle nicht mehr mit ihrer eigenen Familie unter einem Dach wohnen. Albanisch und Griechisch haben gar keine lebenden Verwandten mehr. Rumänisch befindet sich hunderte von Kilometern von seinem nächsten romanischen Cousin entfernt, dem Italienischen. Romanes, eine indische Sprache, ist sogar tausende Kilometer weit weg von seinen südasiatischen Verwandten, während auch die meisten Geschwister des Türkischen sich ein gutes Stück weiter östlich aufhalten. Die slawischen Balkansprachen schließlich (Bulgarisch, Mazedonisch und Serbokroatisch) bilden zusammen mit Slowenisch zwar eine zusammenhängende Gruppe, sie alle leben jedoch vom Großteil ihrer Familie isoliert, darunter Russisch, Ukrainisch und Polnisch. Der Balkan ist also so etwas wie ein linguistisches Waisenhaus.
Türkisch ist ein wenig introvertiert. Im Umgang mit den anderen Sprachwaisen hat es nicht viel mehr getan, als Wörter zu entlehnen und vor allem zu verleihen. Die anderen sieben haben einander tiefgreifender beeinflusst. Das ist kein Wunder, denn sie hatten lange Zeit kein eigenes Zimmer, sondern haben gemeinsam dieselben Räumlichkeiten bewohnt. Sie sind über Jahrhunderte miteinander umhergezogen, haben untereinander geheiratet, Handel getrieben, sich gemeinsam niedergelassen, Kriege geführt – als Feinde oder als Verbündete – und sich gegenseitig in der Religion beeinflusst. Sogar jetzt noch, im 21. Jahrhundert, strotzt der Balkan vor Minderheiten. Es gibt Serbisch sprechende Enklaven in albanischen Gebieten, mazedonische und rumänische Sprachinseln in griechischen Regionen und so weiter. In der Vergangenheit war die Bevölkerung noch gemischter, und viele beherrschten mindestens zwei Sprachen – nicht unbedingt perfekt, aber ausreichend, um miteinander kommunizieren zu können.
Durch diese ganze Mehrsprachigkeit konnte es passieren, dass Sprachen, die anfänglich so unterschiedlich waren wie Tag und Nacht, sich immer mehr ähnelten. Dies gilt insbesondere für Rumänisch, Albanisch, Mazedonisch und Bulgarisch. Sie haben heute so viele Gemeinsamkeiten, dass sie für Verwandte gehalten werden könnten (Mazedonisch und Bulgarisch sind es auch, die anderen beiden nicht). Auch Serbokroatisch, Griechisch und Romanes haben inzwischen einiges mit diesen vieren gemeinsam. Zusammen bilden sie den sogenannten Balkansprachbund.
Was sind ihre Gemeinsamkeiten? – Artikel zum Beispiel. Die meisten Mitglieder des Balkansprachbunds setzen den bestimmten Artikel (›der‹, ›die‹, ›das‹) nicht wie wir vor das Substantiv, sondern dahinter. ›Hund‹ ist câine auf Rumänisch, ›der Hund‹ ist câinele. Auf Bulgarisch sagt man kutsche und kutscheto, auf Albanisch qen und qeni. Die angehängten Buchstaben haben also die Funktion des Artikels. Das ist bemerkenswert, da die nächsten Angehörigen dieser Sprachen (wie Italienisch und Slowenisch) dies nicht so tun. Wie die Sprachwissenschaftler Joachim Matzinger und Stefan Schumacher (die Herren aus Kapitel 56) vor einigen Jahren herausgefunden haben, liegt der Ursprung dieser besonderen Gewohnheit wahrscheinlich im Albanischen.
Auch typisch ›balkanesisch‹ ist der Hang, den Infinitiv möglichst selten anzuwenden oder ihn ganz verschwinden zu lassen. Der Infinitiv wird in den meisten europäischen Sprachen oft in Sätzen wie »Sie spielt, um zu gewinnen« oder »Da kann ich einpacken« eingesetzt. Das Rumänische und die meisten anderen Balkansprachen verwenden in dieser Art von Mitteilungen lieber eine gebeugte Verbform. Das ergibt Sätze, die wörtlich in etwa mit »Sie spielt, damit sie gewinnt« und »Es kann, dass ich einpacke« übersetzt werden können. Auch dies kommt bei verwandten Sprachen außerhalb des Balkans nicht vor.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.