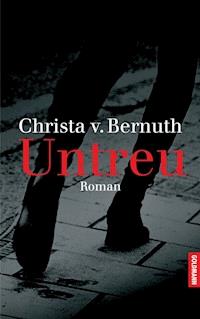6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Mordfall. Drei Tote. Eine unfassbare Wahrheit.
Ein grausames Verbrechen erschüttert die Stadt am See: Die angesehene Familie Rheinfeld wird nachts in ihrem Haus regelrecht hingerichtet. Der Verdacht fällt auf den heranwachsenden Sohn Leon, der erst seine Eltern und dann sich selbst getötet haben soll. Er war psychisch krank und – zur Verzweiflung seiner machtlosen Eltern – fasziniert von Waffen. Doch dann stellt sich heraus, dass Leons enger Freund Ben in den Fall verstrickt zu sein scheint: die ermittelnden Polizisten entdecken auf seinem Handy ein Video der drei Leichen. Stimmt seine Aussage, dass er einen Amoklauf verhindern wollte, den Leon geplant hatte? Oder handelt es sich gar um einen Auftragsmord? Je tiefer die Ermittler graben, desto unglaublichere Erkenntnisse bringen sie ans Licht. Bis sie auf Spur 33 stoßen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Ein grausames Verbrechen erschüttert die Stadt am See: Die angesehene Familie Rheinfeld wird nachts in ihrem Haus regelrecht hingerichtet. Der Verdacht fällt auf den heranwachsenden Sohn Leon, der erst seine Eltern und dann sich selbst getötet haben soll. Er war psychisch krank und – zur Verzweiflung seiner machtlosen Eltern – fasziniert von Waffen. Doch dann stellt sich heraus, dass Leons enger Freund Ben in den Fall verstrickt zu sein scheint: Die ermittelnden Polizisten entdecken auf seinem Handy ein Video der drei Leichen. Stimmt seine Aussage, dass er einen Amoklauf verhindern wollte, den Leon geplant hatte? Oder handelt es sich gar um einen Auftragsmord? Je tiefer die Ermittler graben, desto unglaublichere Erkenntnisse bringen sie ans Licht. Bis sie auf Spur 33 stoßen …
Autorin
Christa von Bernuth ist Schriftstellerin und Journalistin. Ihre Romane »Die Stimmen«, »Untreu«, »Damals warst du still« und »Innere Sicherheit« wurden mit Mariele Millowitsch und Hannah Herzsprung in den jeweiligen Hauptrollen verfilmt und in mehrere Sprachen übersetzt. Mit »Tief in der Erde« hat sie erstmals einen Kriminalroman veröffentlicht, der von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde. Auch ihr neuer Roman »Spur 33« basiert auf einem wahren Fall. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in München.
Christa von Bernuth
Spur 33
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe September 2022
Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Gestaltung des Umschlags: © UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Trevillion Images/Nic Skerten, Silas Manhood, Yolande de Kort
Redaktion: Regina Carstensen
BH · Herstellung: ast
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-29562-2V002www.goldmann-verlag.de
»Spur 33« orientiert sich zwar an einem tatsächlichen Kriminalfall, ist aber bewusst kein erzählendes Sachbuch, sondern ein Werk der Fantasie, ein Roman.
Die in diesem Roman geschilderten Handlungen sind deshalb keinesfalls als Schilderungen tatsächlicher Ereignisse zu verstehen. Zahlreiche Personen und Handlungsstränge sind frei erfunden. Auch bei Personen mit scheinbaren Anklängen an die Realität sind deren biographische Details, Verhaltensweisen und subjektive Erwägungen sämtlich verfremdet, fiktionalisiert oder gänzlich erfunden.
Auch scheinbar realistische und detaillierte Erzählungen von Geschehnissen und Schilderungen intimer und intimster Details haben sich in der Realität so nicht abgespielt. Sie dienen wie auch alle Dialoge und Textnachrichten einzig und allein dem Zweck, Abläufe und mögliche Motive eines Kriminalfalls in romanhafter Schilderung zuzuspitzen und zu akzentuieren.
Auch wenn dieser Roman hinsichtlich des geschilderten Tathergangs zu gewissen Bewertungen und Schlussfolgerungen kommt, bedeutet dies nicht, dass sich die geschilderte Tat in der Realität so oder so ähnlich abgespielt hat. In Romanen gibt es keine Unschuldsvermutung – in der Wirklichkeit gilt diese aber absolut.
Das Haus stand zwischen zwei Straßen, die in spitzem Winkel aufeinander zuliefen. Mit der vergilbten Rauputz-Fassade und der Mütze aus dunkel gebeiztem Holz passte es nicht zu seinen Nachbarn – quaderförmige, verglaste Villen und romantisch eingewachsene Jugendstil-Anwesen. Ein Fremdkörper. Ein Mauerblümchen, umringt von Ballköniginnen.
Aber das war eigentlich vollkommen egal. In ein paar Jahren würde trotzdem jemand das Flurstück kaufen, alles bis auf die Grundmauern abreißen, und die beiden finsteren Tannen gleich mit, die es einrahmten wie zwei stumme Wächter. Ein Bauträger würde ein schickes Mehrfamilienhaus hinstellen oder einen hochmodernen Dreispänner. Schimmernde Holzdielen, Bäder mit Sauna und Jacuzzi, riesige Küchen in Weiß und Taupe. Maximale Raumausnutzung, optimale Rendite. Schlüsselfertig.
Ein Grundstück in dieser Lage verlor nicht an Wert. Man musste einfach nur geduldig sein. Warten, bis das Vergessen einsetzen würde.
1
Samstag, 12. Januar
Mam
Hey, Mam! Kann dich nicht erreichen, rufst du mal zurück? Ihr seid doch zurück aus Sirmione? Oder bist du noch mal hingefahren? Melde dich, Kuss, Steff
11:26
»Hallo Mam. Puh, ich sprech dir jetzt auf den AB, weil … Ich weiß auch nicht, dein Handy ist aus, und du bist seit gestern nicht mehr online … Keiner von euch ist online, macht ihr alle Digital Detox? Ich wollte jedenfalls, ich wollte einfach nur mal hören … Bitte ruf doch mal zurück!«
»Ich noch mal, ich will nicht nerven, aber du hast den Brunch bei Lydia vergessen, und dabei hast du gestern zugesagt, oder? Lydia meint, sie hat extra wegen dir Wildlachs gekauft, und du bist nicht gekommen und hast nicht mal abgesagt, und sie war wirklich … also wirklich traurig, weil sie hat sich auf dich gefreut, und sie versteht, dass es dir nicht gut geht, weil Hannes gestorben ist, und vielleicht willst du dich gerade zurückziehen deswegen, aber wenn du nicht reden magst, dann schreib doch wenigstens ganz kurz oder hinterlass eine Sprachnachricht … An mich oder Lydia. Oder du, Markus, äh, Papa. Kurze Nachricht reicht, ich will einfach nur wissen … Okay? Danke, Bussi!«
Leon
Leon, Schatz, rufst du mal zurück, oder schreib pls … Kein Netz, oder was? Ciao
13:29
Markus
Hallo, ihr Lieben! Meldet ihr euch mal? Sagst du Mam Bescheid, dass sie kurz anrufen soll? Danke, liebe Grüße, Steffi
14:48
*
Kälte. Ein Eisklotz tief drinnen, der nicht schmelzen wollte. Heiße, trockene Luft kam aus dem Fußraum, das Gesicht spannte wie verrückt, aber der Körper weigerte sich, die Wärme aufzunehmen. Stattdessen zog sich die Haut zusammen, wurde eng wie ein eingelaufenes Kleidungsstück.
Dazu das Chaos im Kopf, ein endloser Strom aus Satzfetzen und Bildern, einzelne blitzten auf wie silbrige Fische, die aus dem Wasser sprangen und wieder abtauchten – ich hab ihn wieder Markus genannt, er wird sauer sein deswegen, vielleicht ruft er deswegen nicht an, es wird nichts sein, es KANN nichts sein, Leon hat eine gute Phase …
Mal ehrlich, hatte Leon je eine gute Phase?
Das Hasenkind mit den ausgerissenen Öhrchen. Sie hatte es nie gesehen, aber es reichte, davon erfahren zu haben.
Denk nicht dran!
Aber natürlich dachte sie genau jetzt genau daran. Jo wusste nichts davon, und sowieso nicht alles von den Sachen, die in der Vergangenheit vorgefallen waren, unglaubliche Dinge, die man in der Krassheit niemandem zumuten konnte, und schon gar nicht seinem eigenen Mann, mit dem man einmal Kinder haben wollte. Gesunde Kinder, keine wie Leon.
Jo fuhr in den Luise-Kiesselbach-Tunnel, Lichter tanzten über dem Glasdach, die Steffis Augen wehtaten, bis sie wieder auftauchten in den Nebel über der A95. Januar war der Monat, den sie am meisten hasste. Der Frühling war weit weg, der Winter noch nicht einmal richtig auf Touren gekommen, und Sonne gab es nur in den Bergen ab tausend Meter aufwärts. Sie sah zur Seite, während Jo beschleunigte. 100, 120, 140. Vorbeiziehende Bäume im Restlicht des vergehenden Tages, Reif umhüllte jeden Ast, jeden Grashalm, jede Fichtennadel wie eine zarte, fragile Rüstung, lauter diamantenbesetzte Festgewänder, schimmernd in der Dämmerung.
»Schön«, sagte Steffi.
»Bitte?«, fragte Jo. Er schaute konzentriert auf die Straße.
»Inversionslage«, sagte Steffi.
»Mhm.«
»Die warme Luft liegt über der kalten, und es findet kein Austausch statt, der Nebel friert zu winzigen Eiskristallen, und dann …«
»Ich weiß, was Inversionslage …«
»Die Bäume sind wie mit Zucker bestreut. Das ist so schön, oder? Wie im Märchenland, wie in diesem Film, weißt du noch, wie hieß der gleich wieder? Ach ja, Der Eissturm, aber gut, da ging es um Eisregen …«
»Schatz …«
»… den wir hier gar nicht so kennen, also das war was anderes.«
»Hey, Steff! Entspann dich!«
»Ja, schon gut. Alles gut.«
Wenn sie Angst hatte, geriet sie ins Plappern, und dann konnte sie nicht mehr aufhören. Sie wusste das, sie wusste auch, dass es nervte, aber es half nichts, es sprudelte dann aus ihr heraus, komisches Zeug, das sie ein paar Sekunden später wieder vergessen hatte.
»Keine Hektik«, sagte Jo, der gut reden hatte; es war fast übernatürlich, geradezu beängstigend, wie er sich nie aus der Ruhe bringen ließ. Aber andererseits liebte sie ja genau das an ihm, auch wenn sie es manchmal hasste. Dass ihn nichts zu erschüttern schien. Sie betrachtete seine Hand mit dem Ehering, die auf der Schaltung ruhte, während er den Blinker bediente, einen Mercedes überholte und wieder auf die Mittelspur einschwenkte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er.
Sie antwortete nicht. Natürlich machte sie sich Sorgen, das Sorgenmachen gehörte zu ihrem Leben, eine alte und nach Lage der Dinge sehr verständliche Gewohnheit, die sich nicht abstellen ließ. Da es gerade nichts anderes zu tun gab, rief sie noch mal alle drei Nummern an, es sprangen auch diesmal nur die jeweiligen Mailboxen an und auf dem Festnetz der AB mit der Stimme ihrer Mam. Hallo, ihr Lieben, hier ist die schrecklich nette Familie Rheinfeld, wir sind beim Schwimmen, beim Arbeiten oder sonst wo unterwegs, hinterlasst gern eine Nachricht …
Später sollte sich dieser Moment bei ihr einbrennen, Mams heitere Stimme mit dem abgründigen Unterton, eine Mischung aus echter Fröhlichkeit, Nervosität und angestrengtem Optimismus. Sie würde davon träumen, weil sie genau jetzt wusste, dass etwas passiert war. Also wirklich etwas passiert war. Etwas, das nie wieder rückgängig zu machen sein würde, etwas, das sie aus der Bahn schleudern würde in ein finsteres, brodelndes Nichts.
Und plötzlich fühlte sie sich ein paar Sekunden lang ganz ruhig. Alles fiel von ihr ab, ein Impuls der Erleichterung, weil sie doch ohnehin nichts tun konnte, oder? Gar nichts. Sie war nicht verantwortlich für irgendwas. Fast wäre sie eingenickt, aber dann waren sie schon da. Fuhren von der Autobahn ab, direkt in das Städtchen hinein, vorbei an der Shell-Tankstelle auf der linken und der Esso-Tankstelle auf der rechten Seite und ein paar Straßen weiter die Anhöhe hoch. Der Nebel war nun dicht, fast opak, die Straßenlaternen – diffuse Lichtinseln, geheimnisvolle Aureolen – erleuchteten nur noch sich selbst.
Jo parkte vor dem Haus. Es war dunkel und still.
»Da ist Lydias Wagen«, sagte Steffi.
Sie stiegen aus in die feuchte, klamme Kälte.
Lydia kam rasch auf sie zu, klappernde Absätze, rot geschminkte Lippen, ein voluminöser Mantel aus schneeweißem Teddystoff – typisch Lydia eben. Die beiden Frauen umarmten sich kurz, Lydia und Jo gaben sich Küsschen links und rechts. Ein paar Sekunden lang schien alles so wie immer zu sein; man traf sich bei Mam und Markus zum Pastaessen, wusste nie genau, wie dieser Abend verlaufen würde, ob die Stimmung ganz cool, sogar lustig sein würde, oder ob sich Markus über Leon aufregen würde, weil er nicht zum Essen kommen wollte, oder ob sich Mam und Markus in die Haare kriegten, weil Mam Leon zu viel durchgehen ließ. Oder alles zusammen.
Ganz normal eben.
Aber es war nichts normal, diese Erkenntnis sickerte bei allen ein, sie sah es Jo und Lydia an, dass sie dasselbe dachten: Etwas war nicht in Ordnung, ganz und gar schief und krumm. Steffi hätte fast aufgelacht über diese idiotische Formulierung, die durch ihren schmerzenden Kopf rauschte, dabei gab es nichts zu lachen, nichts, eine völlig unpassende Reaktion wäre das gewesen.
Stopp!
In ihren Ohren rauschte und klingelte es; sie versuchte flach zu atmen, nicht zu keuchen. In ihrer Manteltasche kramte sie nach dem Blister mit den Migränetabletten.
»Alles okay?«, fragte Lydia.
Sie stand direkt vor Steffi und hielt sie an den Oberarmen fest, ihre kajalumrandeten Augen wirkten sehr groß und ihr roter Mund fast schwarz. Steffi entwand sich ihren Händen; sie konnte jetzt keine Berührung ertragen.
»Alles gut«, sagte sie, und Lydia nickte gedankenvoll, als würde sie ihr nicht glauben (natürlich glaubte sie ihr nicht), aber sie ließ sie trotzdem los und trat einen Schritt zurück.
Lydia war Leons Patentante und Mams engste Freundin, sie wusste Bescheid über alles, was hier in den letzten beiden Jahrzehnten abgegangen war, und das machte Steffi gerade etwas aus, eine Menge sogar, so viel, dass sie sie am liebsten heimgeschickt hätte. Aber das ging nun wirklich nicht; immerhin war Lydia extra aus Garmisch gekommen, um mit ihr zusammen nach dem Rechten zu sehen.
»Du bist ziemlich blass, Süße«, sagte Lydia.
Steffi reagierte nicht darauf. »Hast du geklingelt?«, fragte sie.
»Nein, ich … Ich hab auf euch gewartet.«
Lydia hätte nicht klingeln müssen. Sie hatte ihren eigenen Türcode, sie hätte einfach reinspazieren können. Aber das war Steffis Aufgabe, schien Lydia mit ihrer Antwort gemeint zu haben, sie musste sich dem stellen.
Allein. Das war ihr Job.
Markus’ schwarzer BMW und Mams knallroter Alfa Spider standen beide auf dem Parkplatz innerhalb des Grundstücks, und das Haus wirkte trotzdem leer. Kein einziges erleuchtetes Fenster, auch nicht im Esszimmer oder im Wintergarten, vor dem sich das buschige, winterharte Pampasgras zu wiegen schien, obwohl es völlig windstill war.
»Ich kann das machen«, sagte Jo, fürsorglich wie immer. Er fasste nach Steffis Hand und drückte sie durch den Handschuh.
»Nein«, sagte Steffi unfreundlich, fast brüsk.
Sie drückte auf die Klingel. Sie schloss die Augen, als sie das vertraute melodische Ding-Dong hörte, das durchs ganze Haus zu hallen schien. Sie wartete. Keine Schritte, keine Stimmen, niemand machte das Licht an. Dann: lautes Bellen und Jaulen, Kratzen an der Tür.
»Bodi!«
Hastig langte sie über das schmiedeeiserne Gartentürchen und drückte die Klinke herunter. Es waren nur ein paar Schritte, vier Treppenstufen bis zur Haustür. Die automatische Beleuchtung an der Hauswand flammte auf, spiegelte sich in den abgerundeten Quadern aus dickem, bronzefarbenem Glas zwischen schwarzen Holzstreben; wie riesige Lupen sahen die Dinger aus, weshalb auch alle Besucher fasziniert von dieser Tür waren. Original aus den Sixties, sagte Markus dann jedes Mal mit stolzem Grinsen, und dass sein Vater sie damals in Auftrag gegeben habe, weil er genau so eine Tür in Swinging London gesehen habe. Eine Geschichte, die er in Steffis Anwesenheit so oft zum Besten gegeben hatte.
Im Ernst? Wie cool ist das denn!
Ja, mein alter Herr war ein geborener Designer.
Steffi gab ihren Code in die Schalttafel im Holzrahmen ein, und die Tür öffnete sich folgsam mit einem metallischen Knacken nach innen, aber sie ließ sich nicht richtig aufstoßen. Der Hund, es war der Hund, der sie halb versperrte, sie hörte sein Winseln und Jammern, konnte ihn aber nicht sehen.
»Bodi!« Sie drängte sich hinein, merkte kaum, dass Lydia und Jo plötzlich direkt hinter ihr waren, irgendwas riefen, vielleicht versuchten, sie zurückzuhalten. Sie machte sich los, weinend. Jo griff über sie hinweg und schaltete das Flurlicht ein.
Bodi lag neben der Tür auf der Seite. Er hob den Kopf und ließ ihn kraftlos wieder sinken.
Blut. Die ganze rechte Seite war blutverklebt.
»Bodi! Armer, armer Bodi!« Steffi kniete sich hin, wiegte ihn in den Armen, streichelte seinen Kopf. Stand dann wieder auf, mit blutverschmierter Daunenjacke. Bodi folgte ihr hinkend, lief schließlich an ihr vorbei die Holztreppe hoch.
Es roch anders als sonst. Dumpf und rostig. Nach Blut und Hundekot und vollem Mülleimer.
Zu dritt gingen sie vorsichtig, wie auf Zehenspitzen ins Esszimmer. Blutflecken auf dem Stäbchenparkett. Einige Patronenhülsen lagen herum.
»O mein Gott«, flüsterte Lydia.
Der Geruch verstärkte sich, und Steffi wurde schwindlig und schließlich übel. Das Brausen in ihren Ohren nahm apokalyptische Ausmaße an. Sie bekam noch mit, dass Jo sie eilig rausführte, dann ganz vorsichtig über die Steinstufen nach unten, und dass die frische, eisige Luft sie traf wie eine Ohrfeige. Sie fiel auf die Knie und übergab sich in den Vorgarten zwischen die zurückgeschnittenen Rosenbüsche.
Sie hob den Kopf und hörte Lydia schreien – »O nein, o nein!« – und dann ein Trommeln und Rumpeln, als wenn jemand auf High Heels die Treppe im Haus herunterstolperte und dabei hinfiel. O nein, o nein, dachte Steffi, immer wieder, Oneinonein, so lange, bis es nach nichts mehr klang, eine inhaltsleere, willkürliche Tonfolge. Sie wollte nach Lydia rufen, aber es kam nur ein unverständliches Krächzen heraus. Neben ihr sagte jemand: »Ich bring dich in den Wagen«, und sie vermutete, dass das Jo war, aber ihre Reaktionen hatten sich derart verlangsamt, dass sie nicht einmal den Kopf schütteln konnte.
Sie war so müde plötzlich. Der Boden war gefroren und hart, sie spürte jeden einzelnen Stein, aber sie schaffte es nicht, sich aufzurichten. Sie machte die Augen zu. Manchmal half nur das. Nicht hinschauen, nicht hinhören, nicht hineinfühlen. Sie lag wieder auf ihrem Bett, ein Teenager mit dicken blonden Haaren, eine glatte Mähne, um die sie alle ihre Freundinnen beneideten, und hörte »Toxic«. A guy like you should wear a warning / it’s dangerous, I’m falling. Und durch den Kopfhörer hindurch das Schreien von Leon, das Gebrüll von Markus, das Scheppern irgendwelcher Gegenstände.
Dann war alles für ein paar gnädige Sekunden lang pechschwarz. Eine Dunkelheit, die sie erleichtert umarmte, wie eine lang vermisste Schwester.
*
Wenn KK Stettner von seinem Schreibtisch aus den Kopf nach rechts wandte, konnte er rausschauen auf die belebte Straße vor der Dienststelle. Manchmal war das ganz schön. Die dreifach verglasten Fenster schluckten jedes Verkehrsgeräusch, und dann kam es einem vor, als würden die Autos stumm dahinschleichen, eine endlose Parade aus silbernen, weißen, dunkelblauen und nachtschwarzen Playmobilen, die irgendwer irgendwohin steuerte. Stettner kam manchmal auf so merkwürdige Gedanken, zum Beispiel eben, dass sie sich alle nur einbildeten zu existieren und in Wirklichkeit bloß Spielzeug in den Händen eines dicken Kindes waren.
Heute war nicht viel los, draußen nicht und drinnen auch nicht. Ein derart ereignisloser Tag, dass Stettner und PK Obermeier unabhängig voneinander darüber nachdachten, ob schon Zeit für ein Feierabendbier sein könnte. Es war Samstag, ihr Dienst würde in gut zehn Minuten vorbei sein, sie wohnten beide fußläufig vom Revier entfernt, es sprach also nichts dagegen.
Das penetrante Summen der Telefonanlage beendete diese Idee. Hätte Stettner auch nur die leiseste Vorstellung von dem Rattenschwanz an Konsequenzen gehabt, hätte er vielleicht einfach nicht abgehoben. Obermeier war auf der Toilette, es wäre also möglich gewesen, den ganzen verdammten Mist dem Nachtdienst zu überlassen, der in ein paar Minuten eintreffen würde. Aber so war Stettner nicht, Pflichtbewusstsein lautete sein zweiter Vorname, außerdem kam Obermeier nach dem dritten Läuten wieder ins Büro.
Also musste man wohl davon ausgehen, dass Gott – KK Stettner war sehr gläubig und ein eifriger Kirchgänger – all das, was jetzt passieren würde, genauso gewollt hatte. Gott hatte gewollt, dass Stettner neben vier weiteren Kollegen derjenige sein sollte, der Monate später mit allen Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden würde, während seine Ehe den Bach runterging und seine Familie zerbrach, weil sich seine Frau in seinen besten Freund Heiner verlieben würde.
Heiner besaß einen gut laufenden Gärtnereibetrieb, der sich auf exotische Pflanzen spezialisiert hatte. Sein Gewächshaus war stets angenehm tropisch temperiert und eine lichte Oase der Ruhe und Schönheit. Er musste sich nicht mit Drogendealern und ihrer Kundschaft abgeben, den bekifften und zugekoksten Schülern mit zu viel Taschengeld, deren Eltern Krach schlugen, sobald man ihre verwöhnte Brut ein wenig härter rannahm. Er musste keine Autofahrer maßregeln, die die neue Tempo-30-Regel als unzulässige Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit empfanden und diese Auffassung gern und lautstark kundtaten, weil Reichtum Menschen automatisch zu Arschlöchern machte.
Er musste sich überhaupt nicht mit dem Dreck unter den Schuhen der Gesellschaft befassen, mit dem Gefühl, zu oft erst dann vor Ort zu sein, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen war. Da Stettner privat nie über diesen Scheiß redete, wusste Heiner wahrscheinlich nicht einmal, dass es solche Leute gab, solche Dinge passierten, und zwar genau hier, in dieser netten, sauberen, reichen Stadt, ganz in der Nähe vom Irish Pub, in dem sie sich einmal wöchentlich zu viert trafen, um zu trinken und ein paar Runden Darts zu spielen.
Gott wollte ihn nicht nur prüfen, würde Stettner Monate später oft denken – meistens dann, wenn er im Stuhlkreis wieder mal über seine Ängste sprechen sollte, was er nicht ausstehen konnte (was brachte es, etwas herzureden, das man loswerden wollte) –, Gott wollte ihm auf einigermaßen drastische Weise klarmachen, dass er den falschen Beruf gewählt hatte. Das hätte Ihm andererseits auch zwei Jahrzehnte früher einfallen können, und auf die Frage nach einer Alternative schien der Allwissende ebenfalls keine Antwort parat zu haben. Gärtner kam jedenfalls nicht in Frage. Selbst anspruchslosesten Zimmerpflanzen reichte Stettners pure Gegenwart, um kollektiven Selbstmord zu begehen.
Aber noch war nichts davon passiert. Noch war Stettner verheiratet, nicht immer glücklich, aber doch so weit ganz zufrieden, noch kannte er das Wort »Depression« nur aus dem Fernsehen, und so drückte er ahnungslos auf die blinkende Taste, die den externen Anruf einer unbekannten Handynummer anzeigte. Er nahm den Hörer in die Hand und meldete sich mit seinem Namen und seiner Dienststelle. Eine Männerstimme murmelte ihm etwas ins Ohr. Er verstand erst gar nichts, dann: »Es ist was passiert, was ganz Schlimmes passiert.«
»Etwas Schlimmes?«, fragte Stettner, winkte Obermeier heran und stellte auf laut.
»Ja. Ja!«
»Was denn?«
Keine Antwort, nur hastiges Atmen.
»Wie ist denn Ihr Name?«, erkundigte sich Stettner.
Obermeier kam zu seinem Schreibtisch. Sie wechselten einen Blick. Ein Verrückter?
»Jo«, sagte der Mann schließlich. »Johannes«, präzisierte er.
»Johannes, und weiter?«
»Kellermann!« Das kam raus wie ein Geschoss.
»Herr Kellermann, immer mit der Ruhe«, sagte Stettner. »Wo sind Sie gerade?«
»Rosen … Rosenstraße 122. Bitte kommen Sie schnell.«
Es klickte.
»Der hat aufgelegt«, sagte Obermeier erstaunt.
»Wir fahren hin«, sagte Stettner. Was beinhaltete, den geplanten Kinobesuch um sieben mit seiner Frau abzusagen, die wiederum dem Babysitter absagen musste.
Und damit nahm alles seinen Lauf.
Stettner fuhr mit PK Obermeier zur angegebenen Adresse. Die Rosenstraße war sehr lang und mündete in einen unbefestigten Waldweg, der um einen Golfplatz mit abartig hohen Mitgliedsbeiträgen herumführte. Das wusste Stettner, weil in dem hauseigenen Restaurant vor einem Jahr eingebrochen worden war und es jede Menge Scherereien mit den Betreibern gegeben hatte, obwohl der Schaden vergleichsweise gering gewesen war. Während der Fahrt rutschte Jungspund Obermeier hibbelig wie ein Kind auf dem Beifahrersitz hin und her.
Er fragte: »Sollten wir nicht das Martinshorn anstellen?«
»Ach was«, sagte Stettner.
»Aber …«
»Wir sind gleich da. Ich überlass dir gern den Vortritt.«
Schließlich war es dann doch Stettner, der alles in die Hand nahm. Zu seinem eigenen Schaden.
Vor dem Gartentor des V-förmigen Grundstücks befanden sich drei Personen, zwei Frauen und vermutlich der Mann, der ihn angerufen hatte. Die Haustür stand offen, Licht fiel auf die Straße. Die Frauen lagen sich in den Armen, schienen sich regelrecht aneinanderzuklammern. Der Mann stand ein Stück abseits an der Gartentür. Stettner parkte quer auf der Straße und ließ das Blaulicht an. Er ging mit Obermeier auf das Grüppchen zu, mit jedem Schritt wurde ihm ein wenig schwerer ums Herz. Kein Spinner, so viel stand fest.
»Hast du deine Bodycam?«, fragte er Obermeier mit gedämpfter Stimme.
»Ja!«
»Gut. Wir schalten sie ein, sobald wir mit den Zeugen gesprochen haben.«
»Geht klar«, flüsterte Obermeier.
Die eine Frau löste sich von der anderen und schob sie zu dem Mann, der sie auffing und behutsam zu einem silberfarbenen Citroën führte. Er öffnete die Beifahrertür und half ihr hinein. Die Innenbeleuchtung flammte auf, und Stettner sah dunkle Flecken auf ihrer Daunenjacke.
Der Mann kam zurück und stellte sich neben die Frau im Teddymantel. Stettner schätzte ihn auf Mitte dreißig. Die Frau war älter als er, etwa fünfzig, und sah einigermaßen derangiert aus. Blass, verschmierter Lippenstift, Wimperntusche, die sich unter den Augen abgesetzt hatte.
Stettner stellte sich und Obermeier vor und sagte: »Sie haben mich angerufen? Johannes Kellermann?«
Der Mann nickte. Er war schlank und blond, trug einen weich fallenden grauen Mantel, darunter einen naturfarbenen Rollkragenpullover, ausgewaschene Jeans und dicke Wanderschuhe. Alles wirkte auf undefinierbare Weise teuer, genauso wie der lässige Haarschnitt mit angedeutetem Undercut.
»Was ist passiert?«, fragte Stettner.
Keiner der beiden antwortete.
»Herr Kellermann?«
»Ich weiß nicht«, sagte der Mann. Sein Blick war vollkommen leer, er starrte an Stettner vorbei zu seinem Auto.
»Ist das Ihr Haus?«, fragte Stettner.
Hinter ihm trat Obermeier unruhig von einem Fuß auf den anderen.
»Ich war drin«, schaltete sich die Frau ein. »Also auch oben.« Sie nickte ein paarmal bekräftigend, als müsste sie sich selbst davon überzeugen, dass es wirklich so gewesen war, dass sie sich nichts ausdachte, dann begann sie zu schluchzen. Der Mann legte mechanisch den Arm um sie.
»Ich war drin«, wiederholte die Frau. Sie schauderte und sah Stettner direkt an. Ihr Gesicht spiegelte das Grauen, dem sie ausgesetzt gewesen sein musste, und Stettner wurde kalt.
»Was haben Sie gesehen?«, fragte er. Er ignorierte das Einsatzprotokoll, demzufolge sie erst die Personalien abzufragen hatten, bevor irgendwas anderes passierte.
»Da oben liegt ein Toter.« Die Frau nickte wieder, holte ein zerknülltes Tempo aus ihrer Handtasche und tupfte sich damit das Gesicht ab, als wollte sie es pudern.
»Ein Toter? Sind Sie sicher?« Stettner berührte den Druckknopf seines Halfters.
»Da ist ganz viel Blut an seinem Kopf. Ich weiß nicht, wer das war, ob das Markus war, ich bin gleich wieder runter.«
»Wer ist Markus?«
»Ich weiß nicht mal, ob er’s war.« Schluchzen, bebende Schultern. »Er … Man erkennt ihn gar nicht mehr.«
»Wohnt Markus da?«
»Ja.«
»Allein?«
»Sein Sohn Leon und … und …« Sie wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen.
»Und wer noch?«, hakte Stettner behutsam nach.
»Barbara, Markus’ Frau. Babsi ist meine beste Freundin. Ich bin … Ich konnte das nicht aushalten und bin wieder runter. Ich weiß nicht, ob sie …«
»Das war richtig«, sagte Stettner. »Vollkommen richtig«, betonte er. Aus dem Augenwinkel sah er, dass Passanten – jemand mit Hund, ein junges Paar und noch ein paar Leute – stehen blieben, guckten, tuschelten. Einer zog sein Handy raus. »Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Jemanden gehört?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Da war niemand.«
»In Ordnung. Wir gehen da jetzt rein. Sperr weiträumig ab«, sagte er zu Obermeier. »Und dann benachrichtigst du das Revier, dann den Notarzt und anschließend nimmst du die Personalien auf. Dann kommst du nach. Wir müssen schauen, ob Gefahr im Verzug ist.«
Obermeier nickte und eilte zum Wagen, um das Trassierband zu holen.
»Ich kann da nicht mehr hin«, flüsterte die Frau währenddessen und packte Stettner am Arm, krallte sich förmlich fest, Panik in den schwarz umrandeten, rot geweinten Augen. »Ich kann einfach nicht.«
»Sie bleiben hier stehen. Polizeikommissar Obermeier wird Ihnen gleich ein paar Fragen stellen, während ich ins Haus gehe. Schaffen Sie das?«
»Mir ist wahnsinnig kalt.«
»Nur ein paar Fragen.«
»Ich friere so.«
»Gleich kommt der Notarzt, der hat eine Decke für Sie.«
»Kann ich heimfahren? Bitte? Und morgen wiederkommen?«
»Das geht leider nicht.«
Stettner schaltete die Bodycam ein und ging die Treppe hoch durch die offene Haustür. Als er die Schwelle passierte, war es, als würde er die Realität verlassen und in eine Parallelwelt voller Gespenster eintreten. So würde er es viel später einer Therapeutin zu erklären versuchen, die ihm ermutigend lächelnd zunicken würde, was Stettner wahnsinnig nerven würde, weil er da schon mehrere Therapeuten durchhatte, die das alle machten. Nicken mit wissendem Gesicht, als ob sie nicht genauso ahnungslos wären wie er.
Stettner zog seine Waffe, rief: »Hier ist die Polizei. Bitte kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!« Aber da war niemand, er spürte es. Niemand, der lebte. Im Flur roch es unangenehm nach Kot und Müll. Links neben der Tür befand sich ein großer Blutfleck. Stettner rief Obermeier zu, er solle den Kriminaldauerdienst verständigen. »Und dann komm rein!« Obermeier antwortete von draußen irgendwas Zustimmendes.
Stettner ging weiter hinein. Der Flur kam ihm ewig lang vor. Der Geruch verstärkte sich. Links war ein großes Wohnzimmer mit einem angrenzenden Wintergarten. Rechts befanden sich eine Garderobennische und ein Gästebad. Geradeaus ein Esszimmer mit schweren, unmodernen Möbeln. Keine Bilder an den Wänden, alles wirkte so merkwürdig lieblos und zweckmäßig zusammengestellt, als hätte sich hier ewig keiner mehr über so etwas wie Inneneinrichtung Gedanken gemacht. Stettner öffnete die Tür zu einer nicht sehr sauberen Küche, deren Einbauten ebenfalls mindestens zwanzig Jahre alt waren. Auf dem Parkettboden im Esszimmer Blutflecke und Patronenhülsen. Es war totenstill bis auf die Geräusche von draußen.
»Verdammt«, sagte Obermeier hinter ihm. Er klang aufgeregt und eine Spur ängstlich.
»Was ist mit dem KDD?«, fragte Stettner.
»Sitzen in Fürstenfeldbruck, das dauert. Staudinger und Wagner sind gleich da.« KK Staudinger und KK Wagner waren für den Nachtdienst eingeteilt.
»Notarzt?«
»Kommt.«
»Gut.«
»Das Haus gehört Kellermanns Schwiegereltern. Seine Frau ist die im Auto. Das ist die Tochter.«
»Wir müssen hoch«, sagte Stettner. »Packst du das?«
»Klar.«
»Du weißt, was uns da vielleicht erwartet?«
»Kann’s mir denken.«
Auf der Treppe blutige Abdrücke von Tierpfoten, wahrscheinlich von einem größeren Hund. Labrador oder Golden Retriever.
»Scheiße, scheiße«, flüsterte Obermeier.
Stettner spürte seinen Atem im Nacken, der leicht nach Alkohol roch. Noch ein Trinker im Revier.
Der Flur machte hinten einen Knick nach rechts. Vorne gingen zwei Zimmer ab. Stettner öffnete die Tür des ersten und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Den Lichtschalter fasste er nicht an, das war Aufgabe der Spurensicherung. Im Strahl der Lampe sah er ein schmales Bett mit Patchwork-Überdecke, leuchtete auf verblichene Poster einer Popgruppe, die er nicht kannte, ein Regal mit Pferdebüchern und Harry-Potter-Romanen, einen kleinen weißen Schreibtisch und darüber ein Regalbrett mit alten Schulbüchern. Stettner öffnete den Kleiderschrank. Er war staubig und leer. Wahrscheinlich das Jugendzimmer der Frau im Citroën.
Er hörte Obermeier rufen und eilte nach draußen.
»Scheiße, scheiße«, sagte Obermeier. Seine Stimme zitterte. »Oberscheiße«, fügte er hinzu und deutete mit seiner Lampe auf das Bett des zweiten Zimmers. Stettners Funkgerät meldete sich, die Nachtdienstler waren da.
»Mutmaßlich 011, 048«, sagte Stettner.
»Okay. Wir kommen rein.«
Auf dem Bett lag ein junger, sehr schlanker Mann auf dem Rücken, leicht seitwärts gedreht. Der rechte Arm über dem linken, in der rechten Hand eine Waffe. Über seine rechte Gesichtshälfte lief eine breite Spur aus getrocknetem Blut. Sein Oberkörper war nackt und unverletzt.
»Schuss in die Schläfe«, murmelte Obermeier und ging wieder raus.
Stettner hatte schon viele schmutzige und chaotische Zimmer gesehen, aber niemals so ein wüstes Durcheinander. Auf dem Boden lagen gebrauchte Unterhosen, zerknüllte T-Shirts, leere Wodka-, Bier- und Weinflaschen, Waffenteile, Patronenhülsen und Munitionsschachteln, auf dem fleckigen weißen Einbauschreibtisch standen ein Crusher zum Zerkleinern von Marihuana-Dolden und eine rußverschmierte Bong aus Glas. An der Wand darüber war ein Sturmgewehr angebracht, vielleicht eine AK-47. In einer Vitrine neben dem Bett lagen weitere Waffen, darunter zwei Maschinenpistolen. Ob sie echt oder Deko-Objekte waren, konnte Stettner auf die Schnelle nicht beurteilen. Es stank nach Dreck und Tod. Stettner verließ den Raum und ließ die Tür offen.
»Da ist noch einer«, rief Obermeier von irgendwoher. Seine Stimme kiekste und brach.
»Wo bist du?«, rief Stettner. Er bog mit erhobener Waffe um die Ecke des L-förmigen Flurs und sah den blutüberströmten Körper eines Mannes zwischen dem Türrahmen zum mutmaßlichen Elternschlafzimmer. Aus seiner Schulter blinkte etwas. Stettner sah genauer hin; es war vermutlich das Ende einer Patrone. Von unten hörte man die Kollegen hereinkommen, jedenfalls nahm Stettner an, dass sie es waren. Er versuchte, ruhig zu atmen, das Ganze nicht zu nah an sich heranzulassen.
Im Doppelbett des mutmaßlichen Elternschlafzimmers lag eine weitere Tote. Mindestens eine Schusswunde im Kopf, so viel Stettner sehen konnte, denn sie war zugedeckt. Die Bettdecke hatte zwei Löcher in Brusthöhe, aus denen blutverschmierte Daunen quollen. Rechts neben ihr lagerte ein Golden Retriever und hielt Wache. Als sich Stettner der Leiche nähern wollte, richtete sich der Hund auf und begann zu knurren. Stettner zog sich zurück und entdeckte auf der anderen Seite des Betts Obermeier. Er saß auf dem braunen Teppich, kreidebleich, die Pistole lag nutzlos in seinem Schoß.
Stettner war erst sauer, dann ließ er sich neben Obermeier nieder.
»Dein erster Toter?«, fragte er.
Obermeier nickte.
»Der erste ist immer der Schlimmste«, sagte Stettner tröstend, obwohl ihm selbst miserabel zumute war.
»Du meinst, die ersten drei?« Obermeier probierte ein sarkastisches Lächeln, das misslang. Er sah aus, als würde er gleich losheulen.
Stettner legte ihm die Hand aufs Knie. »Kannst du aufstehen?«
»Mir ist sauschlecht.«
»Mir auch. Ist manchmal ein Scheißjob. Der Notarzt kommt gleich hoch.«
»Gewöhnt man sich irgendwann dran?«
Stettner überlegte, dann beschloss er, ehrlich zu sein. »Man packt es irgendwann weg.«
Er tätschelte noch einmal ungeschickt Obermeiers Bein, dann stand er ächzend auf.
»Das ist die Hölle hier«, sagte Obermeier kummervoll und stützte seinen Kopf in die Hände.
»Da hast du recht«, pflichtete ihm Stettner bei.
»Warum tun Leute sich so was an?«
»Keine Ahnung.«
Vor der Tür sah er den Schatten einer Frau mit langen Haaren. Es war die Notärztin, die hier nichts zu tun haben würde, außer den Tod von drei Menschen festzustellen. Und Obermeier wieder auf Betriebstemperatur zu bringen.
Stettner ging nach unten und traf auf der Treppe zwei Kollegen vom Kriminaldauerdienst. Zwei andere sahen sich im Erdgeschoss um.
»Drei Tote. Keine Anzeichen für Einbruch oder Raub«, sagte Stettner und wies mit dem Kinn nach oben.
»Feierabend«, entgegnete einer der beiden. »Wir übernehmen jetzt. Kripo ist unterwegs.«
Stettner nickte, obwohl er natürlich keinen Feierabend hatte.
048. Das war der Polizeicode für Mord.
011. Das war der Code für Selbstmord.
2
Sechs Wochen vor der Tat
Auf Barbaras Nachttisch stand ein Foto von ihr und Markus am Gardasee. Beide strahlten, beziehungsweise Barbara strahlte, und Markus zeigte sein typisches schiefes, ein bisschen widerwilliges Grinsen, das er immer vor der Kamera aufsetzte, falls er sich überhaupt mal fotografieren ließ. Die Aufnahme war einundzwanzig Jahre alt, Barbara war damals noch nicht schwanger mit Leon oder wusste noch nicht, dass sie es war, und es war ein zauberhafter Tag gewesen, voller Liebe und Sonne (und vielleicht war Leon sogar hier entstanden, ganz genau ließ sich das nicht sagen).
Sie hatten sich ein paar Tage in einem Luxushotel in Sirmione geleistet, eine prächtige Villa in Sonnengelb und Cremeweiß, bewachsen mit einer leuchtend pinken Bougainvillea, die sich üppig neben dem säulenbewehrten Eingang hochrankte. Es hatte nur ein bisschen Krach gegeben, weil Markus trotz der vielgepriesenen Gourmetküche keinen einzigen Abend im Hotelrestaurant essen wollte. Seine Begründung – die Kellner taten ihm zu vornehm und zu servil, er fand das dekadent – überzeugte Barbara nicht, sie hätte sich gern einmal von vorne bis hinten bedienen lassen. Und was war gegen Silberbesteck, Stoffservietten und superfreundliche Bedienungen einzuwenden?
Aber das blieb die einzige Unstimmigkeit in diesem Kurzurlaub, ansonsten hatten sie eine fantastische Zeit, und manchmal sehnte sich Barbara so sehr danach zurück, also nicht unbedingt nach Sirmione selbst (ein hübscher, aber überfüllter Touri-Ort), aber an die Stimmung in diesem Hotel. An die Liebe und die Unbeschwertheit in der Zeit vor Leon.
Leon war ein Wunschkind gewesen, daran konnte es nicht gelegen haben. Er war so willkommen im Leben von Barbara und Markus gewesen, er war die Krönung ihrer noch jungen zweiten Ehe, der Höhepunkt nach Jahren voller Enttäuschungen und Kummer, der Beweis, dass alle Kämpfe sich gelohnt hatten, und vielleicht hatte ihn gerade das überfordert.
Diese freudigen Erwartungen, diese übertriebenen Hoffnungen. Welcher Säugling konnte die schon einlösen?
Nun war er jedenfalls da, unübersehbar, unüberhörbar, er wuchs und gedieh, und man musste mit ihm zurechtkommen, denn er würde nicht wieder verschwinden. Leon, Sternzeichen Löwe, ein kraftvoller und besonderer Mensch, mittlerweile ein junger Mann von außergewöhnlicher Intelligenz und mit extrem starken Gefühlen und Ängsten und – ja – auch Aggressionen. Begabt, aber schwierig. Wie so viele Genies passte er in keine Schublade, sprengte jedes Raster, war ein Naturereignis, lieb und böse, großartig und schlimm, hoffnungsvoll und verzweifelt, und manchmal alles zusammen, so wie an diesem Samstag Anfang Dezember.
Barbara hatte sich morgens ausgedacht, mittags zum vorzeitigen Nikolaus-Familienbrunch einzuladen, und war dann, ohne sich mit Markus abzustimmen, in aller Herrgottsfrühe losgefahren, um in einem Feinkostladen die entsprechenden Delikatessen einzukaufen. Das gab dann den ersten Ärger des Tages, weil Markus ein Problem damit hatte, wenn über seinen Kopf hinweg bestimmt wurde. Aber wie immer, wenn Barbara sich etwas spontan ausdachte, entwickelte sie eine derart freudige Energie, dass es praktisch unmöglich war, sie einzubremsen. Markus hatte sie angeschrien, was ihr eigentlich einfiele, Steffi versuchte es auf sanfte Art – »Sehr geile Idee, Mam, aber ich muss für die Prüfungen lernen, und Jo fliegt morgen auf einen Neurologen-Kongress nach New York und hat noch nichts gepackt« – und kam genauso wenig damit durch, weil Barbara, bereits gestählt durch Markus’ Gebrüll, alle Einwände einfach weglachte.
Eine kleine Geschäftsreise, also bitte, und lernen könne Steffi auch morgen noch, und so ging das hin und her, bis Steffi nach offenbar resignierter Rücksprache mit Jo doch zusagte.
»Wir können aber nicht lange bleiben, das weißt du.«
»Ich freu mich auf euch!«, sagte Barbara und überhörte absichtlich das »Aber«.
»Ja. Okay.«
»Mach dich nicht immer so rar, Schätzchen«, ermahnte sie ihre Tochter, während leiser Ärger in ihr hochstieg.
»Mam, bitte. Wir haben uns vor ’ner guten Woche gesehen, schon vergessen?«
»Sag ich ja!«
Nach solchen Gesprächen fühlte sich Barbara manchmal erschöpft, ein bisschen wie Sisyphos, der mit allen Kräften schob und schob, sich abrackerte und kämpfte und vermutlich schon ahnte, dass wieder das letzte Quäntchen Kraft fehlen würde, um den Stein über den Berg zu rollen. Ihre Physiotherapeutin und Craniosacral-Expertin Anne arbeitete sich seit Jahren an Barbaras Verspannungen im Nacken ab, die laut Anne ein Symptom ihrer Sehnsucht nach jemandem sei, der ihr Arbeit abnahm, statt ihr noch mehr Lasten aufzubürden.
»Man kann auch zu stark sein«, sagte Anne immer, und Barbara stimmte ihr zu, zu hundert Prozent. Sie war zu stark, zu leistungsfähig, sie verführte ihr Umfeld dazu, alles bei ihr abzuladen: Sie war im Grunde selber schuld. Es gab immer wieder Phasen, wo ihr das klar wurde, also so richtig klar wurde, nicht nur im Kopf, sondern auch mit dem Bauch und dem Herzen, und dann beschwerte sie sich schon mal. Was natürlich nichts änderte, es gab höchstens eine Riesenschreierei mit Markus und – falls alles ganz schlecht lief – auch mit Leon. Aber irgendwie hatten sie sich doch immer wieder zusammengerauft, oder nicht? Und Leon war in einer guten Phase, das stand fest, es gab Anlass zur Hoffnung. Er machte eine Ausbildung, genau die, die er wollte, und das war ein harter Kampf gewesen. Aber er blieb dran, und das war das Wichtigste, auch wenn Büchsenmacher nicht gerade der Beruf war, den sie sich für ihren Sohn gewünscht hätte.
Sie hörte das trockene Rattern einer Maschinenpistole und horchte nach unten, wo Leon nach eigenen Angaben ein Video drehte. Das war immer so, wenn unten im Werkzeugkeller geschossen wurde, dann durfte ihn niemand stören, sonst gab es eine Riesenaufregung. Gottverfickte Scheiße, hau ab, verfickte Scheiße, stör mich nicht, wenn es knallt. Sie verdrehte die Augen. Heute war es besonders laut; Dauerfeuer auf eine Aluplatte, vermutete sie, das machte richtig Lärm. Letzte Woche hatte sie schon ein komplett durchlöchertes Exemplar entsorgt. Der Sinn dieser Aktion erschloss sich ihr nicht, und sie hatte schon längst aufgegeben, Leon zu fragen, was er da eigentlich tat und wozu das gut sein sollte. Warum schoss man auf eine Metallplatte? War das so was wie ein Kunstprojekt?
Im Grunde hätte sie sich spätestens jetzt schon denken können, dass das mit dem Brunch heute keine gute Idee war. Aber hey, no risk, no fun, wie Leon manchmal grinsend sagte, und das hatte er ja vielleicht von ihr, diese Waghalsigkeit, sich in irgendwas reinzustürzen, ganz egal, was dabei rauskam.
Sie ging in die Küche, wo das Rattern aus dem Keller weniger hörbar war, lehnte sich an die Arbeitsplatte neben dem Herd, dachte nach, wobei sie unbewusst die Arme vor der Brust kreuzte, als müsste sie sich vor irgendwas schützen, irgendwen abwehren. Sie überlegte, sich ein Glas Prosecco außer der Reihe einzuschenken, und verwarf den Gedanken wieder.
Dann nahm sie doch ein Fläschchen aus dem Kühlschrank und holte sich ein Glas aus der Vitrine. Et voilà, die richtige Entscheidung. Nach ein paar Schlucken war alles gar nicht mehr so schlimm, und dann fielen sogar ein paar zarte Sonnenstrahlen durch das Fenster, vertrieben die trübselige Wolkendecke, die seit Tagen über dem See hing und alles in winterliches Grau getaucht hatte. Jetzt leuchtete das feurig rote und senfgelbe Herbstlaub im Garten und erinnerte Barbara daran, dass sie den Rasen davon befreien musste, damit er atmen konnte.
Aber das hatte noch Zeit. Barbara, ausnahmsweise entspannt und untätig, ließ den Blick schweifen. Er streifte den altmodischen Elektroherd, den man nicht mehr sauber kriegte, die müffelnde Kunststoffarbeitsplatte in Holzoptik, die an den Rändern schon Risse aufwies, und verweilte schließlich missmutig auf den tannengrünen Hängeschränken. Wie sie diese schweren Dinger hasste, wie sehr sie sich eine neue Küchenzeile wünschte – ohne Hängeschränke, ganz in Weiß, mit einer eleganten Kücheninsel in der Mitte, ihretwegen auch gern von IKEA. Hauptsache neu, Hauptsache anders.
Manchmal hatte Barbara Angst vor diesem Haus. Seit über zwanzig Jahren lebte sie hier, und dennoch fühlte sie sich nie daheim, das hatte sie neulich einer Freundin gestanden. Die Fenster waren zu klein, die Decken zu niedrig und die Atmosphäre auf undefinierbare Weise zäh. Als wäre die Luft hier dicker, als würden sich Gerüche länger halten. Selbst Lüften half nicht wirklich. Und dann war es selbst bei strahlendem Sonnenschein immer zu dunkel für ihren Geschmack. Selbst im verglasten Wintergarten wurde es nie so richtig hell, was unter anderem daran lag, dass der Garten nach Nordosten ging, weshalb auch der Rasen selbst dann vermooste, wenn sie ihn jährlich vertikutierte. Etwas an diesem Haus erdrückte sie. Hinderte sie daran, frei zu atmen, Dinge beherzt in die Hand zu nehmen und zu verändern. Oh, wie sehr sehnte sie sich nach Veränderung! Frischen Wind und mehr Helligkeit! Das brauchte sie!
Egal.
Sie kippte den Rest Prosecco herunter und stellte anschließend fest, dass der schwarz-weiße Linoleumboden schon wieder voller Krümel und anderen klebrigen Ekelhaftigkeiten war, obwohl sie ihn gestern erst gesaugt und gewischt hatte. Zwei Männer im Haus waren eindeutig einer zu viel, vor allem wenn es sich um jene berüchtigten Exemplare handelte, die sich keinen Deut um Ordnung und Sauberkeit scherten.
Egal.
Sie stellte das Glas in die Spülmaschine und machte sie an, obwohl sie erst halb voll war. Eine Verschwendung von Ressourcen, über die sich Markus wahnsinnig ärgern würde, aber wenn sie Glück hatte, würde er es diesmal nicht merken. Sie holte den frisch gekauften Aufschnitt aus dem Kühlschrank, naschte eine Scheibe edlen Pata-Negra-Schinken und probierte ein Löffelchen von dem köstlichen Gorgonzola Cremoso. Danach richtete sie alles schön an und trug es ins Esszimmer, das ebenfalls auf eine komplette Runderneuerung wartete, doch mit einer frisch gebügelten Damast-Tischdecke würde es schon gehen.
Dann stellte sie fest, dass keine saubere mehr da war. Alle in der Wäsche. Gottverfickte Scheiße.
*
Als Leon das dritte Mal ins MRT geschoben wurde, war er gerade dreizehn geworden. Natürlich konnte man ihn nicht ohne Sedierung in einem lärmenden Tunnel ausharren lassen, wo er sich eine halbe Stunde lang nicht würde bewegen dürfen, aber Fragen beantworten musste. Also saßen Steffi und Barbara rechts und links neben ihm und hielten seine Hände fest, während ihn zwei Ärzte auf die Liege drückten und ein Pfleger seine Beine fixierte. Dann endlich konnte die Beruhigungsspritze gesetzt werden.
Nach langem Kampf beruhigte sich Leon schließlich, und Steffi sah zum ersten Mal, wie sein Gesicht aussah, wenn er vollkommen entspannt war, aber nicht schlief. Einer der Ärzte war Jo gewesen, damals noch Assistenzarzt auf der Neurologie. Sie erinnerte sich, wie ihr die Tränen in die Augen schossen, weil Leon plötzlich ein normales Kind war, ein hübscher Junge sogar, mit ebenmäßigen Zügen, wie die von Mom. Jo hatte sie dabei beobachtet und sich auf Anhieb in sie verliebt. Davon ahnte Steffi bis heute nichts; es wäre Jo komisch vorgekommen, ihr zu erzählen, dass er sich in eine Frau verliebte, bloß weil sie weinte.
Während der Untersuchung, die von einem Oberarzt durchgeführt wurde, lud er sie und Mam zu einem Kaffee in der Krankenhauskantine ein, aber Mam lehnte ab.
Die Kantine, laut Jo früher ein finsterer Raum in Braun- und Grautönen, war gerade renoviert worden und nun bunt wie ein Pfau. Blaue Wände, orange Tische, weiße Plastikstühle. Diese plötzliche Farbenpracht in dieser optisch eher trübseligen Klinik wirkte so absurd, dass Steffi einen Lachkrampf bekam.
»Ist das hier ein Spielplatz?«
»Wenn Sie so wollen. Der Architekt wollte eine positive Atmosphäre. Eine lebendige Insel inmitten von Leid und Tod.«
»Nicht Ihr Ernst.«
»Seine Worte«, sagte Jo und bot Steffi sehr gentlemanlike einen der Stühle am Fenster mit Blick in den Park an, während sie nicht aufhören konnte, hysterisch zu kichern.
»Fehlt nur noch das Bällebad«, prustete sie, und Jo ließ sich von ihrem Gelächter anstecken, was der Moment war, in dem sie – nein, sich nicht in ihn verliebte, aber immerhin aufmerksam wurde. Ein gut aussehender Mann, der aus vollem Herzen lachen konnte, war wie ein Sechser im Lotto – das würde sie ihren Freundinnen erzählen, später, als sie schon sehnlichst auf seinen ersten Anruf wartete.
Das MRT war ohne Befund. Sie hatten währenddessen verschiedene Tests mit Leon durchgeführt, er hatte erstaunlich kooperativ mitgemacht, als wüsste er, worauf es ankam. Ergebnis: kein Tumor, keine auffälligen Aktivitäten im Frontallappen oder im limbischen System oder sonst wo in seinem Gehirn. Nichts fehlte, alles war da, alles im Normbereich. Das, was mit Leon los war, ließ sich nicht messen.
Als sie mittags bei den Eltern ankamen, hörten sie schon von draußen das Geschrei von Markus und Leon, das Scheppern von Geschirr, das auf den Boden oder an die Wand geschleudert wurde, und Steffi wäre am liebsten wieder umgekehrt. Aber es ging nicht, Mam mit dieser Situation alleinzulassen. Also fassten sie sich an den Händen und gingen hinein.
Leon und Markus (nein, sie würde ihn nicht Vater nennen, nicht nach allem, was passiert war!) standen einander gegenüber, Markus in seiner typischen Wuthaltung – vorgebeugter Oberkörper, überstrecktes Kinn, die Arme eng nach hinten gestreckt –, die Steffi immer an einen übergroßen Pinguin erinnerte, kurz vor dem Sprung ins Wasser.
Das Esszimmer war ein Schlachtfeld. Jemand hatte die pinkfarbene Tischdecke mit Schwung heruntergezogen, auf dem Boden lagen Scherben von Mams gutem Geschirr zwischen Wurstscheiben, zerplatzten Tomaten, zermatschter Butter und einem klebrigen Käseklumpen.
Leon knallte eine Pistole so vehement auf den Tisch, dass sich die Platte knirschend nach unten bog. Sein blasses Gesicht war verzerrt, der ungekämmte hellblonde Schopf stand fast senkrecht nach oben wie eine Flamme, Schweiß lief ihm in die geröteten Augen. Mam saß am Kopfende des Tisches und hielt den knurrenden und bellenden Bodi am Halsband fest. Ihr Ausdruck wirkte entrückt, als hätte sie sich irgendwohin gebeamt, wo die Sonne schien, es schön warm war und man nichts hörte als friedlich rauschende Meereswellen.
»Hey«, sagte Steffi. »Mordsstimmung hier.«
»Das ist eine Deko-Waffe, Pop! Eine Scheiß-Deko-Waffe!«
»Und was ist das da?« Markus machte eine beinahe elegante Drehung nach hinten, wo eine durchlöcherte Metallplatte an einem Stuhl lehnte, bückte sich und bohrte wie ein Irrer mit dem Zeigefinger in den Löchern herum. Währenddessen schrie er mit überschnappender Stimme: »Peng, Peng, PENG. Na? Ist das vielleicht ein Deko-Ziel?«
»Es reicht jetzt«, sagte Lydia. Sie stand mit verschränkten Armen im Türrahmen zur Küche, wie üblich topgepflegt und -gestylt. Keiner beachtete sie. Steffi beobachtete eine bräunliche Flüssigkeit, die links neben dem Ostfenster herunterlief und über den äußeren Rand des Fensterbretts auf das Parkett tropfte. Da es in dieser Situation nichts weiter zu tun gab, zählte sie die Tropfen und kam auf elf. Mam würde den lang gezogenen Fleck spätestens morgen mit einem feuchten Schwämmchen entfernen, wenn nötig auch drüberstreichen. Es befand sich immer frische Wandfarbe im Haus für solche Fälle.
»Das geht dich nichts an, verfickter …«
»Geht mich nichts an, wenn du mit deinen bescheuerten Freunden in MEINEMHAUS herumschießt? Mit SCHARFERMUNITION?«
»Rede nicht so über meine Freunde, du Spast!«
»Ich rede, wie’s mir passt INMEINEMHAUS! UNDINMEINEMHAUSDULDEICHKEINEUNTERMENSCHENWIEDIESENBEN. DERHATABSOFORTHAUSVERBOT!«
»Fick dich, du Scheißrassist. Ich bring dich um, wenn du das machst.«
»Vorher bring ich mich um«, sagte Mam, aber versonnen, fast lächelnd, und immer noch so, als ginge sie das alles überhaupt nichts an.
Am späteren Nachmittag machten Jo und Steffi einen Spaziergang durch ihr Viertel. Es nieselte, Herbstlaub lag nass und platt auf dem Bürgersteig, in den Häusern gingen die Lichter an.
»Es tut mir leid«, sagte Steffi, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander gegangen waren.
»Was denn?«
»Puh. Was wohl?«
»Ist schon gut«, sagte Jo nach einer Weile, aber seine Stimme klang müde. »Er kann ja nichts dafür.«
»Das sagst du immer, Jo, und ich weiß, dass du es gut meinst. Aber das hilft einfach nicht weiter.«
»Was hilft denn? Willst du ihn wegsperren lassen?«
»Ich liebe ihn, aber so kann es nicht weitergehen. Mam ist Familientherapeutin. Und sie hat Leon überhaupt nicht im Griff. Ich versteh das nicht.«
»Du bist noch keine Mutter. Mit dem eigenen Kind – das ist wie ein blinder Fleck. Man sieht Dinge nicht von außen. Man ist nicht objektiv.«
Sie seufzte. »Vielleicht hast du recht. Aber irgendwas muss sie tun.«
»Du willst, dass sie ihn wegsperren lassen. Das können sie nicht.«
»Ich will, dass er sich ändert.«
»Er wird sich nicht ändern. Er ist Leon.«
»Ich weiß.«
Jo schwieg. Er mochte solche Gespräche nicht, er war ein Mensch für Lösungen, und für dieses Problem gab es keine.
Während Jo abends seinen Koffer packte, versuchte Steffi für ihre Prüfungen zu lernen und gleichzeitig dem Impuls zu widerstehen, ihn zu bitten dazubleiben. Das ging gar nicht, schon gar nicht, weil er es ihr zuliebe vielleicht sogar getan hätte und sie sich dann wie die schlimmste Spielverderberin vorgekommen wäre. Ein internationaler Neurochirurgen-Kongress, ein freier Abend morgen in New York, der Stadt der Städte, wie hätte sie ihm diese Freude verderben können?
Wie immer hatte er sie natürlich gefragt – nein: richtig eindringlich gebeten –, ihn zu begleiten, und wie immer hatte Steffi das Gefühl, gerade jetzt nicht wegzukönnen. Nicht nur wegen ihrer anstehenden Prüfungen, sondern auch wegen Mam, die man nicht alleinlassen durfte.
Deine Mam ist erwachsen. Du kannst nicht ewig …
Ich weiß.
Irgendwann mal später, wenn Mams Probleme nicht mehr gar so dringlich sein würden, würde sie mit ihm verreisen. Ganz, ganz sicher.
Aber wann wird das sein, Steff?
Bald. Es muss bald sein, weil ich das nicht mehr lange aushalte.
*
Zu etwa derselben Zeit saß ein Mann vor seinem Schreibtisch und surfte durchs Deep Web. Es erforderte ein wenig Übung, um auf die Seiten zu kommen, die ihn interessierten. In erster (und zweiter und dritter) Linie waren das Waffenhändler, die auch an Personen ohne gültigen Waffenschein lieferten. An jemanden wie ihn.
Er wusste selbst nicht genau, woher diese Affinität zu Tötungswerkzeugen stammte. Manchmal fragte er sich das selbst, aber da er nicht zur Innenschau neigte, waren solche Überlegungen selten. Was zählte, war, dass es Möglichkeiten gab, dieses Bedürfnis im Geheimen zu stillen, und dazu zählte das Darknet mit seinen zahlreichen Plattformen für sämtliche illegalen Wünsche. Schon allein die Möglichkeit, sich außerhalb der Gesetze zu bewegen, hatte etwas Inspirierendes.
Dieses Mal war es eine AK-47 Typ II, die es ihm angetan hatte, ein original Kalaschnikow-Sturmgewehr aus den frühen Fünfzigerjahren, voll funktionsfähig, wie der Händler betonte. Dazu gab es die entsprechende Munition. Der Mann klickte das Gewehr an. Es dauerte eine Zeit lang, bis sich die Seite vom Warenkorb aufbaute; das Deep Web war wegen seiner zahlreichen Proxyserver in allen möglichen Ländern, die ausschließlich dazu dienten, seine digitalen Spuren zu verwischen, immer etwas langsamer als das normale Internet.
Er bestellte das Gewehr, das postlagernd versendet werden würde, und bezahlte mit der verlangten Kryptowährung. Dann schaute er sich weiter um. Eine Glock 19 stach ihm ins Auge, bei einem anderen Händler. Er kaufte auch sie. Als Lieferadresse gab er eine seiner Postfachadressen an. Sein Büro- Handy brummte neben ihm, er warf einen Blick darauf und rollte gereizt mit den Augen. Es war seine Ex-Frau, mit der er im Bösen auseinandergegangen war. Mittlerweile – er hatte wieder geheiratet und nun zwei weitere Kinder im Vorschulalter – waren sie allerdings zumindest manchmal ein Herz und eine Seele. Dann, wenn es darum ging, seine aktuelle Gattin in Misskredit zu bringen.
Was jedoch nicht hieß, dass er seine Ex deswegen lieber mochte. Sie war eine früh gealterte, übergewichtige, in jeder Hinsicht unattraktive Erscheinung, und er musste sich wirklich zusammennehmen, um ihr das nicht an den Kopf zu werfen. Er brauchte sie schließlich noch, ohne sie würde Plan A auf keinen Fall funktionieren, und Plan B war noch Zukunftsmusik. Ziemlich genial, jedoch mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet, eine wirklich hochriskante Wette sozusagen und definitiv nicht spruchreif.
Die Mailbox hatte sich mittlerweile eingeschaltet, und der Mann überlegte, doch besser gleich anzurufen, statt sich das endlose Geplapper seiner Ex auf Band anzuhören. Er drückte seine EarPods in die Ohren, wählte ihre Nummer und lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück. Jetzt sah er nur sich selbst als Schattenriss in der Scheibe, geblendet von der Stehlampe hinter ihm. Tagsüber genoss man hier aber bei sonnigem Wetter einen spektakulären Blick über den See und auf die Alpen.
»Butzi!«, rief seine Ex auf diese exaltierte Weise, in die er sich einmal unsterblich verliebt hatte und für die er sie jetzt töten könnte. Dass er diesen Kosenamen nur anfangs charmant und heute einfach schrecklich fand, kam strafverschärfend hinzu. Wer ihn als Butzi bezeichnete, musste wirklich einen Sprung in der Schüssel haben.
»Mitzi«, antwortete er dennoch mit seidenweicher Stimme, während er einen Spiegel in die Hand nahm und sich selbst begutachtete. Mitzi und Butzi waren einmal ein wunderschönes Paar gewesen, aber nur Butzi hatte diese Phase optisch überlebt. Immer noch dunkelbraunes, volles Haar, sorgsam zurückgegelt, regelmäßige Gesichtszüge, blaue Augen, gebräunter Teint, attraktive Fältchen um Augen und Lippen. Konnte er etwas dafür, dass sich Frauen reihenweise in ihn verliebten? Dass kaum eine seinen Flirtanstrengungen widerstand?
»Ich bin so froh, deine Stimme zu hören!«, miaute Mitzi in ihrem angelernten bayerisch-österreichischen Mix-Akzent, der von vielen Besuchen auf den Salzburger Festspielen und mehreren Luxus-Aufenthalten am Fuschlsee künden sollte, die in der Vergangenheit zwar tatsächlich reichlich stattgefunden (Mitzi hatte gut geerbt), aber mittlerweile aus mehreren Gründen Seltenheitswert hatten.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte der Mann und zündete sich eine Zigarette an. Er war der Chef, er durfte das, außerdem war Wochenende und kein einziger Mitarbeiter da, obwohl es genug zu tun gab.
»Ich hab deine Frau beobachtet.« Ihren Namen spuckte sie geradezu aus, nach all den Jahren anscheinend immer noch geifernd vor Eifersucht. Ekelhaft, aber nützlich.
»Wirklich?«
»Wir müssen uns treffen, Butzi. Ich habe gute Neuigkeiten.«
Das war natürlich ein Trick, um ihn wieder in ihre Einflusssphäre zu locken. Meistens waren diese Beobachtungen vollkommen wertlos. Er wählte seine Worte mit Bedacht.
»Schatz, heute kann ich leider nicht. Ich bin im Büro, mit einem Haufen an Arbeit.«
»Heute ist Samstag, Butzi! Du musst doch mal eine Pause machen, du holst dir noch den Tod!«
»Du hast so recht, aber was will man machen. Ich habe Kunden über Kunden, aber nichts zu verkaufen.«
»Komm auf ein Glas Wein vorbei!«
»Mitzi, das müssen wir leider auf nächstes Wochenende verschieben. Magst du mir vielleicht in der Zwischenzeit mailen, was du beobachtet hast? Dann können wir uns nächstes Wochenende darüber unterhalten und einen Schlachtplan entwerfen. Was hältst du davon? Du kochst uns was Schönes, und wir reden über alles?«
»Das sagst du immer, und dann hast du doch nie Zeit!«
»Ich versprech’s. Samstag in einer Woche um sieben Uhr bin ich bei dir.«
»Ehrlich?«
»Ich schwör’s.« Währenddessen vibrierte sein Zweithandy in der Hosentasche, und er beendete eilig das Gespräch. Julia, die Süße aus dem Rathaus. Eigentlich hatte er sich noch mit einem Porno in Stimmung bringen wollen, aber bei einer Granate wie Julia war das nun wirklich nicht nötig. Er fuhr seinen Computer herunter, verließ sein Büro, sperrte alles ab und fuhr bestens gelaunt in die Tiefgarage.
*
Am Tag darauf, einem Sonntag, hing Ben bei seinem Pa und seinem Bruder Jimmy in Kulmbach ab. Weit weg von Leon, der ihn mit WhatsApps und Sprachnachrichten bombardierte, die er ignorierte. Vormittags gingen sie nach einem ausgiebigen Frühstück ein paar Stunden in den Schützenverein, wo sein Pa Mitglied war. Seitdem Ben über achtzehn war, durfte er unter seiner Aufsicht auch mit großkalibrigen Waffen schießen, nicht mehr nur mit Luftgewehren (da war er ja ohnehin schon längst drüber hinaus). Er entschied sich diesmal für eine SIG Sauer P226, eine Halbautomatik, mit der unter anderem die Navy Seals, die israelischen Streitkräfte und das Berliner SEK ausgerüstet waren.
Das war so cool. Sein Pa lobte ihn, einigermaßen überrascht, weil er sich ziemlich geschickt anstellte und mehrmals sogar auf Entfernungen von über hundert Metern ins Schwarze traf. »Ein Naturtalent«, sagte Pa anerkennend, und das tat so gut, vor allem, weil Bens Verfassung in den letzten Wochen nicht so besonders gewesen war. Das lag vor allem an Leon, aber nicht nur an ihm. Das alte Jahr ging zu Ende, das neue stand vor der Tür, und Ben hing in der Luft.
Gaby, die Freundin seines Vaters, hatte Dampfnudeln gebacken, und die aßen sie am Nachmittag mit Vanillesauce. Danach zockten sein Bruder Jimmy und er »Zombie Apokalypse« bis zum Abendessen. Jimmy war cool und ein Spaßvogel, wie Ben es mal gewesen war, irgendwas war da zurzeit in ihm verschüttet, aber Jimmy konnte es wieder rausholen aus ihm. Also den Witzbold, das Spaßvogel-Gen.
Das Abendessen war nicht so cool, weil sein Pa wieder mit Bens Ausbildung anfing und sich Ben alle möglichen Geschichten ausdenken musste, weil er den Scheiß ja schon längst geschmissen hatte. Warum er es geschmissen hatte, darüber dachte er nicht so viel nach, weil das ja gar nichts brachte. Es ging im Wesentlichen um das frühe Aufstehen, das er auf die Dauer nicht gepackt hatte, und dass sich der Lehrstoff eines angehenden Elektrotechnikers nicht mit seinem Drogenkonsum vertrug. Oft war er deshalb in der Berufsschule weggedöst, speziell in Fächern wie Chemie, Physik, Informationstechnik oder Messtechnik hatte er schließlich nur noch Bahnhof verstanden.
Und so war er nach ein paar Wochen eben einfach nicht mehr hingegangen, und da nützte es auch nichts, dass Gaby ihn jeden Morgen anrief, um ihn zu wecken. Er ging dann immer brav an sein Handy, behauptete, er sei im Bad oder beim Frühstücken, und nachdem er aufgelegt hatte, schlief er weiter bis zehn oder zwölf. Dass das so nicht weitergehen konnte, wusste er selber. Irgendwann würde sein Pa ihm auf die Schliche kommen, dann würde er die Wohnung nicht mehr bezahlen, und es würde überhaupt einen Mega-Stress geben. Seine Ma würde davon erfahren, wahrscheinlich musste er am Ende wieder zu ihr ziehen und wieder in diese verfickte Kirche gehen.
Und was dann?
All diese Gedanken waren ständig da, aber eher wie eine Art Background-Geräusch, etwa wie in dem Film Die nackte Kanone, den er mal total high gestreamt und sich halbtot gelacht hatte, weil sich die verrücktesten Sachen immer ein paar Meter hinter den Hauptdarstellern abgespielt hatten. Und so war das eben auch bei ihm. Seiner Familie erzählte er komplett erfundene witzige Storys von komischen Mitschülern und nervenden Lehrern, und währenddessen machte er sich Sorgen um alles Mögliche, und es war fast ein wenig unheimlich, wie leicht ihm das fiel. Diese Gleichzeitigkeit von Lüge und Wahrheit. Dass beides in ihm drin war und er es fertigbrachte, nur das eine zu zeigen und das andere mit sich auszumachen.
Gerade als es begann, anstrengend zu werden, weil selbst ihm langsam die Ideen ausgingen, klingelte sein Handy. Natürlich war es wieder Leon, aber diesmal kam ihm die Unterbrechung zupass, und so entschuldigte er sich und ging ins Wohnzimmer. Räumte die Laptops weg und lümmelte sich der Länge nach auf das zerknautschte Ledersofa. Guckte an die Decke, über die seit Jahr und Tag ein zackenförmiger Riss von der linken vorderen bis zur rechten hinteren Ecke lief, den sein Pa immer noch nicht verspachtelt hatte, und stöpselte seine Kopfhörer in die Ohren.
»Hi«, sagte er.
»Fuck«, sagte Leon. Im Hintergrund lief ziemlich lautstark »Gangsta’s Paradise«.
»Bist du high?«, fragte Ben. Er dachte an die Bong in Leons Zimmer, fühlte den süßlich-erdig-bitteren Geschmack auf der Zunge, das Gefühl, wenn der Rauch in der Lunge festsaß und man ihn auf einen Schlag wieder rausließ. Die Watte im Kopf, der Lachflash, die verschobene Zeitwahrnehmung (eine Minute konnte sich ewig hinziehen, eine Stunde wie nichts verschwinden), das supergute Gefühl, nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein, sondern ihr Sklave. Er zündete sich eine Zigarette an.
»Haha. Ja«, sagte Leon, und man hörte es auch an seiner Stimme, die tief und dumpf klang.
»Was rauchst du?«
»Bester Shit ever, Digga. Komm vorbei.«
»Kann ich nicht. Du weißt, dass ich bei meinem Vater bin.«
»Fuck. Mir geht’s scheiße, Bro.«
»Wieso?«
»Ich bring ihn um.«
»Wen?«
»Pop. Ich hasse ihn.«