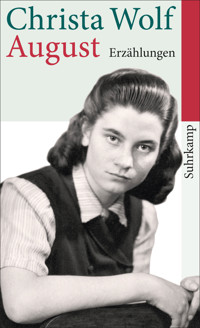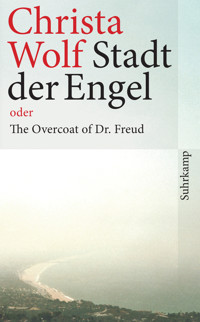
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Los Angeles, die Stadt der Engel: Anfang der 1990er Jahre verbringt die Erzählerin dort einige Monate auf Einladung des Getty Centers. Sie spürt dem Schicksal einer Frau nach, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA emigrierte, und wird immer wieder mit der Frage konfrontiert: Könnte der „Virus der Menschenverachtung“ in der neuen, wiedervereinigten deutschen Gesellschaft zurückkehren?
In der täglichen Lektüre, in Gesprächen, in Träumen stellt sich die Erzählerin einem Ereignis aus ihrer Vergangenheit, das sie in eine existentielle Krise bringt und zu einem Ringen um die Wahrhaftigkeit der eigenen Erinnerung führt.
Stadt der Engel ist mehr als ein Roman: Es ist autobiografisches Erzählen auf höchstem Niveau, ein eindringliches Zeugnis über ein Leben, das drei deutsche Staats- und Gesellschaftsformen erlebt hat, und über die Kunst, sich der eigenen Geschichte zu stellen. Ein Buch über Überleben, Erinnerung und die Kraft der Zeugenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Christa Wolf
Stadt der Engel
oder
The Overcoat of Dr. Freud
Suhrkamp Verlag
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen
Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch ein-
zelner Teile. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,
Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Ver-
lages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
eISBN 978-3-518-74240-2
Alle Figuren in diesem Buch, mit Ausnahme der namentlich angeführten historischen Persönlichkeiten, sind Erfindungen der Erzählerin. Keine ist identisch mit einer lebenden oder toten Person. Ebensowenig decken sich beschriebene Episoden mit tatsächlichen Vorgängen.
So müssen wahrhafte Erinnerungen viel weniger berichtend verfahren als genau den Ort bezeichnen, an dem der Forscher ihrer habhaft wurde. Walter Benjamin: Ausgraben und Erinnern
Die wirkliche Konsistenz von gelebtem Leben kann kein Schriftsteller wiedergeben.
E. L. Doctorow
AUS ALLEN HIMMELN STÜRZEN
AUS ALLEN HIMMELN STÜRZEN das war der Satz, der mir einfiel, als ich in L. A. landete und die Passagiere des Jet dem Piloten mit Beifall dankten, der die Maschine über den Ozean geflogen, von See her die Neue Welt angesteuert, lange über den Lichtern der Riesenstadt gekreist hatte und nun sanft aufgesetzt war. Ich weiß noch, daß ich mir vornahm, diesen Satz später zu benützen, wenn ich über die Landung und über den Aufenthalt an der fremden Küste, der vor mir lag, schreiben würde: Jetzt. Daß so viele Jahre über beharrlichen Versuchen vergehen würden, mich auf rechte Weise den Sätzen zu nähern, die diesem ersten Satz folgen müßten, konnte ich nicht ahnen. Ich nahm mir vor, mir alles einzuprägen, jede Einzelheit, für später. Wie mein blauer Paß ein gewisses Aufsehen erregte bei dem rotblonden drahtigen officer, der die Papiere der Einreisenden genau und streng kontrollierte, er blätterte lange darin, studierte jedes einzelne Visum, nahm sich dann das mehrfach beglaubigte Einladungsschreiben des CENTER vor, unter dessen Obhut ich die nächsten Monate verbringen würde, schließlich richtete er den Blick seiner eisblauen Augen auf mich: Germany? – Yes. East Germany. – Weitergehende Auskünfte zu geben wäre mir schwergefallen, auch sprachlich, aber der Beamte holte sich Rat am Telefon. Diese Szene kam mir vertraut vor, das Gefühl der Spannung kannte ich gut, auch das der Erleichterung, als er, da die Antwort auf seine Frage wohl befriedigend gewesen war, endlich das Visum stempelte und mir meinen Paß mit seiner von Sommersprossen übersäten Hand über die Theke zurückreichte: Are you sure this country does exist? – Yes, I am, antwortete ich knapp, das weiß ich noch, obwohl die korrekte Antwort »no« gewesen wäre und ich, während ich lange auf das Gepäck wartete, mich fragen mußte, ob es sich wirklich gelohnt hatte, mit dem noch gültigen Paß eines nicht mehr existierenden Staates in die USA zu reisen, nur um einen jungen rothaarigen Einreisebeamten zu irritieren. Das war eine der Trotzreaktionen, derer ich damals noch fähig war und die, das fällt mir jetzt auf, im Alter seltener werden. Da steht das Wort schon auf dem Papier, angemessen beiläufig, das Wort, dessen Schatten mich damals, vor mehr als anderthalb Jahrzehnten, erst streifte, der sich inzwischen so stark verdichtet hat, daß ich fürchten muß, er könnte undurchdringlich werden, ehe ich meiner Berufspflicht nachkommen kann. Ehe ich also beschrieben habe, wie ich mein Gepäck vom Transportband herunterhievte, es auf einen der übergroßen Gepäckwagen lud und inmitten der verwirrenden Menschenmenge dem EXIT zustrebte. Wie, kaum hatte ich die Ausgangshalle betreten, geschah, was ich nach allen inständigen Warnungen Einreisekundiger nicht hätte geschehen lassen dürfen, ein riesenhafter schwarzer Mann kam auf mich zu: Want a car, Madam?, und ich, unerfahrenes Reflexwesen, das ich war, nickte, anstatt entschieden abzuwehren, wie man es mir anbefohlen hatte. Schon hatte der Mann sich den Karren geschnappt und war damit losgezogen, auf Nimmerwiedersehen, meldete mein Alarmsystem. Ich folgte ihm, so schnell ich konnte, und da stand er tatsächlich draußen am Rand der Zufahrtsstraße, auf der, Stoßstange an Stoßstange, mit abgeblendeten Scheinwerfern, die Taxis heranrollten. Er kassierte den Dollar, der ihm zustand, und übergab mich einem Kollegen, ebenfalls schwarz, der sich einen Job als Taxiherbeiwinker geschaffen hatte. Der waltete seines Amtes, stoppte das nächste Taxi, half mein Gepäck verstauen, empfing ebenfalls einen Dollar und überließ mich dem kleinen hageren wendigen Fahrer, einem Puertoricaner, dessen Englisch ich nicht verstand, der aber gutwillig meinem Englisch lauschte und, nachdem er den Briefkopf mit meiner zukünftigen Adresse studiert hatte, zu wissen schien, wohin er mich zu bringen hatte. Erst jetzt, als das Taxi anfuhr, daran erinnere ich mich, spürte ich die milde nächtliche Luft, den Anhauch des Südens, den ich von einer ganz anderen Küste her wiedererkannte, wo er mich wie ein dichtes warmes Tuch zum ersten Mal getroffen hatte, in Warna auf dem Flughafen. Das Schwarze Meer, seine samtene Dunkelheit, der schwere süße Duft seiner Gärten.
Noch heute kann ich mich in dieses Taxi versetzen, an dem links und rechts Lichterketten vorbeijagten, manchmal zu Schriftzügen geronnen, weltbekannte Markennamen, Werbetafeln in grellen Farben für Supermärkte, für Bars und Restaurants, die den Nachthimmel überstrahlten. Ein Wort wie »geordnet« war hier wohl fehl am Platze, auf dieser Küstenstraße, womöglich auf diesem Kontinent. Sehr leise, schnell wieder unterdrückt, kam die Frage auf, was mich eigentlich hierhergetrieben hatte, gerade so laut, daß ich sie wiedererkannte, als sie sich das nächste Mal, dann schon dringlicher, meldete. Immerhin, als sei das Grund genug, glitten die schuppigen Stämme von Palmen vorbei. Geruch von Benzin, von Abgasen. Eine lange Fahrt.
Santa Monica, Madam? – Yes. – Second Street, Madam? – Right. – Ms. Victoria? – Yes. – Here we are.
Zum ersten Mal das Blechschild, am Eisenzaun befestigt, angestrahlt: hotel ms. victoria old world charm. Alles still. Alle Fenster dunkel. Es war kurz vor Mitternacht. Der Fahrer half mir mit dem Gepäck. Ein Vorgarten, ein Steinplattenweg, der Duft unbekannter Blüten, die sich nachts zu verströmen schienen, der schwache Schein einer leise schaukelnden Lampe über der Eingangstür, ein Klingelbrett, hinter dem ein Papier mit meinem Namen steckte. Welcome, las ich. Die Tür sei offen, ich solle eintreten, in der Halle auf dem Tisch liege der Schlüssel zu meinem Apartment, second floor, room number seventeen, the manager of ms. victoria wishes you a wonderful night.
Träumte ich? Aber anders als in einem Traum verirrte ich mich nicht, fand den Schlüssel, benutzte den richtigen Treppenaufgang, der Schlüssel paßte in das richtige Schloß, der Lichtschalter war da, wo er zu sein hatte, ein Wimpernschlag, und ich sehe alles vor mir: Zwei Stehlampen beleuchteten einen großen Raum mit einer Sesselgruppe und einem langen Eßtisch an der gegenüberliegenden Wand, der von Stühlen umstellt war. Ich bezahlte den Taxifahrer anscheinend zu seiner Zufriedenheit mit dem ungewohnten Geld, das ich zum Glück vor dem Abflug in Berlin eingetauscht hatte, bedankte mich bei ihm in angemessener Weise und bekam, wie es sich gehörte, zur Antwort: You are welcome, Madam.
Ich inspizierte mein Apartment: Außer diesem großen Wohnraum eine angrenzende Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder. Welche Verschwendung. Eine vierköpfige Familie könnte hier bequem wohnen, dachte ich an jenem ersten Abend, später gewöhnte ich mich an den Luxus. Ein Willkommensgruß von einer Alice lag auf dem Tisch, dies mußte die Mitarbeiterin des CENTER sein, die die Einladungsbriefe unterschrieben hatte, und sie war es wohl auch, die mir fürsorglich Brot, Butter, ein paar Getränke in die Küche gestellt hatte. Ich kostete von allem etwas, es schmeckte merkwürdig.
Ich machte mir klar, daß dort, wo ich herkam, schon Morgen war, daß ich telefonieren konnte, ohne jemanden im Schlaf zu stören. Nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen, bei denen mehrere overseas operators sich um mich bemüht hatten, gelang es mir, das Telefon in dem winzigen Kabinett neben der Eingangstür mit den richtigen Nummern zu bedienen, hörte ich hinter dem Rauschen des Ozeans die vertraute Stimme. Das war das erste der hundert Telefongespräche nach Berlin in den nächsten neun Monaten, ich sagte, ich sei nun also auf der anderen Seite der Erdkugel gelandet. Ich sagte nicht, was ich mich fragte, wozu das gut sein sollte. Ich sagte noch, daß ich sehr müde sei, und das war ich ja wirklich, eine fremde Müdigkeit. Ich suchte Nachtzeug aus einem der Koffer, wusch mir Gesicht und Hände, legte mich in das zu breite zu weiche Bett und schlief lange nicht. Früh erwachte ich aus einem Morgentraum und hörte eine Stimme sprechen: Die Zeit tut, was sie kann. Sie vergeht.
Dies waren die ersten Sätze, die ich in das große linierte Heft schrieb, das ich vorsorglich mitgebracht hatte und auf die Schmalseite des langen Eßtischs legte und das sich sehr schnell mit meinen Notizen füllte, auf die ich mich jetzt stützen kann. Inzwischen verging die Zeit, wie es mir mein Traum lakonisch mitgeteilt hatte, es war und ist einer der rätselhaftesten Vorgänge, die ich kenne und die ich, je älter ich werde, um so weniger verstehe. Daß der Gedankenstrahl die Zeitschichten rückblickend und vorausblickend durchdringen kann, erscheint mir als ein Wunder, und das Erzählen hat an diesem Wunder teil, weil wir anders, ohne die wohltätige Gabe des Erzählens, nicht überlebt hätten und nicht überleben könnten.
Zum Beispiel kann man sich solche Gedanken flüchtig durch den Kopf gehen lassen und zugleich in dem Konvolut blättern, das ich am Morgen auf dem Tisch meines Apartments vorfand, eine »First day survival information« des CENTER für alle Neuangekommenen. Die nächsten Lebensmittelmärkte, Coffeeshops und Apotheken sind aufgeführt. Der Weg zum CENTER ist beschrieben, auch die Regeln, nach denen es arbeitet, sind benannt, und natürlich wird sein Tag und Nacht besetzter Telefonanschluß bekanntgegeben. Restaurants und Bistros werden empfohlen, aber auch Buchhandlungen, Bibliotheken, Touristik-Routen, Museen, Vergnügungsparks und Stadtführer, und nicht zuletzt werden dem ahnungslosen Neuling die Verhaltensregeln für den Fall eines Erdbebens eingeschärft. Dies alles nahm ich gewissenhaft zur Kenntnis, studierte auch die Liste der Mitstipendiaten aus den verschiedenen Ländern, die im nächsten halben Jahr meine Kollegen sein würden, die sich zu Mitgliedern einer freundschaftlichen Kommune entwickeln sollten und inzwischen wieder in alle Winde, das heißt in ihre Heimatländer, zerstreut sind.
Ein schweres Erdbeben hat sich erst nach meinem Aufenthalt in der Stadt ereignet, für die der Andreasgraben, der unter ihr verläuft und große Erdschollen gegeneinander verschiebt, eine ständige Bedrohung bleibt. Hätte man mir ein Bild der Welt von heute gezeigt, ich hätte diesem Bild nicht geglaubt, obwohl meine Zukunftsvisionen düster genug waren. Der Rest von Arglosigkeit, mit dem ich damals noch ausgestattet gewesen sein muß, ist mir vergangen. Ein Vorsatz, der schwer zu befolgen ist, der uneingelöst bleibt und sich daher dauerhaft hält, ist mir geblieben: Der Spur der Schmerzen nachgehen.
Darüber habe ich später oft mit Peter Gutman geredet, den aber kannte ich an jenem ersten Morgen noch nicht, er würde einer der letzten von meinen Kollegen sein, den ich kennenlernen würde, darüber haben wir dann gelacht. Überhaupt wurde viel gelacht in der Lounge des CENTER, wenn wir bei Tee und Keksen zusammensaßen, die Jasmine, die jüngere der beiden Sekretärinnen im office, pünktlich vormittags um elf und nachmittags um vier für uns bereithielt, ebenso wie die Zeitungen aller Länder, aus denen wir kamen, amerikanische natürlich, aber auch italienische, französische, deutsche, Schweizer, österreichische, sogar russische, obwohl kein Russe unter uns war, alle auf Holzleisten aufgezogen wie in einem Wiener Kaffeehaus, alle um ein, zwei Tage veraltet, was uns eine wohltuende Distanz gestattete zu den meist unerfreulichen Nachrichten, die wir ihnen entnahmen und die wir uns manchmal kopfschüttelnd gegenseitig vorlasen, als müßten wir in einen Wettbewerb eintreten um die betrüblichsten Zustände, die in dem jeweiligen Heimatland herrschten.
Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich sage, ich zog neugierigere Blicke auf mich als jeder andere aus unserem Kreis. Nicht nur, daß ich die Älteste war, daran mußte ich mich gewöhnen, es war mein Herkunftsort, der mir eine Sonderstellung sicherte. Keiner war so taktlos, mich direkt darauf anzusprechen, aber sie hätten schon ganz gerne gewußt, wie eine sich fühlte, die geradewegs aus einem untergegangenen Staat kam.
Das Morgenlicht fiel jeden Tag durch das Gitterfenster in meinen Schlafraum, gefiltert von einigem Rankenwerk, das sich an der Mauer des ms. victoria hochgearbeitet und mein Fenster teilweise erklettert hatte. Meine Morgenträume trieben mir Wörter zu, die ich später notierte: »Heillos«, lese ich herausfallend aus einem Zusammenhang, der verlorenging. Zuerst im Bett, dann auf dem Bettrand absolvierte ich jene wenigen Übungen, die ich mir verordnet hatte, weil ich, allein in diesem entfernten fremden Land, nicht krank oder bewegungsunfähig werden durfte, stieg dann im kleineren Bad, für das ich mich entschieden hatte, unter die Dusche, deren Kopf, anders als in Europa, fest an die Wand montiert war, so daß es besonderer Techniken bedurfte, um alle Körperteile zu benetzen. Das Frühstück, das ich mir von der mir unverständlichen Musik und den mir unverständlichen Nachrichten aus dem Stadtsender von Los Angeles begleiten ließ, setzte ich, mit schon gewohnten Handgriffen, aus zum Teil ungewohnten Bestandteilen zusammen, Muffins, ja warum denn nicht, eine eigenartige Müsli-Mischung und der Orangensaft, der mir nach einigen Fehlkäufen am vertrautesten erschien, nur mit dem Kaffee mußte ich noch experimentieren, ich mußte jemanden finden, der den Kaffeegeschmack der Germans kannte und mir unter den Dutzenden Büchsen bei PAVILIONS diejenige Marke empfehlen würde, die diesem Geschmack am nächsten kam. (In der DDR wäre es einmal beinahe zu einem Aufstand gekommen, als die Regierung, um die kostbaren »echten« Bohnen zu strecken, der Bevölkerung einen ungenießbaren Kaffee-Mix zumutete, den sie aber, als in den Betrieben die Proteste dagegen bis zu Streikdrohungen gingen, schnellstens wieder aus dem Verkehr zog.) Bill, der vor mir in meinem Apartment gewohnt hatte und bei einem Freund untergekommen war, hinterließ mir diverse exotische Gewürzmischungen und eine ansehnliche Batterie von Flaschen – Olivenöl, Balsamico-Essig, guten Whiskey und kalifornische Weine. An seinem letzten Tag in der Stadt war er mit mir zum Italiener in der Second Street essen gegangen und hatte mich liebevoll und ironisch in die Gebräuche des alten ms. victoria und in die des jungen CENTER eingeführt. Das Verflixte ist, hatte er gesagt, du kannst über die Geschichte von good old Europe nirgendwo besser arbeiten als hier in der Neuen Welt. Besessen sammeln sie alles, was den alten Kontinent betrifft, so als wollten sie, wenn Europa durch Atombomben oder durch andere Katastrophen unterginge, jedenfalls eine Kopie davon hier bereithalten. Bill arbeitete über die Geschichte des Katholizismus in Spanien und Frankreich und rechnete mir die Tausende von Menschenopfern vor, welche die verschiedenen Christianisierungsschübe in diesen Ländern gefordert hatten. Bei jeder Kolonisierung, sagte er, sei es das erste, die Religion, den Glauben der Unterworfenen auszurotten, um ihnen ihre Identität zu nehmen. Außerdem, das höre sich vielleicht unglaubhaft an, hätten die Eroberer aus einem tiefsitzenden Minderwertigkeitskomplex heraus das dringende Bedürfnis, nicht nur ihre Waffen, nicht nur ihre Waren, auch ihre Glaubens- und Gedankenwelt als die überlegene zu behaupten. Das weiß ich doch, hatte ich gesagt, und Bill, der Engländer, hatte mich prüfend angesehen: Ihr erfahrt das gerade, wie? Er hatte nicht auf einer Antwort bestanden. Manchmal, wenn ich abends ein Glas Wein aus seinem Vorrat trank, stieß ich in Gedanken mit ihm an.
Viele Male machte ich mich also morgens auf den Weg, durch den blühenden Vorgarten des ms. victoria, der mit fremden Gewächsen ausgestattet war und in dessen Mitte in einem Rondell ein Pomeranzenbäumchen stand, dessen Früchte ich reifen sah. Die Autos hier schlichen sich in ihrer außerordentlichen Breite vorsichtig an die Kreuzungen heran, sie hielten höflich an, selbst wenn kein grünes Ampelmännchen den Fußgängern WALK erlaubte, sie wiegten sich sanft in ihren Federungen, freundliche, gut gekleidete und sorgfältig frisierte Fahrerinnen oder smarte Fahrer in dunklen Anzügen mit Schlips und Kragen ließen mit lässigen Handbewegungen der Fußgängerin den Vortritt, ohne Hast überquerte ich die California Avenue, nahm ich die im November, Dezember grellrot blühenden Bäume am Straßenrand überhaupt noch wahr? Herbstlaub, graue Nebeltage blieben mir in diesem Jahr erspart, aber auch versagt. Vermißte ich sie schon?
Jederzeit kann ich das CENTER vor meinem inneren Auge aufsteigen lassen, damals ein vielstöckiges sachliches Bürogebäude, das inzwischen längst durch einen spektakulären postmodernen Gebäudekomplex hoch über der Stadt ersetzt ist. Eine breite Außentreppe also, die zu einer Reihe von Säulen hin aufsteigt, durch die ich mich jeden Tag auf die riesigen spiegelnden gläsernen Flügeltüren zugehen sah. Von sechs möglichen Türen zog ich immer die gleiche auf, betrat die mächtige Vorhalle, wo tagein tagaus an immer dem gleichen Platz immer der gleiche Mann postiert war, Pförtner oder Wächter, der bevorzugte Besucher mit ausgestrecktem rechten Arm und vertraulichem Fingerschnippen begrüßte, und der seinen wachsamen Blick auch über das weitläufige Schaltergelände der First Federal Bank schweifen ließ, in welches die Halle rechterhand überging. Die Bank übrigens, der ich schon mehrmals meinen vierzehntägig eintreffenden Scheck anvertraut hatte und die mich zwar mündlich und schriftlich ihrer Dankbarkeit für diesen Vertrauensbeweis versichert, ihrerseits aber wenig Vertrauen in meine finanzielle Seriosität bekundet hatte; denn immer noch vermißte ich jene ATM-Card, die mich in den Stand setzen würde, bares Geld, cash, am Geldautomaten zu ziehen, worüber die Damen hinter den Schaltertischen sich ein ums andere Mal sehr betrübt gezeigt und mit Zusicherungen nicht gegeizt hatten, während in mir der Eindruck sich verfestigte, daß sie oder ihre unsichtbaren übergeordneten Vorgesetzten die Herausgabe dieses wichtigen Dokuments absichtlich hinauszögerten, weil sie sich erst davon überzeugen wollten, daß sich der Kontostand dieser Kundin zwar geringfügig, doch stetig erhöhte und kaum Gefahr lief, einen plötzlichen Kollaps zu erleiden. Immer noch überkam mich manchmal ein Gelächter, wenn ich bedachte, wie unterschiedlich die Gründe für Mißtrauen gegen mich in den verschiedenen Gesellschaftsformationen waren, in denen ich gelebt hatte und lebte.
Jedenfalls ersparte ich es mir, zu den Bankschaltern abzubiegen, ging stracks auf die Fahrstühle zu und registrierte nicht ohne Genugtuung, daß der Pförtner – Wächter? – mich zum ersten Mal mit jener Geste begrüßte, die unter den zahllosen Besuchern dieses Hauses denjenigen vorbehalten war, die er in den inneren Zirkel der Zugehörigen aufgenommen hatte. How are you today, Madam? – O great! – Es gibt Steigerungsstufen für jedes Wohlbefinden.
Von den vier Fahrstühlen nahm ich wie immer den zweiten von links und betrachtete dann bewundernd die junge Dame aus dem staff, die mir gegenüberstand und, superschlank in ihrem knapp sitzenden Kostümchen, einen aus Goldpapier geformten Schwan, ein Geschenk, auf ihrer flachen Hand, nach oben schwebte in die höheren Sphären, in den zehnten Stock, in den ich mich nie verirrte. How are you today? – Fine, hörte ich mich sagen, Anzeichen dafür, daß neue Reflexe sich bildeten, denn vor ganz kurzer Zeit, gestern noch, hätte ich in meinem Gehirn gegraben nach einer zutreffenden schnellen Antwort, die pretty bad hätte lauten können – warum eigentlich? Darüber müßte ich später nachdenken –, aber nun hatte ich begriffen, daß von mir nichts erwartet wurde, als ein Ritual zu bedienen, das mir auf einmal nicht mehr verlogen und oberflächlich, sondern beinahe human vorkommen wollte. Elevatorsyndrom.
Wie immer stieg ich im vierten Stock aus, wo der schwarze Security-Mann mich schon mit meinem Namen anzureden wußte und mir einen Umschlag überreichte, der für mich abgegeben worden war; wo ich automatisch zum richtigen Haken im Schränkchen mit den Schlüsseln griff, Identity Card, mit meinem Foto versehen, am Jackettaufschlag zu befestigen, ein weiteres wichtiges Zeichen für Zugehörigkeit, und darauf kam es ja schließlich an.
Die zwei Treppen zum sechsten Stock ging ich manchmal zu Fuß, manchmal, wenn die Gelenke zu stark schmerzten, fuhr ich mit dem Fahrstuhl. Den Weg zwischen den Regalen, in denen die Fotos aller Kunstwerke aller Jahrhunderte und aller Kontinente archiviert sind, fanden meine Füße von allein, es passierte mir nicht mehr, daß ich einen falschen Schlüssel in eine falsche Tür steckte. Ich öffnete also die Tür zu meinem Büroraum und war schon so blasiert, daß ich nicht mehr jeden Morgen sofort an das große Fenster treten mußte, um hinter der Second Street, einer Häuserzeile und einer Palmenreihe mit einem Gefühl, das dem der Andacht nahekam, den Pazifischen Ozean hingebreitet zu sehen. Das Telefon. Es war Berlin, die Stadt war auf eine Stimme zusammengeschmolzen, die ich täglich hören mußte. Die wollte mich an die Ostsee erinnern. Die Ostsee, nun ja. Sie ist mir lieb und wert, und sie wird es bleiben, und daß ich auf Dauer eine grandiose Landschaft nicht aushalte, die Alpen etwa, das ist ja bekannt. Aber das Gefühl, daß bis Japan nichts mehr kommt, einfach nur immer diese unendliche Wasserfläche! Waren meine Gefühle übertrieben?
Ich legte meine Tasche ab, in der ich jenes Bündel Papiere mit mir herumtrug, das mir zwei Jahre zuvor nach dem Tod meiner Freundin Emma zugefallen war und das mir, das ist nicht zuviel gesagt, auf der Seele brannte: Briefe einer gewissen L., von der ich nichts wußte, als daß sie in den USA gelebt hatte und mit meiner Freundin Emma, deren Altersgenossin sie war, eng befreundet gewesen sein mußte. Auch dieser Briefe wegen war ich hierhergekommen und wiegte mich in der Illusion, hier müßte es möglich sein, herauszufinden, wer diese »L.« eigentlich war.
Ich ging zum Zentrum des office, winkte im Vorübergehen in offene Türen, wo meine Kollegen auf Zeit in ihren Zellen an ihren Computern saßen, wenn sie nicht irgendwo in dem weitläufigen Gebäude in der Bibliothek oder in Archiven eine Spur verfolgten oder sich in der Stadt mit anderen Wissenschaftlern trafen. Manchmal beneidete ich sie um ihr fest umrissenes Arbeitsprofil, auf Anhieb konnten sie ihr Fach benennen, Architekturgeschichte oder Philosophie oder Literatur- und Kunstwissenschaft, Filmgeschichte, sogar Literatur des Mittelalters kam vor, und sie alle konnten auch ohne weiteres das Thema der Arbeit hersagen, die sie hier zu befördern dachten. Während ich durch eine Frage nach meinem Arbeitsvorhaben in Verlegenheit geriet, oder sollte ich zugeben, daß ich nichts in der Hand hatte als ein Bündel alter Briefe von einer Toten und daß ich einfach neugierig war auf deren Urheberin, die vor Jahren, als sie diese Briefe an meine ebenfalls verstorbene Freundin Emma schrieb, in dieser Stadt gelebt haben mußte? Und daß mir die Einladung hierher eben auch deshalb zupaß gekommen war und ich nun das Privileg in Anspruch nahm, daß man von einer Autorin belletristischer Bücher nicht allzu genaue Auskunft über ihr Projekt verlangen durfte. Mir aber kam es sehr wahrscheinlich vor, daß ich mit meinem Vorhaben glück- und erfolglos bleiben würde, und auch jetzt noch erscheinen mir die Zufälle unglaublich, die mich am Ende, jedenfalls bei diesem Projekt, zu Glück und Erfolg geführt haben. Wenn ich diese unpassenden Wörter ausnahmsweise einmal benutzen will.
Am wenigsten peinlich waren mir übrigens meine Ausweichmanöver, die ich vielleicht nur selbst so empfand, gegenüber den beiden Sekretärinnen der Abteilung, Kätchen und Jasmine: die eine mittleren Alters, eher unscheinbar vom Äußeren, doch kundig und erfahren in allen Angelegenheiten, die das CENTER betrafen, absolut zuverlässig und diskret und versiert in jenen technischen Fertigkeiten, bei denen gerade ich am Anfang häufig Hilfe brauchte, und, was wir alle zu schätzen wußten, teilnahmsvoll bei Nöten und Bedrängnissen, die etwa ein Mitglied unserer community betrafen. Die andere, Jasmine, blond und jung und rank und schlank und den Blicken der Männer ein Wohlgefallen, war zuständig für unser leibliches Wohlergehen, für den Postein- und -ausgang und für alle Angelegenheiten außerhalb des Hauses, also die Vermittlung von Treffen mit anderen Personen aus der Stadt, wozu Einladungen in dieses oder jenes Restaurant durch einen der scholars gehörten, denn die Mitarbeiterinnen der Abteilung wußten sich verantwortlich dafür, daß die Neuankömmlinge sich in dieser Fremde bald zu Hause fühlten.
Ich nahm die Post aus meinem Fach, Jasmine reichte mir ein paar Zeitungen, und Kätchen sagte, auf die Anfrage, die sie auf meine Bitte hin an die libraries der Universität und der Stadt gerichtet habe, sei noch keine Rückmeldung gekommen. Aber es sei sowieso unwahrscheinlich, daß es dort oder an irgendeiner anderen Stelle ein vollständiges Verzeichnis der deutschen Emigranten geben werde, die in den dreißiger und vierziger Jahren hier Zuflucht gefunden hätten. Obwohl, sagte Lutz, mein um vieles jüngerer Landsmann, Kunstwissenschaftler, der nebenan am Kopierer arbeitete, obwohl das schier Unmögliche hier möglich sei, wo, wenn nicht hier. Er nannte gleich ein Beispiel dafür, wie er das Foto von einem Gemälde eines lange vergessenen und gerade wiederentdeckten Malers, den er sich zum Arbeitsgegenstand erwählt hatte, ganz einfach hier im Archiv gefunden habe, nachdem alle Archive Europas es als verschollen gemeldet hatten. Ja gut, sagte ich, ein wenig verlegen, aber ich kenne von der gesuchten Person ja nicht einmal den Namen. Ich kenne ja nichts weiter als eine Initiale, wahrscheinlich von ihrem Vornamen, und diese sei L. Ja dann, sagte Lutz, dann sei das allerdings ein besonders schwieriger Fall. Dann wisse auch er nicht so recht weiter, sagte er, während wir zur Lounge gingen, weil inzwischen Teezeit war und die anderen sich auch dort versammeln würden.
In der Lounge, wo eine riesige Glaswand das kalifornische Licht ungefiltert hereinließ und den Blick auf den Pazifischen Ozean lenkte und auf den Lauf der Sonne in ihrem großen Bogen von links nach rechts, ein Bild, das mir jedesmal den Atem nahm und das seitdem öfter als jedes andere Bild aus jenem Jahr vor meinem inneren Auge ersteht – dort saßen sie, ein jeder hinter der Zeitung seines Herkunftslandes. Wohltätige Gewohnheiten begannen sich auszubilden. Hi! grüßte ich, hi! kam es hinter den Zeitungen zurück. Es gab schon etwas wie Stammplätze, der meine war, zufällig oder nicht, zwischen den beiden Italienern, Francesco, der über Architektur arbeitete, und Valentina, die zu einem kurzen Aufenthalt gekommen war, um ihre Studien über eine antike Figur im berühmten Museum des CENTER abzuschließen. Sie hatte mir meine Tasse hingestellt, die Thermoskanne mit Tee in Reichweite, die deutsche Zeitung, die man hier abonniert hatte, auch. Ich bedankte mich bei ihr mit einem Blick. Mit ihrem braunen lockigen Haar und der in allen Farben zusammengesetzten Patchwork-Jacke war sie wieder einmal besonders schön. Wie immer, wenn wir uns begegneten, strahlte sie mich entzückt an. Ich goß mir also Tee ein, entfaltete meine Zeitung und las, was vor drei, vier Tagen in Deutschland des Berichtens für wert befunden worden war. Las also, daß ein Kollege, der unser Land wenige Jahre vor dessen Zusammenbruch hatte verlassen müssen, aber doch etwas wie ein Gesinnungsgenosse gewesen war, sich nun als radikaler Kritiker zeigte all derer, die in der DDR geblieben waren, anstatt dieses Land ebenfalls mit Abscheu zu verlassen. Ich las, er warf der »Revolution« vom Herbst 1989 vor, daß sie unblutig verlaufen war. Köpfe hätten rollen müssen, las ich, und daß wir zu zaghaft und zu feige gewesen seien. Das schrieb einer, dessen Kopf jedenfalls nicht in Gefahr gewesen wäre, dachte ich, und ich merkte, wie ich in meinem Innern eine Diskussion mit diesem Kollegen anfing.
Ich erinnerte mich – und erinnere mich noch heute – an deine Erleichterung, als dir am Morgen des 4. November 1989 rund um den Alexanderplatz in bester Stimmung die Ordner mit den orangefarbenen Schärpen entgegenkamen, auf denen stand: KEINE GEWALT! In der Nacht davor wurde bei einem Treffen, an dem du teilnahmst, das Gerücht verbreitet, Züge mit als Arbeiter verkleideten Stasi-Leuten seien in Richtung Hauptstadt in Fahrt gesetzt, um die friedlich Demonstrierenden zu provozieren und den bewaffneten Kräften einen Vorwand zum Eingreifen zu liefern. Eine Art Panik ergriff dich, du riefst die Tochter an, sie möge die Kinder nicht mit auf den Alexanderplatz bringen, aber die hatten längst ihre Transparente gemalt: SCHULE WERDE SPANNENDER! und GORBI HILF UNS!, und sie würden nicht mehr zurückzuhalten sein. Du gingst deine Rede Wort für Wort noch einmal durch. Ihr spracht nicht davon, aber ihr dachtet an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Die Vorstellung, ihr könntet zu naiv, zu leichtfertig in eine Falle gelaufen sein, lastete auf dir, aber je mehr Demonstranten aus den U-Bahnschächten auf den Platz strömten, ihre Transparente und Schilder aufrichteten, sich zum Demonstrationszug formierten, ohne Anweisungen zu brauchen, um so sicherer warst du, daß nichts passieren würde. Du konntest nicht wissen, ihr alle wußtet nicht, daß auf den Dachböden öffentlicher Gebäude Unter den Linden kompanieweise Volksarmee stationiert war, mit scharfer Munition. Für den Ernstfall. Falls die Demonstranten die vereinbarte Route verlassen und zum Brandenburger Tor durchbrechen sollten, zur Staatsgrenze West. Und was du erst später erfuhrst: daß einer der Söhne einer Kollegin dort oben in Uniform auf einem der Dachböden lag, während der andere im Demonstrationszug unten vorbeizog.
Aber hätten die Soldaten überhaupt geschossen? Einige Monate nach diesem Tag, die Grenzen waren längst offen, die Hochstimmung war verflogen, die Realität, die anscheinend immer ernüchternd sein muß, war auf dem Vormarsch, gingst du mit Einkaufsbeuteln bepackt in deinem Stadtviertel nach Hause, als ein jüngerer Mann dir nachlief und dich dringlich bat, mit ihm und zwei seiner Kameraden, alle drei Offiziere der Nationalen Volksarmee in Zivil, einen Kaffee zu trinken. Ihr saßet in einem Vorgartencafé, es müssen die ersten wärmeren Tage gewesen sein, die drei hatten bis zum Fall der Mauer die Staatsgrenze West bewacht, von der sie nun, da sie dort nicht mehr gebraucht würden, abgezogen worden seien, um an die polnische Grenze verlegt zu werden, was sie aber auf keinen Fall wollten, da sie ihre Familien, ihre Wohnungen oder kleinen Häuschen hier in Berlin hätten, und überhaupt: Die Truppe werde reduziert. Was dann mit ihnen werden solle. Wo sie doch mit dafür gesorgt hätten, daß in der Nacht vom 9. November an der Mauer kein Schuß gefallen sei. Sie, ein Hauptmann und zwei Leutnants, hätten, als die Massen auf die Grenzübergänge zugeströmt seien und sie keinen Vorgesetzten erreichen konnten, der ihnen Befehle erteilt hätte – sie hätten da bei ihrer Einheit die Munition eingesammelt, damit ja nichts passieren konnte. Warum sie das gemacht hätten, fragtest du. Sie sagten: Eine Volksarmee schießt doch nicht auf das Volk. – Hut ab, sagtest du. – Und das sei nun alles, was sie dafür kriegen würden? – Ich fürchte ja, sagtest du. – Dann seien sie, sagten die drei, die Verlierer der Einheit.
Die Lounge. Bruchteile von Sekunden war ich abwesend, die Erinnerung übertrifft das Licht an Geschwindigkeit. Ich würde den Zeitungsartikel meines Kollegen kopieren und ihn zu den anderen Ausschnitten und Kopien in das Regal in meinem Apartment legen, ein Stapel, der schnell wuchs, den ich über den Ozean mit zurücknehmen würde, per Luftfracht, um ihn zu Hause auf ähnliche, allerdings ungleich größere Stapel zu legen, unnütze Staubfänger, die aber irgendwann einmal gebraucht werden könnten, um eine Erinnerung zu stützen, der ich sonst nicht trauen würde. Nicht mehr trauen könnte. Für den Notfall. Obwohl mir bewußt war, daß das Gedächtnis, welches die Zeitungen mir lieferten, für meine Arbeit höchstens den Wert einer Prothese hatte.
Francesco stöhnte über seiner italienischen Zeitung. Die Politiker richten uns zugrunde, sagte er, diese Verbrecher. Mein Land versinkt in Korruption. Ich zeigte ihm meinen Artikel, er las ihn kopfschüttelnd. Sind denn alle verrückt geworden, sagte er, ich hoffe, du nimmst dir diesen Unsinn nicht zu Herzen. Ich sagte ihm nicht, was ich mir zu Herzen nahm. Er sagte, wie sehr er sich wünschen würde, auch einmal eine Revolution zu erleben. Wie er sich vorstelle, daß das Lebensgefühl eines Menschen, das unser Alltag doch je länger je mehr erdrücke, durch eine solche Erfahrung dauerhaft verändert, er denke: befeuert würde.
Ich überwand meine mir selbst nicht ganz verständliche Abneigung, über jene Tage zu sprechen. Ich sagte, ja, daß ich das erleben, daß ich teilnehmen durfte an einer der seltenen Revolutionen, welche die deutsche Geschichte kennt, das habe mir jeden Zweifel darüber genommen, ob es richtig gewesen sei, in dem Land geblieben zu sein, das so viele mit Grund verlassen hätten. Nun sei ich sogar froh darüber. Aber irgendein Defekt, mit dem ich anscheinend behaftet sei, verhindere, daß ich bei sogenannten historischen Ereignissen die ihnen angemessene Stimmung empfände. An jenem 4. November zum Beispiel, sagte ich, ein Tag für Hochgefühl, überfiel mich mitten in meiner Rede vor den Hunderttausenden, die auf dem Platz standen, meine mir wohlbekannte Herzrhythmusstörung, welche die Ärzte partout nicht mit psychischen Erlebnissen in Zusammenhang bringen wollten, und ich mußte mit einer der am Rand der Demonstration bereitgestellten Ambulanzen in die nächste Klinik gebracht werden, in der alles vorbereitet war für die Aufnahme vieler Patienten. Ich aber war die erste und einzige, die eingeliefert wurde, und ich traf auf ein Team von Ärzten und Schwestern, die mich für eine Erscheinung hielten, weil sie mich eben noch quicklebendig auf dem Bildschirm gesehen hatten. So lag ich denn für den Rest der Veranstaltung auf einer Liege in einer Notaufnahme und wartete die Wirkung einer Spritze ab. – Soviel, lieber Francesco, in Sachen Lebensgefühl. Wir lachten. Ich versprach, an der Tour teilzunehmen, die Francesco für den nächsten Tag organisiert hatte und die uns zu einer modernen Kunstinstallation führen sollte.
Pat und Mike, die jungen Amerikaner mit ihren Clinton-Buttons an der Bluse, Assistenten unserer Abteilung, brüteten über der »New York Times« vom Wochenende, welche die Wahlchancen der Demokraten vermindert sah. Mike sagte düster: If Clinton doesn’t win, I have to leave my country. – Why that? – Die beiden, die jeden Abend im Wahlkampfbüro der Demokraten arbeiteten, erklärten mir, wie schwer es Liberale, nicht zu reden von Linken! in den letzten Jahren gehabt hätten, einen angemessenen Job zu finden, wie stockig und niederziehend, auch denunziatorisch, die Atmosphäre in den öffentlichen Ämtern, bis in die Universitäten hinein, geworden sei, wie man habe abwägen müssen, mit wem man noch offen sprechen konnte, und daß junge Leute wie sie überhaupt keine Perspektive gehabt hätten, ohne sich bis zur Selbstverleugnung anzupassen. Davon höre man im Ausland wohl wenig? – In der Tat, sagte ich.
Dann aber versammelten wir uns alle zum Schauspiel des Sonnenuntergangs über dem Pazifik, ein Ritual, das nicht verabredet war, aber meistens eingehalten wurde, und die Sonne machte aus ihrem Untergang etwas Besonderes, eine Steigerung, die wir nicht für möglich gehalten hätten, und wir sahen stumm ihrer Inszenierung zu, bis jemand den Einfall hatte zu sagen: God exists.
Das Licht! Ja, das Licht, würde ich zuerst sagen, wenn jemand mich fragte, wonach ich mich sehne, wenn ich zurückdenke. Die endlosen palmenumsäumten Straßen, die direkt in den Ozean zu münden schienen, wie der Wilshire Boulevard, den ich oft und oft hinauf- und hinuntergefahren bin. Und, ja, auch das ms. victoria würde mir einfallen, in das ich mich allmählich verliebte, als ich begriffen hatte, daß es ein magischer Ort war. Ganz überraschend war es nicht, daß das Erdbeben, das Los Angeles wenige Jahre nach unser aller Abreise heimsuchte, dieses alte, etwas morsche Gebäude im spanischen Stil bis zur Unbrauchbarkeit beschädigte. Es war nicht so einfach, dahinterzukommen, »how it works«, aber dann mußte man es mit Humor nehmen, von welcher Behausung könnte man das sonst sagen? Einige der Bulletins von der unsichtbaren Managerin des Hotels, die uns regelmäßig unter der Tür durchgeschoben wurden, habe ich aufgehoben, Warnungen zumeist: Wir sollten zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit darauf richten, daß die Außentür allzeit geschlossen bleibe. Daß wir niemals, unter keinen Umständen, fremden Personen diese Tür zu öffnen hätten, denn wir fänden uns doch sicherlich mit ihr vereint in dem Bedürfnis nach Sicherheit, besonders in diesen von Mrs. Ascott nicht näher bezeichneten Zeiten. Da hatte noch niemand von uns die Managerin zu Gesicht bekommen, aber ein Bild von ihr hatte sich vor unseren Augen schon entwickelt, eine strenge, in graue Kostüme gekleidete Frau mittleren Alters mit straff zusammengesteckten Haaren. Natürlich mußten wir, um das ms. victoria lebensfähig zu halten, ihre Anweisungen unterlaufen, zum Beispiel ein Netzwerk einrichten für den Fall, der selten, aber eben doch vorkam, daß abends ein verspäteter Gast vor der Tür stand, die ihm unerbittlich verschlossen bleiben sollte, und der, je nach Alter und Geschlecht, entweder bei Emily, der amerikanischen Filmwissenschaftlerin, die über mir wohnte, oder bei Pintus und Ria, den jungen Schweizern, die unter mir wohnten, oder eben bei mir ein Nachtquartier fand.
Es stellte sich heraus, daß man Menschen eher einschmuggeln konnte als Tiere. Eines Tages prangte ein großes Schild: NO PETS!, an der geheiligten Außentür, und Mrs. Ascott, die Urheberin dieses Schildes, nahm es verteufelt ernst mit dem Haustierverbot, wie ich von Emily erfuhr, die keine einzige ihrer geliebten Katzen hatte mitbringen dürfen.
Da hatte ich sie immer noch nicht zu Gesicht bekommen, unsere Mrs. Ascott, und als ich eines Tages eine hinfällige alte Dame in den riesigen weißen Cadillac einsteigen sah, der zu unserem Ärger auf Dauer die eine Hälfte der Garageneinfahrt blockierte, wäre mir nicht im Traum eingefallen, in dieser Dame Mrs. Ascott zu vermuten, die ja schließlich den Titel »Manager« trug, also, wie ich dachte, funktionstüchtig zu sein hatte und das offensichtlich auch war, denn die Gruppe von zumeist puertoricanischen Reinigungskräften, die zweimal in der Woche mein Apartment saubermachte und die Wäsche wechselte, eine Frau und zwei Männer, arbeitete auch sonntags, und die Frau, eine Schwarze mit kurzem krausen Haar, kräftigem Busen und ausladenden Hüften, die ich fragte, ob dies denn nötig sei, verdrehte die Augen und sagte in ihrem harten mühsamen Englisch, Mrs. Ascott sei »not good«. Da nahm ich mir vor, auf den monatlichen Fragebögen, die das Management ausgab und in denen nach der Qualität der Reinigungskräfte gefragt wurde, mein Kreuzchen ausnahmslos hinter die Note »excellent« zu machen. Ja, excellente Reinigung von living room, bedroom, bathroom und kitchen, Mrs. Ascott. Wenn Sie wüßten, wie egal mir das ist.
VOM ENDE HER ERZÄHLEN
VOM ENDE HER ERZÄHLEN kann auch ein Nachteil sein, man kommt in die Gefahr, sich unwissender zu stellen, als man ist, zum Beispiel, was Mrs. Ascott betrifft, die ich unvermeidlicherweise doch eines Tages treffen mußte, falls das der richtige Ausdruck ist für unsere erste Begegnung. Eines Morgens huschte aus der Apartmenttür, die auf dem Treppenabsatz der meinen gegenüberlag, ein hageres weibliches Wesen mit zerzaustem weißen Haar, in einen groß geblümten Morgenrock gehüllt, vor mir die Treppe hinunter, ich erkannte die Cadillacfahrerin, die mit flinken leichten Schritten die im spanischen Kolonialstil gehaltene, etwas verstaubte Eingangshalle durchquerte und schnurstracks auf den kleinen mexikanischen Herrn zustrebte, der an einem schalterähnlichen Tischchen saß und den Hausmeister darstellte, »Herr Enrico«, geschätzt und beliebt bei allen Bewohnern des ms. victoria. Zu meiner Verwunderung erhob sich der, als die merkwürdige Dame sich ihm näherte, und empfing in nicht gerade unterwürfiger, doch achtungsvoller Haltung Anweisungen von ihr. Dies konnte also nur Mrs. Ascott sein. Sie beschenkte mich, als wir uns nun endlich in der Halle begegneten, mit einem fahrigen Blick aus ihren wäßrig blauen Augen, zum ersten Mal hörte ich ihr übertrieben freundliches, mit hoher zittriger Stimme ausgestoßenes »Hi!« und gewann den Eindruck, daß diese Hotelmanagerin nicht die blasseste Ahnung hatte, wer ihr da in ihrem Hotel entgegenkam und was sich unter dem Dach, unter dem sie für Ordnung sorgen sollte, überhaupt zutrug.
Beweisen könnte ich es nicht, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß ich alle Einladungen, noch einmal in diese Stadt zurückzukehren, in den letzten Jahren nicht zuletzt deshalb abgelehnt habe, weil ich das ms. victoria nicht als halbzerstörte Ruine oder als ein neu errichtetes modernes Gebäude antreffen wollte. Wie ich mir vorstellen kann, daß frühere europäische Gäste der Stadt New Orleans nicht mehr dorthin fliegen wollen, nachdem sie diese Stadt in Fernsehbildern überflutet gesehen haben, ihre ärmsten Bewohner bis zur Brust durch verseuchtes Wasser watend. Aber darin habe ich mich wohl getäuscht.
Ehe ich dazu übergehe, einige der wichtigen Personen einzuführen, die meinem Aufenthalt Spannung geben sollten, muß ich mich erinnern, womit ich meine Zeit verbrachte, wenn ich nicht allein oder mit Kollegen unterwegs war, um in die Stadt einzudringen oder ihre Vorteile zu genießen. Da ich mein eigentliches aberwitziges Projekt, eben jene L. ausfindig zu machen, deren Briefe an meine Freundin Emma ich mit mir herumtrug, nicht näher diskutieren wollte, mußte ich Arbeit vortäuschen. Also setzte ich mich, wie alle anderen, mehrere Stunden am Tag in mein Büro, dessen Tür offenblieb wie die Türen der anderen auch, und fuhr damit fort, meine Tage hier getreulich und ausführlich zu dokumentieren, auf meinem elektrischen Maschinchen, einer BROTHER, die ich mir überflüssigerweise mitgebracht hatte, weil ich sie für ein Übergangsmodell zum Computer hielt und mich an die echten Computer noch nicht herantraute, die hier natürlich allen zur Verfügung standen und von den anderen auch genutzt wurden. Die Tatsache, daß ich die Älteste war, ließ man großzügig als Entschuldigung für meinen blamablen Rückstand in technischen Fertigkeiten gelten, den ich allerdings später aufholte. Jedenfalls saß ich immer arbeitsam vor meinem Maschinchen und merkte schnell, daß die Zeit, die mir zur Verfügung stand, für diese ausführlichen Tagesprotokolle kaum ausreichte. Sie, die Protokolle, häufen sich jetzt um mich herum auf verschiedenen provisorischen Tischen, werden aber weniger häufig als Gedankenstütze herangezogen, als man denken sollte. Übrigens schrieb ich ja auch Gedankensplitter auf, Überlegungen, die mit den Tagesnotizen scheinbar nichts zu tun hatten. So finde ich gerade, in Kapitälchen geschrieben:
die stadt kannst du wechseln, den brunnen nicht. das soll ein altes chinesisches sprichwort sein, es kommt mir sehr nahe, aber stimmt es überhaupt, hat es eigentlich einen sinn. und widerspricht es nicht dem losungswort, das mich heimlich hierherbegleitet hat und das anscheinend distanz heisst.
Der Mensch ist geheimnisvoll, sagte die Stimme am Telefon, und wenn wir solche Familiensätze wechselten, ging es mir im allgemeinen gut, natürlich geht es mir gut, wie denn sonst. Und warum und wovon Distanz?
Eine Krise soll ja auch ihre Vorteile haben, jedenfalls behaupten das Leute, die gerade nicht in einer Krise stecken. Der Hauptvorteil einer Krise sei es, den von ihr Befallenen in Zweifel zu stürzen. Zum Beispiel: Die uralte Tatsache, daß von allem, was gleichzeitig geschieht und gedacht und empfunden wird, in dem linearen Schriftzug auf dem Papier nicht gleichzeitig die Rede sein kann, macht mir plötzlich wieder so zu schaffen, daß der Zweifel an der Wirklichkeitstreue meiner Schreibarbeit sich zu schierer Schreibunmöglichkeit auswachsen kann.
Warum habe ich die drei Racoons noch nicht erwähnt, die manierlichen Waschbären, die ich doch viel früher kennengelernt habe als Mrs. Ascott? Sie waren mir etwas unheimlich, wie sie da auf dem Plattenweg vor dem Eingang des ms. victoria hockten, mich mit ihren runden, hell umränderten Augen unverwandt anstarrten und gar keine Anstalten machten, zurückzuweichen, bis ich sie mit einem Händeklatschen verscheuchte.
Du denkst doch sicher daran, hierzubleiben, sagte Francesco, unser Italiener. Da saß ich neben ihm in seinem uramerikanischen extravaganten holzverkleideten Cabriolet, mit dem er sich einen Jugendtraum erfüllte, und wir fuhren nach einem frühen schnellen Sonnenuntergang auf einem der Freeways lange, lange gen Osten, um die Installation eines Künstlers zu besichtigen, den Francesco »berühmt« genannt hatte. Ich kannte ihn nicht, hatte mich einfach mit den anderen scholars in der Tiefgarage des ms. victoria versammelt, wo wir uns auf drei Autos verteilten. Ich fuhr einfach mit, wie ich immer mitfuhr, wenn sich eine Gelegenheit dazu bot, weil die Stadt, das Monster, anfing, einen Sog auf mich auszuüben, den ich noch nicht wahrhaben wollte. Und nun erschreckte mich Francesco mit seiner Vermutung, oder Aufforderung, hier zu bleiben.
Ich? Hierbleiben? Aber wie kommst du darauf?
Die meisten von uns denken, du wärst dumm, wenn du es nicht tätest. Wenn du jetzt zurückgingest. In diesen deutschen Hexenkessel.
Ihr meint, ich soll emigrieren?
Auf Zeit. Übrigens wohnen wir ja in der Stadt der Emigranten.
Kannten die anderen mich so wenig? Oder sahen sie meine Lage realistischer als ich selbst? Ich konnte nicht voraussehen, wie oft Francescos Frage mir noch gestellt werden würde. Und wie sie als Behauptung weiter kolportiert werden würde.
Die harte Poesie der Freeways, im Abendlicht. Mit Genuß fädelte Francesco sich in den Verkehr ein, während er versuchte, mir den Kauf dieses extravaganten Autos mit der Infektion durch Begierden zu erklären, die er sich als Jugendlicher durch eine Überdosis an amerikanischen Filmen zugezogen habe. Ich sah Francesco von der Seite an: tiefschwarzes, über der Stirn etwas störrisches Haar, eine große gerade Nase, alles sehr männlich, Ines, die hinter uns saß, gab einen Ton von sich, der Zweifel bedeuten konnte, Mißfallen, aber auch überlegenes Gewährenlassen. Sie war die Schönste von uns, fand ich, mit ihrem gemmenhaft geschnittenen Gesicht und dem schwarzen Haarbusch, der nicht zu bändigen war.
Rush hour. Wir mußten ein Bestandteil dieses tausendäugigen Fabelwesens werden, das, auf je fünf Spuren, in zwiefacher gleichartiger Gestalt einander entgegen und scheinbar um Haaresbreite aneinander vorbeiraste, wir mußten uns einfühlen in die vor uns, hinter uns, rechts und links neben uns mitfahrenden anderen Bestandteile dieses Wesens, das uns alle beherrschte und das jede Eigenbewegung, jeden Fehler grausam bestrafte, wie es uns Abend für Abend auf dem Bildschirm vorgeführt wurde. Die ineinander verkeilten Karossen, die im Schockzustand weggeführten oder als Verwundete, als mit einem weißen Laken bedeckte Tote auf Bahren weggetragenen Insassen dieser Schrotthaufen, als untauglich ausgespien, als weichliche Versager den Härtetest nicht bestanden, dem wir uns, dachte ich, arglos und leichtfertig ohne Not aussetzten.
Die gleichförmige Bewegung, in die wir eingeschlossen waren, übte eine hypnotische Wirkung auf mich aus und versetzte mich in einen leichten Trance-Zustand, in dem Francescos Worte mich nur gedämpft erreichten: Bei dieser Installation, zu der wir unterwegs waren, handle es sich um etwas sehr, sehr Modernes, aber daß dieses verdammte College, dem wir zustrebten, so weit draußen liegen würde, hätte er auch nicht gedacht. Längst hatte er die Scheinwerfer angeschaltet, mit unzähligen Lichtern warf sich uns nun das Ungeheuer Verkehr entgegen. Jetzt erst tauchte linkerhand Downtown auf, eine Fata Morgana, Lichtertürme in bizarren Formen. Zu denken, sagte Francesco, daß es das vor zwanzig Jahren noch nicht gab, daß Los Angeles ein platter Pfannkuchen war, städtebaulich gesprochen. Aber diesem Eindruck konnte man auch heute noch leicht erliegen, dachte ich, wenn nämlich Downtown sich langsam vorbeigedreht hatte und sich endlos nach beiden Seiten die manchmal an Laubenkolonien erinnernde flache Stadtlandschaft ausbreitete, aus der nur die Säulen der Palmstämme mit ihren zerzausten Blattwedeln aufragten. Was die für Platz haben zum Bebauen und Verbauen, aus Francesco sprach der Architekt.
Es war ganz dunkel geworden. Ines fragte sich, ob Francesco nicht doch die Abfahrt verpaßt habe, Francesco widersprach gereizt, da überholten uns auf der linken Spur Ria und Pintus, unsere Jüngsten, kenntlich an ihrem schnittigen grellroten Wagen und an Pias Ledermützchen. Sie machte verzweifelte Gesten über die Endlosigkeit der Fahrt. Dann tauchte plötzlich auf dem Wegweiser über uns der Name der Abfahrt auf, die wir suchten, jetzt mußte Francesco schnell auf die rechte Spur kommen, mußte darauf hoffen, daß die anderen Fahrer ihn alle anderen Spuren überqueren lassen würden. Sie taten es, sie taten es fast immer, Amerikaner lassen ihren Frust nicht beim Autofahren aus – dafür haben sie zu Hause ihre Waffen, you see, wird eine Amerikanerin mir einmal erklären. EXIT ONLY, es war kaum zu glauben, wir waren auf der richtigen Straße, fanden die richtige Abbiegung, gerieten in dunkles Gelände, umfuhren suchend einen Häuserblock, sahen Pintus und Ria vor einem erleuchteten Hauseingang aussteigen, da hielt auch das Auto mit unseren vier anderen Combattanten, Hanno, dem leidenschaftlichen Pariser, der in einer grundlegenden Arbeit die Städte Paris und Los Angeles vergleichen wollte, und Emily, der einzigen Amerikanerin unter uns, die sich unaufhörlich ärgerte über ihr scharfgeschnittenes Profil, das wir alle bewunderten, ebenso wie ihre überaus klugen Essays über den amerikanischen Film. Lutz, mein Landsmann aus Hamburg, hatte mir gestanden, daß er nur aus Höflichkeit mitkam, diese sogenannte Moderne sei seine Sache nicht, während Maja, seine Frau, die lose Kleider liebte, überall erschien, wo es für sie etwas Neues gab, und am Ende mehr über Los Angeles wußte als jeder andere von uns. Die ganze Bande, sagte jemand.
Wir traten ein. Eine Studentin erwartete uns, ein Mädchen mit japanischem Gesichtsschnitt, das uns durch verschachtelte, teilweise von Bauzäunen gebildete Gänge zum Objekt unserer langen Fahrt, jener berühmten Installation, führte: Ein quadratischer Raum, durch schnell aufgestellte Wände aus leichtestem Material erschaffen, an zwei gegenüberliegenden Seiten waren Sitz- und Liegeflächen entstanden, indem man verschieden hohe graue Blöcke übereinandergestapelt hatte, auf denen der Besucher sich niederlassen sollte, um dann den Blick an den stumpfroten, indirekt beleuchteten Wänden hinaufzuschicken, zur Decke hin, in der ein zwei Quadratmeter großes viereckiges Loch ausgespart war, ein Himmelsloch, das eigentliche Ereignis dieser Installation: Tiefschwarzer Nachthimmel, in den man mit in den Nacken gelegtem Kopf so lange blicken sollte, bis man etwas sah. Der Künstler wolle mit dieser Aufstellung sein Publikum sehen lehren, erklärte Francesco. Lutz, spezialisiert auf die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. Okay, sagte Pintus, der sich sonst mit der Literatur des Mittelalters beschäftigte, wolln mal sehn. Der Spott in den Mienen der meisten war deutlich, nur gezügelt durch die Anwesenheit der japanischen Studentin, die vollkommen ungerührt blieb. Ziemlich hart, diese Sitze, sagte Ines noch, und Ria bemängelte, daß wir nicht mal Sterne sehen würden. Sie nahm ihr Ledermützchen ab und drängte sich in eine Ecke. Nur Emily, deren Arbeitsgebiet auch der Fantasy-Film war, blieb still und aufmerksam, als erwarte sie etwas Außergewöhnliches.
Okay. Ich legte mich auf einen der grauen Blöcke und blickte hoch zu dem Himmelsloch. Die Schwärze begann, so schien mir, nach einiger Zeit zu wabern. Das nichtende Nichts, sagte ich. Schweigen. Anscheinend kamen wir alle allmählich zur Ruhe, aber was hieß das eigentlich, fragte ich mich. Francesco würde sich vielleicht für eine kurze Zeitspanne durch Ines’ Ungenügen an ihrem gemeinsamen Leben nicht bedroht und nicht schuldig fühlen und von der Spannung befreit sein, die ihn sonst dazu zwang, aufzutrumpfen. Ines würde für eben diese kurze Spanne soviel Zutrauen zu sich selbst gewinnen, daß sie nicht Francesco verantwortlich machen mußte für ein Versagen, das nur sie an sich, niemand sonst an ihr wahrnahm. Ria würde ihr Ledermützchen nicht immer wieder in den Ring werfen müssen, und Pintus würde nicht immer erneut loslaufen müssen, um es als erster herauszuholen – eine Übung, deren beide müde geworden sein müssen, sie trennten sich später, ich erfuhr es erst neulich. Hanno, dachte ich weiter, mochte sich von dem Zwang befreit fühlen, durch geschliffene Formulierungen und elegante Kleidung seine großstädtische Überlegenheit darzutun.
Und ich? Ich selbst?
Allmählich lösten die Bedeutungen sich auf. Das dunkle Himmelsviereck übte einen Sog auf mich aus, es erinnerte mich an das viereckige Löwentor von Mykene, hinter dem für die Besiegte die Dunkelheit lauerte, jene endgültige Dunkelheit, von der mein nachtdunkles Himmelsviereck nur einen schwachen Vorgeschmack gab, doch nahm es mich mit, die Sinne schwanden, die Sinne schwinden, dachte ich noch, in mich gehen, warum denn nicht, tiefer, noch tiefer, die endgültige Dunkelheit, erwünscht, ja, manchmal erwünscht, die befreien würde von dem Zwang, alles sagen zu müssen. In diesen Schacht nicht wieder, das kann niemand verlangen, aber wer sagte mir denn, daß ich mich nach dem richten müßte, was andere verlangten, richten, ein schönes Wort, ich liebe diese doppeldeutigen Wörter, sich richten, gerichtet werden, das ist richtig. Gerechtigkeit, du Donnerwort. Tiefer. Noch tiefer. In den Wirbel gerissen, ausgespien werden. Stille. Im Auge des Orkans ist es am stillsten. Jetzt fallen lassen. Haltlosigkeit, ein Fallen ins Bodenlose.
He, aufwachen!
Aber ich habe doch gar nicht geschlafen!
Sah aber verdächtig danach aus. Hast du wenigstens geträumt.
Ich glaube ja.
Und jetzt fahren wir noch zum Chinesen. Hast du Lust?
Lust, gegen Mitternacht zum Chinesen zu fahren? Ich hatte immer Lust, erinnere ich mich. Die Platte mit den verschiedenen Speisen drehte sich inmitten des großen runden Tisches, angestoßen von unseren Händen. Ja, sie hatten recht: Dies war der beste Chinese in der ganzen großen Stadt. Es war spät, wir waren die letzten Gäste an unserem Tisch, der unser Stammtisch werden sollte. Der Besitzer des schlichten Lokals und seine zierliche Frau bedienten uns mit gleichbleibender undurchdringlicher Höflichkeit, mit jenem kleinen Lächeln, das abweisend oder einladend sein konnte, und mit einer Geschicklichkeit, die uns Europäern unerreichbar ist. So würde es jedesmal sein, so ist es jedesmal gewesen, wenn wir den langen Weg zu diesem entlegenen Lokal auf uns nehmen würden, auf uns genommen hatten. Wir priesen uns gegenseitig die verschiedenen Gerichte an, die wir bestellt hatten, wir kosteten von allen, wir tranken Reiswein, wir waren in guter Stimmung.
Da kam Pintus auf die unselige Idee, mich zu fragen, merkwürdigerweise, wahrscheinlich aus Verlegenheit, auf Englisch: What about Germany?
Die Frage hatte ich fürchten gelernt, sie bedeutete immer dasselbe: Wie erklärst du dir und uns die Fotos aus deutschen Städten, von denen die Zeitungen hier voll sind: Brennende Asylantenheime, antisemitische Inschriften an Häuserwänden, ein mit Eiern beworfener Präsident während einer Demonstration gegen Rassismus. Da waren alle eindringlich forschenden Blicke auf mich gerichtet und machten es mir unmöglich, einfach zu sagen: Aber ich weiß doch auch nicht. Ich kann es doch selbst nicht erklären. Es überrascht mich doch beinahe genauso wie euch.
Aber auf dieses Beinahe kam es vielleicht gerade an. Denn hättest du nicht seit dem Tag, an dem du vor den mit »Judensau« beschmierten Grabsteinen von Brecht und Helene Weigel gestanden hattest, auf alles gefaßt sein müssen? Worauf denn aber? Darauf, daß die Leute aus der mecklenburgischen Kleinstadt, die immer so friedlich und geduckt und ein bißchen öde dagelegen hatte, eines schönen Tages nach der WENDE hinausziehen würden vor das Kasernengelände, das, mit sowjetischen Truppen besetzt, immer streng abgeriegelt und von Gerüchten umgeben abseits lag – Gerüchte, die nach dem Abzug der sowjetischen Truppen bestätigt wurden: Ja, hier, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, waren Atomraketen stationiert gewesen – daß also all die friedlichen Leute hinausziehen würden aus ihrem Städtchen und das Kasernengelände tage- und nächtelang besetzen würden, weil es in ein Übergangslager für Asylbewerber umgewandelt werden sollte und nicht, wie sie alle, die inzwischen arbeitslos waren, gehofft hatten, in ein Tourismuszentrum für diese landschaftlich paradiesische Gegend. Hätte ich mir vorstellen können, daß sie in Zelten leben würden, was sie seit ihrer Kindheit und seit ihrem Dienst in der Nationalen Volksarmee nicht mehr getan hatten? Und daß die Frauen ihnen in Thermosbehältern das Essen bringen würden in den friedlichen duftenden Frühsommerwald? Ob sie abends gesungen haben, fragte ich mich. Welche Lieder, das würde ich doch ganz gerne wissen.
Sie seien nicht fremdenfeindlich, gaben die Einwohner der kleinen Stadt bekannt. Sie wollten auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam machen und die mutwillige Vernichtung von Arbeitsplätzen verhindern. Als sie aber von der Kaserne abgezogen, in ihre Häuser zurückgekehrt waren, sollen sie kleine grüne Birken vor ihre Haustüren gestellt haben. Als Zeichen dafür, daß Zigeuner hier unerwünscht waren. Und ich mußte mir vorstellen, wie hübsch die sonst so nüchterne, in letzter Zeit durch ein paar grellbunte Werbeschilder aufgestylte einzige lange Straße der kleinen Stadt im Schmuck der grünen Birken ausgesehen haben und wie traurig diese Hübschheit gewesen sein mochte. Und wie traurig es abends in den kleinen Stuben zugehen mochte, in denen den lieben langen Tag der Fernseher lief und der Mann nicht von der Arbeit nach Hause kam, sondern aus dem Schrebergarten oder aus der Kneipe oder von der Bank vor dem Haus, auf der er jetzt alle Stunden des Tages sitzen und Zeitung lesen konnte, die ihn nur noch wütender und mutloser machte, denn da las er – und liest er noch heute, was ich nicht wissen konnte, als wir bei dem Chinesen saßen und ich den anderen sagen sollte, was in Deutschland los sei –, er las und liest noch heute Arbeitslosenzahlen um die zwanzig Prozent, und die sind noch geschönt, und ich fragte mich und sagte es: Ich frage mich, wie man verhindern kann, daß immer ein falsches Signal auf ein anderes falsches Signal gesetzt wird, warum zum Beispiel, sagte ich, während die runde Platte mit den chinesischen Gerichten sich drehte, warum hat niemand mit den Leuten in der kleinen Stadt gesprochen, warum hat niemand sie gefragt, was sie eigentlich wollen, warum hat man es dazu kommen lassen, daß sie als fremdenfeindlich angeprangert wurden? Nein, hörte ich mich sagen, nein, ich glaube es nicht. Die Berichterstattung in euren Medien ist einseitig, als gebe es in Osteutschland nichts anderes mehr als brennende Asylbewerberheime. Das ist es doch, was man hier von den Deutschen erwartet. Aber es wird die Wiederholung nicht geben, vor der ihr euch fürchtet. Das werden wir nicht zulassen.
Wer: Wir? fragte Francesco, das laute Echo der Frage, die ich mir im stillen selber stellte.
Und übrigens, sagte Hanno, der Franzose, auf Ausgleich bedacht, übrigens ist das doch nicht das Problem eines Landes, oder einer Region. Die entscheidende Frage ist doch, wie dick und wie haltbar die Decke unserer Zivilisation ist. Wie viele vernichtete, sinnlose, perspektivlose Existenzen sie tragen kann, bis sie an dieser oder jener Stelle reißt, dort, wo sie mit heißer Nadel genäht ist.
Und dann?
Damals war ich noch sparsamer im Umgang mit dem Wort BARBAREI, heute liegt es mir auf der Zunge. Die Nähte sind geplatzt, die unsere Zivilisation zusammenhielten, aus den Abgründen, die sich aufgetan haben, quillt das Unheil, bringt Türme zum Einsturz, läßt Bomben fallen, Menschen als Sprengkörper explodieren.
Signale auf dem mehrspurigen Band, das in einer Endlosschleife in meinem Kopf lief, dessen eine Spur ohne mein Zutun besprochen wurde. Cuttern cuttern, unerwünschtes unbrauchbares Material, ins Unreine gedacht oder vielmehr gedacht worden, während auf einer der anderen Gedächtnisspuren andauernd ein Bildtongemisch aufgezeichnet wurde, Stadtgeräusche, die Tag und Nacht gegenwärtigen gemeinen Sirenen der Polizeiwagen, die, indem sie ihre Opfer verfolgten, aufjaulten wie gefährliche verwundete Tiere. Oder das kurze schrille Anschlagen einer Alarmanlage, wenn jemand einem der geheiligten Autos zu nahe gekommen war. Oder die Feuerwehr. Heulend raste sie in ihrer ganzen unglaublichen kindlichen Feuerwehrschönheit vorbei, immer direkt auf den Brand und die Kameras zu, die immer schon da waren und mir abends unvermeidlich die Leichen der Verbrannten und Verstümmelten und das Geschrei und die Tränen der Hinterbliebenen auf dem Bildschirm in mein Apartment apportierten, getreulich wie unerzogene Katzen jede einzige gefangene Maus, jeden einzigen der täglichen Ermordeten in dieser ungeheuren Stadt auf meine Schwelle legten, was ich zuerst geschehen ließ und wie eine Pflichtübung auf mich nahm, was gingen mich diese fremden Toten an, bis ich mich eines Abends damit überraschte, daß ich mitten in einem Verzweiflungsausbruch einer Mutter, deren kleiner Sohn bei den jüngst niedergegangenen Wolkenbrüchen von einem sonst harmlosen Bach mitgerissen und weggeschwemmt worden war, die rosa Austaste drückte. Diese kleine Geste machte mir klar, daß ich angekommen war und daß die verborgene Hoffnung, mich hier heraushalten zu können, wieder einmal getrogen hatte.
Dann saß ich an der Schmalseite des langen Eßtisches in meinem Apartment, auf dem neuerdings mein Maschinchen stand, und schrieb:
und wenn all meine geschäftigkeit, die verdammt nach fleiss aussehen soll, nichts weiter wäre als der versuch, das tonband in meinem kopf zum schweigen zu bringen. aber ich kann ja noch nicht wissen, welche untiefen in mir hier umgepflügt oder im gegenteil zugedeckt werden sollen.
Das Telefon machte sich die Mühe, mich über einen Ozean hinweg zu ermahnen: Du bist doch jetzt ganz frei und kannst schreiben, was du willst. Also leg einfach los, was soll dir noch passieren. – Ja ja. – Du sollst dich nicht verteidigen, du sollst nur sagen, wie es war. – Ja ja. Verteidigen? Es waren zuerst nur solche einzelnen verräterischen Wörter.
Dann versuchte ich einzuschlafen in meinem überbreiten Bett, das nicht mehr zu weich war, seitdem Herr Enrico ein Brett unter die Matratze gelegt hatte, nach dem meine Wirbelsäule dringlich verlangt hatte. Ich konnte nicht einschlafen, ich konnte das Bild der besudelten Grabstelle von Brecht nicht verscheuchen, ich konnte nicht aufhören, Gedichtzeilen zu memorieren:
In Erwägung, daß ihr uns dann eben /
Mit Gewehren und Kanonen droht /
Haben wir beschlossen: nunmehr schlechtes Leben /
Mehr zu fürchten als den Tod.
Auf der Bühne oben die Schauspieler im Kostüm der Pariser Communarden, im Zuschauerraum ihr, die Jungen, die begeisterten Gesichter deiner Generation, die ihr das Schicksal der Communarden, das Scheitern, nicht an euch erleben würdet, da wart ihr euch ganz sicher, hohnlachend gegen alle Zweifler, dachte ich und konnte die Gesichter vor meinem inneren Auge in Sekundenschnelle altern sehen, verkniffen, verbraucht, enttäuscht werden. Auch ängstlich, berechnend, dumm. Zynisch. Ungläubig und verzweifelt. Das Übliche. Nur uns hatte es erspart bleiben sollen. Welche Hybris.
Zeitsprung. War es nicht hier gewesen, vor einem halben Jahrhundert, in dieser Stadt, wenige Kilometer von diesem Zimmer entfernt, in dem ich schlaflos lag, daß der Emigrant Brecht seinem Galilei, der uns, den damals Jungen, dann in der Gestalt des Ernst Busch begegnen sollte, daß er diesem Galilei den unbezähmbaren Wahrheitsdrang auferlegte. Kein Mensch könne auf Dauer einen Stein zu Boden fallen sehen und dazu sagen hören: Er fällt nicht. O doch, Brecht, wir können das fast alle. Und als wir Ihren Galilei verachten wollten, weil er schließlich abschwor, da fiel der Stein schon, vor unseren Augen, er fiel und fiel unaufhaltsam, und wir sahen ihn nicht einmal. Und wenn uns einer darauf hingewiesen hätte, hätten wir nur gefragt: Welcher Stein.