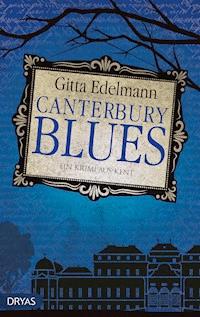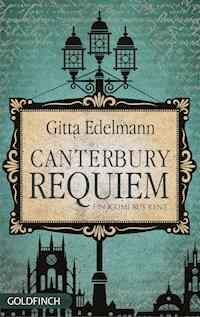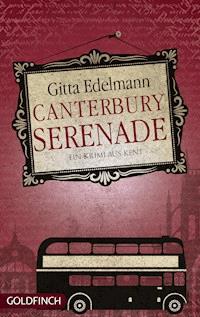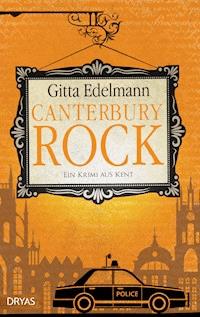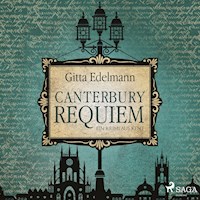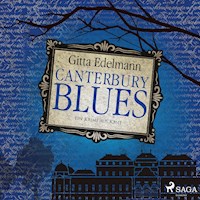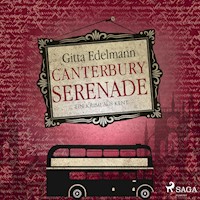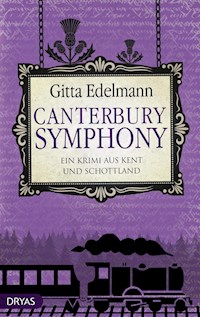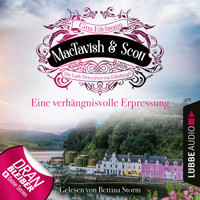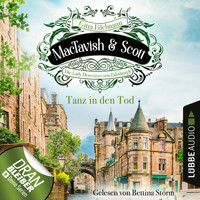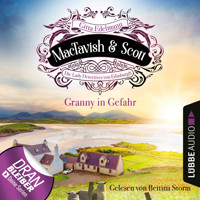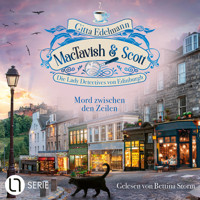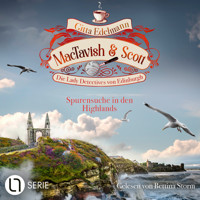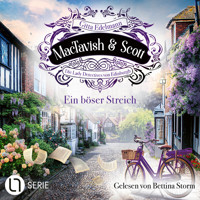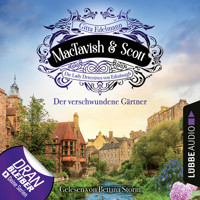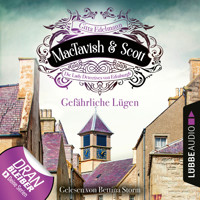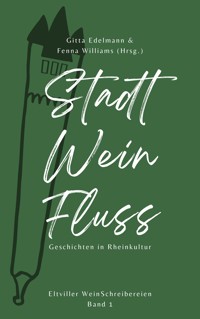
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition silbenreich
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
20 Geschichten mit Rheingau-Flair Geschichten in Rheinkultur laden Sie zu einer literarischen Entdeckungsreise ein, um die Stadt Eltville als Wein-, Sekt-, Rosen-, Fachwerk- oder Gutenbergstadt kennenzulernen. Die in diesem ersten Band versammelten Geschichten unterschiedlicher Genres spiegeln nicht nur die Vielfalt der Stadt und der Region wider, sondern auch die kreative Kraft, die in den Menschen, der Landschaft, dem Wein, der Gastfreundschaft und der Fantasie der Schreibenden lebt. Entstanden sind die Geschichten aus den einzigartigen WeinSchreibereien des Eltviller Wein- und Kulturvereins. www.weinschreibereien.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STADT – WEIN – FLUSS
GESCHICHTEN IN RHEINKULTUR
ELTVILLER WEINSCHREIBEREIEN
BAND 1
Herausgegeben vonGITTA EDELMANN
&FENNA WILLIAMS
Erste Auflage
Copyright © 2025
Gitta Edelmann
& Fenna Williams
* * *
Scraping, Crawling, Text- & Data-Mining untersagt.
INHALT
Vorwort
1. Gestört. Frau.
Ulrike Bliefert
2. Dass wir frei sind und frei sein wollen
Roland Stark
3. That’s What Friends Are For
Gitta Edelmann
4. Denk ich an den Rheingau
Martina J. Kohl
5. Um drei am Stand vom Ernst
Martina Weyreter
6. Todesurteil in Blei
Karl-Heinz Behrens
7. Im Kork liegt Freiheit
Fenna Williams
8. Otto und der Dichter
Dietmar Gaumann
9. Nächtliche Watscheltour
Ulrike Neradt
10. Der Weinkönig
Oliver Baier
11. Eine neue Heimat
Andreas Arz
12. Martinsthaler Wildsau – furztrocken
Petra Spielberg
13. Der Reinfall in Eltville
Claudia Schmid
14. Das Buch
Franziska Franke
15. Der Apfel der Erkenntnis
Brigitte Pons
16. Kloster Eberbach und sein Wein
Martin Meyer
17. Fast ein Johannes
Meike Schwagmann
18. Der Firmenwagen
Gitta Edelmann
19. Der Name der weißen Rose
Regina Schleheck
20. Gendersterbchen
Fenna Williams
Über die Autor:innen
Vielleicht mögen Sie auch …
VORWORT
Mit den WeinSchreibereien betreten der Eltviller Wein- und Kulturverein und die Stadt Eltville Neuland. Es ist im deutschsprachigen Raum einzigartig, dass über sechzig Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland für bis zu eine Woche in die Stadt kommen, sich inspirieren lassen und ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Kurzgeschichten aller Genres verwandeln. Andere StadtschreiberInnen-Projekte sehen oft viele Monate Aufenthalt vor, deren Genuss dann nur wenigen Autoren und Autorinnen vorbehalten bleibt. In Eltville hingegen sind alle willkommen, die für einige Tage in die Welt am Rhein eintauchen möchten.
Bei den WeinSchreibereien entsteht so nicht nur auf dem Blatt Papier Vielfalt; der kurze Aufenthalt wird auch von schriftstellerisch Tätigen begrüßt, die längere Abwesenheiten nicht mit ihrem Alltag vereinbaren können.
Geplant sind insgesamt drei Anthologien in drei aufeinanderfolgenden Jahren, beginnend mit diesem ersten Band. Zusätzlich werden Podcasts aufgenommen, die die Beiträge der Schreibenden begleiten und außerdem Landmarken mit QR-Codes an Plätzen gesetzt, die in den Geschichten entscheidende Rollen spielen.
Bereits seit dem Auftakt des Projekts im Jahre 2024 finden Lesungen an unterschiedlichen Orten in Eltville statt und stellen so eine besondere Nähe zwischen Publikum und WeinSchreiberInnen her.
Mit den ersten Geschichten in Rheinkultur laden wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf eine literarische Entdeckungsreise ein, um Eltville sowohl als Wein-, Sekt-, Rosen-, Fachwerk- oder Gutenbergstadt kennenzulernen. Die in Band I versammelten Geschichten spiegeln somit nicht nur die Vielfalt der Stadt und der Region wider, sondern auch die kreative Kraft, die in ihren Menschen, ihrer Landschaft, ihrem Wein, ihrer Gastfreundschaft und vor allem in der Fantasie der Autorinnen und Autoren lebt.
Ulrich Bachmann
für den Eltviller Wein- & Kulturverein
GESTÖRT. FRAU.
ULRIKE BLIEFERT
Nikodemus Hummel verschwieg, wo immer es möglich war, seinen Vornamen und nannte sich Nico. Letzteres hätte schließlich auch die Kurzform von Nikolaus sein können, und das war zumindest nicht ganz so prätentiös wie der Name eines Pharisäers aus dem Neuen Testament.
Abgesehen von seinem Vornamen hatte er es ohnehin nicht leicht gehabt in der Schule. Das lag keineswegs an mangelnder Intelligenz oder unzureichendem Arbeitseifer. Im Gegenteil: Nico war ein Musterschüler. Das Problem war seine Herkunft als Spross eines Priesters und einer Religionslehrerin. Im Mief der späten fünfziger Jahre waren ein vom Glauben abgefallener Katholik und eine promovierte – zu allem Überfluss auch noch evangelische – Studienrätin im frommen Mainz ein Skandal! Nicos Eltern führten jedoch allen Anfeindungen zum Trotz eine glückliche Ehe, und ihr Genpool trug ein Übriges dazu bei, dass ihr Sohn ein Einser-Abi hinlegte und fortan Archäologie studierte.
Und da Marianne und Hieronymus Hummel nichts davon hielten, ihren Sprössling in Watte zu packen, war es selbstverständlich, dass er in den Semesterferien jobbte.
Also bewarb sich Nico gleich nach dem dritten Semester als Hilfsstudent bei den Ausgrabungen im nahe gelegenen Eltville: merowingerzeitliche und frühmittelalterliche Gräber, Ausgrabungsphase 6.
Es traf sich geradezu ideal, dass Nicos Großvater in den Dreißigerjahren südlich von Rauenthal eine kleine Jagdhütte erstanden hatte. Zwar wurde die schon lange nicht mehr genutzt und hatte ihre besten Zeiten deutlich hinter sich, aber Nico war hart im Nehmen; dass es weder Strom noch fließendes Wasser gab, störte ihn nicht: Der Brunnen war intakt, und die alte Petroleumlampe reichte durchaus zum Lesen.
4. August 1969, schrieb Nico in sein Tagebuch. Heute womöglich Freilegung. Wetter: Leicht bewölkt, könnte mittags wieder heiß werden. Hoffe diesmal auf was Ergiebigeres.
Er schmierte sich ein Leberwurstbrot, packte es in Butterbrotpapier, verstaute es mitsamt seiner Thermoskanne in Opas altem Rucksack und machte sich auf den Weg: über den Oberen Schlangenpfad, quer durch den Wald und dann hinunter zum Gräberfeld.
»Ei gude, wie?« Der Grabungsleiter deutete vage in Richtung Quadrant fünf, »Schaffsch allei, gelle?«
»Selbstverständlich. Kein Problem.«
Nico hatte sich in der Hierarchie der Grabungshelfer in Windeseile von Spaten, Sieb und Kelle zu Pinsel, Skalpell und Zahnbürste hochgearbeitet.
Die anderen schauten nicht einmal auf, als er an ihnen vorbeiging. Es war der Fluch aller Hochbegabten, nicht gerade beliebt bei Gleichaltrigen zu sein. »Streberleiche« hatten sie ihm schon am ersten Schultag hinterhergerufen. Und das nur, weil er da bereits fließend lesen konnte und wusste, was ein Pharisäer war. »Nikodemus wird in Johannes, Kapitel drei erwähnt …«
Flugs hatten die Anderen »Niko-dämlich« aus seinem Namen gemacht, und wegen seines leichten Übergewichts wurde aus Hummel Pummel: Nikodämlich Pummel.
Seitdem bestand Nikodemus auf »Nico«, und da sein Babyspeck nie so ganz verschwunden war, vermied er es – rein prophylaktisch – wo immer es möglich war, seinen Nachnamen zu nennen.
Vorsichtig, um nur ja nichts zu beschädigen oder unwiederbringlich zu zerstören, stieg er in das Erdloch im Quadranten B 5. Bis zum Nachmittag hatte er die letzte Erdschicht entfernt. Er atmete tief durch: Vor ihm lag das Fragment eines hölzernen Sarges! In südöstlicher Richtung war ein Schacht erkennbar, zweifellos hatten Grabräuber die Gruft bereits in grauer Vorzeit rücksichtslos zerwühlt. Selbst das Skelett war unvollständig.
Typisch, dachte Nico, wahrscheinlich haben sie jedes einzelne Knöchelchen als Reliquie verkauft: »Ein Mittelfußknochen von Sankt Eustachius, dem Standfesten« oder »Ein Backenzahn des heiligen Blasius«.
Vorsichtig kratzte er das verkrustete Erdreich, das Schädel und Hüftknochen umgab, beiseite. Der Kopf war zierlich und das Becken deutlich breiter als das eines Mannes: Eindeutig eine Frau.
Nico wusste nicht recht, ob es der Stolz auf seinen ersten eigenen Fund oder das Mitgefühl für die ihrer Grabesruhe beraubte Tote war, das ihm Tränen in die Augen steigen ließ.
Er zog die Arbeitshandschuhe aus und legte seine bloßen Hände auf ihren Schädel. »Tut mir leid, was mit dir passiert ist«, flüsterte er.
Wann sie gelebt hatte, würde man erst später genauer datieren können, aber da König Chlodwig I. sich bereits anno 496 zum römisch-katholischen Glauben bekannt hatte, nahm Nico an, dass auch die Tote zu Lebzeiten katholisch getauft worden war. Er murmelte ein Ave Maria.
»… nunc et in hora mortis nostrae …«
Kurz vor dem »Amen« riss ihn schallendes Gelächter aus seiner andächtigen Stimmung.
»Vergiss es, von wegen ›in der Stunde unseres Todes!‹ Bei dem Kerl da ist die logischerweise 'n paar hundert Jahre her!«
»Es ist eine ›Sie‹«, wandte Nico fast unhörbar ein.
»Ey, du hast se echt nicht mehr alle aufer Latte!« Am Rand der Aushebung stand Nicos Kommilitone Jens-Uwe. Er hatte den Arm um die Schultern der schönen Dorothee gelegt. Sie war die einzige Archäologie-Studentin des Semesters, trug Hot Pants und ein fast noch knapperes Bikinioberteil und sah einfach umwerfend aus. Sie kicherte. »Ekklesiogene Neurose, würd ich sagen.«
»Ach was! Der hat schlicht und ergreifend 'n Sprung inner Schüssel!« Jens-Uwe ließ seinen Arm wie zufällig auf Dorothees Hüfte gleiten, und die beiden schlenderten davon; zweifellos amüsierten sie sich auch im Weitergehen noch königlich.
»Die sind bloß neidisch, dass ich dich gefunden habe«, flüsterte Nico dem Schädel zu. Dann stand er auf, schüttelte die Erde von seiner Arbeitshose und machte sich auf, den Grabungsleiter zu informieren.
Grab 449. Lage: B 5. Gestört. Frau. 20-22 Jahre würde es später im Katalog heißen. Oder auch ein wenig älter.
Die Grabräuber hatten neben ein paar Perlen eine Bronzekette, Schuhschnallen und ein Messer zurückgelassen. Vielleicht hatten sie diese Dinge übersehen oder nicht für wertvoll genug erachtet. Die Scherbe eines Tongefäßes ließ jedenfalls darauf schließen, dass sie bei ihrem Raubzug alles andere als zartfühlend vorgegangen waren.
Nachdem Nico den gesamten Fund unter den wachsamen Augen seines Vorgesetzten freigelegt hatte, wurde alles in Tücher und Sandkisten gepackt und abtransportiert.
»Adieu«, murmelte Nico. Nach der Auswertung des Fundes würden die Artefakte im Museum und die Knochen im Krematorium landen, »Asche zu Asche, Staub zu Staub«.
In Großvaters Jagdhütte angekommen, wusch sich Nico unter der improvisierten Freiluftdusche geradezu wehmütig den Schmutz und den Arbeitsschweiß vom Körper. Die junge Frau würde sein einziger Fund bleiben, denn man hatte ihn für den Rest der Semesterferien mit dem Anfertigen von Fundskizzen betraut; der Grabungsleiter sah darin offenbar eine Art Beförderung.
Nico schlüpfte in seinen Schlafanzug, ließ sich in Opas Ohrensessel fallen und schaltete das Transistorradio ein. Richard Nixon, Willy Brandt, Vietnamkrieg und Nordirlandkonflikt – das alles interessierte ihn ebenso wenig wie die allmähliche Zersplitterung der Studentenbewegung oder die Mondlandung. Er suchte den BFBS und bei »Crimson and Clover« sang – oder besser hauchte – er leise mit:
»Aaaah,
dah-dah-dah-dah-dah …
now I don’t hardly know her
duh-duh-duh-duh duh …
But I think I could love her«
Nico seufzte tief auf und griff zur Luftgitarre.
»… dah-dah-duh«
Crimson and clover …«
Nico wusste, dass »Crimson and Clover« – Purpur und Klee – ein völlig sinnfreier Titel war, aber der Song klang genau so sentimental und sehnsuchtsvoll, wie er sich an diesem Abend fühlte.
»Wie heißt 'n du?« Eindeutig eine Frauenstimme!
»Shit«, murmelte Nico und drehte am Suchknopf: Anscheinend hatte sich da irgendein deutscher Sender reingemendelt, und auf Wencke Myhre oder Siw Malmkvist hatte er nun wirklich keine Lust. Doch rechts und links vom BFBS war nur das übliche Rauschen zu hören.
»Hey! Ich hab dich was gefragt!« Das kam eindeutig nicht aus dem Kofferradio. Nico drückte auf die Aus-Taste und lauschte.
»Na bitte. Geht doch!«
Erschrocken drehte er sich um. Auf seinem Feldbett saß eine junge Frau. Ihr Gesicht wurde von zwei straff geflochtenen blonden Zöpfen flankiert, und sie trug ein langes, exotisch wirkendes grünes Gewand. Obwohl sie leicht durchsichtig war, konnte Nico die Schnallen an ihren Schuhen deutlich erkennen; sie hatten eine verdächtige Ähnlichkeit mit denen, die er am Nachmittag im Grab Nr. 449 ausgebuddelt hatte.
»Ähm«, sagte er.
»Nix ›ähm‹! Name?« Das klang ganz schön kess.
»Ähm. Nico.«
»Nicasius, Anicetus, Dominicus oder Nikolaus?«
»Nikodemus.«
»Auch schön.«
»Aber ich werde lieber Nico genannt, weil … ähm …«
»Jetzt hör doch mal mit deinem blöden ›Ähm‹ auf!« Das Geistfräulein zuckte ungehalten mit den Schultern. »Ich heiß übrigens Fredegunde, und ich weiß, das hier is 'n bisschen ungewohnt, also gewöhn dich dran, und wenn du dich statt Nikodemus Nico nennst, kannst du meinetwegen Freddie zu mir sagen. Passt dann ja besser, nich?«
»Okay. Ähm …«
Das Geistfräulein verdrehte genervt die Augen.
»Wieso sprichst 'n du kein Althochdeutsch? Ostfränkisch oder Mainfränkisch oder so?«
»Typisch!« Fredegunde kicherte, »Ihr Archäologen glaubt wohl, wir sind von gestern, was?«
»Na, in deinem Fall eher von vor-vorgestern« wandte Nico lachend ein.
»Was? Das ist aber mehr als unhöflich einer Dame gegenüber!« Fredegunde lachte nicht mit.
»Upps! War nicht so gemeint … Freddie.«
Das Geistfräulein zog die Nase kraus und zeigte Nico im wahrsten Sinne des Wortes die kalte Schulter.
»'tschuldigung!«
»Na ja, auf meinem Alter rumzuhacken is nu wirklich mehr als unfein!« Freddie war offenbar nachhaltig beleidigt und zog eine Flunsch.
»Ich hab doch nicht dein Lebensalter gemeint!«
»Ach, nicht?«
»Nee.«
»Na, dann is ja gut. Weißte, mit über zwanzig noch unverheiratet zu sein, das war zu meiner Zeit – erst recht in so 'nem Kuhkaff wie Altavilla – echt peinlich.«
»Verstehe.«
»Rund anderthalbtausend Jahre später hätte man mich ›Blaustrumpf‹ geschimpft. Aber wir hatten damals ja noch keine Strümpfe, und erst recht keine blauen.«
»Stimmt. Die gab’s ungefähr ab sechzehnhundert, und zuerst sowieso nur in England. Strümpfe, mein ich.«
»Ja. Ständig kalte Füße«, Freddie nickte bekümmert. Einen Moment lang schwiegen Nico und das Geistfräulein in Gedanken versunken vor sich hin.
»Aber was soll ich dann sagen?«, trumpfte Nico schließlich auf, »In meinem Alter noch nie gekifft und keinen Sex gehabt zu haben, ist anno neunzehn-neunundsechzig erst recht ehrenrührig.«
»Ehrlich?« Fredegunde machte Kulleraugen, »Kein Sex?«
Nicos bekümmertem Kopfschütteln folgte eine atemlose Pause. Dann begann das Geistfräulein provozierend langsam einen ihrer langen, blonden Zöpfe zu lösen.
Als die Sonne am nächsten Morgen wieder über Eltville aufging, marschierte Nico übermütig vor sich hin pfeifend den alten Schlangenpfad entlang.
»Ei gude, wie?«, begrüßte er den Grabungsleiter. Der grüßte irritiert zurück. So gut gelaunt hatte er seinen Lieblings-Studiosus noch nie erlebt.
Nico schnappte sich Klappstuhl, Maßband und Skizzenbuch, steckte Bleistift, Spitzer und Radiergummi in die Brusttasche seiner Jeansjacke und zog los. In Abschnitt 5 B/C saßen Jens-Uwe und die schöne Dorothee neben Grabstätte Nummer 451 auf dem Boden und siebten den Aushub auf der Suche nach archäologisch Bedeutsamem durch.
»Ah, unser Klugscheißer!«, begrüßte in Jens-Uwe. »Neuerdings zu fein, sich die Finger dreckig zu machen, was?«
Nico nickte Jens-Uwe und Dorothee strahlend zu, baute sein Klappstühlchen auf und begann zu zeichnen.
Dorothee kicherte. »Van Gogh is 'n Scheißdreck dagegen!«
»Bring den nich noch auf Ideen!« Jens-Uwe prustete, »sonst fehlt ihm morgen sein rechtes Ohr!«
»Das linke«, bemerkte Nico, ohne aufzublicken.
»Hä?«
»Es war das linke Ohr. Und ganz abgeschnitten hat van Gogh es auch nicht.«
Einen Moment lang verschlug es Jens-Uwe die Sprache, und als Dorothee zu allem Überfluss zaghaft »Da hat er recht«, murmelte, sprang er wutschnaubend auf.
»Ey, Nico, sag mal, spinnst du? Was riskierst 'n du hier plötzlich für 'ne dicke Lippe?!«
»Tja«, Nico zuckte ungerührt mit den Achseln, »wie man in den Wald reinruft und so. Bei all deinen dummen Sprüchen musst du halt auch mal das Echo vertragen.«
Als Jens-Uwe mit geballten Fäusten auf ihn zuging, hob Nico den Kopf und schaute ihm gelassen lächelnd ins Gesicht. »Und für dich ab jetzt ›Nikodemus‹! Oder ›Herr Hummel‹. Verstanden?«
Als Nico an jenem Abend vor Opas Jagdhäuschen ankam, saß die schöne Dorothee auf der Gartenbank vor dem Eingang. Sie trug ein hellblau gemustertes Minikleid, hatte frisch gewaschene Haare und streckte ihm einen Joint entgegen. »Peace?«
»Peace«, konstatierte Nico.
Die beiden nannten ihre erste Tochter Franziska. »Das ist das fränkische Wort für Streitaxt«, erklärte Nico dem diensthabenden Standesbeamten, »nomen est omen«.
Anmerkung der Autorin:
Die Grabstelle 449 gab es wirklich. Der Katalogtext dazu lautet:
4.8.1969
Lage: B 5
Arch.: Gestört. Frau.
Zur Inventarliste gehörten 1 Stangengliederkette, 2 ovale Schnallen, 1 Messer und eine Bodenscherbe.
Zitat aus: »Crimson and Clover« – Tommy James and the Shondells, Verfasser: Tommy James und Peter Lucia Jr., 1968
DASS WIR FREI SIND UND FREI SEIN WOLLEN
ROLAND STARK
Der alte Mann saß in der Abendsonne vor seinem Haus. Seine Frau hatte den Hof geschmückt, wie es der Brauch am Georgstag verlangte. Heute hatte er mit der Hacke den Boden rund um die Rebstöcke gelockert, während der Enkel nach der Kirche auf den Jahrmarkt gezogen war. Das Fest zu Ehren des Drachentöters, des Heiligen der Bauern und Soldaten, wurde immer noch gefeiert; alles andere hatte sich nach dem Aufstand verändert.
Aus dem Haus wehte der Geruch von geschmortem Hammel zu ihm, Elisabeth bereitete das Essen für den Festtag vor. Der Duft entführte ihn in längst vergangene Tage, als er mit der Wehr des Rheingaus in Eltville stand und die Harnische im Morgenlicht aufleuchten sah. Er war jung gewesen, voller Schwung und Zuversicht. Und voller Zorn. Damals schien die Sonne strahlend hell, die Spieße glänzten und die Harnische blitzten. Alle spürten, dass etwas geschehen musste.
»Verlierst du dich in alten Zeiten, mein Herz?«
Elisabeth war vor die Tür getreten. Sie waren zusammen alt geworden, doch sie verzauberte ihn noch immer. Die stolze und ungebeugte Haltung, die weißen Haarsträhnen, die frech unter dem Kopftuch hervorlugten, die Augen voller Schalk – all das ließ ihn seine Müdigkeit vergessen.
»Na endlich, du hast mich ja fast übersehen«, neckte sie ihn und strich sich eine Locke aus dem Gesicht. »Hol noch einen Krug Wein aus dem Keller. Jakob wird gleich da sein.«
Er erledigte den Auftrag, ging danach wieder nach draußen. Die Verse eines Mainzer Spottliedes ließen ihn nicht los.
Als ich auf dem Wacholder saß,
da tranken wir aus dem großen Fass.
Wie bekam uns das? Als dem Hund das Gras.
Der Teufel gesegnet uns das.
Er erkannte seinen Enkel bereits von weitem am ausgreifenden Gang. Jakob war ein Bursche mit breiten Schultern und offenem Gesicht. Seine Augen glühten vor Begeisterung: Er berichtete vom Jahrmarkt, von den Soldaten, den Akrobaten und den Blicken der Mädchen.
»Das Mainzer Erzstift wirbt Landsknechte an. Ob das etwas für mich wäre? Großmutter hat erzählt, dass du dabei gewesen bist.«
Warum redete das Weib von früher, wenn sie ihn dafür schalt, auch nur daran zu denken?
»Es waren andere Zeiten. Gehen wir hinein«, antwortete er unwirsch. Er hatte geglaubt, diese längst hinter sich gelassen zu haben, doch heute waren die Stimmen der Vergangenheit lauter als je zuvor.
»Was habe ich für einen Hunger!«, rief Jakob, als sie die Küche betraten, und schielte zum Herd, auf dem der Eintopf brodelte. Hammel und Zwiebeln, Petersilie, Beifuß und Bärlauch dufteten verführerisch. Matthias legte einen Finger auf die Lippen und schlich zum Herd, füllte zwei Schüsselchen mit dem köstlichen Essen und brachte sie an den Tisch.
»Wie könnt ihr nur?« Elisabeth nahm ihnen lachend die Schüsseln weg und kippte die Reste in den Kessel. »Macht euch nützlich, deckt den Tisch!«
Sie folgten ihren Anweisungen.
Danach schenkte Jakob Wein ein. Er leerte seinen Becher in einem Zug. »Wie war das, als du bei der Rheingauer Wehr warst? Erzähl!«
Das hatte Matthias vermeiden wollen. Er murmelte etwas von Wachen am Gebück.
»Da könnte ich auch hin«, sagte Jakob. »Der Bischof sucht Männer, die unsere Heimat beschützen.«
»Er sucht Männer, die seinen Besitz schützen«, wies Matthias ihn zurecht.
Jakob hielt einen Moment inne. »Die Soldaten haben gesagt, dass die Bauern damals das große Fass in Eberbach leergesoffen hätten. Stimmt das?«
Ein halbes Leben lang hatte er aus Angst um seine Familie geschwiegen. Je länger er schwieg, desto mehr glaubte er, dass niemand die Geschichte noch hören wollte.
»Warst du einer von denen?«, hakte Jakob nach.
Er hatte versucht, seinem Sohn davon zu erzählen. Aber der Pfarrer der Gemeinde hatte ein Auge auf den Jungen geworfen. Ein Bauer, der lesen konnte und dies weitergab, hatte ihn misstrauisch gemacht, und Matthias stand nach den Ereignissen auf der Wacholderheide unter Beobachtung. So war aus seinem Jungen ein frommer Katholik und gehorsamer Untertan geworden. Dann starb er an einer Verletzung, die er sich während der Fron für das Kloster zugezogen hatte, als er in einen rostigen Nagel getreten war. Gesegnet sind die, die dem Herrn auf seinem Wege folgen, hatte der Pfarrer auf der Beerdigung gesagt. Gleich unserem Herrn wurde er von Nägeln durchbohrt.
»Mein Herz«, hörte er Elisabeths Stimme, »wo weilen deine Gedanken?« Ihre Hand berührte seine Schulter. »Willst du Jakob nicht antworten?«
Er drehte sich zu ihr und schüttelte den Kopf. Seine Hände fühlten sich feucht an.
»Es dauert noch, bis sich die Tischgesellschaft versammelt«, sagte sie. »Was hast du mir von deinem Großvater erzählt?«
Sein Großvater hatte bei den Druckern in Eltville gearbeitet und dort das Lesen gelernt. »Er hat gesagt, dass die Wahrheit uns allen gehört.«
Elisabeth strich ihm über die Wange. »Ja, mein Herz.«
Matthias richtete sich auf. »Also gut, Junge, ich werde dir alles erzählen!«
»Jetzt bin ich auf das große Fass gespannt!«, rief Jakob und füllte seinen Becher.
»Sachte!«, ermahnte ihn Matthias. Genau solches Ungestüm hatte sie damals ins Verderben geführt.
»Unser Leben ist bitter und hart. Viele von uns sind Leibeigene, dürfen ihr Land nicht verlassen und nicht einmal heiraten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Selbst die freien Bauern müssen Frondienst leisten, und die Herren nehmen sich vom gemeinschaftlichen Land, was sie wollen.«
»Der Pfarrer sagt, es sei von Gott so gewollt.«
»Das sagen die Pfaffen, weil sie zu den Herren gehören«, erwiderte Matthias scharf. »Aber es ist nicht wahr. In der Schrift steht nichts von Leibeigenschaft oder Adel. Der Doktor aus Wittenberg hat sie in unsere Sprache übersetzt.«
Jakob schien etwas zu begreifen. »Du konntest sie lesen!«
»Freilich!« Matthias lächelte stolz.
Die Erinnerungen flossen nun, erst wie ein Rinnsal, dann wie ein munterer Bach, schließlich wie ein reißender Fluss. Ein Prediger hatte auf der Wacholderheide verkündet, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Himmelreich komme. Was war das für ein Gejohle unter den Zuhörern gewesen! Und dann der Georgstag – zweihundert Brüder, die sich Treue schworen. Anfangs handelten sie planvoll, sicherten Übergänge und bereiteten sich auf Widerstand vor.
»Wir haben uns überall im Rheingau gegen die Herren erhoben«, sagte Matthias. »Der Adel hatte die Jagdrechte, die Klöster kassierten den Zehnten, und wir schufteten. Das musste ein Ende haben. Die schwäbischen Bauern haben ihre Forderungen in zwölf Artikeln niedergelegt. Unsere Ältesten haben in Winkel darüber beraten. Doch es war nicht alles gut.«
»Was meinst du damit?«, fragte Jakob neugierig.
»Es gab nicht nur gerechten Zorn, es gab auch Hass«, sagte Matthias. »Gegen die Klöster waren alle. Vor den weltlichen Herren hatten viele Angst. Aber wenn es gegen die Juden ging, fühlten sich manche ganz stark.«
»Wann kommst du endlich auf das große Fass zu sprechen?«, fragte Jakob ungeduldig.
»Eins nach dem anderen. Unsere Abgesandten legten die Artikel dem Vizedom vor, der Vizedom dem Erzstift, und das Erzstift verlangte Bedenkzeit.«
»Wann seid ihr auf die Wacholderheide gezogen?«
»Wenige Tage später. Wir wollten nicht auf die Antwort aus Mainz warten. Niemand traute damals einem Bischof oder Abt.«
Es war ein bunter Zug, der auf die Wacholderheide zog. Bewaffnete Kämpfer der Rheingauer Wehr, Handwerker, Bauernjungen, Marketenderinnen. Der Treffpunkt war gut gewählt. Er lag zwischen Eltville, Kiedrich und dem Kloster Eberbach. Dort trafen sie auf Mannschaften aus anderen Gemeinden.
»Wir haben über unsere Forderungen gesprochen. Ich hatte die Druckschrift mit den zwölf Artikeln dabei und las sie vor. Alle wollten die Klöster abschaffen. Wir sind also in die Klosterhöfe gezogen und haben Vieh und Wein geholt. Es wurde ein großes Fest.«
Rauch hing über der Wacholderheide, der würzige Geruch von gebratenen Ochsen. Abends blies ein Spielmann den Dudelsack, die Menschen stampften mit den Füßen auf den Boden auf und tanzten um die Feuer herum.
»Da wäre ich gerne dabei gewesen.« Jakobs Augen leuchteten.
»Warte es ab! Wir haben den Platz befestigt und über unser weiteres Vorgehen beraten. Manchen konnte es nicht schnell genug gehen, das Kloster zu schleifen. Andere wollten unbedingt die Juden vertreiben.«
Eines Abends kamen Isaak Levin und sein Sohn Johann mit ihrem Pferdefuhrwerk auf die Wacholderheide. Sie hatten ein Fass und einige Krüge mit Wein geladen. ›Das ist für euch, gute Bauern‹, rief der Weinhändler.
Viele Feiernde lachten, aber die feindseligen Stimmen waren nicht zu überhören. ›Wir wollen keine Juden hier haben! – Warum kommt er gerade jetzt? – Was hat er mit den Mönchen ausgemacht? – Will er Geschäfte mit uns machen? – Jagt sie davon!‹
Einige Männer bauten sich drohend vor dem Fuhrwerk auf. Einer griff in das Geschirr und brüllte, die beiden sollten froh sein, hier lebendig fortzukommen, Fuhrwerk und Wein blieben hier.
Johann war ein Bursche in seinem Alter. Matthias sah die Angst in seinen Augen. Für einen Augenblick stockte ihm der Atem, dann wurde er zornig.
›Der Gegner sitzt im Herrenhaus und nicht in der Judengasse!‹, rief er den Raufbolden zu. Er ging nach vorne, stieg auf den Kutschbock des Fuhrwerks. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. ›Unser Zorn muss die Richtigen treffen! Morgen holen wir uns den Wein aus dem Kloster!‹
Die Menge stimmte begeistert zu, auch die Männer, die gerade noch den Weinhändler bedroht hatten. Johann warf ihm einen dankbaren Blick zu. Gemeinsam hievte man das Fass und die Krüge vom Fuhrwerk herunter und ließ die beiden mit Karre und Gaul in die Stadt zurückkehren.
»Großvater, wo bist du mit deinen Gedanken?« Jakobs Stimme vertrieb die Bilder in seinem Kopf.
»Ich dachte über die Feindschaft nach, die manche von uns gegen die Juden hegten. Das war nicht recht. Es gibt in ihrer Gemeinde genauso Rechtschaffene und Verwerfliche wie unter den Christen.«
»Wann ging es denn endlich ins Kloster? War das Fass, das ihr ausgetrunken habt, wirklich so groß?« Diese Frage schien den Jungen brennender als alles andere zu interessieren.
»Ja, die Mönche von Eberbach hatten ein Fass bauen lassen, das größer war als alles, was wir je gesehen hatten. Vierhundert Ohm – so hoch wie zwei Männer.«
Jakobs Mund stand sperrangelweit auf.
»Und uns haben sie vor Hochmut gewarnt.« Matthias spürte die alte Empörung in sich aufsteigen. »Als es hieß, dass Bischof und Stift sich unseren Forderungen beugen würden, gab es kein Halten mehr. Irgendwann standen wir vor dem Fass.«
Genau konnte sich Matthias an die Ereignisse nicht erinnern. Das Spiel der Dudelsäcke, der Gesang aus rauen Bauernkehlen, der Wein auf der Zunge – alles verschwamm zu einem einzigen Rausch.
»Und während wir den Sieg über Kloster und Bischof feierten, marschierten ihre Truppen bereits gegen uns.«
Es war still in der Stube. Elisabeth hantierte in der Küche, Matthias hing seinen Gedanken nach. Drei Tage und Nächte schien ihnen die Welt zu gehören. Dann zogen Gewitter auf.
»Wir glaubten, dass unser Wille zählte. Wir hatten das Land in Besitz genommen, die Klöster enteignet. Die Herren sollten sich beugen. Plötzlich hieß es, dass das Bauernheer aufgerieben sei und feindliche Truppen auf dem Weg wären.«
Matthias Kehle war trocken geworden. »Der Bauernjörg war ein grausamer Kriegsherr. Wo er wütete, dampfte das Land vom Blut unserer Brüder. Was blieb anderes übrig, als uns auf Gnade oder Ungnade zu ergeben?«
Er erinnerte sich an ihre letzte Versammlung. Die Sonne stand hoch am Himmel, die Erde unter ihren Knien war hart und trocken. Sie sprachen die Worte, die verlangt wurden. Ein Bewaffneter ritt vorbei, sein Pferd schnaubte, die Klingen an seinem Gürtel klirrten. Er hielt bei einem der Ihren, der nicht tief genug kniete. ›Kopf runter, Bauer!‹ Ein Hieb mit der flachen Klinge ließ ihn zu Boden stürzen. Einer nach dem anderen schwor dem Erzbischof Gehorsam und Treue, und mit jedem Schwur starb etwas in ihnen.
Jakob starrte ihn an. »Habt ihr Gnade gefunden?«
»Eher Ungnade«, versetzte Matthias. »Wer sich bei dem Aufstand hervorgetan hatte, der wurde gesucht. Viele wurden in den Kerker der Burg geworfen. Ich konnte fliehen.«
Matthias wartete in der Scheune des elterlichen Hofes auf die Entdeckung durch die Häscher. Er lag im Dunkeln und hörte sein eigenes Herz schlagen. Er sah die Gesichter der Brüder vor sich – lachend, trinkend, singend. Waren sie schon gefasst? Als sich das Tor öffnete, und eine Gestalt im Zwielicht der Dämmerung auf ihn zukam, sah er seine letzte Stunde gekommen. Doch dann erkannte er den Sohn des Weinhändlers.
›Komm schnell‹, rief Johann.
Matthias befürchtete eine Falle und zögerte.
Johann streckte seine Hand aus. ›Du musst weg. In der Stadt errichten sie ein Blutgerüst. Neun Männern wird der Henker den Kopf abschlagen, heißt es.‹
Er vernahm das Raunen der Menge, das Knarren des Blutgerüsts. Er hörte den Schlag der Axt, das dumpfe Poltern, wenn ein Kopf fiel.
Johann riss ihn aus diesem Albtraum. ,Draußen wartet mein Fuhrwerk.‹
›Warum tust du das?‹, fragte Matthias.
›Zakar tov. Erinnere dich an das Gute!‹ Johann ergriff Matthias' Hand.
Der Weg, den das Fuhrwerk nahm, zog sich eine Ewigkeit. Zwischen Decken und Weinschläuchen versteckt, bemerkte er, wie der Tag anbrach. Düstere Gedanken suchten ihn heim. Warum sollte er weiterleben, während seine Brüder vor aller Augen starben? Plötzlich stoppte das Fuhrwerk.
›Halt! Wer da?‹ Die Stimme war rau und fordernd.
›Ein Weinhändler, guter Mann‹, antwortete Johann ruhig.
›Haben wir denn noch Krieg, dass ihr euch so früh auf den Weg macht? Oder habt ihr mehr geladen als nur Wein?‹
Matthias wurde die Kehle eng. Hatte man ihn bemerkt?
Johann lachte auf. ›Vielleicht ein paar Flöhe, die sich in den Decken verstecken. Wollt Ihr nachsehen?‹
Der Landsknecht schwieg.
›Wartet, guter Mann‹, rief Johann.
Kurz darauf hörte Matthias ein zufriedenes Schmatzen. Der Geruch getrockneter Wurst drang zu ihm.
›Weiterfahren‹, sagte der Landsknecht mit vollem Mund.
»Einer, von dem ich es nie erwartet hätte, hat mich in Sicherheit gebracht«, sagte Matthias. »Der Sohn des Weinhändlers hat mich nach Kiedrich gefahren. Dort hielt ich mich lange Zeit verborgen.«
Elisabeth trat an den Tisch und sah ihn an. »Mein Vater und meine Brüder wollten bei der Erhebung eigentlich mehr tun. Immerhin konnten wir dich verstecken.«
Matthias wandte sich an Jakob. »Deine Großmutter hat ihren Vater bekniet, mich auf seinem Hof zu lassen.«
Elisabeth gab ihm einen Schubs. »Das waren bloß deine schönen Augen!«
Matthias griff in die Tasche seines Wamses und zog einen hölzernen Becher hervor. »Da, Junge, fass ihn einmal an.«
Jakob nahm den Becher zögernd entgegen.
»Diesen Becher hat Johann mir geschenkt. Er wollte, dass ich mich erinnere.«
Jakob wog den Becher in der Hand, ließ die Finger über das Holz gleiten, dann stellte er ihn vor sich auf den Tisch.
»Eines Tages wird er dir gehören«, sagte Matthias leise.
»Hattest du Angst?«, fragte Jakob.
Matthias nickte. »In den ersten Wochen haben die Schergen nach Aufständischen gesucht. Das Blutgerüst war noch nicht abgebaut. Sie haben Hof um Hof durchkämmt.«
Er schlief in einem Heuschober. Die Nächte waren still. Das Knistern einer Maus im Stroh klang wie das Scharren einer Stiefelsohle. Manchmal meinte er, das Wispern von Stimmen oder das Klirren von Stahl zu hören. Eines Nachts zerrte ihn Elisabeths Vater ins Freie. Er glaubte, seine letzte Stunde habe geschlagen. Doch der Vater marschierte mit ihm in das Tal unterhalb der Burg. Als er ihm eine Decke und einen Lederschlauch mit Wasser in die Hand drückte und ihm den neuen Schlafplatz zeigte, schämte sich Matthias für sein Misstrauen.
»Eine Zeit lang musste ich im Unterstand eines Hirten am Waldrand hausen.«
»Ansonsten kannst du dich an nichts erinnern?«, fragte Elisabeth und zupfte sich an der Schürze.
Die erste Nacht schlief Matthias kaum, am nächsten Morgen beobachtete er Landsknechte, die die Straße vom Gebück herunterkamen. Sie zogen einen Burschen, den er auf der Wacholderheide hatte tanzen sehen, mit einem Strick um den Hals hinter sich her.