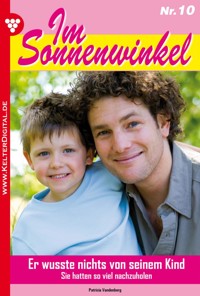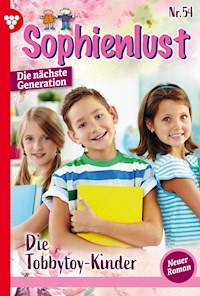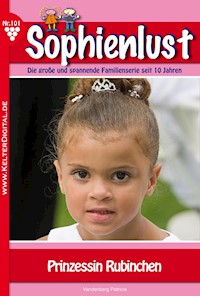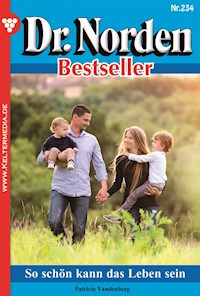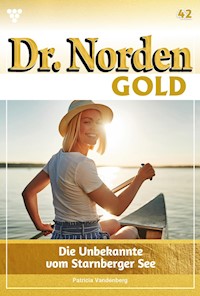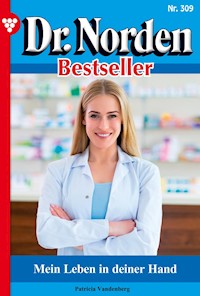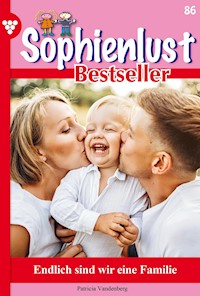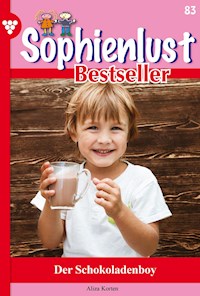30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dr. Norden Digital
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Dr. Norden – Unveröffentlichte Romane Dr. Norden ist die erfolgreichste Arztromanserie Deutschlands, und das schon seit Jahrzehnten. Mehr als 1.000 Romane wurden bereits geschrieben. Für Dr. Norden ist kein Mensch nur ein 'Fall', er sieht immer den ganzen Menschen in seinem Patienten. Er gibt nicht auf, wenn er auf schwierige Fälle stößt, bei denen kein sichtbarer Erfolg der Heilung zu erkennen ist. Immer an seiner Seite ist seine Frau Fee, selbst eine großartige Ärztin, die ihn mit feinem, häufig detektivischem Spürsinn unterstützt. Auf sie kann er sich immer verlassen, wenn es darum geht zu helfen. E-Book 1: Versöhnung auf Raten E-Book 2: Verleumdung in der Praxis E-Book 3: Irgendwo in Venedig E-Book 4: Keine Zeit für Träume E-Book 5: Souvenir aus dem Urlaub E-Book 6: Die Wahrheit über Anna M. E-Book 7: Chrissi wagt die Flucht nach vorn E-Book 8: Eine Affäre mit Risiko E-Book 9: Olivia steht sich selbst im Weg E-Book 10: Das Leben nach dem Happy-End
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Versöhnung auf Raten
Verleumdung in der Praxis
Irgendwo in Venedig
Keine Zeit für Träume
Souvenir aus dem Urlaub
Die Wahrheit über Anna M.
Chrissi wagt die Flucht nach vorn
Eine Affäre mit Risiko
Olivia steht sich selbst im Weg
Das Leben nach dem Happy-End
Dr. Norden – Unveröffentlichte Romane – Staffel 1 –Staffel 1-10
Patricia Vandenberg
Versöhnung auf Raten
Was hält Debora an diesem Mann?
Roman von Vandenberg, Patricia
»Du hast schon wieder den Schlüssel stecken gelassen«, beschwerte sich Roger Feldmann ohne Umwege bei seiner Frau, als sie ihm die Tür öffnete. »So kann ich natürlich nicht aufschließen«, fügte er statt einer Begrüßung schlecht gelaunt hinzu.
»Tut mir leid. Im Haus war das anders. Da sperrte das Schloß trotz steckendem Schlüssel«, verteidigte sich Debora halbherzig und wartete auf den Begrüßungskuß ihres Mannes. Doch Roger war schon an ihr vorbeigegangen und bückte sich eben, um die Siamkatze Cleopatra zärtlich zu begrüßen.
»Na, meine schöne Cleo, wie geht es dir heute? Hast du was Schönes zu fressen bekommen, wenn du hier schon keine Mäuse jagen kannst?« sprach er mit dem schnurrenden Tier, als hätte er es mit einem Menschen zu tun.
»Als ob dieses verwöhnte Biest in Solln jemals eine Maus gejagt geschweige denn gefressen hätte«, erwähnte Debora beiläufig. »Was ist eigentlich mit meiner Begrüßung?«
Noch immer stand sie an der Tür und sah gelinde enttäuscht auf ihren Mann hinab.
Als hätte er sie nicht gehört, überging Roger diese Bemerkung.
»War das ein anstrengender Tag heute«, seufzte er, stupste die Katze auf die samtweiche Nase und erhob sich. Versöhnlich gestimmte kam Debora auf ihren Mann zu und legte die Arme um seinen Hals.
»Möchtest du etwas essen? Ich habe Schmorbraten gemacht, dein Leibgericht.«
»Tut mir leid, ich muß gleich wieder fort, Lagebesprechung in der Firma«, entschuldigte sich Roger und drängte sich an Debora vorbei in das winzige Schlafzimmer, um sich umzuziehen. »Ein Elend, wie eng es hier ist«, schimpfte er ungehalten, als er dabei einen Blumentopf vom Fensterbrett wischte, der klirrend auf dem Boden zerbrach.
»Jetzt sieh dir diesen Dreck an!« entfuhr es Debora vorwurfsvoll. Sie warf einen verzweifelten Blick auf den feuchten Erdfleck, der sich auf dem hellen Boden ausbreitete. »Wie soll ich das jemals wieder herausbekommen?«
»Du hast doch sonst den ganzen Tag nichts zu tun«, tönte Rogers Stimme aus dem Nebenzimmer. »Das wirst du gerade noch schaffen.«
Deprimiert stand Debora mit gesenktem Kopf vor den Scherben. Eine blonde Strähne fiel ihr ins Gesicht, die sie traurig nach hinten strich.
»Als wir noch im Haus wohnten, hatte ich wirklich genug zu tun damit, es in Ordnung zu halten. Und der große Garten war ja auch viel Arbeit.«
Roger hatte sich inzwischen umgezogen und erschien in der Schiebetür, die das Schlafzimmer vom Wohn- und Eßbereich mit der Küchennische trennte. Er band sich die Krawatte, während er seine Frau prüfend ansah.
»Wann begreifst du endlich, daß das Haus nach dem Wasserschaden abbruchreif ist? Diese Zeiten sind erstmal vorbei. Bis die Versicherung den Schaden beglichen und ich genügend Geld verdient habe, bis wir uns ein neues Anwesen leisten können, wird noch einige Zeit ins Land gehen. So lange wirst du dich mit dieser Situation arrangieren müssen«, erklärte er ihr mit einer unterdrückten Ungeduld in der Stimme, während er seine Frau mißbilligend musterte. »Du solltest dir wirklich überlegen, ob du dir nicht einen Job suchen willst. Erstens bist du dann nicht mehr so unzufrieden und gehst mir mit deinem ständigen Gemecker auf die Nerven, und zweitens könnten wir unsere Träume mit einem zweiten Gehalt schneller erfüllen.«
Debora meinte, nicht richtig gehört zu haben. Sie starrte ihren Mann fassungslos an.
»Aber du warst es doch immer, der behauptet hat, seine Frau müsse nicht arbeiten gehen!« erklärte sie überrascht. »Du hast darauf bestanden, daß ich mich um Haus und Garten kümmere und ausschließlich für dein Wohlbefinden zuständig bin.«
Als er das hörte, machte Roger eine wegwerfende Handbewegung und zog sein Sakko über.
»Daß du immer so unbeweglich sein mußt. Das ist doch nicht zeitgerecht, mein Schatz. Flexibilität heißt das Zauberwort. Wo kämen wir denn da hin, wenn jeder in den Modellen verharrt, die für eine bestimmte Zeit gültig waren? Das würde Stillstand in jeder Hinsicht bedeuten. Und, wie sehe ich aus?« ließ er das Thema jedoch fallen, noch ehe Debora sich gegen diese Anschuldigung wehren konnte.
»Sehr gut, wie immer«, antwortete sie wahrheitsgemäß und wollte sich an ihn schmiegen, als das Telefon klingelte.
»Tust du mir einen Gefallen und gehst ran?« bat Roger, der sich aufs Bett setzte, um die Schuhe anzuziehen.
Obwohl sie große Sehnsucht nach Wärme, Geborgenheit hatte, erfüllte Debora selbstverständlich diesen Wunsch.
»Schon wieder diese Evelyn Schuster«, erklärte sie gleich darauf irritiert und reichte ihm den Hörer. »Hast du sie nicht noch vor einer halben Stunde im Büro gesehen?«
Doch Roger achtete gar nicht auf den Kommentar seiner Frau. Ein strahlendes Lächeln verzog seine vollen Lippen.
»Evi, gut, daß du anrufst. Ich brauche unbedingt deine Meinung zu den Plänen für das Bürogebäude in der..., bevor ich sie Karlsen heute abend präsentiere.«
Debora hielt die Luft an, als sie das hörte. Sie konnte ihren Mann nicht aus den Augen lassen, während ein tiefer Schmerz durch ihr Herz schnitt. Gleichzeitig beobachtete sie, wie sich Rogers Miene entspannte. »Wunderbar, daß du derselben Meinung bist wie ich. Wir sind wirklich ein hervorragendes Team. Bis später dann. Ich freue mich!« erklärte er noch und beendete das Telefonat zufrieden.
Ohne Debora eines Blickes zu würdigen, gab er ihr den Hörer zurück, um seine Schuhe weiterzubinden.
»Früher hast du mir die Pläne für die neuen Gebäude gezeigt und mich um meine Meinung gebeten«, wagte Debbie eine leise Bemerkung.
Roger sah noch nicht einmal auf sondern lachte nur rauh.
»Herzchen, Evelyn ist Hochbauingenieurin wie ich und ein absoluter Profi auf ihrem Gebiet. Du wirst doch verstehen, daß sie erheblich kompetenter ist als du als gelernte Hotelfachfrau.«
»Früher warst du stolz auf meine Fähigkeiten. Immerhin habe ich die Schule mit Auszeichnung abgeschlossen. Damals waren wir auch noch ein gutes Team«, beharrte Debora trotzig.
»Daß du immer in der Vergangenheit leben mußt, Schätzchen«, kritisierte Roger noch einmal milde lächelnd und erhob sich. Als er sich diesmal an Debora vorbeidrängte, drückte er ihr einen Kuß auf die Stirn. »Warte nicht auf mich, es wird spät heute.«
Debora sah ihren Mann fragend an. Dieser Blick verunsicherte Roger.
»Was ist? Warum schaust du mich so an? Stimmt was nicht mit meiner Frisur?« Unsicher fuhr er sich mit der Hand durch das hellbraune Haar.
»Hast du was mit ihr?« kam statt einer Antwort eine überraschende Frage.
Roger zuckte zusammen und sah seine Frau an. Als er die Unsicherheit in ihren blauen Augen entdeckte, lachte er spöttisch.
»Wie bitte? Wir sind Arbeitskollegen und bearbeiten gemeinsam ein wichtiges Projekt. Jetzt erzähl mir bloß nicht, du bist eifersüchtig.«
»Warum ruft sie so oft an, wenn es nur ums Geschäft geht? Ihr seht euch doch den ganzen Tag. Und war nicht erst gestern eine Präsentation?«
»Glaubst du, wir haben nur ein einziges Projekt zu besprechen?« fragte Roger etwas ungehalten. »Herzchen, du solltest dir wirklich eine Arbeit suchen. Du hast viel zuviel Zeit, dir Gedanken und Sorgen zu machen.« Damit winkte er ihr zu, drehte sich um und stieß sich den Kopf an der Garderobe. »So ein Mist!« fluchte Roger. »Es wird Zeit, daß wir uns endlich wieder eine größere Bleibe leisten können.«
Mit der einen Hand rieb er sich die Stirn, während er sich mit der anderen ein paar Rollen unter den Arm klemmte und die Wohnung ohne ein Wort des Abschieds verließ. Laut krachend fiel die Tür ins Schloß und Debora zuckte zusammen, als die Katze schnurrend um ihre Beine strich.
»Tja, Cleo, so schnell landet man auf dem Abstellgleis. Das hättest du nicht gedacht, was?« Doch alles, was sie von der Katze bekam, war ein mißtrauischer Blick aus den hellblauen Augen. Sie hatten sich noch nie leiden können, und so verzog sich jede der beiden wie nach einer stillschweigenden Vereinbarung in eine andere Ecke der kleinen Wohnung, um sich nur ja aus dem Weg zu gehen.
*
In sich gekehrt wanderte Dr. Jenny Behnisch an der Seite ihres langjährigen Freundes und Kollegen Dr. Daniel Norden einen der langen, freundlichen Flure der Behnisch-Klinik hinunter.
»Auch wenn ein Leben erfüllt und womöglich glücklich war, ist es doch immer wieder berührend, wenn es zu Ende geht«, teilte sie schließlich ihre Gedanken mit dem Freund.
»Kann man glücklich sein, wenn man so einsam sterben muß wie Martin Kowatsch?« stellte Daniel eine berechtigte Frage.
»Manche Menschen sind anders strukturiert als du und ich. Sie lieben die Einsamkeit und Unabhängigkeit«, bemerkte Jenny schlicht.
Während Daniel sich an seinen Patienten Martin Kowatsch erinnerte, nickte er beifällig. Wenn er es recht bedachte, mußte er Jenny recht geben.
»Er war auch in der Praxis stets einsilbig und schweigsam. Deshalb war es auch nicht einfach, eine Diagnose zu stellen, um ihn überhaupt behandeln zu können«, seufzte er.
Jenny Behnisch sah ihren Freund von der Seite an.
»Du machst dir doch nicht etwa Vorwürfe, daß du ihn so spät in die Klinik geschickt hast?« fragte sie besorgt. »Solche Gedanken kannst du dir wirklich sparen. Dieser Mann war einfach alt und erschöpft. Seine Lebensuhr war abgelaufen. Der Tumor hat diesen Vorgang nur beschleunigt. Und ehrlich gesagt bin ich froh, daß wir nicht dazu gekommen sind, lebensverlängernde Maßnahmen einzuleiten. Das hätte ihm nur eine unnötige Verlängerung seines Leidens verschafft«, beruhigte sie Daniel.
»Ich weiß ja, daß du recht hast. Und es ist eine schöne Art zu sterben, wenn man ganz ruhig und friedlich einschlafen darf.« Eine Weile hing er seinen Gedanken noch nach. »Hat Herr Kowatsch denn gar keine Verwandten gehabt?« erkundigte sich Dr. Norden schließlich.
Jenny Behnisch zuckte mit den Schultern.
»Offenbar nicht. In der ganzen Zeit, die er hier in der Klinik war, hat er nur ein einziges Mal Besuch bekommen. Und das war der Notar, dem er seinen letzten Willen aufgetragen hat.«
»Wie so viele Leute ohne Familie wird Martin Kowatsch seinen Besitz vermutlich der Stadt oder irgendeiner Stiftung vererben. Wenn er denn überhaupt etwas besessen hat«, dachte Daniel Norden laut nach. »Einen Vorteil hat die Sache aber doch: zumindest ist keine Verwandtschaft da, die sich um den Nachlaß streiten kann. Solche Auseinandersetzungen gehören für mein Empfinden zu den geschmacklosesten Dingen, die sich nicht wenige unserer Mitmenschen zuschulden kommen lassen«, fügte er kritisch hinzu.
Und auch dazu konnte Jenny Behnisch etwas sagen.
»Fest steht auf jeden Fall, daß Martin Kowatsch nicht mittellos war. Den Schwestern hat er immer ein großzügiges Trinkgeld gegeben. Deshalb war er trotz seiner Schweigsamkeit äußerst beliebt«, erzählte sie, als die beiden Ärzte eilige Schritte hinter sich hörten. Inzwischen waren sie an Jennys Büro angelangt und sahen sich gleichzeitig interessiert um, wer ihnen da so aufgeregt folgte.
Es war ein kleiner, schmächtiger Herr mit grauem, schütterem Haar, einer Nickelbrille vor den flinken Augen und einem altmodischen Spitzbart. Sein ebenfalls grauer Mantel flatterte hinter ihm her, und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, als er atemlos vor Jenny Behnisch und Daniel Norden innehielt. Bevor er etwas sagte, zog er ein blütenweißes Stofftaschentuch aus seiner Tasche und betupfte sich damit die Stirn.
»Frau Dr. Behnisch, die Schwestern haben mir gesagt, Sie wären gerade auf dem Weg in Ihr Büro«, begrüßte er die Klinikchefin schließlich noch immer ein wenig atemlos von der ungewohnten Anstrengung.
Jenny hatte den Verfolger längst erkannt und streckte bedauernd die Hand aus.
»Herr Dr. Schwan, ich grüße Sie. Bitte kommen Sie doch herein«, ließ sie dem Notar den Vortritt in ihre Räume. »Ich wollte Sie eben telefonisch vom Ableben Ihres Mandanten in Kenntnis setzen.«
Nachdem sie die Tür geschlossen und allen einen Platz angeboten hatte, zögerte Jenny nicht lange, diese traurige, aber nicht überraschende Neuigkeit mitzuteilen. Doch Wolfgang Schwan war bereits im Bilde.
Er räusperte sich umständlich.
»Die Schwestern haben mich bereits unterrichtet«, erklärte er dann. Seine flinken, hellwachen Augen wanderten von Jenny Behnisch hinüber zu Dr. Daniel Norden. »Bitte machen Sie keine so traurigen Gesichter. Mein Mandant Martin Kowatsch fürchtete den Tod nicht. Er hat in seinem Leben viele Abenteuer bestanden und war der Erlebnisse überdrüssig.«
Daniel Norden zögerte nicht, dem Notar den Grund für seine Betroffenheit mitzuteilen, erntete dafür aber nur ein feines Lächeln.
»Obwohl er die Einsamkeit schon immer liebte, war Herr Kowatsch schon immer ein Menschenfreund. Deshalb wußte er die außerordentliche Zuwendung zu schätzen, die ihm durch die Ärzte und besonders durch Dr. Daniel Norden, in dessen Behandlung er sich längere Zeit befand, widerfahren ist«, erklärte er, ohne zu ahnen, daß eben dieser Dr. Norden vor ihm saß.
Jenny Behnisch kam nicht umhin, das Geheimnis zu lüften.
»Das hier ist Dr. Daniel Norden. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, Sie bekannt zu machen«, klärte sie den Notar auf.
Der nahm daraufhin seine Nickelbrille ab, putzte sie umständlich, setzte sie wieder auf und musterte Daniel schließlich wohlgefällig.
»Schade, daß ich seit langer Zeit einen Hausarzt habe. Aufgrund der Schilderungen meines Mandanten müßte ich eigentlich gleich zu Ihnen wechseln«, erklärte er dann schmunzelnd. »Herr Kowatsch hat sich selten so freundlich und aufmerksam behandelt und gut betreut gefühlt wie in Ihrer Praxis.« Doch beinahe sofort wandte sich Dr. Schwan an Jenny. »Keine Sorge, auch mit dem Service der Klinik war er überaus zufrieden. Das ist auch der Grund, warum er mich vor ein paar Tagen noch einmal herbestellt hat. Er hatte noch einige Änderungen im Testament zu machen.« Dr. Wolfgang Schwan hüstelte, ehe er fortfuhr. »Vor der offiziellen Testamentseröffnung muß ich selbstverständlich Stillschweigen bewahren. Damit mein Besuch in der Klinik aber nicht ganz umsonst ist, dachte ich mir, Sie könnten mir schon einmal Ihre Postanschrift mitteilen, damit ich die Ladungen ohne Umstände direkt verschicken kann.«
Diese Neuigkeit war nun doch eine echte Überraschung. Jenny und Daniel wechselten verwunderte Blicke, ehe sie dem Notar ihre jeweiligen Anschriften gaben. Als er mit den Notizen fertig war, klappte er sein Notizbuch zu und lächelte verschmitzt.
»Sie sind verwundert, das sehe ich Ihnen an. Und ich denke, Sie haben auch allen Grund dazu. Kennen Sie das Sprichwort ›Stille Wasser sind tief‹?« Nun, genau diese Eigenschaft traf auf meinen Mandanten zu, den ich mit Fug und Recht als meinen Freund bezeichnen darf.« Mit diesen rätselhaften Worten erhob sich Dr. Wolfgang Schwan und machte eine knappe Verbeugung, während er sich verabschiedete.
Jenny begleitete ihn zur Tür, durch die er mit schnellen Schritten verschwand. Und so gerne sich Daniel auch noch mit seiner Freundin und Kollegin über diesen seltsamen Besuch unterhalten hätte, so blieb ihm im Augenblick keine Zeit mehr dazu. Die Mittagspause, die er für diesen Besuch genutzt hatte, war vorüber. Dr. Norden war so gewissenhaft, seine Patienten, die auf seine Hilfe und seinen Rat hofften, nicht warten zu lassen.
Wenige Tage nach diesem Gespräch studierte die Hochbauingenieurin Evelyn Schuster interessiert und zu einem bestimmten Zweck die Todesanzeigen der Tageszeitungen. Wie schon häufiger stieß sie dabei auf eine bemerkenswerte Nachricht. Sofort griff sie zur Schere, schnitt eine bestimmte Anzeige aus und ging mit dem Ausschnitt hinüber ins Büro ihres Kollegen Roger Feldmann.
»Schau dir das mal an! Das ist ja nahezu eine Sensation.«
Wie immer, wenn seine hübsche dunkelhaarige Kollegin ins Zimmer kam, setzte Roger ein strahlendes Lächeln auf. Eifrig beugte er sich über den Zeitungsausschnitt, den sie ihm auf den Tisch gelegt hatte.
»Martin Kowatsch ist vor ein paar Tagen verstorben. Ich habe diesen Namen nie gehört«, blickte er dann fragend zu Evelyn hoch, die ihn triumphierend anlächelte.
»Ich habe nicht erwartet, daß du mit aller Welt bekannt bist«, gab Evelyn mit leisem Spott zurück. »Kowatsch war ein stiller Zeitgenosse, der es liebte, im Hintergrund zu agieren. Ich hatte das Glück, ihn zufällig anläßlich einer Feierlichkeit eines Geschäftsfreundes kennenzulernen. Für gewöhnlich mied Martin Kowatsch diese Menschenansammlungen. An diesem Tag hatte er jedoch eine Ausnahme gemacht, die uns jetzt zugute kommt.«
»Ich verstehe nicht ganz. Willst du nicht endlich Klartext mit mir reden?« bat Roger sichtlich ratlos, während sein Blick zwischen der Anzeige und der schönen Kollegin hin- und her wanderte.
»Mann, Feldmann, du lebst wirklich hinter dem Mond«, erklärte Evelyn daraufhin provozierend. »Kowatsch besitzt ein Haus mitten in München in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt. Als ich damals mit ihm sprach, betrieb er dort eine Pension oder ein kleines Hotel. Und«, jetzt funkelten Evelyns braune Augen vergnügt, »er ist weder verheiratet noch geschieden, noch hat er Kinder.«
Endlich verstand Roger Feldmann. Er zog die Mundwinkel nach oben, dabei kräuselten sich einige Fältchen um seine blauen Augen.
»Du meinst, er hat dieses Haus an irgend jemanden vererbt, der nur darauf brennt, es so schnell wie möglich wieder loszuwerden.«
»Und einen satten Gewinn einzustreichen«, bestätigte Evelyn zufrieden. Es war nicht das erste Mal, daß sie diese Methode anwandte, um an begehrtes Bauland für die ehrgeizigen Büroprojekte zu kommen. »Ich werde sofort in Erfahrung bringen, wer das Haus geerbt hat. Dann rufen wir den Chef auf den Plan. Er muß dem oder den Erben so schnell wie möglich ein entsprechendes Angebot unterbreiten, damit wir die Falle zuschnappen lassen können, bevor andere diese Idee haben.«
»Du bist wirklich eine clevere Frau, Evi. Diese Aktion zu diesem Zeitpunkt wird dir die Prokuristenstelle einbringen«, erklärte Roger und versuchte, den Neid in seiner Stimme zu unterdrücken.
Evelyn, die wußte, wie wichtig dieser Posten für ihren Kollegen war, lächelte ihn ermutigend an.
»Ohne dich kann ich diesen Coup nicht durchführen. Es ist also eine Ehrensache, daß wir gemeinsam als Drahtzieher auftreten.«
»Du bist nicht nur clever sondern auch noch fair«, errang sie damit die uneingeschränkte Bewunderung von Roger, der sich erhob, um den Schreibtisch herumging und die Hände auf Evelyns schmale Schultern legte. »Worauf warten wir noch? Laß uns mit der Suche nach den Erben beginnen, ehe es andere tun«, forderte er sie enthusiastisch auf.
Evelyn nickte.
»Ich werde zunächst einmal meine Kontakte spielen lassen. Der Gastgeber von damals kann mir vielleicht weiterhelfen. Du informierst inzwischen unseren lieben Chef Hugo Bernwart von unserem Vorhaben. Er wird begeistert sein.« Evelyn nickte dem Kollegen noch einmal zu, ehe sie sich abwandte und auf atemberaubend hohen Absätzen davonstöckelte.
Fasziniert sah ihr Roger Feldmann nach. In ihrer ganzen Art war Evelyn das genaue Gegenteil seiner Frau Debora. Und besonderst seit Debbie ihrer Aufgabe, sich um das große, alte Anwesen in Solln zu kümmern, beraubt war, ließ sie sich für seinen Geschmack äußerlich wie auch sonst zu sehr gehen. Da war eine karrierebesessene, ehrgeizige und erfolgreiche Frau wie Evelyn Schuster eine willkommene und äußerst reizvolle Abwechslung, auch wenn sie geschäftlich eine ernstzunehmende Konkurrenz war.
*
Es war ein grauer, regnerischer Tag, als Daniel Norden gemeinsam mit seiner Frau Fee durchgefroren von der Beerdigung zurückkehrte. Selbst wenn ihm die geheimnisvolle Ankündigung des Notars Wolfgang Schwan nicht zu Ohren gekommen wäre, hätte Daniel Norden diese Gelegenheit wahrgenommen, sich in aller Stille von seinem Patienten zu verabschieden. So aber bekam die ganze traurige Angelegenheit eine ganz andere Dimension.
»Außer Jenny und Dr. Schwan waren ja nicht viele Menschen da«, bemerkte Felicitas nachdenklich, als sie zum Wagen zurückkehrten. »Dabei erzählte auch der Pfarrer noch einmal ausdrücklich, welch großer Menschenfreund Martin Kowatsch gewesen ist.«
»Er muß im Verborgenen gewirkt haben, ohne sich zu erkennen zu geben«, vermutete Daniel, der aber auch nur spekulieren konnte. Trotzdem hatte er in diesem Zusammenhang etwas bemerkt, was Fees Aufmerksamkeit entgangen war. »Ist dir der Mann mit dem schmuddeligen Mantel und den langen, ungepflegten Haaren aufgefallen? Er stand etwas weiter entfernt und hat die ganze Zeremonie aufmerksam mitverfolgt.«
»Nein, den habe ich nicht bemerkt. Meinst du, er kannte Kowatsch?«
»Keine Ahnung. Es mag auch sein, daß es lediglich ein Zaungast war. Ich habe von solchen Menschen gehört, die es sich zum Hobby gemacht haben, sich Trauergesellschaften anzuschließen.«
»Und sich auf diese Art und Weise eine warme Mahlzeit zu erschleichen«, vollendete Felicitas den Gedanken ihres Mannes. »Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß diese arme Kreatur bei diesem unfreundlichen Wetter aus reiner Langeweile an der Beerdigung teilgenommen hat. Jetzt tut es mir fast leid, die Einladung des Notars ausgeschlagen zu haben. Ich wüßte doch zu gern, ob wir mit unserer Vermutung recht haben«, lächelte sie.
Doch Daniels Gedanken waren schon weitergewandert. Inzwischen waren sie am Wagen angelangt, und ganz Kavalier hielt er seiner Frau die Tür auf. Dann stieg er selbst ein und ließ den Motor an. Wenig später fuhren sie durch die belebten Straßen von München.
»Mich würde viel mehr interessieren, wer die beiden Herrschaften waren, du weißt, wen ich meine«, nahm er den Gesprächsfaden wieder auf.
Felicitas erinnerte sich an eine sehr schick gekleidete dunkelhaarige Frau, die sogar einen schwarzen Hut mit kleinem Schleier und ein Nerz-Cape getragen hatte. Und auch ihr Begleiter hatte nicht gerade armselig gewirkt in seinem maßgeschneiderten Anzug.
»Du meinst diese ›Bonzen‹, um es in den Worten unseres Sohnes Janni zu sagen?« erkundigte sie sich bei ihrem Mann.
Der lächelte amüsiert.
»Ehrlich gesagt hätte ich dieses Wort nicht gewählt. Aber ich muß zugeben, daß diese Bezeichnung ganz gut paßt«, gab er erheitert zurück. »Es würde mich interessieren, in welchem Verhältnis sie zu dem Verstorbenen stehen. Auch Jenny kannte die beiden nicht von Klinikbesuchen.«
»Ist es nicht oft so, daß urplötzlich aus dem Nichts Verwandtschaft auftaucht, sobald es etwas zu erben geben könnte?«
»Die beiden machten nicht den Eindruck, als wären sie auf eine kleine Erbschaft angewiesen«, gab Daniel nun etwas nachdenklich zurück.
»Wer weiß. Womöglich war Martin Kowatsch ein hoffnungslos unterschätzter Mann. Spätestens bei der Testaments-Eröffnung wirst du es ja erfahren. Wenn die beiden dann auch anwesend sind, handelt es sich zumindest um Verwandte«, erklärte Fee und sah hinaus in den grauen Mittag, als ihr Blick auf ein Veranstaltungsplakat fiel, das großflächig einen häßlichen Bauzaun zierte. Schlagartig waren ihre Gedanken abgelenkt. »Das hätte ich ja beinahe vergessen!« rief sie erschrocken und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn.
Vor Schreck hätte Daniel beinahe seinen Vordermann gerammt, der plötzlich bremste.
»Was ist denn passiert?« fragte er, als er das Unglück erfolgreich verhindert hatte.
Fee, die von dem Manöver in ihrem Schreck gar nichts bemerkt hatte, seufzte.
»Noch nichts. Aber es könnte noch heikel werden. Siehst du da drüben das Plakat?«
»Meinst du die Ankündigung
der Gesundheitsmesse Wellsana?« fragte Daniel, der nur einen kurzen Blick riskierte, um nicht wieder in eine gefährliche Situation zu geraten.
»Genau die. Dort ist Mario mit seiner Firma Vita-Pro vertreten. Es werden auch einige Außendienstmitarbeiter erwartet und er hatte mich vor einiger Zeit gebeten, fünf Zimmer zu reservieren. Das hatte ich vollkommen vergessen.«
Als er das hörte, erschien eine steile Falte auf Daniels Stirn.
»Das könnte so kurzfristig durchaus ein Problem werden«, äußerte er ernste Bedenken. »Derzeit finden viele Messen in München statt. Die Frühjahrsmesse, eine Hochzeitsmesse und diverse andere Ausstellungen, an deren Namen ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Außerdem findet auf der Theresienwiese das Frühlingsfest statt.«
»Dann wird es also mit Sicherheit schwer, jetzt noch Zimmer zu bekommen«, seufzte Felicitas betreten. »Wie konnte mir das nur passieren, das zu vergessen? Es ist bestimmt sechs Wochen her, daß Mario mich um diesen Gefallen gebeten hat.«
Mitfühlend legte Daniel eine Hand auf das schlanke Knie seiner Frau.
»Mach dir keine Vorwürfe. Es kann schon mal vorkommen, daß eine fünffache Mutter so etwas vergißt. Ich verstehe ohnehin nicht, daß sich jeder mit seinen Sorgen an dich wendet und darauf hofft, daß du eine Lösung parat hast. Warum hat er sich eigentlich nicht selbst darum gekümmert?« fragte er mit leisem Vorwurf in der Stimme.
»Es sollten günstige Zimmer sein, und er kennt sich in München doch nicht so gut aus. Als er mir von seinen Sorgen berichtete, bot ich ihm an, das für ihn zu übernehmen«, gestand Fee ein wenig kleinlaut. »Und jetzt habe ich den Salat. Ich hasse es, unzuverlässig zu sein.«
»Und du liebst es, gebraucht zu werden. Ich befürchte, meine süße kleine Fee hat ein ausgewachsenes Helfer-Syndrom«, seufzte Daniel in gespielter Verzweiflung. »Dabei sollte man meinen, du hättest schon genug zu tun mit den Kindern, dem Haushalt, deinen verschiedenen Ehrenämtern...«, zählte Daniel Norden auf.
»Schon gut, du weißt doch, daß ich nicht nein sagen kann und stets um das Wohl meiner Lieben besorgt bin. Außerdem kannst du nicht behaupten, daß du nicht von meinem Helfersyndrom profitierst«, erklärte Felicitas streng.
Daraufhin lachte Daniel herzlich. »Das würde mir niemals in den Sinn kommen, zumal ich dieser liebenswerten Eigenschaft eine wunderbare Kinderschar zu verdanken habe. Wenn du nur eine Spur egoistischer wärst, hättest du dich nicht auf meinen Wunsch nach einer großen Familie eingelassen.«
»Es war nicht nur dein Wunsch«, erinnerte ihn Fee weich. »Es war ein Traum, den ich mit dir geträumt habe.«
Als er das hörte, wollten Daniel Tränen der Rührung in die Augen steigen. Sehr zärtlich streichelte er über das schlanke Bein seiner Frau.
»Dafür werde ich dir ewig dankbar sein.«
Doch Felicitas war in diesem Moment weit davon entfernt, sentimental zu sein. Schon blitzte ein frecher Funke in ihren Augen.
»Deshalb fällt es dir doch sicher nicht schwer, mir einen kleinen Gefallen zu tun, oder?« fragte sie augenzwinkernd.
»Oh, ich weiß schon. Jetzt muß ich die Kartoffeln für dich aus dem Feuer holen und die Zimmer organisieren«, lächelte Daniel, der genau wußte, worauf seine Frau hinauswollte.
Fee lächelte.
»Wie hast du das nur so schnell erraten?« schmeichelte sie mit der Stimme, von der sie wußte, daß Daniel ihr nicht widerstehen konnte. »Und, wie lautet deine Antwort?«
Daniel mußte keine Sekunde nachdenken.
»Wie lange habe ich Zeit?« fragte er schicksalsergeben.
Freudig erkannte Fee dabei das Lachen in seinem Blick.
*
Die Beerdigung von Martin Kowatsch lag bereits ein paar Tage zurück, und Roger hatte seiner Frau nichts von seinem Besuch auf dem Friedhof erzählt, als ein dicker Brief seinen Weg in den Briefkasten der Familie Feldmann fand. An diesem Abend konnte es Debora noch schwerer als sonst erwarten, bis ihr Mann nach Hause kann. Stundenlang lauschte sie auf die Schritte im Hausflur, bis sie endlich seine zu erkennen meinte. Ungeduldig lief sie zur Tür und riß sie auf.
»Gott sei Dank, da bist du ja!« rief sie so laut, daß Roger erschrocken zusammenzuckte.
»Bist du jetzt vollkommen übergeschnappt?« fragte er entgeistert und zerrte seine Frau in die kleine Wohnung. Ärgerlich schloß er die Tür hinter sich und starrte Debora an. Seine blauen Augen sprühten Funken. »Was sollen da die Nachbarn denken, wenn du so ein Theater veranstaltest?«
»Das ist mir doch egal«, war Debora an diesem Abend jedoch weit davon entfernt, sich einschüchtern zu lassen. »Schau doch nur, was heute mit der Post gekommen ist«, erklärte sie atemlos und hielt ihrem Ehemann den Brief unter die Nase.
Sichtlich genervt versuchte Roger, ihr auszuweichen.
»Darf ich wenigstens erstmal in Ruhe nach Hause kommen? Im
Gegensatz zu dir habe ich einen
anstrengenden Arbeitstag hinter mir.«
Doch Debora ließ nicht locker.
»Ich habe eine Erbschaft gemacht. Das ist die Einladung zur Testamentseröffnung in drei Tagen. Lies doch mal«, erklärte sie ihm so aufgeregt wie lange nicht.
Roger sah seine Frau fragend an.
»Wer sollte dir denn etwas vererben? Hast du in der Einsamkeit den Verstand verloren?« fragte er skeptisch.
Diese neuerliche Verletzung schmerzte Debora zutiefst. Dennoch überging sie sie geflissentlich. Sie war zu aufgeregt über die unerwartete Neuigkeit.
»Willst du den Brief nicht endlich lesen?« fragte sie inständig und sah ihn dabei so bittend an, daß Roger sich einen Ruck gab und herablassend seufzend nach dem Bogen Papier griff. Er überflog die Zeilen. Und stutzte. Um seinen Schreck zu überspielen, täuschte er einen Hustenanfall vor.
»Diesen Namen habe ich ja noch nie gehört«, krächzte er schließlich heiser. Er spielte seine Rolle perfekt. Debbie glaubte ihm und sah ihn besorgt an.
»Ist alles in Ordnung mit dir? Du bist auf einmal ganz blaß. Bekommst du etwa eine Grippe?«
»Nein, nein, es ist nur die trockene Luft in diesem kleinen Loch hier«, redete sich Roger rasch heraus. »Wer war denn dieser Martin Kowatsch? Hast du mir nicht immer erzählt, daß du keine lebenden Verwandten mehr hast?«
Diese Frage hatte Debora erwartet. Wie ertappt wandte sie sich ab und schlängelte sich an Roger vorbei in die kleine Küchennische. Dort schenkte sie sich etwas zu trinken ein, ehe sie stockend antwortete: »Onkel Martin war der Bruder meines Vaters. Er hat mich nach dem Tod meiner Eltern sehr verletzt. Deshalb wollte ich nichts mehr mit ihm zu tun haben, habe ihn verleugnet und den Kontakt abgebrochen.«
»Das war mal wieder eine deiner unüberlegten Aktionen, was? Daß du auch ständig überreagieren mußt«, fällte Roger sofort ein unbarmherziges Urteil über seine Frau. »Wie ich dich kenne hast du wieder mal aus einer Mücke einen Elefanten gemacht.«
»Früher hast du diese Eigenschaften Spontaneität und Leidenschaft genannt und hast mich für meine Impulsivität geliebt«, erklärte Debora geknickt.
Roger lächelte kühl und überheblich.
»Ich habe mich eben weiterentwickelt und sehe die Dinge heute in einem etwas anderen Licht. Der einzige Mensch, der stehengeblieben ist, bist offenbar du. Aber lassen wir das.« Möglichst unauffällig wandte Roger sein Interesse wieder der Erbschaft zu. »Also, was war denn nun mit diesem Onkel Martin?« zwang er sich, etwas geduldiger mit seiner Frau zu sein, auch wenn ihm das beim Gedanken an Evelyn schwerfiel.
Genauso, wie auch Debora die Erinnerung sehr zu belasten schien.
»Er hat sich nach dem Tod meiner Eltern geweigert, mich bei sich aufzunehmen. Dabei hatte er damals ein schönes, großes Haus. Doch er hat mir gesagt, er wolle sein Abenteurerleben nicht wegen eines Mädchens ändern und schon gar nicht wegen der Tochter seines ungeliebten Bruders. Deshalb steckte er mich in ein Heim, um weiterhin ungehindert seinen Reisen nachgehen zu können.« Debbie hielt inne. Auch nach so vielen Jahren schmerzte diese Erinnerung noch. Die Wunde hatte sich zwar geschlossen, aber die Narbe tat noch immer weh. Schließlich fuhr sie leise fort. »Das habe ich ihm nie verziehen, obwohl er Jahre später öfter versuchte, mit mir Kontakt aufzunehmen. Er hatte seine Meinung im Alter offenbar geändert und wollte mich um Verzeihung bitten. Oder aber er brauchte Hilfe. Ich weiß es nicht.«
»Warum hast du mir nie davon erzählt?« fragte Roger fordernd.
»Die Erinnerung daran tat so weh. Ich wollte sie nicht immer wieder aufrühren.«
Roger zuckte mit den Schultern.
»Ist ja auch egal. Sentimentalitäten sind das, nichts weiter. Trotzdem finde ich sein schlechtes Gewissen dir gegenüber sehr erfreulich. Es kommt sozusagen zur rechten Zeit«, konnte er sich eine Bemerkung nicht ersparen. »War er denn ein wohlhabender Mann?« Roger versuchte, die Gier in seiner Stimme zu unterdrücken.
Debora war so gefangen von den schmerzlichen Erinnerungen, daß sie nichts davon bemerkte.
»Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Briefmarkensammlung oder ein altes Grammophon, das ich als Kind so geliebt habe. Recht viel erwarte ich mir nicht davon. Trotzdem bin ich sehr aufgeregt.«
»Das kann ich verstehen, mein Täubchen. Endlich passiert mal was in deinem tristen Leben«, spöttelte Roger und legte den Brief des Notars Dr. Wolfgang Schwan beiseite, ohne sich irgendeine Blöße zu geben. Wohlweislich behielt er sein Wissen für sich. Wenn es wirklich so war, daß seine Frau das Haus des Onkels geerbt hatte, dann war das einer der Glücksfälle des Schicksals. Schon brannte er darauf, Evelyn von diesem Ereignis zu erzählen.
»Ich muß noch einmal fort, mein Schatz. Warte nicht auf mich, es kann spät werden«, erklärte er daher wenig später.
»Du willst mich jetzt alleine lassen? Ich dachte, wir feiern ein bißchen und hab’ extra eine Flasche Sekt kalt gestellt«, erklärte Debora und machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung.
Roger seufzte und nahm seine Frau nicht ganz ohne Hintergedanken in die Arme.
»Es tut mir so leid, das mußt du mir glauben. Ich wäre viel lieber öfter bei dir zu Hause. Besonders seit wir hier in diesem Käfig leben müssen, sollte ich dir viel mehr zur Seite stehen und dich ablenken und erheitern. Aber du weißt doch, was momentan in der Firma für mich auf dem Spiel steht. Demnächst geht es um die Beförderung zum Prokuristen. Es gibt nur zwei Kandidaten, Evelyn und mich«, erklärte er komplizenhaft. »Wenn ich mich jetzt nicht richtig reinhänge, dann überholt mich diese karrierebesessene Frau, und wir werden weiter nur von unserem neuen Haus träumen. Und das willst du doch nicht, oder?« fragte er sehr weich und strich seiner Frau eine blonde Strähne zärtlich aus dem glatten Gesicht.
Debora schüttelte den Kopf und lehnte sich an ihren Mann. So oft vermißte sie seine Nähe, seine fürsorgliche Zuwendung, daß sie sie jetzt doppelt genoß.
»Ich habe mir übrigens deinen Rat zu Herzen genommen und die Stellenanzeigen angeschaut. Für ein Hotel nicht weit entfernt von hier wird ein Zimmermädchen gesucht. Ich dachte, dort könnte ich mich doch mal vorstellen. Was meinst du?« Sie hob den Kopf, um in seinem Gesicht lesen zu können und wartete gespannt auf eine Antwort.
Wider Erwarten schüttelte Roger mißbilligend den Kopf.
»Wo denkst du hin, mein Liebling. Zimmermädchen ist aber wirklich weit unter deinem Niveau, findest du nicht?«
»Aber es wäre doch ein Anfang. Immerhin habe ich viele Jahre nicht in meinem Beruf gearbeitet«, gab Debbie verständnislos zurück.
»Du mußt doch nicht gleich das erstbeste Angebot annehmen, das dir über den Weg läuft. Ich finde, du solltest dir Zeit lassen mit dieser Entscheidung.« Mit einem Mal schien es gar nicht mehr so eilig mit der Beschäftigung zu sein. Roger küßte seine Frau auf die Stirn, ehe er sie losließ und sich zum Gehen wandte.
Ratlos stand Debora nur da und sah ihrem Mann nach. Sie verstand die Welt nicht mehr und hatte wieder einmal keine Ahnung, was sie tun oder lassen sollte.
So sehr sich Dr. Daniel Norden in seiner knapp bemessenen Zeit bemühte, Zimmer für die Kollegen von Mario Cornelius zu finden, so wenig erfolgreich war er in seinen Bemühungen. So konnte er dem Stiefbruder seiner Frau keine positiven Nachrichten überbringen, als er eines Abends anrief, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.
»Es ist wie verhext. Einige meiner Patienten haben gute Kontakte zur Hotelbranche. Aber ganz München scheint ausgebucht zu sein«, erklärte er betreten.
Doch Mario schien die Sache nicht so tragisch zu nehmen.
»Dann müssen die Herrschaften eben zu Hause bleiben«, gab er unlustig zurück.
Daniel Norden horchte auf. Diesen Tonfall kannte er nicht an seinem Schwager.
»Was ist los? Du klingst nicht gerade enthusiastisch. Stimmt was nicht in deiner Firma?« erkundigte er sich interessiert.
Mario seufzte.
»Im Grunde genommen ist alles in Ordnung. Aber ehrlich gesagt hatte ich mir etwas anderes vorgestellt, als ich den Arztkittel mit dem Anzug vertauschte«, gestand er nach kurzem Zögern ein. »Natürlich sind meine Arbeitszeiten in der Firma nicht vergleichbar mit denen eines Arztes an einer Klinik. Und auch über mein Gehalt kann ich mich nicht beschweren. Aber offenbar bin ich doch mehr ein Mann der Praxis. Wenn ich so darüber nachdenke, fehlt mir die Nähe zu den Patienten. Ich arbeite zwar im medizinischen Bereich und in der Foschung, dennoch ist es nicht dasselbe«, versuchte er, seine Gefühle in Worte zu fassen.
Daniel nickte verstehend.
»Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst.«
»Wirklich? Und ich dachte schon, du hältst mich für wankelmütig und unreif«, gab Mario erleichtert zurück.
»Niemals. Ich weiß doch wie das ist mit den Vorstellungen, die meistens meilenweit von der Realität entfernt liegen. Aber wenn man nichts ausprobiert, kann man auch keine Erfahrungen sammeln und keine Sicherheit über den richtigen Weg bekommen. Ich fand deinen Schritt weg von der Klinik damals sehr mutig. Genausoviel Respekt zolle ich dir aber, wenn es nicht das richtige war und du die Konsequenzen daraus ziehst.«
Mario seufzte erleichtert.
»Es ist nicht leicht, sich einzugestehen, daß man sich geirrt hat. Und natürlich weiß ich, daß unsere Produkte Menschenleben retten und erhalten. Trotzdem bin ich unzufrieden.« Er hielt inne und schien zu überlegen, ehe er fortfuhr. »In letzter Zeit unterhalte ich mich öfter mit einer befreundeten Kinderärztin über dieses Problem. Nicht, daß sie mich beeinflussen würde. Aber Carla hat mir doch klargemacht, daß ich unmittelbarer arbeiten möchte, nicht so theoretisch«, gestand er mit jugendlicher Leidenschaft. Als er Carla erwähnte, veränderte sich seine Stimme plötzlich. Doch Daniel war so mit Marios Problem beschäftigt, daß es ihm nicht weiter auffiel.
»Es ist immer gut, sich mit vielen Menschen zu unterhalten, um neue Impulse zu bekommen. Hast du schon eine gewisse Vorstellung?«
»Ich überlege, an eine Klinik zurückzugehen und meinen Facharzt zu machen.«
»An welche Fachrichtung hattest du gedacht?« stellte Dr. Norden eine Frage, die nicht unwichtig war.
Eben diese Frage konnte sein Schwager jedoch nicht beantworten.
»Das ist es ja gerade. Ich bin hin- und her gerissen. Es gibt so viele Teilgebiete der Medizin, die mich interessieren, daß ich mich einfach nicht entscheiden kann.« Mario klang tatsächlich ratlos. »Das ist auch der Grund, warum ich noch in der Firma bin. Mir fehlt ein klares Ziel vor Augen.«
»Und was ist mit Allgemeinmedizin? Du könntest eine eigene Praxis eröffnen«, machte Daniel Norden einen anderen Vorschlag.
Doch Mario Cornelius lehnte dankend ab.
»Nein, ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Ich arbeite gerne mit Kollegen zusammen. Außerdem habe ich keine Lust, Salben gegen Fußpilz zu verschreiben und Blutdruck zu messen. Deshalb kommt auch eine Stelle als Arzt im Sanatorium meines Vaters nicht in Frage.«
»Vielen Dank für die Einschätzung meiner Arbeit«, lachte Daniel Norden, amüsiert über das Bild, das sein Schwager über den Alltag als praktizierender Arzt hatte. »Das klingt ganz danach, als hättest du großen Respekt vor mir.«
»Bitte versteh mich nicht falsch. Du arbeitest schon so lange als Allgemeinmediziner. Deine Patienten bringen dir großes Vertrauen entgegen und konsultieren dich selbst bei schwerwiegenden Krankheiten. Durch deine Nähe zu Jenny Behnisch hast du zudem die Möglichkeit, bei der weiteren Behandlung in der Klinik dabeizusein und sie mit Jenny abzustimmen. Welcher andere praktische Arzt hat schon diese Möglichkeiten«, gab Mario energisch zu bedenken.
Überrascht mußte Dr. Norden ihm recht geben.
»Alle Achtung, du scheinst dir ja wirklich schon viele Gedanken in jede Richtung gemacht zu haben«, stellte er lobend fest.
»Natürlich. Aber keine Angst. Ich tue keine unüberlegten Schritte und bleibe erst einmal da, wo ich bin, bis ich genau weiß, was ich will.«
»Eine sehr positive, reife Einstellung, die du da hast. In diesem Fall solltest du aber auch das nötige Engagement walten lassen«, mahnte Daniel.
»Was willst du mir damit sagen?« fragte Mario irritiert.
»Ganz einfach. Wir brauchen fünf Zimmer für deine Kollegen. Oder wenigstens zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer«, erinnerte er seinen Schwager an das drängende Problem.
»Ich bin sicher, du und Fee, ihr werdet das schon hinkriegen«, lachte Mario daraufhin unbekümmert. »Wie alles im Leben.«
»Dein Vertrauen in allen Ehren. Ich hoffe, wir werden dich diesmal nicht enttäuschen müssen«, erklärte Daniel schmunzelnd und angenehm berührt geschmeichelt über das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde.
Die beiden Männer tauschten noch ein paar Sätze, ehe sie das Telefonat in schönstem Einverständnis beendeten. Jeder der beiden kehrte wieder an seine Arbeit zurück, begleitet von dem guten Gefühl, verstanden und unterstützt zu werden. Der Gedanke, in einer harmonischen Familie Rückhalt und Verständnis zu finden, ließ beinahe jedes Problem zu einer Herausforderung werden, der man sich gemeinsam stellen konnte.
Am Tag der Testamentseröffnung wartete Debora Feldmann bereits eine Viertelstunde vor dem angesetzten Termin im Vorzimmer des Notars Dr. Wolfgang Schwan. Vor Aufregung konnte sie sich nicht setzen und ging statt dessen im Raum auf und ab, als auch Dr. Daniel Norden und Jenny Behnisch eintraten. Murmelnd grüßte Debora die Unbekannten und war erstaunt, als sie wenig später alle zusammen von der Assistentin des Notars in dessen Büro gebeten wurden.
Erfreut erhob sich Dr. Schwan und machte die Anwesenden miteinander bekannt. Schließlich setzten sie sich, und der Notar richtete das Wort an seine Besucher.
»Wie bereits erwähnt, war mein Mandant Martin Kowatsch ein sehr stiller Mann, der seit Ende seiner Reisetätigkeit zurückgezogen in seiner Pension lebte. Nichtsdestotrotz war er ein großer Menschenfreund und unterstützte zu Lebzeiten viele gemeinnützige Organisationen.«
Als Debora das hörte, schnaubte sie ärgerlich auf.
»Von mir wollte er damals nichts wissen. Wahrscheinlich, weil er mich nicht von der Steuer absetzen konnte.«
Wolfgang Schwan schickte ihr einen mitfühlenden Blick und nickte.
»Diesen schweren Fehler hat Herr Kowatsch Zeit seines Lebens zutiefst bereut. Mir liegen Informationen vor, daß er versucht hat, Sie zu kontaktieren.«
»Als ich erwachsen und verheiratet war. Da war es zu spät«, erklärte Debbie zutiefst verletzt. »Damals, als ich Vollwaise geworden bin und ganz allein auf der Welt war, hätte ich seine Hilfe, Liebe und Unterstützung gebraucht. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, mit einem Schlag sein ganzes Leben zu verlieren? Dabei war der Tod meiner Eltern zwar tragisch, aber noch nicht einmal das Schlimmste. Viel schlimmer war, einen Onkel zu haben, der mich ablehnte. Er war viel mehr gestorben für mich als meine Eltern. Immerhin hat er mich wissentlich alleine gelassen«, brach all die Verzweiflung aus ihr hervor, die sie in den Jahren nie vergessen, nur verdrängt hatte.
Jenny und Daniel tauschten betroffene Blicke, sagten jedoch nichts.
Der Notar nickte wieder und seufzte.
»Ich kenne die Geschichte. Mein Mandant hat sie mir mehr als einmal erzählt. Viele Stunden saßen wir zusammen und haben uns unterhalten. Immer wieder kam er auf diesen einen großen Fehler seines Lebens zurück. Als er ihn erkannte, war es aber zu spät. Um ein wenig von dem wiedergutzumachen, was er an Ihnen versäumt hat, hat er Sie, Frau Debora Feldmann, als Haupterbin eingesetzt.«
Unter Tränen schüttelte Debora den Kopf.
»Ich will sein Geld nicht haben. Er hat sein Glück auf meinem Unglück aufgebaut. Diesen Gedanken ertrage ich nicht«, erklärte sie spontan.
»Bitte seien Sie doch vernünftig«, bat Wolfgang Schwan sanft. »Was geschehen ist, kann kein Mensch der Welt rückgängig machen. Und es ist nun einmal so, daß Menschen Fehler machen. Mal große, mal kleine. Wichtig ist, das einzusehen und daraus zu lernen. Heute sind Sie erwachsen und eine glückliche, verheiratete Frau. Sehen Sie das Geschenk Ihres Onkels als Entschuldigung«, sprach Dr. Schwan beruhigend auf die Verzweifelte ein.
Und tatsächlich verfehlten seine Worte ihre Wirkung nicht. Langsam aber sicher versiegten Deboras Tränen. Sie warf den Kopf in den Nacken und lächelte tapfer.
»Sie haben recht, ich benehme mich kindisch. Wenn es nur um Onkel Martin gehen würde, wäre es nicht so schlimm. Aber ich habe einfach im Augenblick das Gefühl, daß mein ganzes Leben in Unordnung geraten ist«, gestand sie kläglich. »Sie müssen mir glauben. Normalerweise jammere und beklage ich mich nicht. Aber momentan ist einfach alles zuviel. Mein Mann kanzelt mich nur noch ab, hat kein liebevolles Wort und keine Zeit mehr für mich. Unser Haus ist kaputt und die Wohnung zu klein. Ich habe keine Arbeit«, zählte sie all die Mißstände auf, die ihr das Leben in diesen Zeiten schwer machten.
Doch statt ernsten Anteil an diesen Problemen zu nehmen, lächelte Dr. Schwan nur geheimnisvoll und strich sich über den altmodischen Spitzbart. Seine Augen funkelten beinahe vergnügt durch die runden Gläser der Nickelbrille.
»Arbeit werden Sie in nächster Zeit mit Sicherheit mehr als genug haben. Und wenn Sie erst einmal wieder zufrieden sind, kommt die Beziehung zu Ihrem Mann bestimmt auch wieder ins Lot.«
Verwirrt horchte Debora auf.
»Wie meinen Sie das?«
»Das erfahren Sie gleich, wenn ich jetzt den Wortlaut des Testaments vorlese.« Der Notar nahm die Unterlagen zur Hand und begann, das Vermächtnis zu verlesen.
Nachdem er geendet hatte, schwiegen die Anwesenden zunächst einmal still. Die Nachrichten waren zu wunderbar, als daß sie sofort faßbar gewesen wären. Daniel und Jenny sahen sich an, als hätten sie geträumt. Und auch Deboras Gesichtsausdruck war voller Verwunderung.
Dr. Wolfgang Schwan registrierte es mit einem feinen Lächeln.
»Wie ich sehe, ist die Überraschung gelungen. Damit hat mein Mandant sein Ziel erreicht. Ich hoffe, Sie, Frau Dr. Behnisch und Herr Dr. Norden, haben eine sinnvolle Verwendung für das Geld, das Ihnen Martin Kowatsch hinterlassen hat.«
Jenny nickte erfreut.
»Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich werde mich mit meinem Stellvertreter Dr. Graef gründlich beraten und gewissenhaft mit diesem großen Geschenk umgehen«, versprach sie zutiefst gerührt.
Daniel Norden stimmte ihr zu.
»Nachdem meine Praxis komplett ausgestattet ist, werde ich mich Jenny anschließen und gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Immerhin kann man mit einer großen Summe mehr bewirken denn mit zwei kleineren.«
»In der Klinik gibt es jede Menge Möglichkeiten«, bestätigte Jenny Behnisch, während sie im Geiste schon durch die verschiedenen Abteilungen der Klinik wanderte.
»Es würde mich freuen, bei Gelegenheit zu erfahren, in was Sie die Erbschaft investiert haben«, erklärte Wolfgang Schwan, ehe er sich an Debora wandte.
»Und Sie? Sind Sie zufrieden mit dem, was Ihnen Ihr Onkel zugedacht hat? Er hatte in Erfahrung gebracht, daß Ihr Mann über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und das Geld woanders besser angelegt wäre. Daher hat er sich dazu entschlossen, Ihnen das zu vermachen, was er Ihnen in Ihrer Kindheit vorenthalten hatte: ein Zuhause.«
In Deboras Augen standen schon wieder Tränen, als sie nickte.
»Ich kann es immer noch nicht glauben. Sind Sie sicher, daß das Haus mitten in München mir gehören soll?« fragte sie stockend.
Noch einmal nahm Dr. Schwan die Unterlagen zur Hand. Er rückte seine Nickelbrille zurecht.
»Hier steht es schwarz auf weiß. Das Haus aus der Gründerzeit, in dem eine Pension untergebracht ist, gehört Ihnen. Bedingung ist, daß ein gewisser Oswald Kuhn lebenslanges Wohnrecht dort hat. Das sollte allerdings kein Problem sein, wie ich finde. Immerhin ist das Haus groß genug.«
»Wer ist dieser Herr Kuhn?« wagte Debora eine schüchterne Frage.
»Soweit ich weiß, handelt es sich um einen ohne Schuld in Not geratenen Mann. Er war eine Weile obdachlos, als er die Bekanntschaft von Martin Kowatsch machte. Der nahm ihn in der Pension auf und stellte ihn als Hausmeister an.«
Debora schluckte schwer.
»Ihn hat er aufgenommen?« fragte sie leise.
»Das ist ein Zeichen dafür, wie sehr er unter seinem Fehler gelitten hat«, erklärte Dr. Wolfgang Schwan sehr sanft und Debora atmete tief durch. Es war an der Zeit, die Vergangenheit abzuschließen.
»Ich bin damit einverstanden, daß Herr Kuhn dort wohnt«, erklärte sie schließlich mit überraschend fester Stimme.
Nichts anderes hatte der Notar erwartet. Er nickte zufrieden und legte die Papiere wieder zurück auf den Schreibtisch.
»Es freut mich zu hören, daß Sie offenbar nicht daran denken, das Haus zu verkaufen.«
»Aber nein, warum sollte ich? Immerhin ist es die Chance für mich, endlich selbst etwas auf die Beine zu stellen«, erklärte Debora. Die Tränen hatten sich zurückgezogen und ein Strahlen hatte sich auf Debbies hübschem Gesicht ausgebreitet. »Noch dazu bietet das Haus offenbar genügend Platz, um dort zu wohnen. Dann können mein Mann und ich endlich aus der winzigen Wohnung ausziehen. Oh, ich kann es kaum erwarten, Roger davon zu erzählen.«
»Gut, dann sind wir uns also einig«, stellte Wolfgang Schwan fest und schraubte den Füller auf, um alle Anwesenden unterschreiben zu lassen. Nicht immer durfte er es erleben, daß die Erben derart glücklich und zufrieden mit dem waren, was ihnen zugedacht worden war. Es stimmte Dr. Schwan zufrieden, daß sein Mandant Martin Kowatsch zumindest im Alter offenbar genau die richtigen Entscheidungen getroffen hatte.
*
Statt an diesem Abend direkt nach Hause zu fahren, lenkte Roger Feldmann seinen Wagen in Richtung Innenstadt. Seine Frau Debora hatte ihn überraschend in ihr Lieblingsrestaurant bestellt. Ihre Stimme hatte lebhaft wie lange nicht geklungen und so war er der Bitte gerne nachgekommen. Schon lange sehnte er sich nach der Frau, die sie einmal gewesen war und die, wie es ihm schien, in der alten, maroden Villa zurückgeblieben war.
Als Roger das Restaurant betrat, mußte er zu seiner großen Enttäuschung allerdings feststellen, daß sie nicht alleine waren. Eine Frau und ein Mann, beides Fremde für Roger, saßen mit seiner Frau am Tisch und unterhielten sich lebhaft. Als Debora ihren Mann erblickte, entschuldigte sie sich bei ihren Gästen und stand auf, um ihn liebevoll zu begrüßen.
»Darf ich dir Frau Dr. Behnisch und Herrn Dr. Norden vorstellen?« fragte sie dann und wies auf die beiden Herrschaften am Tisch.
Jenny nickte dem Neuankömmling freundlich zu, und Daniel erhob sich kurz.
»Es freut mich, den Ehemann dieser charmanten Frau kennenzulernen«, erklärte er lächelnd und jagte Roger mit dieser Bemerkung einen eifersüchtigen Stich durchs Herz.
Er maß Debora mit einem flüchtigen Seitenblick und mußte feststellen, daß sie so hinreißend wie lange nicht mehr aussah. Zur Feier des Tages hatte sie ein dezentes Make-up aufgelegt und trug das Kostüm, das er besonders gerne an ihr sah.
»Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen«, wandte Roger sich zurückhaltend an Daniel und reichte auch Jenny die Hand, ehe er sich neben Debbie an den Tisch setzte. »Darf ich endlich erfahren, aus welchem Grund du mich hierher gebeten hast? Offenbar bin ich der einzige, der noch nicht informiert ist«, fragte er seine Frau eine Spur gereizt. Es gelang ihm kaum, seine Eifersucht zu unterdrücken. »Es geht doch sicherlich um die Erbschaft. Wenn ich mich nicht irre, war doch heute die Testamentseröffnung.«
Doch Debora dachte nicht daran, das Geheimnis sofort zu lüften. Zuerst bestellte sie in aller Seelenruhe Champagner. Als der Ober das Gewünschte gebracht hatte, hob sie ihr Glas.
»Zuerst möchte ich mein Glas heben auf meinen Onkel Martin Kowatsch, der mir zwar in meiner Kindheit sehr weh getan hat, mir aber als Ausgleich dafür heute die Möglichkeit verschafft, ein neues Leben zu beginnen«, erklärte sie feierlich.
Jenny Behnisch lächelte.
»Auch Daniel und ich haben im Namen aller Hilfebedürftigen zu danken. Auch wenn wir uns noch nicht sicher sind, was wir mit dem Geld machen, steht fest, daß wir es einem guten Zweck zukommen lassen werden.«
»Darauf wollen wir trinken«, schloß sich Daniel diesen feierlichen Worten an.
Nur Roger hatte nichts zu sagen. Das kam selten vor und hinterließ ein unbehagliches Gefühl in ihm. Mit mühsam beherrschtem Gesicht trank er mit den Fremden am Tisch.
»Willst du mir jetzt endlich erklären, was passiert ist?« fragte er ungehalten, als jeder sein Glas zurückgestellt hatte.
Beruhigend legte Debora die Hand auf seinen Arm und lächelte ihn an.
»Stell dir vor, mein Lieber. Onkel Martin hat dafür gesorgt, daß all unsere Probleme auf einen Schlag gelöst sind.«
In Rogers Augen glomm ein gieriger Funke auf.
»Du hast Geld geerbt?« versuchte er jedoch, seiner Stimme die nötige Zurückhaltung zu verleihen.
»Nein, viel besser«, beeilte sich Debora zu versichern und warf Jenny und Daniel einen euphorischen Blick zu. »Onkel Martin hat uns das Gründerhaus mitsamt der darin befindlichen Pension vererbt. Na, wie findest du das?« fragte sie triumphierend.
Roger erstarrte innerlich vor Schreck. Mit allem hatte er gerechnet, nur nicht damit, daß ausgerechnet seine Frau das Haus erben könnte, auf das die Firma Bernwart-Hochbau ein Auge geworfen hatte.
»Aber das ist doch nicht möglich!« entfuhr es ihm, und nicht nur Debora sondern auch Daniel und Jenny bemerkten, daß er die Freude seiner Frau nicht teilte.
Debbie sah ihren Mann irritiert an.
»Was ist? Freust du dich denn nicht?«
Roger schützte ein Husten vor und hielt die Hand vor den Mund, bis er sich gefangen hatte.
»Aber natürlich. Das ist wundervoll. Es kommt nur etwas überraschend«, beeilte er sich zu versichern. Mit dieser Bemerkung gelang es ihm, seine Frau wenigstens halbwegs zu beruhigen. Debbie befand sich in einer solchen Hochstimmung, daß sie die unheilvollen Vorzeichen nicht wahrnehmen wollte. Sie lächelte Roger liebevoll an.
»Ich kann dich gut verstehen, mir ging es ja ebenso. Du hättest heute morgen beim Notar mein Gesicht sehen sollen. Meine Gedanken haben sich förmlich überschlagen. Jetzt haben wir nicht nur ein neues Haus, in dem wir wohnen und endlich aus dieser gräßlichen Wohnung ausziehen können, sondern ich habe auch noch eine Arbeit. Ist das nicht wunderbar?«
»Du willst das Haus behalten?« Roger gelang es nicht, seinen Schrecken zu verbergen.
Jenny und Daniel saßen stumm am Tisch und warfen sich vielsagende Blicke zu.
Nur Debora bemerkte nichts.
»Selbstverständlich. Warum auch nicht?« fragte sie und machte keinen Hehl aus ihrer Begeisterung.
Roger schüttelte unwillig den Kopf.
»Weißt du, was so ein Haus an Unterhalt kostet? Und kannst du dir überhaupt vorstellen, wieviel Arbeit der Pensionsbetrieb macht? So eine Herberge rechnet sich nur, wenn sie ständig ausgebucht ist. Wo willst du die Gäste dafür herbekommen?« fragte Roger sichtlich erregt.
Doch sogar über diese Fragen schien sich Debbie schon Gedanken gemacht zu haben.
»Stell dir vor, Herr Norden sucht händeringend nach Zimmern in München. Es ist alles ausgebucht und ich habe ihm schon versprochen, daß er seine Gäste in der Pension Kowatsch unterbringen kann«, berichtete sie begeistert.
»Wollen Sie sich nicht lieber erst mit Ihrem Mann besprechen, ehe Sie mir dieses Angebot unterbreiten? Vielleicht hat er andere Pläne mit dem Haus«, wagte Daniel einen vorsichtigen Einspruch.
Doch Debora winkte lachend ab und streichelte Roger verliebt über die Wange.
»Aber nein. Mein Mann war es doch, der mir sagte, ich solle mir eine neue Arbeit suchen, damit mir zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Roger freut sich wie ich über diese unglaubliche Chance, nicht wahr, Liebling? Und die Stellung als Erste Dame des Hauses ist bestimmt nicht unter meiner Würde, nicht wahr?« fragte sie und gluckste vor Lachen, als sie daran dachte, daß die Stellung des Zimmermädchens in Rogers Augen unwürdig für sie gewesen war.
Zähneknirschend mußte Roger einsehen, daß er an diesem Abend auf verlorenem Posten stand und gute Miene zu diesem Spiel machen mußte, dessen Drehbuch er nicht kannte. Er setzte ein gekünsteltes Lächeln auf.
»Das ist richtig. Allerdings hatte ich nicht daran gedacht, daß du gleich eine ganze Pension übernehmen willst«, erklärte er und hob sein Glas, um es in einem Zug zu leeren.
»Das schaffe ich schon«, wandte sich Debora voller Überzeugung zu Jenny Behnisch und Daniel Norden. »Seit ich in dieser kleinen Wohnung herumsitze, strotze ich nur so vor Energie und Tatendrang. Ich kann es kaum erwarten, das Haus zu besichtigen. Kann ich dich morgen in der Mittagspause abholen, damit wir gemeinsam dorthin fahren? Bitte, mein Liebling. Ich wäre die glücklichste Frau der Welt.«
Debora sah Roger so flehend an, daß er nicht anders konnte, als »Ja« zu sagen. Der Alkohol tat überdies seine Wirkung und schon bald löste sich die Verkrampfung, mit der er den Abend begonnen hatte. Roger Feldmann besann sich auf seine Rolle als Unterhalter. Endlich gelang es ihm, die beiden Ärzte und auch seine Frau in eine anregende Unterhaltung zu verstricken und mit Anekdoten aus seinem Alltag zum Lachen zu bringen.
Als die vier schließlich zu vorgerückter Stunde den Heimweg antraten, war jeder von den gemeinsam verbrachten, harmonischen Stunden erfüllt. Nur Roger dachte noch fieberhaft nach, als er schon im Bett lag. In dieser Nacht konnte er keinen Schlaf finden, während Debora selig lächelnd neben ihm lag und einen schönen Traum träumte.
*
»Es tut mir leid, daß es so spät geworden ist«, entschuldigte sich Daniel Norden bald darauf bei seiner Frau, die trotz der späten Stunde noch auf ihn gewartet hatte.
Fee rieb sich müde die Augen und lächelte ihren Mann liebevoll an. »Solange ich weiß, daß du immer wieder gerne nach Hause kommst, ist alles in Ordnung«, erklärte sie ohne eine Spur von Verstimmung. »Außerdem kannst du von Glück sagen, daß du heute abend nicht da warst.«
»Wie meinst du das?« erkundigte sich Daniel skeptisch.
»Ach, Frau Brandt hat angerufen und mir eine ganze Stunde lang vorlamentiert, wie unzufrieden sie mit der Behandlung und Betreuung ihrer kleinen Tochter in der Kinderklinik ist. Dabei geht es gar nicht um die medizinische Versorgung sondern um die persönliche Betreuung. Offenbar handelt es sich um ein Haus mit völlig veralteten Sitten«, erinnerte sich Fee mit Schaudern an die Schimpftiraden, die die erboste Mutter an ihr ausgelassen hatte.
Doch davon wollte Daniel Norden nichts hören.
»Ich habe Frau Brandt klipp und klar gesagt, daß die Behnisch-Klinik der beste Ort für Ihre Tochter ist. Doch sie bestand darauf, daß ein Kind zur Behandlung in eine Kinderklinik gehört.«
»Ganz unrecht hat sie damit ja nicht«, wandte Felicitas vorsichtig ein. »Zumindest was die medizinische Versorgung angeht. Pädiatrie ist nicht umsonst ein eigenständiges Fachgebiet.«
Dem widersprach Daniel nicht.
»Das ist richtig. Aber ich bin sicher, daß das Team von Jenny Behnisch den Abszeß von Mia Brandt auch ohne besondere kindermedizinischen Kenntnisse perfekt versorgt hätte.«
»Das sehe ich genauso«, konnte Felicitas ihrem Mann recht geben. »Schließlich und endlich ist es mir auch gelungen, die aufgeregte Mutter zu beruhigen.«
Daniel seufzte und warf seiner Frau einen dankbaren Blick zu.
»Du bist einfach unvergleichlich. Welcher Mann kann schon von sich behaupten, eine so kluge, geduldige und verständnisvolle Frau zu haben?« fragte er, ohne eine Antwort zu erwarten.
»Nun will die verständnisvolle Frau aber auch wissen, was den glücklichen Ehemann so lange von zu Hause ferngehalten hat«, wechselte Felicitas lächelnd das Thema und war auf einmal wieder ganz munter.
Daniel lachte.
»Bist du darauf eingestellt, die ganze Nacht wachzubleiben? Es war nämlich wirklich ein ereignisreicher Tag.«
»Für dich würde ich für den Rest meines Lebens auf Schlaf verzichten, wenn es denn sein müßte.«
»Oh, bitte nicht, das würde deinem zauberhaften Äußeren mit Sicherheit nicht gut bekommen«, ging Daniel auf den scherzhaften Tonfall seiner Frau ein und setzte sich neben sie auf das Sofa. Er besann sich kurz und begann seinen Bericht dann mit der Testamentseröffnung beim Notar.
»Dieser schweigsame Patient hat dir ein kleines Vermögen vermacht!« stellte Fee staunend fest, als er geendet hatte. »Wer hätte das für möglich gehalten?«
»Ich auf jeden Fall nicht«, gab Daniel Norden offen zu. Auch ihm war Martin Kowatsch ein ständiges Rätsel geblieben, das ihm jedoch postmortum regelrecht sympathisch wurde. »Seine rauhe Schale barg, wie es oft der Fall ist, einen weichen Kern.«
»Weißt du schon, was du mit dem Geld machen wirst? Wenn ich mich nicht irre, ist die Praxis gut ausgestattet und komplett.«
»Ich denke daran, meinen Anteil Jenny zu überlassen. Natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist«, wollte Daniel diese Entscheidung auf keinen Fall alleine treffen.
»Das finde ich sehr gut. Immerhin hat eine Klinik einen ganz anderen Bedarf als eine Allgemeinpraxis. Jenny wird das Geld gut brauchen können«, stimmte Felicitas erwartungsgemäß jedoch sofort zu. »Es ist eine schöne Summe, mit der sie Großes anfangen kann. Aber was?«
Daniel nickte versonnen. Auf der Heimfahrt hatte er schon darüber nachgedacht, wie dieses Geld am sinnvollsten verwendet werden könnte. Aber die zündende Idee war ihm noch nicht gekommen.
»Das ist wirklich gar nicht so einfach. Da träumt man stets davon, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Und wenn die Träume dann Wirklichkeit werden, ist man verwirrt und überfordert«, stellte er nachdenklich fest.
»Nicht umsonst heißt es, man soll auf seine Wünsche achten«, lächelte Fee vielsagend. »Häufig stellt man sich etwas vor, was in der Realität dann völlig unpraktikabel ist. Aber ich glaube kaum, daß diese Weisheit für diese Art von Wünschen gilt. Bestimmt hat Jenny so viele Ideen, was sie damit anfangen kann, daß ihr die Entscheidung schwerfallen wird.« Sie dachte eine Weile nach, als ihr plötzlich eine Idee in den Sinn kam.
Das sah Daniel seiner Frau schon an der Nasenspitze an.
»Was ist? Du siehst so aus, als hättest du das Ei des Kolumbus gefunden.«
»Die Lösung liegt doch auf der Hand, Dan. Das, was die Behnisch-Klinik dringend braucht, ist eine pädiatrische Abteilung, eine Kinderabteilung«, erklärte Felicitas entschieden. »Dann können solche Situationen, wie Frau Brandt sie derzeit mit ihrer Tochter erlebt, in Zukunft vermieden werden.«
Daniels Gesicht hellte sich auf.
»Zudem wäre es viel einfacher für mich. Wie oft muß ich meine kleinen Patienten an andere Kliniken verweisen, wo ich doch so gerne die Behandlung mitverfolgen und begleiten möchte«, fand er sofort Gefallen an dieser zweifellos genialen Idee. »Was die Behandlungsmethoden angeht, liegt Jenny vollkommen auf meiner Wellenlänge. Es wäre ein Traum, auch in diesem Bereich mit ihr und ihrem Team zusammenarbeiten zu können«, fügte er mit wachsender Begeisterung hinzu.
Fee freute sich sichtlich darüber, daß ihre Idee ein Volltreffer zu sein schien. Dennoch blieb sie zurückhaltend.
»Freu dich nicht zu früh. Womöglich heckt Jenny eben mit Michael ganz andere Pläne aus. Du solltest morgen in aller Ruhe mit ihr darüber sprechen«, wollte sie den Enthusiasmus ihres Mannes ein wenig einbremsen.
Daniel lächelte und zog seine Frau an sich.
»Ich bin überzeugt davon, daß Jenny diese Idee ebenso begrüßen wird. Sie ist doch immer auf der Suche, wie sie ihre Klinik noch besser machen kann.«
»Dabei habe ich ohnehin das Gefühl, daß sie auf höchstmöglichem Niveau arbeitet«, konnte Felicitas nur bestätigen. »Ich kenne keinen Menschen, der sich so intensiv mit den medizinischen Neuerungen und deren Sinnhaftigkeit auseinandersetzt wie Jenny.«
»Siehst du, und eine Kinderabteilung ist das, was ihr zur Perfektion noch fehlt«, erklärte Daniel voller Überzeugung. »Am liebsten würde ich sie sofort anrufen, um diesen Plan mit ihr zu diskutieren.«
Fee lachte über diese verrückte Idee.
»Deine Freundin würde dir einen Besuch beim Psychiater empfehlen.«
»Und du? Was empfiehlst du mir?« erkundigte sich Daniel zärtlich und strich Fee mit dem Zeigefinger liebevoll über die weiche Wange.