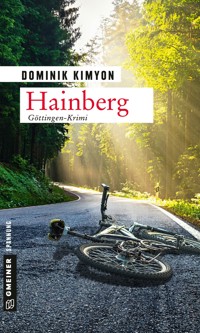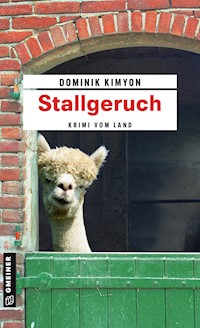
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Christian Heldt
- Sprache: Deutsch
Die Angst geht um im beschaulichen Eichsfeld: Die frisch verlobte Linda Becker liegt tot zwischen ihren Alpakas. Ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit nimmt sie mit ins Grab. Doch während ihre Familie auffällig schnell versucht, zur Tagesordnung überzugehen, geschieht ein weiterer Mord. Kriminalhauptkommissar Christian Heldt aus Göttingen gerät bei den Ermittlungen in einen Sog aus Intrigen, Hass und Selbstsucht, der ihn und die Menschen um ihn herum in Lebensgefahr bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dominik Kimyon
Stallgeruch
Kriminalroman
Zum Buch
Stadt, Land, Mord Die Angst geht um im idyllischen Duderstadt im Eichsfeld: Die frisch verlobte Linda Becker liegt tot zwischen ihren Alpakas. Während ihre Familie auffällig hastig versucht, zur Tagesordnung überzugehen, beginnen Christian Heldt und Tomek Piotrowski vom Polizeikommissariat Göttingen mit den Ermittlungen. Das missfällt den Kollegen der Duderstädter Polizei, die eine Schließung ihrer kleinen Dienststelle fürchten. Schnell merken Christian und Tomek, dass sich hinter der heilen Welt auf dem Alpakagestüt Abgründe auftun. Bald wird klar: Die lebenslustige Frau nahm ein düsteres Geheimnis aus ihrer Vergangenheit mit ins Grab. Als Vorwürfe der Tierquälerei laut werden, kommt es zu einem weiteren Mord und es stellt sich einmal mehr die Frage, was hier vertuscht werden soll. Die Kommissare geraten in einen Sog aus Intrigen, Hass und todbringender Selbstsucht, der sie selbst und die Menschen um sie herum in Lebensgefahr bringt.
Dominik Kimyon wurde 1976 in Duderstadt im Eichsfeld geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Nordhessen, doch mit Anfang 20 zog es ihn zurück nach Niedersachsen in die Universitätsstadt Göttingen. Dort studierte er Medienwissenschaft und Sozialpsychologie, arbeitete als freier Mitarbeiter für eine Lokalzeitung und war in der Werbebranche tätig. Seit einigen Jahren ist er Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter in Hannover. Mit feinem Gespür für menschliche Abgründe erweckt er Figuren zum Leben, die niemand gerne in der eigenen Nachbarschaft haben möchte – die aber mit Sicherheit genau dort leben.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bestimmte örtliche Gegebenheiten wurden aus
dramaturgischen Gründen leicht verändert.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Olga D. van de Veer / fotolia.comund © grafikplusfoto / fotolia.comISBN 978-3-8392-5312-0
Kapitel 1
Auf drei Dinge reagierte Walter allergisch: auf Mandeln, auf Niederlagen von Hannover 96 und auf die Rechthaberei seiner Frau. Die Nüsse ließ er einfach weg, gegen schlechten Fußball gab es Bier und bei Helga – nun, nicht ohne Grund prangte ein Wanderabzeichen in Gold an seinem Stock.
»Hast du dein Handy dabei?«, hatte sie ihm hinterhergerufen.
Er hatte mit den Händen geantwortet, »ja, ja, alles dabei«, und wusste doch, dass es auf seinem Nachtschränkchen lag. In der Frühe hatte er sich am Duderstädter Omnibusplatz in den 170er gesetzt, war in Göttingen umgestiegen und hatte in Hann. Münden direkten Anschluss nach Volkmarshausen gehabt. Dort war er losgelaufen, hinein in den Bramwald. Nach sechseinhalb Stunden querdurch hatte er sich unterhalb des Totenbergs nur für eine kurze Rast ins Moos legen wollen. Aufgewacht war er, als es längst duster geworden war.
Walter fluchte. Er konnte nicht einen einzigen Hinweis ausmachen, wie er auf dem schnellsten Weg aus dem Wald herausfinden würde. Er hatte die Wahl: Entweder an Ort und Stelle die Nacht verbringen, bei seinem Glück mitten im Revier einer Wildschweinrotte, oder loslaufen. Missmutig streckte er die Glieder.
Seine Augen gewöhnten sich schneller an die Dunkelheit, als er gedacht hatte. Gekonnt wich er Zweigen aus, damit sie ihm nicht ins Gesicht schlugen. Er blieb stehen. Überall raschelte es, in der Nähe tönte ein Steinkäuzchen. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Gab es im Weserbergland inzwischen auch Wölfe? Walter überkam das ungute Gefühl, beobachtet zu werden. Sei nicht albern, mahnte er sich. Seine Furcht war davon überhaupt nicht beeindruckt. Er entschied sich, den Trampelpfad zu verlassen und sich quer zwischen den Buchen durchzuschlagen. Irgendwann musste er doch auf einen Forstweg stoßen, verdammt noch mal!
Er stolperte über eine Wurzel im Boden und prallte mit seinem Musikantenknochen gegen einen Baumstumpf. Der Schmerz blitzte durch den Arm über die Schultern bis ins Rückenmark. Zum ersten Mal in seinem Leben kam Walter sich richtig alt vor und er war überrascht, wie schrecklich sich das anfühlte. Bleib einfach hier sitzen, dachte er, es wird schon nichts passieren. Seine innere Stimme hatte allerdings keine Lust darauf, ohne jeden Schutz mitten im Wald zu übernachten. Also rappelte er sich wieder auf.
Plötzlich erahnte er einen mannshohen Holzzaun, keine fünf Meter von ihm entfernt. Walter ging darauf zu und tastete sich an den blanken Holzlatten entlang. Ein Splitter fuhr ihm in den Daumen. Er zog den Span heraus und schmeckte das Blut, als er den Finger in den Mund steckte. Achtsam ging er weiter. Da, ein Griff! Er drückte die Klinke, doch die Tür war verriegelt. Es hatte alles keinen Sinn: Er würde über den Zaun klettern müssen, um auf der anderen Seite geschützt bis zum Morgengrauen auszuharren. Bei Tagesanbruch würde er den Weg fortsetzen und wahrscheinlich schon gegen halb neun mit Helga einen frischen Kaffee trinken. In der Zwischenzeit würde sie zwar verrückt werden vor Sorge um ihn und hatte weiß der Himmel wen nicht alles längst in Aufruhr versetzt, um ihn zu suchen. Das konnte er jetzt allerdings nicht ändern. Walter warf seinen Rucksack über den Zaun und stieg auf den Türgriff. Mit letzter Kraft hievte er sich hoch und holte zweimal Schwung, bis er ein Bein über die Tür gehoben hatte. Er zog das andere nach und sprang hinab.
Der Geruch von Heiligenkraut und feuchtem Gras stieg ihm in die Nase. Etwa eine Baumlänge von ihm entfernt sah er die Umrisse eines Schuppens und ging unsicher darauf zu. Walter suchte den Eingang, zog die Tür auf und tastete mit der Hand die Wand ab, bis er etwas Rundes erspürte. Er drehte den Knauf und eine Glühbirne an der Decke glimmte auf.
Im gleichen Augenblick sprang ihn das Grauen an.
Kapitel 2
»Das ist einfach nichts für mich!« Christian Heldt stützte die Hände auf seine Oberschenkel und schnappte nach Luft. Salzige Schweißperlen, dick wie Rosinen, rollten von der Stirn über den Nasenrücken und tropften hinab. Er wälzte sich über das Gras und streckte Arme und Beine so weit von sich, dass er glaubte, sie würden ihm bald abfallen. Er hatte Baumstämme so schwer wie ein Dutzend Bierkästen in die Höhe gewuchtet. Beim Klimmzug hatte er alles gegeben und sich an den Stangen entlanggehangelt wie ein Orang-Utan auf Brautschau. Die Übungen waren dermaßen anstrengend gewesen und Christian hatte Grimassen geschnitten, für die man in anderen Ecken der Welt kastriert worden wäre. Liegestütze, Kniebeuge – »Und jetzt auf einem Bein« – egal welche Befehle Fabian gerufen hatte, Christian hatte alles gegeben. Ein Todesmuskelkater bis in die Spitze seines linken kleinen Zehs war das Mindeste, was ihm nach dieser Aktion blühen würde. Was für eine Quälerei, nur damit er am ersten Göttinger Herbstlauf teilnehmen und sich an den glotzenden Massen am Straßenrand vorbeischieben konnte, mit einem Gesicht so rot wie eine Kardinalshaube und sehr wahrscheinlich im Feld der Altersgruppe 75 plus. Ihn gruselte der Gedanke.
Er hob den Kopf und wagte einen Blick hinüber zu seinem besten Freund. Der hatte ein Pokerface aufgesetzt. Christian hatte keine Chance, auch nur einen Hauch wohlwollender Bestätigung oder vernichtender Kritik darin zu erkennen. Entnervt warf er die Arme in die Höhe. »Ich bleibe lieber bei meinen Mördern und Totschlägern.«
»Im Jammern bist du schon ganz gut«, sagte Fabian lachend und fuhr sich mit der Hand durch sein gelocktes Haar. »Schalte den perfektionistischen Kriminalbeamten in dir für ein Weilchen ab und setz dich nicht so unter Druck. Du wirst sehen, bis zum Lauf am Wochenende wirst du in Topform sein!« Er hob den Daumen und grinste schelmisch.
Erschöpft von den akrobatischen Übungen setzte Christian sich neben Fabian, seines Zeichens rechte Hand des Landrats und leidenschaftlicher Triathlet, ins Gras. »Wer will mich Fettsack schon durch die Fachwerkschluchten der Stadt hecheln sehen?«
Fabian stand auf und ging quer über den Trimm-dich-Platz am Jahnstadion zu seinem Rucksack, den er an der Barren-Station abgelegt hatte. Mit zwei Flaschen Biolimonade kam er zurück, drehte sie auf und reichte eine davon Christian. »Erstens: Du hast die besten Voraussetzungen, beim Lauf zu glänzen.«
»Das Einzige, was an mir glänzen wird, werden meine völlig durchgeschwitzten Klamotten sein«, entgegnete Christian und trank die Flasche halb aus. Im nächsten Moment prusteten beide los.
»Zweitens«, setzte Fabian immer noch lachend fort, »bist du nur etwas zu klein für dein Gewicht. Und schließlich: Es war deine Idee, dich für den Lauf anzumelden.«
»Das war keine Idee«, protestierte Christian. »Ich bin reingelegt worden!« Gleichzeitig huschte ein Lächeln über seine Lippen, als er an den lauen Abend vor dreieinhalb Monaten zurückdachte. In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn hatte er sich zu einer Wette hinreißen lassen und als Wetteinsatz seine Teilnahme am Stadtlauf eingebracht. »Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass ich verlieren würde.«
»Du bist ihr direkt in die Falle getapst, mein Bester.«
Christian dachte an sie. Tanja! Wenn er nicht zugelegt hätte wie Joschka Fischer in seiner postparlamentarischen Phase, wenn sie nicht mit Markus Kratzer verheiratet wäre, wenn er sich nur nicht auf diesen ganzen Humbug eingelassen hätte … Wenn, wenn, wenn! Tanja hatte damals gewettet, dass Fabian und er mindestens ein Jahr brauchen würden, um die Vorkriegselektronik und giftigen Bleirohre aus den Wänden zu reißen und das Gehöft, ein unerwartetes Erbe von Fabians Großtante, bautechnisch ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Das alte Gemäuer gut zehn Autominuten südöstlich von Göttingen hatte zwar mehr Ähnlichkeit mit einem heruntergekommenen Bauernhof und war sanierungsbedürftiger als eine 68-jährige russische Oligarchengattin. Doch in den Wanderkarten der Region war es nach wie vor als Gut Eschenberg markiert. Es lag direkt hinter den Gleichen auf einem Hügel, dem Eschenberg, und bot bei gutem Wetter einen Blick bis zu den Westausläufern des Harzes. Fabian hatte sich vorgenommen, dem Gebäudeensemble wieder Leben einzuhauchen, nachdem die letzten Bewohner zu Wirtschaftswunderzeiten das Landleben als altertümlich kategorisiert hatten und eine Wohnung im noblen Göttinger Ostviertel bevorzugten. Einer an zwischenmenschlicher Nähe desinteressierten Verwandtschaft hatte Fabian es schließlich zu verdanken, als einziger Erbe in Frage zu kommen. Das nötige Kleingeld für den Unterhalt des Erbes hatte die Tante leider nicht hinterlassen. Er hatte es sich daher zur Aufgabe gemacht, an dem Schmuckstück herumzubasteln, es zu renovieren und Schritt für Schritt wieder bewohnbar zu machen. Christian half dabei, so gut er konnte. Voller Eifer hatten sie sich in ihre nagelneuen Latzhosen gezwängt, Gemäuer freigelegt und Fußböden geschliffen. Tanja würde schon sehen, wie alles bald blitzen und glänzen und wunderschön werden würde. Überschwänglich hatten sie eine gruselige Halloween-Einweihungsparty im Herbst in Aussicht gestellt. Tanja hatte sich gekringelt vor Lachen, was Christian letztlich zu dem wagemutigen Wetteinsatz hatte hinreißen lassen. Tanja hatte natürlich sofort eingeschlagen. Es sah aus, als sollte sie Recht behalten – bis Halloween waren es keine drei Wochen mehr und das Haus war nach wie vor eine einzige Baustelle. Der Strom floss inzwischen zwar aus den richtigen Steckdosen und das Leitungswasser hinterließ keinen metallischen Geschmack mehr auf der Zunge. Doch eine Übernachtung auf Gut Eschenberg war eher abenteuerlich als angenehm. Nun galt es, sich irgendwie mit dem Schicksal zu arrangieren und diesen Lauf zu bewältigen, koste es, was es wolle.
»Hey, du Tagträumer«, holte Fabian ihn wieder auf den Planeten.
»Als weltbester Triathlet hättest du mich vor diesem Blödsinn doch schützen müssen«, maulte Christian, bevor Fabian dumme Fragen über seine Gedanken stellen konnte.
»Du bist der cleverste Kriminalhauptkommissar, den ich kenne. Du brauchst keinen Beschützer.« Er klatschte zweimal. »Zeit für ein paar Extraeinheiten Crunches!«
Christian stöhnte auf. Sein Handy brummte.
»Was für ein Pech, Joshuas Basketballtraining ist wohl vorbei«, murmelte er halb erleichtert, stemmte sich in die Höhe und kramte sein Handy aus der Jacke hervor. »Verdammt«, Christian drehte die Augen gen Himmel, »es ist Bauschke.«
»Lass es einfach klingeln«, sagte Fabian, doch Christian lief bereits mit Telefon am Ohr zwischen den Holzgeräten hin und her.
»Sie sollten sich angewöhnen, schneller ans Telefon zu gehen, Heldt. Schon mal was von Notfällen gehört?«, bellte es ihm am anderen Ende der Leitung entgegen.
Es war typisch für Hubert Bauschke, seine Gespräche mit einer Kritik zu beginnen. Am Anfang hatte Christian diese Seitenhiebe seines Chefs noch ernst genommen und war davon verunsichert gewesen. Mittlerweile wusste er, dass es nur eine Marotte war, von der Bauschke glaubte, damit seine trübe und humorlose Art zu übertünchen. Seit sein eigentlicher Vorgesetzter Paul Stern vor etwas mehr als einem halben Jahr eine längere »Auszeit« genommen hatte, war dessen Team direkt Bauschke unterstellt worden, der den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen unter seinen Fittichen hatte. Christian wäre das letztlich egal gewesen – seine Arbeit wurde dadurch nicht weniger. Nervig war der Umstand, dass Bauschke und Stern in etwa so gut miteinander auskamen wie Tom und Jerry. Wegen seiner guten Kontakte bis ins Innenministerium in Hannover – böse Zungen behaupteten, nur deswegen – hatte es Bauschke seinerzeit geschafft, sich den Posten und damit die Aussicht auf höhere Sphären unter den Nagel zu reißen. Stern hatte sich schon lange zuvor für diese Position bewährt, doch das hatte nicht gezählt. Seither kämpfte Stern einen ungleichen Kampf. Es war, als gäbe es eine gläserne Decke, die es ihm unmöglich machte aufzusteigen. Christian vermutete, dass sein Burn-out – er war eines Nachmittags einfach im Büro zusammengeklappt – unter anderem diesem Machtspiel geschuldet war.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Christian, ohne auf Bauschkes Stichelei einzugehen. Er schaute zu Fabian und zuckte mit den Schultern.
Bauschke räusperte sich und schluckte den Schleim geräuschvoll hinunter. »Ich brauche Sie hier. In 20 Minuten!«
Wenn Bauschke ihn aus dem Urlaub zurück in den Dienst pfiff, musste es dringend sein. Christian wurde flau im Magen. Er hatte sich ein paar Tage freigenommen, um die Herbstferien mit Joshua verbringen zu können. Im Sommer hatten sie die einzige Regenwoche der Saison erwischt und sich in ihrem Zelt auf einem Fehmarner Campingplatz angeödet. Die Herbstferien sollten das ausgleichen. Einen kurzfristigen Konferenztermin konnte er gerade als Letztes gebrauchen. Denn meistens war der nur der Auftakt für eine viel langwierigere Angelegenheit. Außerdem war er völlig durchgeschwitzt. Er presste Daumen und Zeigefinger auf die Augen und suchte fieberhaft nach einer Ausrede.
»Ich muss meinen Sohn gleich vom Basketballtraining abholen. Danach könnte ich …«
»Der müsste in seinem Alter doch selbstständiger sein!«, unterbrach Bauschke.
Seitdem Ellen kurz nach Joshuas Geburt sie beide allein gelassen und die Stadt verlassen hatte, als wütete dort die Pest, sorgte Christian für seinen Sohn. Er kümmerte sich darum, dass seine Klamotten sauber waren, dass der Kühlschrank nicht nur ein Lager für Bier und Fleischsalat war, dass er verdammt noch mal auch ohne seine Mutter zu einem ganz normalen Jungen heranwachsen konnte. Dennoch drückte all die Jahre die Last auf ihm, es nicht gut genug, etwas falsch gemacht zu haben. Bauschke hatte ihn zielsicher an seiner verwundbarsten Stelle getroffen.
Kapitel 3
Sunny riss die Tür auf. Drei energische Schritte und sie stand am Fenster, zog den schwerfälligen Vorhang zur Seite und öffnete es. Im Zimmer stank es nach Schweißfüßen und Männerunterhosen. Sie blieb am Fenster stehen und füllte ihre Lungen mit der hereinströmenden frischen Luft.
»Genug Bäume gesägt!« Sie verschränkte die Arme vor ihrer Brust, doch ihre Entrüstung war nur zum Teil gespielt. Den halben Tag schon hatte sie sich in Geduld geübt und darauf gewartet, dass er endlich aus seinem Zimmer kriechen und ihr berichten würde. Selbst der Duft frischer Frühstückspfannkuchen hatte ihn nicht aus seiner Koje gelockt.
»Lass mich in Ruhe«, maulte Fletscher schlaftrunken. Er klang wie ein Hafenarbeiter, der nach zu viel Bier mit dem Kopf auf dem Tresen seiner Stammkneipe eingeschlafen war und ans Bezahlen erinnert wurde. Dann rieb er sich den Schlaf aus den Augen und zog sich die Decke so weit über den Kopf, dass sein linker Fuß am anderen Ende hervorlugte. Sunny lächelte gerissen. Sie trat ans Bett und strich mit einem Finger ganz sacht an der Fußsohle entlang. Schnell wie eine zuschnappende Mausefalle zog er die Beine an und warf die Decke genervt zurück.
»’Ne Stechmücke ist umgänglicher als du!« Mit nackten Füßen und nur mit seinen Schlafshorts bekleidet schlurfte er zum Badezimmer. Am Plastikhocker, der bei der Tür stand und auf dem er seine schmutzigen Jeans und das T-Shirt vom Vortag abgelegt hatte, griff er nach einer eingedrückten Packung Luckys.
Nachdem er eine gefühlte Ewigkeit geduscht hatte, setzte er sich in seinem blauweiß gestreiften Secondhand-Morgenmantel an den Kieferntisch in der Küche, den Gürtel nur locker um die schlanke Hüfte geschlungen. Das nasse Haar hatte er zu einem braven Seitenscheitel gekämmt. In seinem tiefen Braun glänzte der Schein der brennenden Glühbirne, die ohne Schirm nur an einem Stromkabel über dem Tisch baumelte. Sunny hatte von Hand aufgebrühten Kaffee in zwei Becher gefüllt. In dichten Schwaden stieg der Dampf auf. Fletscher hielt einen Löffel über die heiße Flüssigkeit und bestaunte die Tropfen, die sich in der Wölbung bildeten.
»Nur zwei Tassen?«
»Schon mal auf die Uhr geguckt? Felix und Sœren müssten längst im Emsland sein. ›Chicken Run‹. Etwa vergessen?« Sunnys Stimmung wurde nicht besser. Seit ein paar Wochen strapazierte der Job in der Bar ihre Nerven. Das hieß, besonders nervig war ein Gast, der immer das Gleiche bestellte: erst einen frisch gemixten Martini ohne Olive und anschließend eine Weißweinschorle mit einer Schale Wasabi-Erdnüssen. Während er trank und knabberte, flirtete er ungeniert mit ihr. Er war groß, schlank und hätte locker ihr Vater sein können. Abstoßend fand sie vor allem seinen aalglatten, blasierten Ton und wie er mit seiner goldenen Uhr und seinen teuren Anzügen pfauengleich herumstolzierte. Sie hatte obendrein den Eindruck, dass er, kurz bevor er die Bar betrat, seinen Ehering abstreifte. Ihre Kollegin riet ihr, sie solle ihm einfach die bestellten Drinks mit einem aufreizenden Lächeln servieren und ein fettes Trinkgeld kassieren.
Fletscher lehnte sich zurück und hob einen nackten Fuß auf die Stuhlkante. Auf die warme Tasse in der Hand reagierte sein Körper mit tiefer Entspannung. Der Morgenmantel rutsche etwas zur Seite und gab den Blick auf seine Erregung frei. Seelenruhig trank er einen Schluck Kaffee, setzte die Tasse wieder ab und streckte sich. Sunny und er hatten, nachdem er in die Wohngemeinschaft gezogen war, ein paar Mal miteinander geschlafen. Sie hatte sofort gespürt, dass ihre schlanke, beinahe knabenhafte Figur ihn reizte. Er hatte nie gefragt, ob sie auch mit Felix oder Sœren Sex gehabt hatte; es schien ihm ohnehin egal gewesen zu sein. Seine anfängliche Leidenschaft war schneller verflogen als ein in einem Baum sitzender Schwarm Spatzen, der von einem platzenden Luftballon aufgeschreckt wurde.
»Wenn ich den Herkules sehen möchte, fahre ich nach Kassel …«
»’tschuldigung. Wusste nich’, dass du so spießig geworden bist.«
Trotzig legte er den Morgenmantel wieder um seinen Körper. Dann erzählte er ihr von seinem Einsatz am Vorabend. Vor fünf Wochen hatten sie in der Wohngemeinschaft beschlossen, dass Fletscher bereit war, diese Sache allein durchzuziehen. Er hatte darum gebeten und warum sollte er nicht zeigen dürfen, was er drauf hatte? »Sieh es als Feuertaufe an, Fletscher«, hatten sie gesagt. Am Nachmittag waren sie den Plan noch einmal durchgegangen. Sie hatten ihm eingeschärft, worauf es ankäme und was zu beachten sei. Jetzt, da Fletscher ihr mit aufgeschlagener Lippe gegenübersaß, fühlte Sunny sich in ihren Bedenken bestätigt.
Beunruhigt drehte Sunny mit der Zunge an ihrem Lippenpiercing. »Is’ etwa was schiefgegangen?« Sie konnte sich nicht länger beherrschen: »Dir ist schon klar, dass du dich und uns damit in große Schwierigkeiten bringen kannst, oder?«
»Denkste, ich bin blöd?«, fauchte Fletscher zurück wie ein in die Ecke gedrängter Kater. »Was glaubste eigentlich, wie’s mir geht? Du bist ja nich’ dabei gewesen. Und jetzt große Reden schwingen, oder was? Es war stockduster da draußen, verstehste?« Er hielt sich eine Hand vor die Augen, um Sunny zu zeigen, wie dunkel es war. »Wenn ich das Feuerzeug …«
»Was ist mit dem Feuerzeug?«
»Keine Ahnung. Als ich zurück war, war’s weg.«
»Hast du das etwa da liegen gelassen?« Sie konnte kaum fassen, wie cool er blieb. »Hast du wenigstens an den Rest gedacht?«
»Ich musste da so schnell wie’s ging weg und bin auch noch über irgendein scheiß Wurzelzeugs im Boden gestürzt!«
»Das darf doch nicht wahr sein! Wer hat denn darauf gedrängt, endlich mal zu zeigen, was in ihm steckt? Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass das hier kein Austin-Powers-Slapstickscheiß ist. Hast du denn gar nichts begriffen?« Wütend knabberte sie an einem Fingernagel und zog mit den Zähnen ein Stückchen Haut ab. Blut sickerte hervor, flink leckte sie es ab. Eine einzige vermasselte Aktion konnte das Aus bedeuten! Nicht zum ersten Mal ging ihr durch den Kopf, dass er einfach zu jung war. Zu jung für diese WG, zu jung für den Einsatz, zu jung für alles. Nein, korrigierte sie sich. Mit seinen 23 Jahren war er nur ein knappes Jahr jünger als sie selbst. Ihm fehlte es ganz schlicht an Erfahrung. Das war der Knackpunkt.
Fletscher zog die Luckys aus seiner Manteltasche und steckte sich eine zur Hälfte aufgerauchte Zigarette an. Die Augen halb geschlossen, blies er Sunny genüsslich den Rauch ins Gesicht, bis sie den Kopf angewidert wegdrehte.
»Wird schon alles gut gehen.«
»Und wenn die Bullen morgen hier vor der Tür stehen? Dann will ich dich mal sehen, du Hosenscheißer!« Wütend griff sie nach seiner Zigarette und warf sie in seine noch halb volle Kaffeetasse. Sie erlosch zischend. Fletscher starrte sie mit offenem Mund an.
»Rauchverbot in der Küche!« Sunny stand auf, nahm die Kaffeebecher und kippte die Reste in die Spüle. Sie ließ warmes Wasser in die Becher laufen, schwenkte sie kurz und stellte sie zu dem übrigen Geschirr in das rostige Abtropfgitter auf dem Herd.
»Du musst sie treffen. Bei der Arbeit.« Er sollte nicht glauben, dass er sich einfach aus der Verantwortung stehlen konnte. Sie drehte sich um und funkelte Fletscher aus Augen an, die Wasser mühelos in Eiswürfel hätten verwandeln können. »Am besten noch heute Abend. Spätestens morgen. Wir müssen wissen, wie die Stimmung dort ist.«
Fletscher machte nicht den Eindruck, als hätte er Lust, schon wieder nach Wollershausen zu fahren. Er hatte sie zuletzt am vergangenen Wochenende direkt am Gestüt getroffen. Wie er anschließend erzählt hatte, war sie nicht einen Deut verwundert darüber gewesen, dass er sie unbedingt von der Arbeit abholen wollte und einen Spaziergang rund um die Stallungen vorgeschlagen hatte. Naives Ding, hatte Sunny gedacht, während Fletscher erzählt hatte. Bereitwillig hätte sie ihn umhergeführt und die ganze Zeit über belangloses Zeug gequasselt, während er sich alles eingeprägt hatte. Er hatte wissen müssen, welchen Weg er zu gehen haben würde, an welcher Stelle der Stacheldrahtzaun endete und wie viele Schritte es von der Landstraße bis zur Stallmauer sein würden.
Sunny schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte, das Gespräch war für sie beendet. Sie würde ihn mindestens noch drei Mal erinnern müssen, bevor er tatsächlich zurück auf das Gestüt fahren würde. Sie betete, dass er es nicht verbockt hatte!
Kapitel 4
19 Minuten nach seinem Anruf stand Christian in Bauschkes Vorzimmer. Er hatte sich nach dem Gespräch sofort auf den Weg nach Hause gemacht, seinen Achseln einen Stoß Deo gegönnt und sich etwas Bürotaugliches übergezogen. Fabian hatte angeboten, Joshua vom Training in der Leine-Sporthalle abzuholen und später mit ihm auf eine »Salami-Peperoni-doppelt-Käse« ins Taormina zu gehen. Das hatte Christian etwas entspannt, denn man konnte nie wissen, wie lange Bauschke einen in Beschlag nehmen würde, befand man sich erst einmal in seinen Fängen. Der Mittagsverkehr hatte sich zäh durch das Stadtzentrum geschlängelt und am Groner Tor hatten sich gut zwei Dutzend Erstsemester versammelt, um ihren neuen Lebensabschnitt mit viel Bier, guter Laune und postpubertären Spielchen zu feiern. Christian hatte damit gerechnet, dass ihm ein nackter Hintern entgegengestreckt würde, der Anblick war ihm allerdings erspart geblieben. Aus aschgrauen Wolken, die sich über die Stadt gestülpt hatten, waren erste Tropfen gefallen. Die Studenten hatte das nicht beeindruckt.
Sigrid Brüggel-Herdermann saß aufrecht wie eine Buchstütze am Schreibtisch, vor sich ein Flachbildschirm groß wie eine Golf-III-Heckscheibe. Im Büro roch es penetrant nach einem künstlichen Duftöl, Christian vermutete eine perverse Mischung aus Bergamotte und Patschuli. Sie sah auf, ohne ihr Getippe zu unterbrechen. Er hatte einmal das Gerücht aufgeschnappt, dass sie ihre Lippen stets nach den aktuellen Vorgaben der »Brigitte« bemalte. In diesem Herbst war wohl ein kräftiges Aubergine angesagt. Leider, dachte er, achtete sie nicht darauf, ob ihr die Farbe schmeichelte oder sich mit ihrer Kleiderwahl vertrug. Sie sprach ein lautloses »Hallo«, und der dunkle Mund gab ihrem Gesicht eine merkwürdig dreieckige Form. Dabei zog sie ihre zu schmalen Streifen gezupften Augenbrauen so weit nach oben, dass sie die Spitzen ihres Ponys berührten, der die Farbe eines Hokkaidos hatte. Ihre Augen, die durch eine leicht mandelförmige Kontur und das Kastanienbraun der Iris einen asiatischen Einfluss durch einen ihrer Vorfahren verrieten, kamen durch dieses Wirrwarr von Make-up und Styling zu Christians Bedauern nicht zur Geltung.
Er fragte sich, ob ein ausgesprochener Gruß irgendjemanden gestört hätte. Wie immer machte sie einen viel beschäftigten Eindruck. Zeit für einen Small Talk hatte sie selten. Mit einer Kopfbewegung in Richtung Bauschkes Bürotür nickte sie ihn durch. Kurz bevor Christian an ihrem Schreibtisch vorbei durch die Tür ging, drückte sie ihm wortlos eine grüne Dokumentenmappe in die Hand. Christian konnte sich ein stummes »Vielen Dank« nicht verkneifen, richtete kurz sein Jackett und schritt in das Büro seines Vorgesetzten. Hubert Bauschke stand mit dem Rücken zur Tür am Fenster. Vor dem grauen Licht, das an diesem Tag den Ton angab, wirkte er wie eine dunkle, eindimensionale Masse.
Der Zentrale Kriminaldienst teilte sich den Dienstsitz mit der Göttinger Polizeidirektion in der Weststadt. Der Neubau erstreckte sich auf verschiedene, gestuft angeordnete Gebäude, die durch gläserne Übergänge miteinander verbunden waren. Aus Bauschkes Büro in der fünften Etage des Quergebäudes gab es bei gutem Wetter einen schönen Blick über die roten Altstadtdächer bis hoch in den Göttinger Stadtwald. Kleinbürgerliche Wohnparadiese in hellen Farben reihten sich am gegenüberliegenden Leineufer auf. Christian überlegte, ob Bauschke möglicherweise heimlich die Menschen beobachtete, die ihre Handtuchgärten trotz des einsetzenden Regens herbsttauglich machten. War sein Vorgesetzter etwa ein Spanner? Er wäre nicht verwundert, hätte Bauschke ein pikantes Geheimnis.
In seiner Ordnung und Sauberkeit übertraf das Büro noch das Vorzimmer. Nirgends lag etwas einfach nur herum. Auf dem wuchtigen Schreibtisch aus dunkel gebeiztem Lindenholz, der schräg zur Fensterfront stand und vom Sitzplatz einen ständigen Blick zur Tür erlaubte, stand eine filigrane Messinglampe, die man, das hatte Christian einmal gesehen, mit dem Finger berühren musste, um sie ein- und auszuschalten. Weiterhin gab es ein Festnetztelefon und ein Blackberry, einen schwarz-grünen, hochglänzenden Füllfederhalter, eine dunkelbraune, lederne Schreibunterlage mit Notizblock sowie einen Flachbildschirm und eine kabellose Tastatur. Auf dem ebenfalls dunklen Konferenztisch, der die andere Hälfte des Büros einnahm, standen zwei silberne, bauchige Blumentöpfe mit imposanten Schmetterlingsorchideen. Eines der karmesinroten Blütenblätter war, vermutlich ohne dass Bauschke es bemerkt hatte, vom Stiel gefallen und leuchtete auf der dunklen Tischplatte. Für einen Moment war Christian versucht, hinzugehen und das Blatt zu entfernen. Die acht Stühle waren ordnungsgemäß an ihre exakte Position gerückt – 90 Grad zur Tischgeraden mit genau einem halben Meter Abstand zum Tisch. Vergebens suchte man in diesem Zimmer nach Aktenstapeln oder anderen Utensilien, die einen geschäftigen Eindruck gemacht hätten, ganz zu schweigen von persönlichen Dingen wie Familienfotos.
Bauschkes nachtblauer Zweiteiler, maßgeschneidert von »Wilder & Söhne« in Hannover, wie er bei jeder Gelegenheit großspurig erzählte, saß so passgenau, als hätten die Schneider ihn direkt an seinem Körper zusammengenäht. Schuhe und Gürtel waren aus hellbraunem Kalbsleder gefertigt, das Armband seiner Uhr hatte er passend dazu gewählt. Er war der erste und bislang einzige Kriminalbeamte, den Christian im Anzug erlebte. Für einen kurzen Moment hatte er Mitleid mit seinem Chef. Dieser Perfektionismus musste einen neurotischen Ursprung haben, so viel war klar. Auffällig war, dass Bauschke es vermied, mehr über sein Privatleben zu verraten, als irgendwie nötig. Seine oberste Maxime schien zu sein, nach außen den Schein einer perfekten Ehe zu wahren. Was er nicht ahnte, war, dass jeder Polizeibeamte im Umkreis von 15 Kilometern wusste, dass die Beziehung zu seiner Frau einem Trümmerhaufen glich. Den Gerüchten nach hatte er mit seinem einzigen Kind gebrochen. Seine Tochter hatte die Unverfrorenheit besessen, ihr Jurastudium an der Sorbonne ohne Abschluss zu beenden und stattdessen einen französischen Gastronomen zu heiraten, um mit ihm glücklich an der Côte d’Azur zu leben. Seine beiden Enkelinnen habe er noch nie gesehen, munkelte man. Von Bauschke hörte man niemals auch nur ein einziges Wort darüber.
»Man muss seine Kinder zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten erziehen, Heldt«, begrüßte Bauschke ihn monoton, den Blick noch immer nach draußen gerichtet.
Fassen Sie sich an die eigene Nase, lag es Christian auf der Zunge, doch er konnte sich gerade noch beherrschen. »Das sehe ich genauso wie Sie«, sagte er stattdessen und hätte am liebsten nach dem Wohlbefinden von Bauschkes Enkelkindern gefragt.
Der drehte sich bedächtig um, fast, als sei ihm etwas schwindelig, und deutete mit einer Hand auf die Mappe, die Christian mit ins Büro gebracht hatte. Einen Sitzplatz bot er ihm nicht an.
»Mögen Sie Alpakas, Heldt?«
Es war egal, welche Antwort er gab, Bauschke würde sie deuten, wie es für ihn am besten war. Also sagte Christian nichts, sondern blickte seinen Chef auffordernd an.
»Sie machen in der jüngsten Zeit einen …«, Bauschke zögerte kurz. Mit seinen Händen formte er eine Halbkugel vor seinem Bauch und spielte offenkundig auf Christians Gewichtszunahme an. »… sagen wir angestrengten Eindruck. Ein kleiner Ausflug tut Ihnen bestimmt gut. Ins Eichsfeld. Weniger Mettwurst und Gefluche, mehr Frischluft und Frömmigkeit, Sie verstehen?«
Christian verstand gar nichts. Hatte Bauschke sich zwischenzeitlich etwa den Samaritern angeschlossen und sich in einen mitfühlenden Menschen verwandelt? Bislang war er nicht dadurch aufgefallen, sich ernsthaft für die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiter zu interessieren. Christian nickte trotz seiner Unkenntnis bestätigend und wartete gespannt, was sein Chef für eine Überraschung aus dem Hut zaubern würde.
Bauschke bat Christian, die Mappe zu öffnen. Sie enthielt ein einziges Blatt Papier: eine ausgedruckte E-Mail von einem gewissen Dr. Wido von den Greben aus Duderstadt. Noch während Christian den Text überflog, fing Bauschke an zu erklären.
»Mein alter Studienfreund Wido!« Bauschke lachte väterlich. »Der Gute ist in eine unschöne Angelegenheit verwickelt. Mord, um genau zu sein. Er hat das Gefühl, dass ihm etwas angehängt werden soll und traut den Kollegen aus Duderstadt nicht recht über den Weg. Er fürchtet um seine Reputation.«
»Wenn Sie mir erlauben …« Christian setze an, um Bauschke an einen früheren Fall zu erinnern, bei dem gleichfalls alte Freundschaften eine Rolle gespielt hatten und der sie allesamt beinahe ihren Job gekostet hätte. Bauschke ignorierte Christian rigoros.
»Von den Greben ist Arzt. Tierarzt, um genau zu sein«, fuhr er fort. »Und er hatte schon immer etwas für junge, hübsche Frauen übrig. Das hat ihm schon an der Uni einigen Ärger eingebracht. Der alte Wido hat offensichtlich seine Nase oder was auch immer in Dinge gesteckt, die ihn nichts angehen. Und jetzt geht ihm sein Allerwertester auf Grundeis.«
Christian schaute verwundert. »Der Tierarzt hat mit Ihnen Jura studiert?«
»Nur zwei Semester. Danach hat er ins Veterinäre gewechselt. Wegen der Frauen. Die seien dort offenherziger, hatte er gehofft. Nachdem wir beide die Uni verlassen hatten, haben wir uns nicht wirklich aus den Augen verloren. Wohnt ja nicht sehr weit weg. Ab und an besuchen wir ihn in Duderstadt, Wido und Margarete sind gelegentlich bei uns zum Essen.« Er blickte ins Leere, als ob er überlegte, warum er seinem Mitarbeiter derart viel von sich preisgab. »Von den Greben hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Alpaka-Spezialist gemacht. Für einige Züchter in Norddeutschland ist er nicht nur als Tierarzt, sondern außerdem als Berater tätig. Auf einem dieser Gestüte wurde heute Morgen eine junge Frau gefunden.« Er hielt sich beide Hände wie im Würgegriff an den Hals, um zu demonstrieren, was mit ihr geschehen war. »Der Letzte, der sie gesehen hat, war wohl von den Greben.«
Christian ahnte, was auf ihn zukommen würde. »Ich nehme an, die Kollegen in Duderstadt waren schon aktiv?«
»Die Leiche ist bereits in der Uniklinik. Der Tatort wurde abgesperrt. Das Übliche halt.« Bauschke lockerte den Knoten seiner Krawatte, bevor er weitersprach. »Es ist an der Zeit, dass der Zentrale Ermittlungsdienst die Angelegenheit übernimmt, Heldt.«
»Entschuldigen Sie«, staunte Christian und legte die Mappe auf den Schreibtisch. »Seit Montag habe ich Urlaub.«
Bauschke streckte Christian die flache Hand entgegen. »Nagler ist zur Fortbildung in Hannover, objektive Brandermittlung. Goldmann ist krank und Hagelmeyer … Nun ja. Unter uns gesagt: Wir können froh sein, wenn sein Versetzungsantrag nach Braunschweig bald durch ist. Kurzum: Fahren Sie hin und spielen Sie ein bisschen Sheriff.«
Christian wusste, dass Stern viel auf ihn hielt. Aber Bauschke? Bislang hatte er den Eindruck, dass der Chef ihn genau deswegen auf dem Kieker hatte. Wollte er mit diesem Auftrag seine Loyalität testen? »Es tut mir leid, daraus wird nichts. Mein Sohn …«
»Keine Sorge, der Urlaub wird Ihnen natürlich wieder gutgeschrieben.«
»Mein Sohn«, begann Christian von Neuem, »hat Herbstferien. Ich kann jetzt keinen Fall übernehmen!«
Bauschke schnippte ein Stäubchen von seiner linken Schulter. »Sie können Ihren Jungen jederzeit mit zur Dienststelle nehmen. Das wissen Sie doch, Heldt, oder nicht?«
»Das löst mein Problem nicht!« Wie Bauschke es schaffte, sich so dumm und so clever zugleich anzustellen, war Christian ein Rätsel. »Soll er etwa allein im Büro sitzen, während ich unterwegs bin?«
»Wollen Sie mir ernsthaft erklären, dass Sie für solche Fälle nicht vorgesorgt haben?«
Es war zwecklos, mit einem Anruf bei der Personalabteilung zu drohen; Bauschke würde immer einen Weg finden, seinen Willen durchzusetzen. Außerdem gehörten der Personalchef, ein schmieriger Endfünfziger, der seine letzten Jahre bis zur Pension auf seinem Hintern absaß, und Bauschke dem gleichen politischen Lager an und waren seit Jahren Duzfreunde. Es war leicht, sich auszudenken, wer in einer solchen Situation den Kürzeren ziehen würde. Was die Sache noch komplizierter machte: Als Beamter war er dazu verpflichtet, seinen Urlaub aus dienstlichen Gründen zu unterbrechen. Genau daran würde Bauschke sich im Zweifel festbeißen. Christian hatte verloren. Doch ein Ass hatte er noch im Ärmel.
»Wie sieht es eigentlich aus mit der neuen Planstelle?«
Die Leitung des Ersten Fachkommissariats war bei der Göttinger Polizeiinspektion von allen möglichen Aufstiegskandidaten genauso heiß ersehnt wie eine Cappuccino-Sahne-Torte in einer Diätklinik. Christian wusste, dass er nicht ohne Konkurrenz sein würde, wenn er seinen Hut in den Ring warf.
Bauschke straffte die Schultern. Er schien kein Interesse daran zu haben, dieses Thema näher zu sprechen.
»Das Innenministerium arbeitet schon seit Sterns Ausfall daran«, legte Christian nach.
»Soll ich Sie etwa am Ausschreibungsverfahren vorbeimogeln und direkt auf den Posten hieven?«
Wie so etwas funktioniert, hatte Bauschke schon am eigenen Leib erfahren, ging es Christian durch den Kopf. »Die Position reizt mich, daraus will ich gar kein Geheimnis machen. Deshalb hätte ich gerne eine faire Chance. Immerhin scheine ich Ihr Vertrauen zu genießen.« Christian hatte sich bislang geweigert, sich politisch nach dem jeweils wehenden Wind zu richten, der von der Staatskanzlei in Hannover aus über das Land wehte. An der einen oder anderen Stelle hatte sich das leider auf seine Karriere ausgewirkt. Andere waren an ihm vorbeigezogen und hatten dabei durchaus auch die Seiten gewechselt wie Rehe die Landstraßen. Ihm war es wichtig, einen guten Job zu machen. Das Hauen und Stechen, das selbst in den Polizeiinspektionen nicht ausblieb, hatte er unterschätzt.
Bauschke schaute ihn an, es folgte ein langsames, kaum merkliches Nicken. Auf Christian wirkte es wohlwollend.
»Die Ermittlung könnte ergeben, dass Ihr werter Freund …«
»Erstens«, unterbrach Bauschke mit einem Bariton, der plötzlich eine freundschaftliche Vertrautheit signalisieren sollte, »verbindet mich mit Dr. Wido von den Greben nicht mehr und nicht weniger als eine alte Freundschaft. Das heißt: Ich helfe, so gut es geht. Zweitens bitte ich Sie, diesen Fall wie jeden anderen zu behandeln. Das sollte nicht allzu schwierig sein.«
»Haben Sie mit Kratzer darüber gesprochen?«
Bauschke plusterte sich auf wie eine Kohlmeise an der Vogeltränke. »Glauben Sie, ich kenne die Regeln nicht? Selbstverständlich ist der Staatsanwalt informiert. Er ist einverstanden.«
Natürlich ist er einverstanden, dachte Christian. Kratzer kannte sich im Geschäft der gegenseitigen Gefälligkeiten aus wie eine römische Bettlerin auf dem Campo dei Fiori. Er wusste nur zu gut, welchen Arsch man zur rechten Zeit lecken musste, um seine eigene Karriere voranzutreiben. Wie konnte Tanja nur mit einem solchen Idioten verheiratet sein? Über diese Frage dachte er besser nicht nach. Er sagte: »Die Mordkommission werde ich in Duderstadt einrichten. Das nimmt den Kollegen die Spannung aus den Segeln. Spricht etwas dagegen, Piotrowski mitzunehmen?«
»Sie leiten die Ermittlungen, alles andere ist mir egal. Ich lasse die Beamten vor Ort informieren, dass Sie«, er blickte zur Uhr, die an der Wand gegenüber hing, »in ungefähr einer Stunde dort sind.«
Das würde knapp werden. Christian hatte keine Ahnung, ob er Tomek überhaupt erreichen würde, geschweige denn, ob sie rechtzeitig aus Göttingen würden losfahren können. Wenigstens konnte er sich darauf verlassen, dass Fabian sich um Joshua kümmern würde.
»Wie wollen Sie über den Fortschritt der Ermittlungen informiert werden?«
»Zwischenberichte genügen. Sollte sich herausstellen, dass Wido mehr Dreck an seinem kleinen Stecken hat, als er behauptet, wäre das seine Sache.« Dann drehte Bauschke sich wieder in Richtung Fenster.
Noch auf dem Weg in sein eigenes Büro zückte Christian sein Telefon. Tomek würde über den Auftrag nicht gerade Luftsprünge machen. Aber es würde ihm gut tun, seinen Kopf mal wieder in einen Haufen Arbeit zu stecken.
»Die Person, die Sie angerufen haben, ist zurzeit –«
Genervt steckte Christian sein Handy zurück in die Innentasche seines Jacketts. Aus dem Büro, das seinem am nächsten lag, drangen geschäftige Geräusche. Die Tür war nur angelehnt, und er lugte hinein. Sabina Wellhausen wühlte in einem Stapel Berichte zu einer aufgeklärten Einbruchsserie im südlichen Landkreis, die sie in eine bestimmte Reihenfolge sortierte und in rosafarbene Ordner abheftete. In den drei Jahren, in denen sie nun als Sachbearbeiterin für das Kommissariat 11 arbeitete, hatte sie nicht einen Tag gefehlt. Ihr Anblick hob seine Laune augenblicklich. Sabina war stets um sein Wohl besorgt. Wann immer es Probleme mit Joshua gab, hatte sie ein offenes Ohr für ihn. Sie wäre sicher eine gute Mutter geworden, hatte Christian oft gedacht. Dass ihre Ehe wegen ihrer Unfruchtbarkeit kinderlos geblieben war, belaste sie sehr, hatte sie ihm einmal anvertraut. Umso wichtiger sei es, sich von seinem Schicksal nicht kleinkriegen zu lassen. Immer schön nach vorne schauen, diese Art von Optimismus war genau das, was Christian jetzt brauchte.
»Urlaub sieht anders aus, Christian«, sagte sie, als sie ihn bemerkte.
»Keine Sorge, Sabina. Du bist mich gleich wieder los«, entgegnete er augenzwinkernd. »Bauschke hat mich mit einem netten kleinen Auftrag versorgt, damit mir die nächsten Tage nicht zu langweilig werden.«
Sie setzte eine Miene auf, die zugleich Bedauern und Aufmunterung signalisierte.
Er riet ihr, es mit den Akten nicht zu übertreiben und langsam an die Stempeluhr zu denken. »Dein Mann würde sich sicher freuen.«
Sie deutete mit ihrem Kopf auf den Stapel Papier. »Wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet. Das Letzte, worauf sich Georg freut, ist, wenn ich früher als gewöhnlich zu Hause bin«, gluckste sie und ihr Busen wippte im Takt.
Christian zog die Tür zu seinem Büro hinter sich zu und lehnte sich an die Fensterbank, auf der ein Benjamini sein Dasein fristete. Es lagen mehr Blätter auf der Fensterbank und auf dem Fußboden herum, als der Baum an seinen Ästen trug; er hatte versäumt, jemanden um die Grünpflege während seines Urlaubs zu bitten. Sein Blick streifte kurz das Zimmer. Es erinnerte ihn an sein Leben; beides musste dringend entrümpelt werden. Überall lagen Akten herum. Am Bildschirmmonitor klebten unzählige gelbe Zettel mit Notizen. Er lehnte sich mit der Stirn an die Fensterscheibe, die Kühle tat ihm gut. Für einen Moment hing er dem Gedanken nach, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, hätte Ellen damals nicht die Biege gemacht und wäre nach Kanada zurückgegangen. Hätten sie sich inzwischen ohnehin getrennt? Wären sie vielleicht verheiratet? Hätten sie ein zweites Kind gezeugt? »Es gibt immer eine Alternative« war Ellens Lebensmotto. Im Nachhinein, überlegte er, war das schon die Überschrift des Abschiedsbriefs gewesen, den sie nie geschrieben hatte. Christian schaltete das Kopfkino schnell ab.
Als er auf seinen Schreibtisch schaute, erkannte er, wie durchtrieben Bauschke war. Dort lag bereits eine Akte zum Fall. Bauschke musste die Unterlagen aus Duderstadt angefordert haben, noch bevor er überhaupt Christian am Wickel gehabt hatte. Berechnender Wichser, ärgerte Christian sich.
Kapitel 5
»Tatuś«, flüsterte er. Papa. Seit jeher benutzte er das polnische Kosewort, obwohl er sich in der Muttersprache seiner Eltern nicht einmal ein Bier bestellen konnte.
Wie ein altgedientes, ausgewaschenes Frotteehandtuch lag Waruslav Piotrowski in dem Klinikbett. Das Haar war brüchig geworden, die Haut überzog das Gesicht wie Reispapier. Der Anblick des einstigen Kraftpakets schmerzte Tomek. Auf dem Flur schepperten Essenswagen über den Boden und er schloss die Tür. Er schaute zu Waruslav, der wohl über die Prozedur der Dialyse eingeschlafen war. Sanft berührte er seine Schulter.
Sein Vater blinzelte. Ein Lächeln huschte über das schmale Gesicht, als er seinen Sohn erkannte. »Wie spät ist es?«, fragte er und leckte sich die trockenen Lippen.
»Bald Zeit für das Mittagessen«, antwortete Tomek, ohne auf die Uhr zu schauen.
»Eine Strafe ist das und kein Essen«, schimpfte Waruslav, der mit einem Mal putzmunter wirkte. »Alles hier schmeckt nach ausgelatschten Straßenschuhen. Was gäbe ich für eine ordentliche Portion Piroschkis!«
Tomek kannte die Schimpftiraden seines Vaters über das vermeintlich miese Krankenhausessen. Seit der Diagnose war er zu strenger Diät verdonnert. Kein Salz, keine scharfen Gewürze, keinen Alkohol. Es verging kein Tag, an dem er nicht trotzdem lautstark nach sauer eingelegtem Wild, salzigem Fisch oder eben gefüllten Teigtaschen verlangte. Es war das brennende Verlangen nach dem Verbotenen.
»Bald wirst du wieder nach Herzenslust zugreifen können, wonach dir ist, Tatuś. Bis dahin wird dir nichts anderes übrig bleiben, als auf die Ärzte zu hören.«
»Bald? Was heißt bald?«, regte sich Waruslav auf. »Die Maschine, die mein Blut wäscht, ist mir inzwischen näher als deine eigene Mutter. Mein Arm schmerzt, dass ich ihn am liebsten abreißen möchte.« Er stemmte sich im Bett so gut er konnte in eine aufrechte Position. Von seinem linken Arm floss das Blut in die Dialysemaschine, deren Waschräder sich wie ein altmodisches Tonbandgerät unaufhörlich drehten. Frisch gereinigt wurde es anschließend wieder in den Körper gepumpt. Tomek war froh über die Medizintechnik, ohne die sein Vater nach seinem Nierenversagen längst nicht mehr am Leben wäre. Plötzlich erahnte er einen Schatten im Gesicht seines Vaters; es war Angst.
»Was ist, wenn ich eine Spenderniere brauche?« Waruslavs Stimme zitterte.
»Sollte es dazu kommen, werden die Ärzte ihr Bestes geben.« Tomek bemühte sich, hoffnungsvoll, aber nicht zu euphorisch zu klingen. Seine eigene Furcht vor einer solchen Operation musste jetzt hinten anstehen. Erst in der letzten Woche war ein Patient auf der Station gestorben, dem es gesundheitlich sogar besser gegangen war als Waruslav. Doch sein Vater war nicht die Sorte Mann, die über ihre Gefühle oder gar Ängste redete. Es war sein Gezeter über das Essen oder über die Geräusche der Maschine, die ihm als Ventil dienten.
»Mein Sohn«, begann Waruslav und Tomek war mit einem Mal gar nicht mehr wohl. »Rutsch ein bisschen heran mit deinem Stuhl.«
Tomek zog das unbequeme Ding, auf dem er saß, näher an das Bett.
»Ich habe mit dem Oberarzt gesprochen.«
»Worüber?« Tomek zog die Augenbrauen besorgt zusammen.
»Worüber schon?«, fauchte Waruslav. »Darüber, was geschieht, sollte mir irgendetwas zustoßen.«
Tomek erschrak. »Was redest du da?«
»Ich war mein Leben lang Realist. Warum sollte ich jetzt anders denken?«
Weil das Leben verdammt noch mal nicht realistisch gelebt werden kann, deshalb! Tomek schwieg.
»Also«, setzte Waruslav noch einmal an. »Falls mir irgendetwas passieren sollte, möchte ich, dass du dich gut um deine Mama kümmerst. Haben wir uns verstanden?«
»Dir wird nichts passieren!«, protestierte Tomek, der diese Art Gedanken bislang als völlig abwegig beiseitegeschoben hatte. Aber stimmte das wirklich? Die Ärzte taten, was sie konnten, doch auch sie waren nur Menschen. Was, wenn er es tatsächlich nicht schaffen würde?
»Du wirst dich um deine Mama kümmern, keine Widerrede!«
Tomek nickte und schloss die Augen. Nicht auszudenken, wie seine Mutter den Tod ihres geliebten Mannes verkraften würde, sollte es dazu kommen. Tomeks iPhone vibrierte.
»Dein Telefon!«, kommentierte Waruslav das Brummen überflüssigerweise. Als Tomek zögerte, setzte er nach: »Nun geh schon ran.«
»Hey, Urlauber. Was liegt an?«, rief Tomek überrascht ins Telefon. »In Hann. Münden. Wieso fragst du?« Er schaute kurz zu seinem Vater und sagte dann: »Gut. Bis gleich.«
»Warum musste mein Kind Kriminalbeamter werden?«, lamentierte Waruslav, der wohl ahnte, wer am anderen Ende der Leitung gewesen war. »Einen Arzt habe ich mir gewünscht. Oder wenigstens einen Anwalt. Aber nein, du suchst die Gefahr!«
Tomek wusste, dass sein Vater stolz darauf war, dass er für den Staat arbeitete, für das Land, in das seine Eltern ausgewandert waren, um ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Trotzdem konnte er es nicht lassen, ihn mit seiner Berufswahl aufzuziehen.
Tomek lächelte verständnisvoll. »Keine Sorge, Tatuś, mein Job ist nicht einmal halb so gefährlich, wie du denkst.«
Kapitel 6
Doreen erschrak. »Entschuldigung. Was haben Sie gesagt?« Sie legte eine Strähne ihres schulterlangen Haares, die ihr vors Auge gefallen war, zurück hinter ihr Ohr. Die letzte Viertelstunde hatte sie sich auf den verkrusteten Fleck Brombeermarmelade konzentriert, der auf der Wachstischdecke festsaß. Wieder und wieder hatte sie mit einem Fingernagel darüber gekratzt, erfolglos. Beinahe hätte sie dabei sogar ihren Kaffeebecher umgekippt. Das wäre ihr gar nicht ungelegen gekommen, hatte sie gedacht, denn dann hätte sie aufstehen und sich durch das Aufwischen ablenken können. Aber das war nicht passiert, also hatte sie still auf ihrem Platz sitzen und so tun müssen, als ob sie dem Geschwafel zuhörte. Das war ihr schon früher in der Schule schwergefallen. Sie hätte sich, nachdem sie die schreckliche Nachricht erhalten hatte, den restlichen Tag am liebsten freigenommen. Jetzt saß sie hier, keine dreihundert Meter von der Stelle entfernt, an der Linda ermordet worden war. ERMORDET! Sie schüttelte sich. Was für eine Aufregung. Doreen verspürte ein Kribbeln, eine knisternde Mischung aus Furcht und Spannung, die sich langsam über ihren gesamten Körper ausbreitete. Nicht, dass sie ihrer Juniorchefin besonders nahe gestanden hätte. Die Frau hatte etwas, das sie von dem Moment an störte, als sie einander vorgestellt worden waren. Dass Linda sich innerhalb kurzer Zeit Frederik unter den Nagel gerissen hatte, empfand sie als schamlos. Immer schön nach dem eigenen Vorteil gucken zahlt sich wohl doch nicht aus, dachte sie mit Abscheu.
»Ob du weißt, wo Henk steckt, habe ich dich gefragt. Warum ist er nicht hier?« Claus Mohr duldete es nicht, dass seine Mitarbeiter ihn duzten. Umgekehrt erlaubte er es sich wie selbstverständlich. Unpünktlichkeit und unentschuldigtes Fehlen konnte er noch weniger leiden. Fuchsteufelswild konnte er dann werden.
»Was weiß ich, wo der sich herumtreibt.« Doreen machte sich nicht die Mühe, sich einen strapazierten Ton zu verkneifen. Warum ging Mohr nicht einfach selbst nach draußen und schaute nach ihm, anstatt sie damit zu nerven? »Wahrscheinlich amüsiert er sich mal wieder mit sich selbst«, ergänzte sie, stand von ihrem Stuhl auf und ließ sich aus der Maschine, die auf einer klapprigen Anrichte stand, noch etwas Kaffee in ihre Tasse laufen. Die kleine Pausenküche, in der sie sich zu ihren Besprechungen trafen, strahlte die Gemütlichkeit einer Bushaltestelle in einem verlassenen Industriegebiet aus. Doreen hasste den Raum, der immerzu nach feuchtem Keller roch. Es gab einen alten Bosch-Kühlschrank, in dem Butter, Milch sowie selbst gemachte Marmeladen, billiger Gouda und ein paar Scheiben Aufschnitt für das tägliche gemeinsame Frühstück standen. Manchmal brummte das Gerät so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Kunterbunt zusammengewürfeltes Geschirr wurde in der Anrichte aufbewahrt, auf der eine Mikrowelle und die Kaffeemaschine standen. Der wuchtige Eichenholztisch stand genau in der Mitte, acht Stühle um ihn herum. Einige der braunen Bodenfliesen waren zerbrochen, an den Fenstern hingen fleckige, rot karierte Gardinen. Sie hatten sich getroffen, um die Aufteilung der Arbeit für die kommende Woche und was sonst noch alles anlag zu besprechen. Bislang war es Linda Beckers Job gewesen, diese Besprechungen zu leiten. Nun saß Mohr senior am Kopf des Tisches, links daneben seine Frau Edith und der Juniorchef Frederik Mohr. Doreen saß ihnen gegenüber.
Die Nachricht vom Mord hatte sich am Morgen wie ein Lauffeuer auf dem Gestüt ausgebreitet. Claus Mohr reagierte, noch bevor die Polizei aufgetaucht war. Er trommelte alle Mitarbeiter und Aushilfen auf dem Hof zusammen, um zu berichten – und um klarzumachen, dass die Arbeit trotzdem erledigt werden musste. Doreen hatte sich zunächst völlig unfähig gefühlt, klar zu denken. Es war ihr vorgekommen, als hätte jemand eine Glocke über sie gestülpt und sie von der Welt außerhalb abgekapselt. Das aufgeregte Geschrei der Alpakas, die irgendwie einen sechsten Sinn zu haben schienen, und das Tuscheln der Kollegen, all das war wie durch Watte gefiltert in ihre Ohren gedrungen. Mohr hatte Kommandos für die nächsten Schritte gegeben. Aus Nordhorn hatten sich Kunden angemeldet, um zwei Stuten, die sie vor einigen Wochen gekauft hatten, abzuholen. Eine Gruppe Hamburger Zahnärzte hatte einen Alpaka-Schnupperkurs gebucht, um sich mit den Tieren vertraut zu machen. Sie alle sollten von dem Vorfall möglichst nichts mitbekommen. Der Teil der Stallungen, in dem Linda gefunden wurde, war sofort von der Polizei mit rot-weißem Flatterband abgesperrt worden. Wie im Fernsehen, hatte Doreen aufgeregt gedacht. Die von der Sperrung betroffenen Alpakas mussten daher in Windeseile in andere Boxen und in den Offenstall umquartiert werden.
Nachdem die wichtigsten Arbeiten für den Vormittag verteilt worden waren, hatte eine gespenstische Ruhe auf dem Gelände geherrscht. Das sonst übliche Gewusel war einem bedrückten Schweigen gewichen. Die Polizei, ein Notarztwagen und Menschen in kalkweißen Ganzkörperanzügen waren längst auf dem Gestüt zugange gewesen. Ein Beamter hatte mit dem Chef gesprochen und war anschließend wieder gefahren. Alle Personen, die am Vorabend auf dem Gestüt gewesen waren, sollten sich für weitere Gespräche mit der Polizei bereithalten.
Jetzt, in der Wochenbesprechung, hatte Doreen das Gefühl, dass seitdem eine Ewigkeit vergangen war. Sie hätte nicht sagen können, welche Reaktionen der Familie sie erwartete. Vielleicht einen Weinkrampf von Edith. Ein schmerzverzerrtes Gesicht von Frederik. Erstaunt bemerkte sie, dass nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil. Die Mohrs machten nicht den Eindruck, als ob diese brutale Gewalt sie in irgendeiner Weise aus der Bahn geworfen hätte. Doreen spürte, dass das alles reine Fassade war. Es würde nur einen Funken brauchen, um das Fass explodieren zu lassen. Schließlich hatte man den Mörder noch nicht einmal gefasst!
Doreen fragte sich zum ersten Mal, warum Linda überhaupt ermordet worden war. Sie hatte erst neulich aufgeschnappt, dass in Österreich Alpakas im großen Stil von Weiden gestohlen worden waren. Hatte Linda etwa jemanden auf frischer Tat ertappt? Oder war es ein Penner gewesen, der bei der Suche nach einem überdachten Nachtlager erwischt worden und ausgerastet war? Was zum Teufel hatte sie überhaupt um die Uhrzeit noch im Stall zu suchen? Meine Güte, wenn es vielleicht gar kein Fremder war! Bei dem Gedanken wurde ihr eiskalt. Froh darüber, nicht wie die anderen auf dem Gestüt zu leben, freute sie sich, nach Feierabend nach Hause fahren und es sich vor dem Fernseher bequem machen zu können. Oder sich mit ihren Freundinnen im Hexenhaus auf ein Bier zu treffen. Oder mit ihm. Nein, mit ihm eher nicht, darauf hatte sie heute keine Lust. Auf jeden Fall würde sie sich ablenken können. Das hoffte sie zumindest.
»Hör auf damit«, herrschte Edith Mohr sie ohne Vorwarnung an. »Wenn du nichts Kluges zu sagen hast, sei bitte still!«
Im ersten Moment wusste Doreen nicht, was Edith meinte. Dann erkannte sie die Anspannung in ihrem Gesicht. Edith stand auf und ging zum Kühlschrank. In der engen Reiterhose, die sie noch vom Ausritt mit ihrem Lieblingspferd am Vormittag anhatte, zeichneten sich ihre durchtrainierten Oberschenkel ab. Ihr dunkles Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte, wippte bei jedem Schritt hin und her. Zu Doreens Überraschung kehrte sie mit einem Schälchen frischer Schlagsahne zum Tisch zurück. Edith gab sich einen reichlichen Löffel in ihre Kaffeetasse und bedeutete den anderen, sich auch etwas zu nehmen. Doch niemandem sonst stand der Sinn danach.
»War nicht die Polizei noch einmal für heute angekündigt?« Demonstrativ ignorierte Doreen Ediths Versuch, die Stimmung auf einem erträglichen Niveau zu halten. Wie sie im Laufe der Zeit gelernt hatte, hatte Edith nichts zu melden. Alle Entscheidungen traf Claus Mohr persönlich. Warum sollten sie jetzt nicht über den Mord sprechen? Es juckte ihr in den Fingern, dieselben genau in die Wunde zu legen. Die Aufregung über dieses Ereignis überwog bei Weitem ihre Angst.
»Ich habe mit der Polizei gesprochen«, mischte sich Frederik in das Gespräch. »Ab sofort sind wohl Beamte aus Göttingen zuständig.« Falls Frederik hoffte, damit Doreens Neugier zu befriedigen, hatte er sich geirrt.
»Aus Göttingen?« Doreen spitzte die Lippen und pfiff anerkennend. Vor Aufregung rutschte sie auf ihrem Stuhl hin und her, der knarzende Geräusche von sich gab. »Das musste ja alles so kommen.«
»Wie meinst du das?«, fragte Claus scharf und seine tiefblauen Augen durchbohrten sie förmlich.
Doreen blickte zufrieden in die Runde. Wie die Mohrs dasaßen und ihr zuhörten!
»Ich weiß ja nicht mehr als ihr, aber …«
»Dann halte einfach deine Klappe!«, platzte es aus Edith heraus. Sie kniff die Augen wütend zusammen, sodass das helle Frühlingsgrün ihrer Iris kaum noch zu sehen war. »Ich erbitte mir ein bisschen mehr Respekt, Doreen. Immerhin war Linda Frederiks Verlobte. Denk ausnahmsweise auch mal an andere.«
Wie ein kicherndes Schulmädchen, das während des Unterrichts vom Lehrer zur Ruhe ermahnt wurde, zog Doreen einen Schmollmund und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Wo wird sie eigentlich beigesetzt?«, fragte Frederik. »Hier bei uns in Wollershausen? Immerhin hat sie hier zuletzt gelebt. Ihre Mutter wird sich von ihrem Altenheim aus kaum um ein Grab kümmern können.«
»Lindas Leiche wird erst noch aufgeschnitten und untersucht. Vorher ist noch gar nicht daran zu denken, sie unter die Erde zu bringen«, fuhr Claus dazwischen, ohne sich um die Wirkung seiner Worte zu scheren. »Sobald die genug von ihr haben, sehen wir weiter. Im Moment …«, er hustete laut und schluckte den Schleim, der sich dabei löste, hinunter, »… haben wir noch ganz andere Sorgen!«
Er schaute Frederik vorwurfsvoll in die Augen und stellte seinen Kaffee ein Stück weit von sich weg. Doreen hatte schon immer das Gefühl, dass Frederik in Claus’ Augen eine einzige Enttäuschung war, obwohl es aus ihrer Sicht keine Gründe dafür gab. Andererseits – was wusste sie schon von der Alpakazucht? Nie ließ er eine Gelegenheit aus, seinem Sohn zu demonstrieren, dass er der Erfahrenere war und die klügeren Entscheidungen traf. Claus schreckte nicht davor zurück, Frederik vor den Augen der Mitarbeiter bloßzustellen. Es war mitunter kaum zu ertragen, wie respektlos er ihn behandelte. Nur gegenüber Linda zeigte Claus sich von einer sanfteren, aufmerksameren Seite. Doreen hatte zeitweilig sogar den Verdacht, dass sich die Harmonie zwischen den beiden nicht nur auf die Arbeit beschränkte. Als dann plötzlich die Verlobung mit Frederik bekannt gegeben wurde, war sie über alle Maße überrascht gewesen. Die Wogen zwischen Vater und Sohn hatten sich, soweit Doreen das überblickte, seither etwas geglättet. Lindas Tod schien die Wellen wieder höher schlagen zu lassen.