
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Migo
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nachdem sich die vier Soul Riders getrennt voneinander auf eigene Missionen begeben haben, befinden sich die Reiterinnen in noch größerer Gefahr. In aller Verzweiflung gelingt es Anne durch ihre neuentdeckten magischen Fähigkeiten sich und ihre Freundinnen zu retten. Wiedervereint bemerken die Soul Riders, wie ihre Kräfte zum ersten Mal in Gegenwart voneinander an Stärke gewinnen. Die Legende erwacht, als die Vier das Training mit den Druiden beginnen und lernen, wer sie sind und was es heißt, ein Soul Rider zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Die vier Soul Riders haben sich getrennt voneinander aufgemacht, um die beiden entführten Pferde Starshine und Concorde zu finden. Anne befindet sich ganz allein in der magischen Unwelt Pandoria, während Lisa auf dem Gelände von Dark Core nach ihrem Vater sucht. Jede weiß um ihre magischen Fähigkeiten – aber ist es eine gute Entscheidung gewesen, nicht zusammenzubleiben? Denn nicht nur eines der Mädchen schwebt nun in großer Gefahr. Sind Elizabeth und die anderen Druiden wirklich auf der Seite der Reiterinnen? Und als schließlich noch ein Pferd verschwindet, scheint Garnoks Rückkehr nichts mehr im Wege zu stehen. Jetzt liegt alles in der Hand der Soul Riders und ihrer Pferde.
»Die Legende erwacht« ist die Fortsetzung der beliebten Buchreihe »Soul Riders« um die vier Freundinnen Lisa, Alex, Linda und Anne und ihre magischen Pferde.
Wer furchtlos ist, braucht keine Tricks, um mutig zu sein.
Tove Jansson
1
In Lisas Herz gab es einen Fleck, der einem ganz bestimmten Lebewesen vorbehalten war: dem Pferd Starshine mit seinem weichen Maul und seinem perfekten, fließenden Galopp. In ihrem jungen Leben hatte die ängstliche Lisa schon einiges durchgemacht und sich erst dank Starshine wieder in den Sattel getraut. Wenn sie recht überlegte, war dieser Fleck in ihrem Herzen eigentlich schon länger besetzt, als man meinen sollte. Bereits als sie im Kindergarten Bilder von einem wunderschönen weißen Pferd mit ungewöhnlich blauer Mähne gemalt hatte, hatte dieser Fleck nach ihr gerufen und sie flüsternd mit Ausritten im Mondlicht gelockt, mit schwindelerregenden Abenteuern und dieser reinen, unkomplizierten Liebe, wie man sie nur für ein Tier empfinden konnte. Dieses Flüstern hatte sie nach Jorvik zu Starshine gebracht.
Natürlich konnte man auch Menschen lieben, das wusste Lisa. Doch irgendwie war die Liebe zu Menschen viel schwieriger. Mit ihnen gab es immer tausend Dinge zu bedenken. Tausend komplizierte Dinge wie Konflikte, Streits, Forderungen und der leidige Alltag. Menschen zermürbten einander. Man wurde falsch verstanden, sagte etwas Verkehrtes oder Dinge, die man später bereute und nicht mehr zurücknehmen konnte.
Ein Pferd zu lieben war hingegen denkbar leicht – eine einfache, bedingungslose Liebe. Und Lisa hatte gelernt, dass man an dieser Liebe wachsen konnte und Mut gewann.
Doch nun war Starshine nicht mehr da. Er war weg, entführt, und es war an ihr und ihren Freundinnen, ihn zu suchen. Vor lauter Angst und Trauer hatte sie schon eine ganze Flut an Tränen vergossen. Jetzt hatte sie sich ausgeweint. Zurück blieb nur die Gewissheit, dass sie ihn suchen musste, und das hatte sie hierher, zur Fabrikanlage von Dark Core, geführt. Wie ein unheimlicher Riese ragte der Komplex vor ihr auf. Getragen vom sanften Wind trudelte ein verdorrter, gelbbrauner Grashalm einsam vorbei. Ein vertrocknetes Blatt wurde vom Baum gefegt und landete auf der Abdeckung eines Schachtes. Ansonsten war es vollkommen still. Beinahe zu still.
Durch ein Loch im Zaun, das sie mithilfe eines Bolzenschneiders in den Draht gebogen hatte, schlich sich Lisa in die scheinbar ausgestorbene Fabrikanlage, auch wenn sie dabei das Gefühl hatte, dass ihr hundert Augenpaare auf den Hinterkopf starrten. Vielleicht war es auch mehr als nur ein Gefühl. Sie hatte die Anlage zwar nicht sehr lange beobachtet, doch sie hatte genug gesehen, um zu wissen, dass hier urplötzlich und aus allen Richtungen Leute auftauchen konnten.
Sie konnten vom dunklen, aufgewühlten Meer kommen oder eine der gewundenen Treppen hinabsteigen, sie liefen über einen der langen Flure oder kamen aus den kupferfarbenen Rohren, die Lisa an gigantische, glänzende Schlangen erinnerten.
Vor ein paar Stunden war dann plötzlich ein riesiger Helikopter am Himmel erschienen, und darin saß er.
Mr Sands. Allein beim Klang seines Namens, allein beim Gedanken an ihn zog sich ihr der Magen zusammen. Nachdem er aus dem Hubschrauber gestiegen war, hatte er noch eine Weile im Wind der Rotorblätter verharrt, die undurchdringlichen schwarzen Augen auf einen unbestimmten Punkt hoch über dem Landeplatz gerichtet. Lisa war sich sicher, dass er sie von so weit weg unmöglich in ihrem Versteck auf dem Wasserturm entdecken konnte, und doch hatte sie das Gefühl, als sähe er sie direkt an, als starre er durch sie hindurch.
Er musste immer noch da drin sein – sie hatte ihn nicht rauskommen sehen. Eigentlich hatte sie gar nichts mehr gesehen, seit sie ihr Versteck auf dem Wasserturm verlassen und sich zum Zaun geschlichen hatte.
Dennoch musste sie auf der Hut sein.
Lisa packte den Bolzenschneider fester. Sollten sie die kräftigen Arbeiter in den grünen Overalls, die sie vorher durch den Haupteingang hatte kommen sehen, entdecken und packen, war dies sicher nicht gerade die perfekt Waffe, auch nicht, falls … Lisa erschauderte … falls er sie entdeckte. Doch immerhin war der Bolzenschneider ein solides Werkzeug, das ihr Halt gab. Etwas, an dem sie sich festhalten konnte und das ihre zitternden Hände für einen Moment beruhigte. Ziellos hastete sie über das Gelände. Mit seinen zahllosen, miteinander verbundenen Komplexen wirkte das Anwesen wie ein Archipel, bestehend aus vielen kleinen Inseln. Es erinnerte sie an die Festung eines Raubritters, nur dass diese hier aus Stahl und Blech gebaut war und nicht aus Stein. Hier und dort verschwanden dicke Rohre im Boden, so als würden sie die Erde aussaugen. Man konnte sich mit Leichtigkeit ausmalen, wie die Rohre sich unter der Erdoberfläche weit verzweigten und dort im Verborgenen ein verschlungenes Universum bildeten. Wer wusste schon, wo sie alle endeten? Lisa sah sich um und entdeckte einige seltsame kleinere Gebäude – mehrere Lagerhäuser und eine Art Pavillon mit einer baufälligen Kuppel, von dem die Farbe abblätterte. Waren sie leer? So wirkten sie zumindest, aber vielleicht lag sie auch falsch. Sie musste sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass sie sich schon oft geirrt hatte.
Sie hatte zum Beispiel geglaubt, sie würde mit Starshine tolle Reiterferien im Herbst erleben, und dass ihr Vater sie zu Hause erwarten würde. Und schon nagte wieder diese bohrende Frage an ihr, eine Frage, die sie sich wieder und wieder gestellt hatte, seit ihr Vater eines Tages zur Spätschicht gegangen und nicht mehr nach Hause gekommen war.
Wo ist mein Vater? Was haben sie mit ihm gemacht?
Tränen brannten ihr in den Augen. Aber sie durfte jetzt nicht die Fassung verlieren. Sie durfte nicht zu viel an ihren Vater denken, sondern musste fest darauf vertrauen, dass sie ihn finden würde. Denn das würde sie, ganz bestimmt. Aber erst musste sie Starshine finden. Sie brauchte ihn, um dem Rest entgegenzutreten. Seine Kraft und seine Wärme. Vielleicht gibt es hier trotzdem Spuren, dachte sie. Wichtige Einzelteile eines Puzzles, die ihr – ihr Herz machte einen kleinen Sprung – vielleicht verrieten, wo ihr Vater steckte.
Sie versuchte den Kummer, der sich wie ein schwerer Klumpen in ihrem Innern zusammengeballt hatte, abzuschütteln und konzentrierte sich wieder auf das Fabrikgelände. Wie ein dunkles Lavafeld aus Asphalt und Beton erstreckte sich das ausgedehnte Areal entlang der Küste. Rauch qualmte aus den hohen Schornsteinen, die hier und dort aus dem Boden wuchsen.
Als sie den nächsten Gebäudeflügel erreichte, stand sie vor einer Reihe von Türen, doch nur eine davon war einen Spalt offen. Endlich mal eine einfache Entscheidung. Sie stieß die Schulter gegen die schwere, grüne Metalltür, und mit einem Kreischen wie von langen Fingernägeln, die über eine Tafel kratzen, schwang sie auf. Lisa zuckte bei dem Geräusch zusammen und huschte dann hindurch.
Schwärze umfing sie. Sie tastete die Wände nach einem Lichtschalter ab und fuhr mit den Fingern über Spinnweben und Kabel. Wird hier nie sauber gemacht?, fragte sie sich. Anscheinend nicht. Sie hatte erwartet, dass eine so große Fabrikanlage irgendwie ordentlicher war.
Die Luft war staubig und stickig. Sie atmete tief ein und kramte in ihrer Erinnerung nach vertrauten Düften – Heu, Pferdeäpfel, warme Pferdekörper. Lag hier in der Luft irgendetwas Vertrautes, irgendeine Spur von Starshine?
Aber welche Anhaltspunkte hatte sie schon? Als sie dort allein in der Dunkelheit stand, überkamen sie Zweifel. Im besten Fall war die ganze Unternehmung vergebens. Im schlimmsten Fall …
Nein, darüber wollte sie lieber nicht nachdenken.
Lisa nieste und tastete weiter herum, bis sie schließlich einen Lichtschalter fand. Eine nackte Glühbirne, die von der Decke baumelte, flackerte und flammte auf. Im fahlen, grünlichen Licht sah sie, dass sie in einem Lagerraum gelandet war, der vor Pappkartons, Bestelllisten und Rollwagen, auf denen sich Kisten stapelten, überquoll. Sie schlich durch eine weitere Tür – diesmal gab sie sich alle Mühe, sie geräuschlos zu öffnen – und fand sich in einem langen Korridor wieder. Bis auf das gedämpfte Brummen von Maschinen irgendwo in der Ferne war es still.
Am liebsten wäre sie gerannt. Sie wollte in Bewegung bleiben und jeden Winkel dieses riesigen Gebäudes absuchen.
Jede Tür, jede Treppe konnte sie Starshine näher bringen. Natürlich nur, wenn er wirklich hier war. Sie versuchte, sich nicht zu große Hoffnungen zu machen – schließlich war dies nur einer von mehreren Orten, die sie, Linda und Alex als mögliche Verstecke von Dark Core vermuteten. Da könnte man einen Dinosaurier drin verstecken. Das hatte Alex über die Fabrikanlage gesagt, als die Orte noch eingekreiste Punkte auf einer Karte gewesen waren. Jetzt waren sie Wirklichkeit geworden. Damals hatte Alex gelacht, dieses etwas atemlose Alex-Lachen, das Lisa so sehr ans Herz gewachsen war.
Lisa vermisste ihr Lachen. Sie sehnte sich nach ihren Freundinnen, einfach, weil sie ihre Freundinnen waren, die besten, die sie jemals gehabt hatte.
Die einzigen, die sie jemals gehabt hatte.
Alex, Linda und Anne. Und dann war Lisa dazugestoßen, die Neue in der Klasse, die Neue auf dem Gestüt. Vorher hätte sie nie zu träumen gewagt, dass sie einmal eine beste Freundin haben würde, geschweige denn drei.
Erst seit einem knappen Monat wohnte sie auf der Insel Jorvik, doch in dieser kurzen Zeit war unglaublich viel passiert. Wenn Lisa darüber eine Kurzgeschichte für den Englischunterricht schreiben würde, würde ihr Lehrer wahrscheinlich bemängeln, dass sie zu unrealistisch sei. Oder er würde ihre blühende Fantasie loben.
Es gab noch so viele unbeantwortete Fragen, doch dafür hatte Lisa jetzt keine Zeit.
Sie zwang sich, langsam, aber sicher tiefer in das Gebäude vorzudringen. Das Brummen war hier im Korridor schon deutlicher zu hören als zuvor im Lagerraum. Die Luft knisterte elektrisch, als wäre sie batteriebetrieben. Über Lisas Kopf ertönten schwere Schritte, und mit angehaltenem Atem blieb Lisa stehen und lauschte angestrengt. Dann hörte sie noch etwas anderes, ein Geräusch, das sich unter die Schritte und das rhythmische Stampfen der Maschinen mischte.
Etwas Vertrautes.
Konnte es …?
Unmöglich.
Plötzlich zerschnitt ein durchdringendes, schrilles Wiehern die Stille und hallte in den dunklen Fluren wider. Da scherte Lisa sich nicht mehr darum, ob sie entdeckt wurde oder nicht. So schnell sie konnte, rannte sie dem entgegen, von dem sie hoffte, dass es Starshine war. Ihre Cowboystiefel hallten laut auf dem Betonboden, bis sie unvermittelt auf ein Hindernis stieß. Und schon steckte sie fest, war gegen etwas Massives, Hartes geprallt, und ihre fliegenden Beine waren mitten im Lauf gestoppt worden. Auch ihr Herz schien für einen Moment ausgesetzt zu haben.
Ihr blieb gerade noch genug Zeit, um das Dark-Core-Logo auf dem grünen Stoff zu erkennen, bevor sie zusammenbrach.
»Sind wir hier richtig, Meteor?«, fragte Linda.
Im Licht des frühen Morgens konnte sie kaum etwas erkennen. Hoch ragten die Bäume vom Kiefernwohld in den dunklen Nachthimmel auf, der langsam den anbrechenden Tag begrüßte. Die ganze Welt klammerte sich noch an die kalte Stille der Nacht und erwachte nur langsam zum Leben. Nur ein einziges Mädchen ritt ganz allein auf ihrem Pferd durch den Wald, der im kühlen Morgentau dalag. Dunkelblaue Schatten fielen über sie. So früh sangen noch nicht einmal die Vögel. In dieser Totenstille kann man schnell den falschen Pfad einschlagen und verloren gehen, dachte Linda. Es war eine Stille, die eher zu tiefen Schneewehen passte als zu einem Herbstwald. Eine alles umhüllende, schwere Stille. Jedes Mal, wenn sie den Mund öffnete und etwas zu ihrem treuen Pferd sagte, hatte sie das Gefühl, dass ihre Stimme unsicherer und kindlicher klang. Natürlich konnte Meteor ihr nicht antworten, aber er war der Einzige, mit dem sie reden konnte, der Einzige, der diese grässliche, erstickende Stille für einen Augenblick vertreiben konnte.
»Wir hätten zusammenbleiben sollen, Meteor. Genau wie Hermann gesagt hat. Ich habe so eine furchtbare Vorahnung, ein Gefühl, dass bald etwas Schreckliches passieren wird. Und als wären wir zwei die Einzigen, die das verhindern können«, sagte Linda zu ihm.
Linda wusste nicht, wie ihre Sehergabe funktionierte. Noch nicht. Weder hatte sie einen Einfluss darauf, welcher kleine Ausschnitt der Zukunft ihr gezeigt wurde, noch konnte sie Träume von der Wirklichkeit unterschieden. Vielleicht, weil ihr die Wirklichkeit mehr und mehr wie ein Traum vorkam.
Auf einmal stolperte Meteor so über einen großen Stein, dass Linda das Gleichgewicht verlor und beinahe heruntergefallen wäre, hätte sie sich nicht mit einer Hand in Meteors dicker, weißer Mähne festgekrallt. Sie spürte die Hitze, die von seinem Körper ausging. Ihre Finger waren nass von seinem Schweiß.
»Tut mir leid, Kumpel«, sagte sie. »Die Pfade hier sind nicht mit den Reitwegen bei uns am Gestüt vergleichbar. Aber jetzt dürfte es nicht mehr weit sein.«
Plötzlich spitzte Meteor die Ohren und lauschte. Hatte er etwas gehört, das ihren Menschenohren verborgen blieb?
Auch Linda lauschte angestrengt. War das Geräusch in weiter Ferne der Gesang eines Vogels?
»Was ist los, Meteor?«, fragte sie und streichelte seinen weichen, struppigen Hals.
Aber natürlich konnte Meteor ihr nicht antworten. Stattdessen fiel er in einen zügigen Trab. Die schmalen Waldwege öffneten sich zu einer großen Lichtung, und Linda konnte auf einmal etwas Helles, Fließendes zwischen den dicht nebeneinander wachsenden, dunklen Fichten ausmachen. Es war das fahle Licht des Neumondes, der sich in der lavendelfarbenen Morgendämmerung abzeichnete. Der Mond hing ungewöhnlich tief. Sie meinte fast, die Hand ausstrecken und ihn vom Himmel pflücken zu können. Im seinem fahlen Schein sah sie die Silhouetten auffliegender Vögel. Ein schwerer Blumenduft lag in der Luft. Der frische, kühle Geruch des Waldes war verschwunden, stattdessen herrschte hier ein ganz anderer Geruch, ein Duft, der in ihr Erinnerungen an fremde Orte und die warmen Nächte des Süden hervorrief.
Sie sah wieder hinauf zum Mond, und ein vertrautes und zugleich unerwartetes Hochgefühl erwachte in ihr.
Als hätte sie mit Meteor ein hohes Hindernis fehlerfrei überwunden.
Da wieherte Meteor unvermittelt. Linda blinzelte hastig. Plötzlich hatte sie das ungute Gefühl, beobachtet zu werden. Unsichtbare Blicke bohrten sich in ihren Rücken.
Sollte sie sich umdrehen und dem Ungeheuer direkt in die Augen starren?
»Welchem Ungeheuer? Da ist kein Ungeheuer«, sagte sie sich leise, doch es klang nicht sehr überzeugend.
Ohne sich umzudrehen, trieb sie Meteor an, und im schnellen Galopp trug er sie aus dem Wald hinaus, fort von den höhnischen Blicken. Mit jedem Galoppsprung ließ sie das Gefühl, beobachtet zu werden, weiter hinter sich. Schließlich drosselte sie das Tempo und richtete sich im Sattel auf. Bis zu ihrem Ziel lagen noch viele Stunden vor ihnen.
Die Sonne brach durch die dichten Wolken. Endlich war der Morgen da, und mit ihm kehrte ihre Zuversicht zurück, dass alles möglich war. Natürlich vermisste sie Alex und ihre Freundinnen, aber dafür hatte sie Meteor, der sie besser verstand als irgendein Mensch auf der ganzen Welt. Zusammen waren sie unbesiegbar. Sie dachte an das geheimnisvolle Herrenhaus, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden. Gut Kiefernwohld. Was, wenn Starshine dort gefangen gehalten wurde? Oder wenn sich dort zumindest ein wichtiger Hinweis befand, der sie zu ihm führen würde? Es war nicht sehr wahrscheinlich, aber was, wenn doch? Für einen Moment schob sich eine strahlende Lisa vor ihr inneres Auge, die auf Linda und Meteor zugeritten kam, Starshine neben sich. Bei der Vorstellung schwoll ihr Herz an.
Oh, Linda, wie kann ich dir jemals danken?
Auf einmal fühlte sie sich frei und federleicht, allein mit ihrem Pferd an einem rauen, frischen, klaren Herbstmorgen unterwegs zu einem Abenteuer, das gerade erst begonnen hatte.
Was auch immer sie auf Gut Kiefernwohld erwartete, sie war bereit.
Alex erinnerte sich noch gut an den magischen Moment. Zwar spürte sie nichts mehr davon, doch sie sah die Szene noch klar und deutlich vor sich: Alles hatte geleuchtet und geglitzert, während der Blitz sie geleitet hatte, und als Alex die Hand gegen Jessica erhoben hatte, war diese zu Boden gegangen. Während sie auf TinCan durch das eisige Tal ritt, das kalt und ausgestorben dalag, trug sie den kleinen Anhänger in Form eines Blitzes an ihrer Halskette. Doch auf ihrem Weg zum Kap Horn gab es keine Blitze und keine pinkfarbenen, pulsierenden Lichtstrahlen mehr. Vor ihr lagen nur leer gefegte Ebenen und scharfe Felszungen, die aus der Erde ragten und zu sagen schienen: »Bleib fort! Geh nicht weiter!« Alles um sie herum war grau oder graubraun, wie ein altes Foto, das alle Farbe und allen Glanz verloren hatte. Alex kam sich vor wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt, vollkommen abgeschnitten von allem und jedem – außer von TinCan natürlich.
»Jetzt gibt’s nur noch uns beide, mein Junge«, sagte sie zu ihrem treuen Vierbeiner und pflückte ein Blatt aus seiner Mähne. »Für immer.«
In dem Grau hier oben lag etwas Unerbittliches, das jeden Mut mit kaltem Wind davonfegte. Die Regenfälle der letzten Nacht hatten den Boden aufgeweicht. Matsch spritzte um TinCans dichten Fesselbehang auf. Sie beschloss, seine Hufe während der nächsten Rast sorgfältig auszukratzen, den Matsch aus seinem Fesselbehang zu bürsten und seine Fesselbeugen zum Schutz vor Feuchtigkeit einzucremen.
Sacht berührte sie ihren Anhänger: An diesem Morgen war er eiskalt. Als der Blitz damals zu ihr gekommen war, war der Anhänger so heiß geworden, dass er ein Brandmal auf ihrer Halsbeuge hinterlassen hatte. Die Wunde war kaum verheilt.
Was hatte das zu bedeuten? War die Magie verschwunden?
Es gab so vieles, was sie noch nicht verstand.
In der kalten Morgenluft fühlte sich alles gedämpft an, beinahe, als würde sie unter Wasser reiten. Eine zähe Steifheit hatte sich in ihren Armen und Beinen ausgebreitet, so als bewegte sich die Welt in Slow Motion.
Sie ließ TinCan ein kurzes Stück traben und versuchte sich in Erinnerung zu rufen, was sie eigentlich genau vorhatte.
»Starshine retten?«, sagte sie versuchsweise. TinCan antwortete mit einem brummelnden Wiehern, das tief aus seiner Kehle kam.
»Die Welt retten?«, fragte sie und richtete sich im Sattel auf. TinCan wieherte lauter.
»Gut, dann hätten wir das also geklärt«, sagte Alex zufrieden und zauste Tin-Can liebevoll durch die struppige Mähne.
Sie überließ ihm das Tempo. Während sie von Trab in Galopp fielen, dachte sie an Anne. Von ihren drei Freundinnen war Anne diejenige, die ihr während des langen Ritts nicht aus dem Kopf gehen wollte. Warum hatte sie nicht mit ihnen gesprochen, bevor sie sich auf den Weg gemacht hatte? Und wohin war sie geritten? Noch drängender war die Frage: Wo war ihr Pferd Concorde?
Anne mit den glänzenden Haaren und dem unverwandten Blick. War sie bereit für das, was vor ihnen lag?
War Alex selbst bereit?
Sie hätten nicht getrennt ausschwärmen dürfen. Das wusste sie inzwischen. Die vier Soul Riders mussten geschlossen zusammenbleiben. So über die ganze Insel verstreut waren sie geschwächt. Bestenfalls.
Schwerwiegender Fehler.
Aber war die falsche Entscheidung einmal gefällt, was blieb einem schon, außer weiterzuziehen?
Deshalb zog sie weiter, wie ein Soul Rider es eben tat.
Alex sehnte sich nach dem Blitz, nach IRGENDETWAS, das ihr die Richtung wies, weg von den Sorgen und den leuchtenden Augen der Raubtiere, die dort in den Schatten lauerten. Seit sie am Morgen im Wald aus unruhigen Träumen erwacht war, hatte sie ihre Blicke auf sich gespürt. Ihr war kalt, und sie fühlte sich einsam. Nicht einmal Tin-Cans warmer Körper und sein langes Fell konnten sie aufwärmen.
Ein paar Möwen segelten über den regenverhangenen Himmel. Jetzt konnte es nicht mehr weit bis zur Küste sein. Unten am Hafen konnte sie schon die Lichter der Frachtschiffe ausmachen, die vor der Bucht lagen. Dort war ihr Ziel.
»Auf geht’s, TinCan«, sagte Alex, und alle Unsicherheit war aus ihrer Stimme gewichen.
Die dunklen Wolken wurden plötzlich von einem blendenden Weiß erhellt. Dann, so schnell, wie er gekommen war, war der Blitz wieder verschwunden.
2
Anne konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann die Welt um sie herum pink und verzerrt geworden war. Sie wusste nur, dass sie sich nicht mehr auf Jorvik befand. Raum und Zeit hatten sich aufgelöst. Vielleicht waren seitdem Tage vergangen. Oder waren es Stunden? Minuten?
Jahre?
Drohend zeichnete sich um sie herum Pandorias Unwirklichkeit in Form von lila Pilzen ab. Ja, »Unwirklichkeit« war das Wort, das ihre Umgebung am besten beschrieb. Die Pilzformationen schienen sich in der Luft hin und her zu wiegen und formten ein knallbuntes Feuerwerk aus allen erdenklichen pinken und lila Schattierungen. Unbarmherzig strahlte ihr die Sonne direkt in die Augen. Als sie auf allen vieren vorankroch, in Richtung von etwas, was in einer anderen Welt – in ihrer Welt – ein Fluss hätte sein können, schwankte der Boden unter ihr. Hohe Klippen glitzerten pink in der Sonne und bildeten eine scharfe Silhouette vor dem Horizont. Sie sahen aus wie riesige Edelsteine. Hatten pinkfarbene Edelsteine einen bestimmten Namen? Anne konnte sich nicht entsinnen.
Sie stand auf und fiel hin. Sie versuchte es noch einmal, kippte jedoch erneut um wie eine schlaffe Puppe. Endlich schaffte sie es, sich aufrecht zu halten, doch ihre kraftlosen Beine trugen sie kaum.
Was tue ich hier?, dachte sie. Egal, wie sehr sie in ihrem Gedächtnis kramte, es wollte ihr einfach nicht einfallen. Sie hatte das Gefühl, in einer riesigen, grellbunten Zentrifuge zu stecken, in der sie hilflos herumgewirbelt wurde, immer schneller und schneller. Als Kind war Anne mal auf einem Jahrmarkt Achterbahn gefahren. Immer wieder war sie eingestiegen, bis die Welt sich vor ihren Augen gedreht hatte und sie sich übergeben musste. Damals war niemand da gewesen, um ihr die Haare aus dem Gesicht zu halten.
War sie wieder am selben Punkt? War sie wieder zehn Jahre alt und hörte im Hintergrund die Musik vom Pferdekarussell?
Die Pferde, Anne. Bleib bei den Pferden.
War da wieder der Duft von Zuckerwatte? Musste sie sich übergeben?
Wo war ihre Mutter?
Die Pferde. Vergiss nicht die Pferde!
Doch sie vergaß sie. Alles vergaß sie. Die Löcher in ihrem Gedächtnis waren so weich und kuschelig, dass es ein Leichtes war, sich hineinsinken zu lassen. Sie konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und fiel erneut hin. Alles hier war fremd, der Boden, die Luft, das Licht und die Farben. Es fühlte sich irgendwie falsch an. Sie gehörte hier nicht hin.
Und doch … Zugleich sollte sie hier sein, oder nicht?
War da nicht etwas, das sie tun sollte? Etwas Wichtiges?
»Bitte«, flüsterte sie sich selbst zu, und Tränen rannen ihr die Wangen hinunter. »FÜHL was. Ganz egal, was.«
Doch sie fühlte und hörte nichts. Sie roch auch nichts. Waren alle Gerüche auf Jorvik geblieben? Vor ihren Augen drehte sich alles. So sehr, dass sie sich am liebsten übergeben hätte, doch sie konnte nicht. Ihr Körper schien hier anders zu funktionieren. Sie war nicht für diese Welt gemacht, sie schien alles Leben aus ihr herauszuziehen. Bald würde sie nicht mehr in der Lage sein zu denken. Die wenigen Gedanken, die ihr kamen, zogen sie nur noch tiefer in die Verwirrung. Nichts ergab Sinn.
Konfetti, dachte sie. Überall rosa Zuckerwatte. In meinen Ohren, in meinen Augen, in meinem Mund. Nein danke, Mom. Ich will nichts mehr. Bitte, Mom, keine Zuckerwatte mehr.
Während Anne sich mühsam an verschwommenen pinken Teichen und kleinen schwimmenden Felsinseln vorbeischleppte, war ihr speiübel. Sie versuchte, von Insel zu Insel zu springen, wie damals, als sie im Sportunterricht in der Grundschule »Nicht den Boden berühren« gespielt hatten. Die Luft kam ihr dünner vor als daheim auf Jorvik, so als wäre die Schwerkraft hier eine andere. Und alles war so pink, dass ihre Augen schmerzten.
Sie war allein, doch in ihrem hilflos verwirrten, trägen Kopf braute sich etwas zusammen. Ihre Mutter erschien und mit ihr das hellgraue Karussellpferd.
Das Pferd ist wichtig. Vergiss bloß das Pferd nicht!
Dann tauchte plötzlich Alex auf … hier, bei ihr? Dort stand sie vor ihr, in ihren schmutzigen Reitstiefeln und mit einem triumphierenden Gesichtsausdruck. Oder war es doch nicht Alex? Doch, ganz bestimmt, das musste sie sein, sie trug ihren Blitzanhänger um den Hals. Er funkelte und verlieh ihrem hellbraunen Haar einen pinken Glanz. Aber als Alex auf Anne hinabsah, die wie eine Stoffpuppe auf den scharfen, pinken Felsen lag, wirkten ihre Augen auf einmal kohlschwarz. Um sie herum gurgelte und zischte das pinke Wasser. Die Schatten, die kurz zuvor kaum sichtbar gewesen waren, wurden länger und dunkler. Sie krochen über Anne und Alex.
»Das war ein schwerer Fehler. Du bist ein Fehler«, zischte Alex ihr ins Ohr. Anne spürte, wie ihr warmer Atem ihrem schwachen Körper die letzte Widerstandskraft raubte.
»Du bist allein losgezogen«, fuhr Alex fort. »Auch gut. Es wäre ohnehin niemand mit dir geritten. Wir haben schließlich Besseres zu tun, als uns die Haare zu machen. Im Ernst, Mädchen, krieg mal deine Prioritäten auf die Reihe.«
Anne hob den Kopf und blinzelte misstrauisch. Ihre Lider fühlten sich klebrig an. Sie hörte, was Alex sagte, und sah sie direkt vor sich stehen – doch war es wirklich Alex? Die Alex, die sie kannte, würde nie so gemeine Dinge sagen. Wichtigtuerisch und laut, das war sie manchmal, aber niemals gemein.
»Wer bist du?«, flüsterte Anne schwach.
Die Antwort hallte träge in ihrem pochenden Kopf wider, doch sie wagte nicht, daran zu glauben. Oder?
Die Anti-Alex. Das ist nicht Alex.
Die Alex-Gestalt verblasste und wurde vor ihren Augen eins mit den pinken Schatten. Erleichtert sank Anne zurück in einen dunklen, trägen Zustand der Bewusstlosigkeit, in eine Art Trance. Doch unter ihrer Benommenheit hörte sie, wie jemand nach ihr rief.
Oder vielmehr wieherte.
Das Pferd, Anne. Ich hab dir doch gesagt, dass er wichtig ist.
»Concorde?«
3
Hoch oben in seinem Stahlschloss aus Rohren und verwinkelten Fluren hatte Mr Sands sein Büro. Man sollte meinen, dass ein Mann in seiner Position den Raum mit dem besten Blick wählen würde, doch sein Büro hatte Blick auf ein heruntergekommenes, verrußtes Industriegelände, weit weg vom Stadtzentrum. Alles war in dichten Rauch gehüllt, der aus den Schornsteinen quoll und dem Himmel einen schmutzig gelben, schwefelfarbenen Anstrich verlieh. In diesem Licht sah Mr Sands aus, als wäre er mindestens hundert Jahre alt.
In Wahrheit kamen hundert Jahre nicht einmal in die Nähe seines echten Alters. Der ungesunde, gelbliche Schein betonte jede Falte und jede Furche in seinem Gesicht, zeigte jedes einzelne Jahr, wie die Ringe eines Baumes. Er seufzte und kehrte seinem Spiegelbild im Fenster den Rücken zu. Dann nickte er der ganz in Weiß gekleideten Gestalt zu, die geräuschlos in den Raum geglitten war und nun neben ihm stand.
»Du kommst genau zur rechten Zeit, Katja«, sagte er und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Katja schwieg und sah ihn nur mit ihren großen, runden Augen an. Sie waren von einem so hellen Grau, dass sie beinahe weiß wirkten, wie bei einem Leichnam.
Mr Sands lehnte sich über seinen schweren Eichenholztisch und sprach in eine Freisprechanlage. Der Empfang war schlecht. Es knackte und rauschte, und der Lautsprecher spuckte nur Wortfetzen aus.
»Generäle, wo seid ihr?«, bellte er in das Mikrofon. »Sabine? Jessica?«
Am anderen Ende der Leitung, in einem Wäldchen, verzog Sabine neben ihrem großen schwarzen Pferd das Gesicht und rieb sich vehement das Ohr.
»Wir sind da, Boss, die Frage ist nur, ob unsere Trommelfelle das auch noch sind«, sagte sie mürrisch.
»Wohl kaum«, brummte Jessica, die nahe der Klippen zwischen Kap Horn und der Ambossbucht ritt und ihr Handy auf der Suche nach besserem Empfang in die Höhe hielt. Kerzengerade und vollkommen reglos saß sie auf ihrem Pferd und blickte hinaus aufs Meer. Ihr Gesicht war hart und ausdruckslos. Die blechernen, abgehackten Worte der anderen wurden von den heranrollenden Wellen geschluckt.
Katja lächelte. Dabei geschah etwas mit ihren Augen: Nun war ganz deutlich zu sehen, dass sie tatsächlich milchweiß und nicht hellgrau waren.
»Generäle!«
Mr Sands Ausruf klang wie ein Peitschenhieb.
»Ich verlange einen Lagebericht! Was gibt es Neues?«
»Eine von ihnen ist anscheinend auf dem Weg zum Kap Horn«, antwortete Jessica und rückte ihr Haarnetz zurecht. »Will bestimmt zum Hauptquartier. Ich werde ihr natürlich einen gebührenden Empfang bereiten.«
»Ausgezeichnet«, erwiderte Mr Sands.
»Versuch, diesmal auf den Beinen zu bleiben, okay?«, mischte Sabine sich ein. Jessica hörte deutlich das hämische Lächeln in ihrer Stimme, und für den Bruchteil einer Sekunde flackerte ein Feuer in ihren Augen auf. Doch dann schnaubte sie nur geringschätzig – ihr wäre es lieber gewesen, nicht an ihr letztes Aufeinandertreffen mit Alex erinnert zu werden. Was für eine Blamage, von einem kleinen Stallmädchen mit Lichtspielchen außer Gefecht gesetzt zu werden! Nein, daran wollte sie nicht mehr denken. Das hätte sie nie für möglich gehalten.
»Die Brillenschlange reitet anscheinend zum Gut Kiefernwohld.« Sabine warf das lange, dunkle Haar zurück. Weil ihr Pferd Khaan die Ohren nach hinten drehte und einem Geräusch zwischen den Bäumen lauschte, kniff sie die dunklen Augen zusammen. Sie konnte jedoch nichts erkennen. Hoffentlich ließ Mr Sands sich schnell abwimmeln, und sie konnte endlich weiterreiten, dachte sie seufzend.
»Und ich nehme an, der dritte General hat alles unter Kontrolle«, sagte Mr Sands mit seiner rauen Sandpapierstimme und warf Katja einen flüchtigen Blick zu.
»Aber sicher.« Katja demonstrierte wieder ihr schauderhaftes, leeres Lächeln. »Ist mir ein Vergnügen. Ich darf ihr doch auch das Pferd zeigen, oder?«, fragte sie begierig und wirkte plötzlich wie ein kleines Mädchen, das um Süßigkeiten bettelte.
»Die Pferde müssen geopfert werden. Das weißt du so gut wie ich. Wir brauchen sie, um Garnok ein für alle Mal zu befreien«, sagte Mr Sands langsam, beinahe nachdenklich, während er Katja abschätzend betrachtete. »Aber warum nicht das Pferd, das wir schon gefangen haben, als Köder benutzen, um die anderen Pferde anzulocken?«, fügte er mit einem wahrhaft bösen Lächeln hinzu.
»Wir müssen warten, bis wir alle vier Pferde haben, oder?«, fragte Sabine. »Vorher können sie nicht geopfert und Garnok nicht befreit werden, richtig?«
»Richtig«, bestätigte Sands. »Um Erfolg zu haben, brauchen wir alle vier Pferde oder vielmehr ihre magische Energie … Darum müssen sie geopfert werden. Und das möglichst bald, solange der pandorische Energiefluss uns begünstigt. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr die Mädchen und ihre Pferde so schnell wie möglich findet. Ein Pferd haben wir schon hier und eins in Pandoria. Nun müssen die anderen beiden gefangen und ins Labor gebracht werden, damit wir mit den Vorbereitungen für das Opferritual beginnen können.«
»Und die Mädchen?«, fragten die drei Generäle im Chor.
»Das Einzige, was mich interessiert, sind die Pferde. Wir müssen sie fangen und opfern. Wenn ihr außerdem die Soul Riders in eure Gewalt bringt oder außer Gefecht setzt, ist das ein netter Bonus. Dann können sie nicht mehr versuchen, die Pferde zu retten oder uns sonst irgendwie dazwischenzufunken. Wobei diese vier Soul Riders alles andere als stark sind …«
»Concorde – also, mein Sternenpferd«, warf Jessica mit einem dünnen Lächeln ein. »Ich glaube, er ist bald bereit, aus Pandoria in die Gefangenschaft überführt zu werden.«
»Gut. Du hast meine Erlaubnis, das Portal im Hauptquartier zu benutzen, um nach Pandoria zu gelangen«, erwiderte Mr Sands.
Seine blassen, fast weißen Spinnenfinger bewegten sich rhythmisch in der Luft, so als knetete er langsam und gründlich einen unsichtbaren Gegenstand.
»Gibt’s noch was, Boss?«, fragte Jessica über das Rauschen der Leitung hinweg.
Mr Sand machte ein Gesicht, als hätte er in eine saure Zitrone gebissen. »Allerdings. Jessica, es gibt Hinweise, dass jemand sich Zutritt nach Pandoria verschafft hat, um das Pferd zu retten.«
»Dann haben wir noch weniger Zeit, als wir dachten«, sagte Jessica halb zu sich selbst und trieb ihr Pferd an. Sie entfernten sich von der Küstenlinie und ritten tiefer in den Wald hinein. Obwohl sie sich immer wieder unter tief wachsenden Ästen bücken musste, ritt sie zügig und entschlossen durch die wilde Landschaft. »Ich muss nach Pandoria, bevor es noch einer der anderen gelingt. Und diesmal mache ich keine Fehler«, schwor sie sich grimmig. »Nie wieder. Wer auch immer da in Pandoria herumschnüffelt …« – sie sah Annes Gesicht vor sich –, »ich werde sie zerstören, das verspreche ich. Und es wird mir ein wahres Vergnügen sein.« Für einen Moment schwieg sie. Dann fuhr sie fort: »Ich nehme doch an, ich bekomme Verstärkung? Schließlich muss ich mich nicht nur um den Eindringling kümmern, sondern auch noch um das Mädchen, das auf dem Weg zum Kap Horn ist!«
Mr Sands ließ seinen Blick über das Industriegelände schweifen, wo die stämmigen, grün gekleideten Arbeiter geschäftig umherliefen.
»Das schaffst du schon, Jessica, da bin ich sicher. Sabine, du hingegen brauchst Unterstützung, denke ich.« Er starrte auf das Mikrofon auf seinem Tisch. »Ich organisiere einen Transporter, damit das Pferd, das du suchst und das wohl auf dem Weg zum Gut Kiefernwohld ist, so schnell wie möglich hier eintrifft.«
Immer schneller bewegten sich seine Spinnenfinger. Bei der Vorstellung, was die Zukunft bereithielt, lächelte er. Durch die Opfergabe der vier Pferde würde genug Energie generiert werden, um Garnok zu befreien. Vor mehreren Hundert Jahren war er Garnok zum ersten Mal begegnet. Damals war ihm ewiges Leben gewährt worden, damit er genau eine Aufgabe erfolgreich vollbrachte: die Befreiung von Garnok. Auch wenn es ihm persönlich wichtiger gewesen wäre, sich an denen zu rächen, die seine Rosalinda auf dem Gewissen hatten. Er hatte noch immer vor, Gerechtigkeit walten zu lassen und Rache zu nehmen für das, was man seiner Geliebten angetan hatte. Und er, John Sands, würde sie am selben Tag zur Königin machen, an dem er König wurde. Denn sobald Garnok befreit war, würde er den Planeten verlassen, und John Sands würde der mächtigste Mensch auf Erden. Mit ewigem Leben gesegnet, wäre er in der Lage, ein Reich aus Geld und Macht zu begründen, wie es niemand je zuvor gesehen hatte. Nicht zu vergessen seine erbarmungslose Rache an all den jämmerlichen Menschen. Das würde ihnen eine Lehre sein.
Doch zunächst war die Zeit der alles entscheidende Faktor. Sands stand von seinem Schreibtisch auf und trat zum Fenster. Das Spiegelbild, das ihm aus der penibel gewischten Fensterscheibe entgegenblickte, zeigte einen erschöpften Mann. Einen gealterten Mann. Je ungeduldiger Garnok wurde, desto mehr spürte er, wie die Jahre an ihm zehrten. Ihm, John Sands, lief die Zeit davon, und seine Träume drohten in unerreichbare Ferne zu rücken. Mit anderen Worten, er durfte diesmal auf keinen Fall scheitern. Niemals! Er ballte die Hand in der Jackentasche zur Faust und kehrte seinem Spiegelbild entschlossen den Rücken zu. Wenn er sich das nächste Mal im Spiegel ansah, würde man keine Spuren seines Alters mehr entdecken. Wenn wir sofort loslegen, wird alles nach Plan verlaufen, dachte er. Er würde Garnoks Freiheitsdurst stillen und seine eigene Haut retten. Und alles, alles würde ihm gehören.
Sands setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, rückte die rote Fliege zurecht, die er stets um den Hals trug, und sagte knapp: »Ich hoffe, damit ist für euch alles geklärt, Generäle. Ich muss mich nun um einen ungebetenen Gast kümmern.«
4
Als Linda schließlich die Anhöhe hinaufritt, auf der das ausgedehnte Gut Kiefernwohld lag, waren ihre Beine steif, und ihr Magen knurrte laut. Das Herrenhaus blickte mit leeren, schwarzen Augenhöhlen auf sie herab. Mehr Tier als Gebäude, erschien es ihr mit einem Mal wie ein Greifvogel mit ausgebreiteten Flügeln, der nur darauf wartete, die Klauen in seine Beute zu graben.
Konnten Häuser eine Seele haben? Wenn ja, dann hatte Gut Kiefernwohld eine dunkle, herausfordernde Seele, fand Lisa – eine verlorene Seele.
»Lies nicht so viele Gruselgeschichten, Linda«, sagte ihre Tante immer. »Die Welt ist doch so schon schrecklich genug.« Vielleicht hatte ihre Tante recht. Das hier war einfach nur ein Haus und ganz bestimmt kein Spukschloss – oder?
Zweifellos aber war es ein verlassenes Haus. Sie suchte die Erde nach Reifenspuren ab, Autos, die irgendwo im Verborgenen parkten, irgendwas, das zu sehen war außer einem dunklen, stillen Herrenhaus. Aber da war nichts. Es sah ganz danach aus, als wäre seit Ewigkeiten niemand mehr hier gewesen.




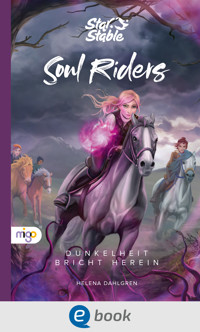











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












