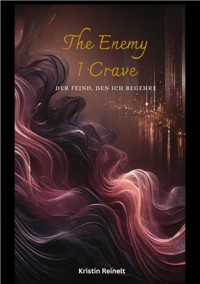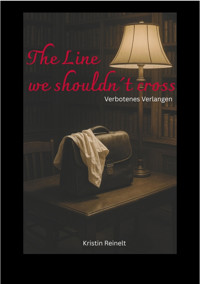8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viel Schmerz kann eine Frau ertragen, bevor sie beschließt, dass ihr Leben nicht mehr lebenswert ist? Anna steht am Rand. Nach dem Verlust ihres Kindes, einer zerbrochenen Ehe und einer Trauer, die jede Farbe aus ihrem Leben gezogen hat, bleibt nur noch Stille. Und Leere. Bis ein Mann in ihr Leben tritt, der keine Antworten gibt, aber Fragen stellt, die sie lange nicht mehr gehört hat. Noah, ein Rettungssanitäter, begegnet ihr nicht als Held – sondern als jemand, der einfach da ist. Leise. Unaufdringlich. Und bereit, sie in ihrem eigenen Tempo zurück ins Leben zu begleiten. „Zwischen den Zeilen soll man atmen können“ – mit dieser Haltung erzählt dieser Roman nicht von der großen Liebe, sondern von etwas Tieferem: Vertrauen, Verlust, Mut und dem zarten Versuch, wieder Boden unter den Füßen zu finden. Ein leiser, kraftvoller Roman über einen Weg, den niemand freiwillig geht – und der dennoch gegangen werden muss. Für alle, die selbst durch Dunkelheit gegangen sind. Und für alle, die verstehen wollen, wie viel Stärke in echter Verletzlichkeit liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kristin Reinelt
Stay for a while
Ich bleibe einfach bei Dir
Liebesroman
Vorwort
Es gibt Geschichten, die schreibt man nicht einfach so. Geschichten, die nicht entstehen, weil es eine nette Idee war oder weil man unbedingt Worte für ein leeres Blatt finden wollte. Dieses Buch ist eine solche Geschichte.
Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Vorwort überhaupt schreiben soll. Ob es notwendig ist, noch etwas zu erklären. Doch am Ende glaube ich: Ja. Es ist notwendig. Vielleicht nicht für alle, aber für die eine Frau, die diese Zeilen liest und sich darin für einen kleinen Moment weniger allein fühlt.
Dieses Buch ist nicht einfach eine fiktive Geschichte. Es ist durchzogen von ganz realen Gefühlen, von ganz echtem Schmerz und von Momenten, die ich selbst so oder ähnlich erlebt habe. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Ich weiß, wie still die Welt werden kann, wie leer der eigene Körper, wie laut die eigene Schuld.
Ich musste feststellen, dass es auch heute, im Jahr 2025, immer noch ein Tabuthema ist. Ein Thema, über das man nicht spricht. Eines, bei dem viele Menschen hilflos werden, schweigen oder — schlimmer noch — falsche Worte finden. Selbst in Internetforen, in vermeintlich geschützten Räumen, wo Frauen sich austauschen könnten, begegnen einem Kommentare, die auf eine subtile, manchmal auch ganz offene Art wehtun. Kommentare, die fragen, ob man vielleicht selbst Schuld trägt. Ob man etwas falsch gemacht hat. Ob man es zu früh anderen erzählt hat. Ob man zu viel gearbeitet, zu wenig aufgepasst hat.
Nein.
Keine Frau dieser Welt sollte sich selbst die Schuld für etwas geben, das ihr den größten Schmerz verursacht hat. Keine Frau sollte sich dafür schämen, dass ihr etwas widerfahren ist, dass sie sich nicht ausgesucht hat. Und keine Frau sollte sich jemals allein damit fühlen.
In Deutschland gibt es Anlaufstellen für Frauen, die einen solchen Verlust erlebt haben. Frauen, die ihr Kind verloren haben — durch eine Fehlgeburt, eine stille Geburt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Einrichtungen, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen. Es gibt Möglichkeiten, Hilfe anzunehmen, wenn man bereit dafür ist.
Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist kein medizinisches Fachbuch. Es ist eine Geschichte. Eine leise Geschichte über Schmerz. Über Verlust. Aber auch über Hoffnung. Und über den Mut, irgendwann wieder kleine Schritte zurück ins Leben zu wagen.
Für alle Frauen, die das hier lesen: Ihr seid nicht allein.
Und ihr habt nichts falsch gemacht.
Von Herzen
Kristin
1
"Er war nur ein Hauch von Leben, und doch hinterlässt er Spuren, tiefer, als Worte je erreichen könnten."
Die Stimme des Pfarrers trug leise über die kleine Lichtung. Nicht laut. Nicht feierlich. Kein Pathos, kein falscher Trost. Nur Worte, schlicht und unbeirrbar wie die nackten Äste über ihren Köpfen.
Anna stand da, als gehörte sie nicht mehr wirklich hierher. Ihre Schultern schmal, zu schmal unter dem schwarzen Mantel, der ihr fremd vorkam. Ihre Hände lagen reglos ineinander, kalt, vielleicht taub. Der Wind fuhr leicht durch ihr Haar, hob eine Strähne, ließ sie wieder sinken. Sie spürte es kaum.
Sie starrte auf den kleinen, viel zu kleinen Sarg vor sich. Weiß. Viel zu weiß gegen die dunkle Erde. Und noch immer keine Tränen. Es war, als hätte ihr Körper vergessen, wie das ging. Wie Weinen sich überhaupt anfühlte.
Neben ihr hielt Mara ihre Hand. Einfach so. Ohne Worte, ohne Bewegung. Ihr Griff war fest, aber nicht fordernd. Warm, irgendwo aus weiter Ferne.
Anna wusste, dass Mara sie ansah. Immer wieder. Aber sie drehte den Kopf nicht. Konnte es nicht. Alles in ihr war still geworden in den letzten Tagen. Nicht ruhig. Nicht friedlich. Nur still. Wie der Moment, bevor etwas zerbricht.
Der Pfarrer sprach weiter, von Hoffnung, von Erinnerung, von Liebe, die bleibt. Worte, die irgendwo über ihr hinwegglitten, ohne sie zu berühren. Anna hörte sie. Aber sie erreichten nichts mehr.
Hinter ihnen raschelte ein Vogel im Gebüsch. Weit weg ein Auto, das viel zu schnell über eine nasse Straße fuhr. Und der Wind roch nach kaltem Regen und feuchter Erde.
Vielleicht, dachte Anna, vielleicht wäre es leichter gewesen, wenn es geschneit hätte.
Als der Sarg langsam hinabgelassen wurde, trat Anna mechanisch einen Schritt vor. Ihre Finger schlossen sich um eine kleine Handvoll Erde. Kalt. Krümelig. Fast leicht zwischen ihren Fingern. Sie ließ sie auf das helle Holz rieseln. Es klang leiser, als sie gedacht hatte. Fast wie Staub.
Dann legte sie die Blume nieder. Eine einzige weiße Freesie. Zart und schlicht. Vielleicht war es alles, was sie noch geben konnte.
Sie hielt kurz inne. Nicht zum Beten. Nicht für Worte. Nur einen Atemzug lang stand sie da, ohne zu wissen warum. Und dann drehte sie sich um. Wortlos. Langsam. Schritt für Schritt. Fort von diesem kleinen Grab. Fort von allem.
Sie konnte nicht länger hier sein.
Das Haus lag still in der Seitenstraße, als wäre es selbst in Trauer gefallen. Weiß gestrichen, Holzverkleidung, altmodisch, aber liebevoll gepflegt. Es wirkte klein zwischen den großen, alten Bäumen, fast wie ein Rückzugsort, den man leicht übersehen konnte, wenn man nicht genau hinsah.
Die kleine Veranda vorne war leer. Nur der Wind bewegte leicht einen losen Faden am Geländer. Zwei Stühle standen dort, nebeneinander, als hätten sie auf etwas gewartet, das nicht mehr kommen würde.
Ein schmaler Weg führte zum Briefkasten am Straßenrand. Auf dem Rasen lagen noch welke Blätter, die niemand weggefegt hatte. Im Garten hinten, halb verwildert, reckten sich die letzten späten Blüten zwischen dem Unkraut.
Innen war es still. Zu still. Der helle Holzboden gab kaum ein Geräusch von sich unter ihren Schritten. In den Fenstern hingen leichte Vorhänge, die sich kaum bewegten. Pflanzen standen da, als warteten auch sie auf irgendetwas.
Anna betrat das Haus, als betrete sie einen fremden Raum. Ohne den Mantel auszuziehen, ohne ein Wort. Sie stellte die Schuhe ordentlich nebeneinander, mechanisch, aus Gewohnheit mehr als aus Absicht.
Mara stand unsicher in der Tür, schaute ihr hinterher. Sagte nichts.
Anna ging durch den Flur, an der kleinen, fast ordentlichen Küche vorbei, bis ins Schlafzimmer. Es war ruhig dort. Minimalistisch. Ein Bett, ein kleiner Schrank, mehr nicht. Alles wirkte fast zu aufgeräumt, zu leer.
Ohne sich umzudrehen, schloss Anna die Tür hinter sich. Nicht laut. Nicht abweisend. Einfach still.
Mara blieb einen Moment stehen. Atmete tief durch, ganz leise, als wolle sie die Luft nicht stören. Dann ging sie langsam in die Küche. Sie stellte den Wasserkocher an, suchte in Annas Schubladen nach Tee. Ihre Bewegungen waren vorsichtig, beinahe zögerlich, als bewege sie sich in einer Welt, die nicht mehr ihr gehörte.
Anna saß auf dem Bett. Regungslos. Die Schultern schmal, die Hände im Schoß gefaltet, ohne zu wissen, wann sie damit begonnen hatte. Es war still hier. Still in einer Weise, die nicht schützte, sondern alles lauter machte, was in ihr war.
Sie dachte an James.
An den Mann, den sie einmal geliebt hatte. An seine klare Stimme. Seine geordneten Pläne. Sein Lächeln, das fast immer wirkte, als gehöre es mehr zu seiner Arbeit als zu ihr.
Er hatte sie verlassen, weil er keine dritte Schwangerschaft wollte. Er hatte es ausgesprochen, als wäre es eine nüchterne Entscheidung. Vernünftig. Sachlich. Fast freundlich. Als ginge es um eine Reise, die man nicht mehr gemeinsam antreten konnte.
Dritte Schwangerschaft. Es hörte sich an, als hätten sie bereits Kinder. Eine kleine Familie vielleicht. Streit um Hausaufgaben, verschüttete Milch, Schlafmangel. Aber es war nichts davon da. Es war nie etwas da gewesen, außer dieser furchtbaren, unsichtbaren Leere.
Die ersten beiden Male hatte es sich angefühlt wie eine starke Periode. Zumindest hatte es so geheißen. "Es ist noch ganz früh. Es war noch nichts Richtiges." Das hatte man ihr gesagt. Als ob das irgendetwas leichter gemacht hätte. Als ob es nicht jedes Mal ein leises Zerreißen gewesen wäre, irgendwo tief in ihr, wo niemand hinsah.
Und dann war da die dritte Schwangerschaft gewesen. Völlig ungeplant. Fast trotzig hatte ihr Körper Leben geschaffen, wo längst kein Platz mehr dafür schien. Der Arzt hatte sie angesehen und gesagt, diesmal sähe alles gut aus. Diesmal habe es Chancen. Hoffnung, in weißen Kitteln und sanften Stimmen.
Es hatte genau sieben Tage gedauert, nachdem sie James davon erzählt hatte.
Sie konnte sich noch immer an den Klang seiner Schritte erinnern, als er gegangen war. An die Tasche in seiner Hand. An das Klicken der Tür.
Ein leises, endgültiges Klicken, das lauter war als jedes Wort.
Abends war es am schlimmsten.
Wenn das Haus still lag, wenn niemand mehr etwas von ihr wollte, wenn kein Telefon klingelte und keine Nachbarin kurz über den Zaun fragte, ob alles in Ordnung sei. Dann spürte Anna am meisten, wie allein sie war.
Und doch war es auch die einzige Zeit, in der sie sich traute zu sprechen.
Leise lag sie dann auf dem Sofa oder auf ihrem Bett, die Hände auf ihrem Bauch. Nicht drückend, nicht fest. Nur da. Fingerspitzen auf Haut, so vorsichtig, als wäre auch das schon zu viel.
"Hallo, kleiner Mensch", hatte sie oft geflüstert. Ganz schlicht. Ganz ohne Geschichten oder Pläne. Nur diese Worte. Manchmal auch nur: "Bleib."
Ihr Alltag war ein langsames Abtasten geworden. Jeder Schritt überlegt. Jede Bewegung von einer neuen Achtsamkeit begleitet. Sie hievte sich vorsichtig aus dem Bett, stand langsam auf, um nicht zu schnell Kreislauf oder Schwindel zu provozieren. In der Dusche hielt sie sich am Griff fest, den sie nie zuvor gebraucht hatte.
In der Küche bewegte sie sich anders. Nicht mehr schnell, nicht mehr zwischen Herd und Spüle hin und her springend. Sondern bewusst. Bedächtig. Wenn sie einen Topf aus dem Schrank nahm, dachte sie kurz darüber nach, ob er zu schwer sein könnte. Wenn sie einkaufen ging, war der Einkaufszettel auf das Nötigste reduziert. Und der Rucksack nie zu voll.
Sie sprach mit dem Baby, wenn sie allein war. Still oft. Aber manchmal auch laut, damit es nicht ganz so still war in diesem Haus.
"Wir schaffen das", hatte sie gesagt. "Nur du und ich."
Es war ihr kleines Versprechen gewesen. An sich selbst. An das Leben, das in ihr schlug. Noch so leise. Noch so unsicher. Aber da.
Jeder Tag brachte mehr Licht.
Langsam erst. Fast unmerklich. Es begann mit kleinen Dingen. Damit, dass Anna morgens wieder Musik einschaltete, wenn sie in der Küche stand. Leise, irgendwo im Hintergrund. Melodien, die den Raum füllten, ohne zu fordern.
Sie summte manchmal mit. Ganz leise. Ohne es zu merken.
Und irgendwann merkte sie, dass sie lachte. Einfach so. Wenn eine Kundin im Blumenladen etwas Lustiges sagte. Oder wenn ein kleiner Junge ihr stolz erzählte, er wolle seiner Mutter Gänseblümchen schenken, weil das die schönsten Blumen der Welt seien.
Die Tage wurden leichter. Nicht unbeschwert. Aber heller.
Sie ging anders durch die Welt. Mit der Hand manchmal auf ihrem Bauch, unbewusst. Mit einem Lächeln, das nicht mehr ganz so vorsichtig war. Sie begann wieder, kleine Dinge zu planen. Neue Pflanzen für den Garten. Ein weiches Tuch für das Baby. Manchmal stand sie minutenlang vor dem Schaufenster eines Kinderladens und sah sich winzige Schuhe an, ohne dass ihr dabei die Kehle eng wurde.
Die Vorsorgetermine verliefen gut. Der Arzt war ruhig, freundlich, ohne Überheblichkeit. Er sagte, alles sehe wunderbar aus. Kein Grund zur Sorge. Und Anna begann, das zu glauben.
Vielleicht durfte sie diesmal wirklich hoffen.
Eines Tages, es war ein klarer Morgen im Februar, fragte der Arzt sie, ob sie das Geschlecht wissen wolle.
Anna hatte kurz überlegt. Es war ihr eigentlich egal. Junge oder Mädchen — Hauptsache gesund. Hauptsache, es blieb.
Und doch hatte sie genickt. Ein stilles, kleines Nicken.
Sie wollte es wissen. Wollte diesem kleinen Menschen einen Namen geben, ein Bild in ihrem Kopf, etwas zum Festhalten. Etwas, das mehr war als nur Angst und Hoffnung. Der Arzt ihr sagte ihr wenig später es würde ein Junge werden
Sie nannte ihn Liam.
Ganz still. Ohne es groß zu beschließen. Ohne Listen, ohne lange Überlegung. Der Name war einfach irgendwann da. Vielleicht hatte sie ihn irgendwo gehört. Vielleicht war er ihr in einem Buch begegnet oder in einem Film, an den sie sich nicht erinnerte.
Aber es war egal.
Liam.
Es fühlte sich richtig an. Weich. Still. Stark auf eine ganz eigene Weise. Kein Name, der etwas beweisen musste. Ein Name zum Schützen vielleicht. Oder zum Festhalten.
Und irgendwann sprach sie ihn aus.
"Liam."
Ganz leise. Wie ein Geheimnis zwischen ihr und ihm.
Sie war jetzt im vierten Monat. Die Zeit, in der Dinge langsam echt wurden. In der sie wieder Mut fasste. Sich traute, mehr zu denken als nur bis morgen. In der ihr Bauch begann, sich rund und sichtbar zu wölben.
Anna begann, Babysachen zu kaufen. Erst zaghaft. Eine kleine Mütze in hellem Grau. Winzige Socken. Ein weiches Tuch mit Sternenmuster. Es war nicht viel. Aber es war ein Anfang.
Sie lief durch kleine Läden, streichelte mit den Fingerspitzen über Stoffe, blieb an Stramplern hängen, die kaum größer waren als ihre ausgestreckte Hand. Und es war nicht mehr nur Angst, die in ihr wohnte.
Es war Vorfreude.
Ganz leise noch. Aber echt.
Anna hatte gelernt, ohne James klarzukommen.
Nicht von heute auf morgen. Nicht ohne Schmerz. Aber Tag für Tag ein bisschen mehr.
Sie vermisste ihn. Nicht immer. Aber manchmal. An den leisen Abenden, wenn die Welt draußen langsam dunkler wurde und das Haus sich plötzlich größer anfühlte als sonst. Dann saß sie manchmal auf dem Sofa, die Knie angezogen, die Arme darum geschlungen, und weinte.
Nicht laut. Nicht bitter. Es war ein stilles Weinen. Eines, das kam, weil sie sich erinnerte. Weil es einmal Liebe gegeben hatte. Und weil etwas in ihr noch nicht ganz begriffen hatte, dass es vorbei war.
Aber sie respektierte seine Entscheidung. Wirklich. Vielleicht, weil sie ihn zu gut kannte. Weil sie wusste, dass James kein schlechter Mensch war. Er war nicht gegangen, um ihr weh zu tun. Er war gegangen, weil er Angst gehabt hatte. Vor dem Schmerz, der kommen konnte. Vor dem Verlust, der sich so leicht zwischen sie stellte. Vor dem Scheitern, das sie beide kannten.
Es war seine Art gewesen, sich zu schützen. Vielleicht auch sie zu schützen, auf seine Weise. Falsch vielleicht. Aber menschlich.
Ab und an erkundigte sich James. Eine Nachricht, ein Anruf. Nie lang. Immer sachlich. "Wie geht es dir? Und dem Baby? Alles gut bei euch?"
Er machte keine Versuche, zurückzukommen. Keine großen Gesten. Keine Entschuldigungen. Es war, als stünde er irgendwo ganz weit außerhalb ihres neuen Lebens und würde durch ein Fenster schauen, ohne es zu öffnen.
Und es war ihr egal.
Nicht aus Trotz. Nicht aus Bitterkeit. Sondern, weil ihr Leben inzwischen ein anderes geworden war. Ein stilles, vorsichtiges Leben. Voller kleiner Rituale. Voller neuer Gedanken. Voller Liam.
Und das reichte ihr.
Mara war geblieben.
Schon immer irgendwie. Schon damals, als alles anfing zu bröckeln. Und erst recht jetzt, in dieser seltsamen Zwischenzeit, in der Anna sich selbst wieder zusammensetzte. Langsam, Stück für Stück.
Es war nie laut zwischen ihnen. Nie übertrieben. Mara war einfach da. Sie kam nach der Arbeit vorbei, brachte Essen mit, oft viel zu viel, und setzte sich zu Anna an den kleinen Küchentisch. Dort tranken sie Tee, redeten über Alltägliches, über die Arbeit, über Nachbarn.
Aber auch über Liam.
Manchmal saßen sie auf dem Sofa und Mara streichelte gedankenverloren über Annas Bauch, als wäre es selbstverständlich. Als gehörte dieser kleine Mensch in Annas Bauch auch ein bisschen zu ihr.
Sie freuten sich zusammen. Still oft. Aber echt.
Mara brachte kleine Geschenke mit. Einen winzigen Body mit einem Elefanten. Eine Decke aus weichem Baumwollstoff. Nichts Übertriebenes. Immer so, dass Anna sich darüber freuen konnte, ohne dass es zu groß wurde.
Sie lachten wieder zusammen. Immer häufiger. Manchmal lachte Anna über sich selbst, über ihre plötzliche Liebe zu Fencheltee oder darüber, wie schnell ihr die Tränen kamen, wenn im Fernsehen ein Baby zur Welt kam.
Mara neckte sie dann, sanft. "Du bist jetzt schon eine von diesen Müttern."
Und Anna lachte. Weil es sich gut anfühlte.
Sie planten kleine Dinge. Den ersten Ausflug mit Liam. Wie das Kinderzimmer aussehen könnte. Ob es überhaupt eines brauchte. Ob er wohl dunkle Haare haben würde wie James oder vielleicht helle wie Anna.
Es waren einfache Gespräche. Aber in ihnen lag Hoffnung. Leben. Ein kleines bisschen Zukunft.
Eines Nachmittags lag das Babybett lag in Einzelteilen im Wohnzimmer.
Schrauben, Bretter, eine Anleitung, die mehr Fragen aufwarf als Antworten. Und mittendrin Anna und Mara, kniend auf dem Boden, mit einem Inbusschlüssel bewaffnet und einer Mischung aus Ehrgeiz und stiller Verzweiflung im Gesicht.
"Das kann doch nicht so schwer sein" murmelte Mara, zog an einem Seitenteil, das sich nicht bewegen wollte.
Anna kicherte leise. "Vielleicht fehlt uns einfach technisches Verständnis."
"Uns fehlt vor allem eine dritte Hand!" erwiderte Mara, schob sich ihre Haare hinters Ohr und griff zum Telefon. Nach kurzem Zögern rief sie bei der Hotline an, deren Nummer in winzigen Buchstaben auf der Anleitung stand.
"Ja, hallo... wir bauen gerade Ihr Babybett auf... und... also... wir haben ein emotionales Problem mit Teil C3."
Anna musste lachen. Richtig lachen. Zum ersten Mal seit Tagen so, dass es ihr die Tränen in die Augen trieb.
Als auch das nicht half, überredete Mara kurzerhand den Nachbarn von gegenüber. Ein ruhiger, älterer Mann, der nach wenigen Minuten das Bett zusammensetzte, als hätte er nie etwas anderes getan.
Anna stand daneben, die Arme leicht um ihren Bauch gelegt, und lächelte. Es war ein gutes Bild. Ein gutes Gefühl.
Später begleitete Mara Anna immer öfter zu ihren Vorsorgeterminen. Sie saß neben ihr im Wartezimmer, blätterte in alten Zeitschriften und hielt ihre Tasche, wenn Anna zur Untersuchung gerufen wurde.
Und dann dieser Moment.
Der graue Monitor. Das leise Flackern von Leben. Dieser kleine Mensch, kaum mehr als ein Schatten, aber doch schon unverwechselbar da.
Mara hatte ihn angesehen. Lange. Und etwas in ihrem Gesicht war weich geworden. Still. Fast andächtig.
"Er sieht aus, als würde er schon jetzt alles beobachten" hatte sie leise gesagt.
Anna hatte nur genickt.
Liam.
2
Es gab keinen bestimmten Moment, keinen plötzlichen Knall. Kein Aufschrei. Kein Fall. Und doch war es genau dieser Tag, dieser Augenblick, der alles veränderte.
Der Moment, der ihr Leben in ein Davor und ein Danach teilte.
Es begann wie immer. Ein Termin beim Frauenarzt. Routine. Ein weiterer kleiner Meilenstein in dieser Schwangerschaft, die sich fast schon leicht angefühlt hatte.
Anna lag auf der Liege. Das Gel auf ihrer Haut war kalt. Der Raum still.
Der Arzt fuhr mit dem Ultraschallkopf über ihren Bauch. Hin und her. Immer wieder. Viel zu lange. Länger als sonst. Länger, als es gut war.
Seine Stirn legte sich in Falten. Die Augen schmal, konzentriert, suchend. Und Anna wusste es. Noch bevor er etwas sagte, wusste sie es. Sie spürte, wie ihr Magen zu Eis wurde, noch während ihr Herz zu rasen begann.
Er sprach ruhig. Führte Worte aus, die fielen wie Steine. Worte, die nicht laut waren, aber zu schwer, um sie je wieder zu vergessen. Er sprach von dem, was er nicht mehr sah. Von dem, was fehlte.
Kein Herzschlag mehr.
Danach war alles nur noch in Trance.
Bilder ohne Farbe. Geräusche, die nicht mehr richtig zu ihr durchdrangen. Bewegungen, die ihr fremd vorkamen, als gehörten sie zu jemand anderem.
Zurück in der Gegenwart.
Anna saß noch immer auf dem Bett. Noch immer im Mantel. Noch immer aufrecht, reglos, als hätte sie vergessen, dass sie sich eigentlich ausziehen könnte. Oder müsste.
Mara kam leise ins Zimmer. In den Händen zwei Tassen Tee. Sie stellte eine auf Annas Nachtschrank. Blieb dann einen Moment stehen, bevor sie sich zu ihr aufs Bett setzte.
Keine schnellen Worte. Keine Fragen. Nur Gegenwart.
"Ruf mich an, ja? Wenn du irgendwas brauchst. Wenn ich kommen soll. Oder einfach nur... wenn du nicht allein sein willst."
Ihre Stimme war sanft. Fester als Annas eigene Gedanken.
Anna nickte kaum sichtbar.
Mara legte noch einmal ganz kurz ihre Hand auf Annas Arm. Und dann stand sie auf. Ging zur Tür. Drehte sich noch einmal um. Ein letzter, stiller Blick.
Dann war sie fort.
Und Anna blieb zurück.
Allein.
Anna wusste nicht, wie lange sie dort gesessen hatte.
Es hätte eine Stunde sein können. Oder zwei. Vielleicht mehr. Zeit war bedeutungslos geworden. Nur Stille blieb. Und Dunkelheit.
Als sie sich endlich regte, war es bereits Nacht. Das kleine Schlafzimmer lag in tiefem Schatten. Nur das blasse Licht der Straßenlaterne fiel schwach durch den Vorhang. Sie konnte kaum noch etwas sehen.
Sie stand auf. Nicht, weil sie darüber nachgedacht hätte. Nicht, weil es einen Plan gab. Ihr Körper bewegte sich, weil irgendetwas in ihr übrig geblieben war, das sie zwang, zu funktionieren.
Mechanisch streifte sie den Mantel ab. Er fiel lautlos auf den Stuhl. Kälte kroch auf ihrer Haut entlang, und erst jetzt spürte sie, dass sie fröstelte.
Sie zog die restliche Kleidung aus. Langsam. Ohne Hast. Einfach, weil es so war.
Dann ging sie ins Badezimmer. Schloss die Tür nicht hinter sich. Es war egal.
Sie stieg unter die Dusche. Drehte das Wasser auf. Heiß. So heiß, wie sie es aushalten konnte. Und dann stand sie einfach da.
Regungslos.
Das Wasser lief über sie hinweg. Über Haut, über Haare, über Schultern, die sich nicht mehr aufrichteten. Als würde es sie reinigen. Als könnte es irgendetwas davon abspülen.
Die Trauer. Die Bilder. Die Gedanken an Liam.
Aber das Wasser konnte es nicht.
Anna stand so lange, bis das heiße Wasser nachließ. Bis es nur noch lau war. Dann kalt. Erst da bewegte sie sich. Erst da griff sie nach dem Handtuch, trocknete sich grob ab, ohne wirklich zu merken, was sie tat.
Sie hüllte sich in ihren Bademantel. Weich. Schwer vom Wasser auf der Haut.
Und dann ging sie zurück ins Schlafzimmer. Setzte sich wieder auf das Bett.
Dort, wo alles begonnen hatte. Und alles aufgehört hatte.
Anna saß auf dem Bett.
Immer noch.
Die Dunkelheit lag um sie wie eine zweite Haut. Ihre Haare waren noch feucht, der Bademantel schwer auf ihren Schultern. Aber sie spürte es kaum.
Immer wieder tauchten Bilder auf. Nicht geordnet. Nicht klar. Nur Bruchstücke, die kamen und gingen, wann sie wollten.
Der Arzt. Sein Gesicht. Die Stirn in Falten. Die ruhige Stimme, die viel zu viel sagte und doch nicht ankam.
Sie hatte kaum wahrgenommen, was er ihr wirklich sagte. Nur einzelne Worte waren hängen geblieben. Worte, die nicht zu ihr gehörten, nicht zu Liam.
"Keine reguläre Abtreibung mehr möglich..."
"Zu weit fortgeschritten..."
"Kein Einschlafen und Aufwachen und alles ist vorbei..."
Es sollte eine Einleitung geben. So schnell wie möglich. Eine Geburt. Ein Kind, das nicht mehr lebte. Und trotzdem geboren werden musste.
Anna wusste nicht mehr, wie sie damals nach Hause gekommen war. Oder wer sie gefahren hatte. Vielleicht Mara. Vielleicht war sie auch einfach gelaufen. Alles verschwamm.
Aber sie erinnerte sich an Liam.
Wie sie ihn im Arm gehalten hatte. Eingewickelt in ein weiches Tuch, viel zu klein für alles, was auf ihr lastete. Wie sie da lag, stundenlang, in diesem Krankenhausbett, mit ihm auf dem Arm.
Sein Gesicht. So friedlich. So vollkommen.
Sie hatte ihn angeschaut, bis ihre Augen brannten. Hatte seine winzigen Finger betrachtet. Seine Nase. Seine geschlossenen Lider.
Alles war still gewesen. Kein Weinen. Kein Laut. Nur dieses Gewicht in ihren Armen, das sich so falsch und so richtig zugleich angefühlt hatte.
Anna schloss die Augen.
Das Bild blieb trotzdem.
Damals, im Krankenhaus, hatte Anna alles um sich ausgeblendet.
Es war, als wäre um sie herum eine unsichtbare Wand gewachsen. Dick genug, dass keine Stimme hindurch kam. Kein Licht. Kein Leben.
Sie saß in diesem Bett, Liam in ihren Armen, und alles andere verschwamm.
Sie bemerkte nicht, wenn jemand das Zimmer betrat. Nicht das gedämpfte Klacken von Schuhen auf dem Boden. Nicht das leise Klirren von Instrumenten. Nicht die ruhigen, vorsichtigen Stimmen der Schwestern und Ärzte, die kamen und gingen.
Sie spürte nur ihn. Dieses viel zu leichte Gewicht in ihren Armen. Diese winzigen Hände, die nie greifen würden. Diese Stille, die schwerer war als jedes Geräusch.
Immer wieder war jemand gekommen. Hatte sich ihr genähert. Ganz behutsam. Ganz respektvoll.
"Miss Evans... es wäre vielleicht Zeit..."
"Wir könnten ihn langsam..."
Aber Anna hatte nicht reagiert. Kein Wort. Kein Nicken. Ihr Blick wich nicht von Liam. Nicht für einen Herzschlag.
Er war alles, was noch zählte.
Erst als eine weitere Schwester sich leise neben sie setzte, ihre Bewegung fast lautlos, hatte sich etwas verändert. Sie legte vorsichtig eine Hand unter das kleine, in Tücher gewickelte Wesen. Keine Hast. Keine Eile. Nur eine unendliche Ruhe in ihren Bewegungen.
Anna spürte, wie Liam langsam aus ihren Armen gehoben wurde. Mit Bedacht. Mit Respekt. Fast so, als wäre er noch da, ganz lebendig.
Erst da ließ Anna los.
Erst da fielen ihre Arme leer in ihren Schoß. Und sie sank langsam zurück in das Krankenhausbett. In die Kissen. In die Erschöpfung.
Und dann, zum ersten Mal seit der Nachricht, konnte sie weinen.
Nicht laut. Nicht wild. Sondern langsam. Leise. Tränen, die kamen, weil es nichts anderes mehr gab, was noch bleiben konnte.
Die Tage zwischen der Geburt und der Beisetzung waren ein Nebel.
Anna bewegte sich hindurch wie durch Wasser. Schwerfällig, langsam, losgelöst von allem, was um sie herum geschah. Sie sprach kaum. Antworten kamen, wenn überhaupt, nur in kurzen Blicken oder einem kaum wahrnehmbaren Nicken.
Mara war da.
Immer.
Sie übernahm alles, was Anna nicht konnte. Sie telefonierte. Organisierte. Fragte nach Terminen. Traf Entscheidungen, weil Anna es nicht mehr schaffte. Weil Anna in diesem Dazwischen lebte, irgendwo zwischen Schmerz und Leere.
Irgendwann, in diesem verschwommenen Verlauf von Tagen, war wohl auch James da gewesen. Anna erinnerte sich nicht mehr genau, wann. Vielleicht war es ein Vormittag gewesen. Vielleicht spät am Abend. Aber plötzlich war er da gestanden, in der Tür ihres Wohnzimmers. Blass. Abgemagert. Die Schultern eingefallen, als trüge er eine Last, die ihn selbst überforderte.
Er war ihr nicht zu nahe gekommen. Vielleicht wusste er, dass er es nicht durfte. Vielleicht auch, dass er es nicht konnte.
Aber sein Blick hatte sie gefunden. Lange. Still. Und in ihm lag derselbe Schmerz. Derselbe Verlust. Dieselbe Leere.
Langsam war er auf sie zugegangen, hatte eine Bewegung gemacht, die so aussah, als wolle er sie in den Arm nehmen. Als wolle er ihr irgendetwas geben, das vielleicht auch ihn selbst retten konnte.
Doch Anna hatte ihn zurückgestoßen. Nicht grob. Aber klar. Instinktiv. Weil es zu viel war. Weil es zu spät war.
James hatte sie angesehen. Lange. Fast hilflos. Und dann war er gegangen.
Zur Beisetzung war er nicht gekommen.
Anna hatte es kaum bemerkt. Es war Mara gewesen, die alles für sie regelte. Die mit James gesprochen hatte. Die ihn gefragt hatte, ob es etwas gab, das er sich wünschte. Ob sie seine Vorstellungen berücksichtigen sollte.
Aber James hatte abgelehnt. Still. Zurückhaltend. Er hatte sich entzogen, wie er es immer getan hatte, wenn es zu schwer wurde. Wenn es zu wehtat.
Und Anna war geblieben.
Mit ihrer Trauer. Mit der Leere. Und mit Mara, die ihr ohne Worte zur Seite stand.
Am Morgen nach der Beisetzung hatte Anna zum ersten Mal seit Tagen einen klaren Moment.
Nicht lang. Nicht stark. Aber deutlich genug, dass es ihr auffiel.
Sie saß noch immer auf dem Bett. Immer noch in diesem Bademantel, das Haar wirr, die Haut fahl. Und sie fragte sich für einen kurzen, fast irrealen Augenblick, ob sie wirklich die ganze Nacht so hier gesessen hatte.
Es war gut möglich.
Langsam stand sie auf. Nicht weil sie es wollte. Mehr aus einem leisen inneren Druck, aus etwas, das sich fast wie Rest-Instinkt anfühlte.
Sie ging in die Küche. Der Raum wirkte fremd. Ordentlich. Fast zu normal. So, als gehörte er zu einem anderen Leben.
Anna stellte Wasser für Tee auf. Sie schmierte sich ein Brot. Mechanisch. Es war keine bewusste Entscheidung. Es waren Bewegungen, die ihr Körper noch kannte, während ihr Kopf irgendwo weit entfernt war.
Mit der Tasse in der einen Hand und dem Teller in der anderen setzte sie sich an den kleinen Küchentisch. Ihr Blick glitt hinaus. Zum Fenster. In den kleinen Garten, der still dalag. Verlassener als sonst.
Sie nahm einen Bissen vom Brot. Kaute. Spürte, wie sich ihr Hals beim Schlucken wehrte. Beim zweiten Bissen legte sie das Brot zur Seite. Es ging nicht.
Anna starrte hinaus.
Wie sollte es weitergehen?
Diese Frage lag schwer zwischen ihr und dem vollen Teller. Keine Antwort kam. Nur diese große, unbewegliche Leere, die sich angefühlt hatte, als wäre sie das Einzige, was noch übrig war.
Und doch wusste sie, irgendwie, irgendwann musste etwas kommen. Ein erster Schritt. Ein Gedanke. Ein Atemzug, der mehr war als nur das Überleben.
Anna hatte sich frei genommen.
Ihre Chefin aus dem Blumenladen hatte kaum gezögert, als Anna ihr von allem erzählt hatte. Es war kein langes Gespräch gewesen. Kein Erklären müssen. Nur ein leises Verständnis in den Augen dieser Frau, die sonst so klar, so praktisch war.
"Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, Anna."
Dann hatte sie Anna in den Arm genommen. Kurz. Nicht aufdringlich. Aber mit echtem Gefühl. Und es war fast schlimmer gewesen als alles andere. Dieses Verständnis, das Anna so schwer aushielt.
Aber Anna kam trotzdem jeden Tag in den Laden. Nicht, um zu arbeiten. Sondern um Blumen zu kaufen.
Immer zur gleichen Uhrzeit. Immer eine weiße Rose. Es war ihre kleine Routine geworden. Ihr Halt.
Mit der Rose in der Hand ging sie jeden Tag denselben Weg. Immer gleich. Immer still. Bis zum Friedhof. Bis zu Liams Grab.
Sie steckte die frische Rose in die Vase. Tauschte die vertrockneten Blätter aus. Manchmal wischte sie über den kleinen Stein, über das Holzschild, als könnte sie so die Zeit anhalten.
Dann sprach sie mit Liam.
Nicht über ihre Trauer. Nicht über den Schmerz. Das war nicht das, was sie ihm sagen wollte.
Sie erzählte ihm von den Nachrichten. Von einem seltsamen Artikel in der Zeitung. Von der Nachbarin, die neuerdings ihren Hund in einem Kinderwagen spazieren fuhr. Von irgendetwas, das banal genug war, um es laut auszusprechen.
Ihr Alltag hing an diesen Momenten. Sie wusste es.
Der Heimweg aber war der schwerste Teil.
Denn er führte immer an diesem Spielplatz vorbei. Ein unscheinbarer Ort. Ein Stück Wiese. Eine Schaukel. Ein kleiner Sandkasten.
Manchmal waren dort Mütter oder Väter. Ihre Kinder lachten. Tobten. Die Stimmen trugen weit.
Dann blieb Anna kurz stehen. Ganz kurz. Ein Atemzug lang.
Und dann ging sie weiter. Schneller. Fast fluchtartig. Nicht weinend. Nie weinend.
Sie funktionierte.
Tag für Tag. Schritt für Schritt. Immer weiter.
Mara kam. Jeden Tag.
Nicht, weil es einen Plan gab. Nicht, weil sie etwas retten wollte. Sondern einfach, weil sie da war. Weil Anna noch da war.
Oft brachte sie Kaffee mit oder ein paar Kekse. Manchmal auch nur sich selbst und ihre Stimme, die das Schweigen füllte, ohne es zu ersticken.
Sie erzählte von der Arbeit. Von der Boutique, in der sie stand, Tag für Tag, zwischen Kleidern und Schuhen und Frauen, die verzweifelt versuchten, jemand anderes zu sein.
"Ich schwör dir, Anna, heute hatte ich eine, die wollte ernsthaft in ein Kleid Größe 36, obwohl sie locker 44 hat. Und dann steht sie vor dem Spiegel, zieht den Bauch ein, hebt die Arme — als würde das helfen."
Anna saß auf dem Sofa. Die Tasse Tee zwischen den Händen. Sie hob kurz den Blick.
"Vielleicht wollte sie sich einfach selbst für einen Moment glauben machen, dass es passt."
Mara grinste schief. "Ja, vielleicht. Aber das Kleid dachte sich eindeutig was anderes."
Anna nickte langsam. "Du bist schlimm."
"Bin ich ehrlich. Schlimm ist ehrlich. Und ehrlich ist immerhin kein Verkaufstrick."
Eine kurze Pause entstand. Kein Schweigen, das drückte. Eher so etwas wie Luft holen.
"Und was hast du gemacht?" fragte Anna nach einer Weile.
Mara lehnte sich zurück. "Ich hab ihr ein Wickelkleid gebracht. Schwarz. Fließend. Macht schöne Taille. Sie hat's genommen. Und gelächelt. Weil sie sich plötzlich nicht mehr anpassen musste."
Anna lächelte schwach. "Dann bist du vielleicht doch nicht so schlimm."
Mara zuckte mit den Schultern. "Ach, Anna. Ich bin der Feind aller Diätpillen und Push-up-BHs. Aber im Grunde will ich doch nur, dass die Frauen sich einmal im Spiegel ansehen und denken: Geht doch."
Anna sah sie einen Moment an. Und dann kam dieser Hauch von etwas, das fast wie echtes Lächeln war.
"Geht doch" wiederholte sie leise.
Stück für Stück kämpfte sich Anna zurück in ihren Alltag.
Oder sie versuchte es zumindest.
Sie stand morgens wieder auf. Ging einkaufen. Schlenderte durch den kleinen Blumenladen, ohne dass ihre Schritte ganz so schwer waren wie noch vor Wochen. Manchmal sprach sie mit Mara — über Belangloses, über Alltägliches. Aber niemals über Liam.
Aber in ihr brodelte es.
Nicht laut. Nicht offensichtlich. Sondern leise. Wie etwas, das im Hintergrund wuchs, Tag für Tag, ohne dass man es wirklich bemerkte, bis es zu groß geworden war.
Diese Stimme.
Diese eine Stimme, die kam, wenn alles ruhig war. Nachts. Oder wenn sie allein auf dem Heimweg war. Wenn niemand da war, um sie abzulenken.
"Bist du sicher, dass du alles richtig gemacht hast?"
Es war kein richtiger Gedanke. Es war ein Flüstern. Ein Zweifel, der sich immer wieder in ihre Gedanken schob. Wie Wasser, das langsam durch einen Riss dringt.
"Vielleicht war es deine Schuld."
Sie hatte doch alles versucht. Alles bedacht. Jeden Schritt, jede Bewegung, jedes Essen, jedes Glas Wasser, jede Stunde Schlaf.
Und trotzdem war Liam nicht hier.
Die Stimme kannte keine Gnade. Sie kam immer dann, wenn Anna glaubte, einen Moment lang durchatmen zu können.
"Vielleicht hättest du es verhindern können."
Sie wusste, dass es nicht stimmte. Sie wusste es.
Aber Wissen und Fühlen waren zwei verschiedene Welten.
Und dieser Strudel zog sie tiefer. Langsam. Leise. Und doch unaufhaltsam.
Die Stimme wurde lauter.
Nicht mehr nur leises Flüstern. Nicht mehr nur ein Gedanke, der kam und ging. Sie nagte an Anna. Unaufhörlich. Immer da. Immer präsent. Wie eine dunkle Schicht, die sich über alles legte.
Anna versuchte zu fliehen.
Nicht wegzugehen. Nicht wirklich. Aber aus ihrem eigenen Kopf zu entkommen. Aus dem, was in ihr längst lauter geworden war als alles andere.
Sie schlief kaum noch. Drehte sich nachts von einer Seite auf die andere. Starrte die Decke an, bis die ersten Vögel draußen zu hören waren.
Wenn es zu schlimm wurde, stellte sie Musik an. Laut. Zu laut für dieses kleine Haus. Sie las Bücher, seitenweise, ohne am Ende zu wissen, was eigentlich darin stand. Alles nur, um der Stimme keinen Raum zu lassen.
Und irgendwann ging sie wieder arbeiten.
3
Es war kein richtiger Entschluss gewesen. Mehr ein Reflex. Etwas tun. Nicht stillstehen. Nicht zuhören müssen.
Ihre Chefin hatte sie angesehen. Länger als sonst. Und nichts gesagt zu dem, was ihr ins Gesicht geschrieben stand: die dunklen Ringe unter den Augen, die blasse Haut, der abwesende Blick.
"Komm, wie es dir gut tut, Anna. Kein Druck. Kein Muss."
Sie setzte Anna nicht gleich wieder voll ein. Keine langen Schichten. Kein Kundenkontakt, wenn es nicht ging. Raum zum Atmen. Raum zum Überleben.
Für den Moment reichte das Anna.
Einfach rauskommen. Nicht denken. Nicht fühlen. Nur für ein paar Stunden Teil von etwas sein, das sich normal anfühlte, auch wenn nichts mehr normal war.
Anna sprach wieder mit Kunden.
Nicht viel. Nicht leicht. Aber sie tat es.
Vor allem die Stammkunden spürten, wie vorsichtig alles geworden war. Sie sprachen nicht über das, was geschehen war. Kein Beileid, keine großen Worte. Nur ihre Blicke verhielten sich anders. Weicher vielleicht. Manchmal ein kurzer, stiller Händedruck über die Theke hinweg. Ein leises Verständnis, das keiner Sprache bedurfte.
Anna war dankbar dafür. Für diese Zurückhaltung, die ihr Raum ließ, ohne sie zu übergehen.
Sie band Blumensträuße. Für Geburtstage. Für Jubiläen. Für Abschiede, die nicht die ihren waren. Ihre Hände arbeiteten ruhig, fast automatisch. Stängel zurechtschneiden, Blumen anordnen, Bindfaden, ein letzter Blick.
Sie goss die Topfpflanzen im Verkaufsraum. Fuhr langsam mit dem Wasser zwischen den Blättern hindurch. Wischte Staub von Blättern. Richtete eine Vase, die schief stand.
Es waren kleine Handgriffe. Aber sie gaben ihr Halt.
Zwischendurch fegte sie den Boden. Das leise Schaben des Besens auf den Fliesen hatte etwas Beruhigendes. Es war Bewegung ohne Gedanken. Tun, ohne zu fühlen.
Für ein paar Stunden konnte sie vergessen.
Nicht wirklich. Nicht tief. Aber genug, um zu atmen. Um zu bestehen. Um wenigstens für diese kurzen Momente wieder sie selbst zu sein — oder wenigstens jemand, der ihr früher einmal ähnlich gewesen war.
Mara war froh.
Nicht im übermütigen, leichten Sinn. Sondern auf diese leise, vorsichtige Weise, wie man froh sein kann, wenn etwas für einen Moment weniger schwer aussieht als noch vor Wochen.
Sie sah, wie Anna sich zurückkämpfte.
Wie sie wieder Schritte tat, kleine, unsichere vielleicht, aber echte. Wie sie sich morgens anzog, das Haus verließ, zur Arbeit ging. Wie sie sprach. Kurze Sätze, manchmal nur ein genervtes Augenrollen über eine Bemerkung von Mara — aber es war Leben. Es war Annas Art von Lächeln, auch wenn ihre Augen oft noch zu müde dafür waren.
Mara wusste, dass nichts jemals wieder so werden würde wie früher. Das Leben hatte sich verändert. Endgültig. Aber es tat gut, ihre Freundin wieder unter Menschen zu sehen. Zu wissen, dass Anna wenigstens für diese Stunden im Blumenladen nicht nur allein in ihrem Schmerz saß.
Es tat gut, sie zu sehen, wie sie Sträuße band, Pflanzen goss, auf ihre stille, bedachte Art Ordnung in Dinge brachte, während in ihr selbst noch alles unaufgeräumt war.
Und vielleicht war das alles, was man in solchen Zeiten erwarten durfte.
Kein großer Schritt. Kein lauter Neuanfang.
Nur Bewegung. Schritt für Schritt. Zurück ins Leben.
Im Laden war es anders.
Nicht leichter. Nicht vergessen im eigentlichen Sinn. Aber Anna war dort gezwungen, auch an andere Dinge zu denken. Und manchmal reichte genau das schon.
Farben. Formen. Zusammenstellungen.
Passten die Blumen farblich zusammen? Wie groß oder klein sollte der Strauß werden? War noch genug Eukalyptus da? Müssten neue Rosen bestellt werden?
Es waren diese kleinen, praktischen Gedanken, die sich zwischen ihre großen Fragen schoben. Nicht laut. Nicht alles überdeckend. Aber genug, um ihre Gedanken für einen Moment zur Ruhe zu bringen.
Sie musste mit Kunden sprechen. Musste Details klären. "Lieber locker gebunden oder klassisch?" "Welche Farbe wünschen Sie sich?" "Wann sollen die Blumen abgeholt werden?"
Und in diesen Momenten war es fast so, als könnte sie atmen.
Nicht frei. Nicht tief. Aber ruhig genug, um für einen Augenblick einfach da zu sein, ohne dass ihr Kopf sie fortzog. Ohne dass die Stimme in ihr lauter war als alles andere.
Der Laden war ihr Anker geworden. Nicht, weil er ihren Schmerz verschwinden ließ. Sondern weil er ihn für ein paar Stunden in den Hintergrund drängte.
Es war Arbeit. Es war Alltag. Es war Leben.
Und manchmal war genau das mehr, als sie gedacht hatte, schaffen zu können.
Es war einer dieser Nachmittage, an denen der Himmel grau und schwer über Seattle hing, als Anna plötzlich seinetwegen ihr Handy in die Hand nahm.
James.
Sie wusste nicht genau, warum. Vielleicht, weil ihre Gedanken auf dem Heimweg so leer waren, dass nur noch Platz für ihn blieb. Vielleicht, weil sie seine Stimme hören wollte. Nur kurz. Ohne Zweck. Ohne Grund.
Das Freizeichen summte länger, als ihr lieb war.
Dann hob er ab.
"Anna?"
Überrascht. Vorsichtig.
Sie zog ihren Schal enger um den Hals, lief weiter die Straße entlang. "Hey... ja. Ich... wollte einfach mal hören, wie es dir geht."
Eine kurze Pause am anderen Ende. "Mir? Ja, ähm... gut soweit. Arbeit halt. Viel los."
"Hm." Anna trat über eine Pütze. "Wie immer eigentlich."
"Wie immer." James klang beinahe erleichtert, dass sie nicht mehr sagte. "Und bei dir? Der Laden?"
"Geht so. Ich bin wieder ein bisschen da. Teilzeit."
"Das ist... gut. Tut dir bestimmt gut, oder? Mal rauszukommen."
"Ja. Ist okay." Sie sah auf den Boden vor sich. "Und du? Noch im gleichen Büro?"
"Ja. Gleicher Schreibtisch, gleicher Kaffee, gleiche genervten Kollegen. Manche Dinge ändern sich eben nie."
Anna musste lächeln, aber es war ein fremdes Lächeln. "Und dein Chef? Immer noch zu laut am Telefon?"
James lachte leise. "Immer. Ich glaub, der überlegt mittlerweile, ob er nicht direkt in ein Megafon sprechen soll."
Es war Smalltalk. Leicht. Und doch seltsam schwer. Keiner von beiden sprach das aus, was zwischen ihnen lag. Niemand nannte Liam. Niemand fragte nach Gefühlen. Es war ein vorsichtiges Balancieren auf einem zu dünnen Seil.
"Schön, dass du angerufen hast, Anna" sagte James nach einer Weile leise.
"Danke, dass du ran gegangen bist“ antwortete sie. Und meinte es. Irgendwie.
Dann verabschiedeten sie sich.
Ein paar Sätze nur. Ein paar Minuten. Aber für diesen Weg nach Hause war es genug gewesen.
Zu Hause war alles anders.
Draußen funktionierte Anna. Irgendwie. Aber zwischen den Wänden ihres kleinen Hauses fiel sie oft wieder in diese Starre, gegen die sie machtlos war.
Es kam leise. Kam einfach über sie, ohne Ankunft, ohne Anzeichen. Sie stand dann manchmal stundenlang am kleinen Babybett, das noch immer im Schlafzimmer stand. Das Bett, das sie mit Mara und dem fremden Nachbarn aufgebaut hatte. Das Bett, das leer geblieben war.
Sie strich über die weiche Bettdecke, glättete Falten, die nicht da waren. Und stand einfach da.
Oder sie saß auf ihrem Bett. Lange. Den Teddy in den Händen, den sie damals gekauft hatte, viel zu früh vielleicht, aber sie hatte ihn einfach haben müssen. Ein kleiner, heller Bär mit weichem Fell. Und sie hielt ihn fest, wie jemand, der sich an irgendetwas erinnern wollte, das nicht fassbar war.
Immer wieder blitzte dieses Bild in ihr auf.
Liam.
Viel zu klein. Ruhig. Friedlich. Ein Gesicht, das sie nie vergessen würde und doch immer wieder neu zusammensetzen musste, weil die Erinnerung an die feinen Linien zu schnell verblasste.
Diese Bilder kamen, wann sie wollten. Manchmal mitten in der Nacht. Manchmal, wenn sie tagsüber einen Moment zu lang in Gedanken versank. Dann war alles wieder da. Das Krankenhaus. Das Gewicht in ihren Armen. Das Loslassen.
Und Anna blieb einfach sitzen.
Mit diesem Bild vor Augen und einem Teddy in den Händen, der viel zu weich war für eine Welt, in der ihr Kind nicht mehr war.
Trotz der Arbeit, die Anna stundenweise wieder aufgenommen hatte, hielt sie an ihrem Ritual fest.
Jeden Tag. Ohne Ausnahme.
Nur die Uhrzeit hatte sich geändert. Früher war es am Vormittag gewesen, jetzt war es nach Feierabend. Nach Stunden, in denen sie Blumen gebunden, Pflanzen gegossen und Menschen angelächelt hatte, obwohl ihr nicht danach war.
Aber der Weg blieb derselbe.
Jeden Tag nahm sie aus dem Laden eine weiße Rose mit. Ihre Chefin sagte nichts dazu. Es war stiller Konsens geworden. Anna bezahlte dafür. Immer. Es war ihr wichtig.
Dann ging sie zum Friedhof. Schritt für Schritt. Nicht zu schnell. Nicht zu langsam. Es war ihr Weg geworden.
Sie kam an. Setzte sich zu Liam. Wechselte die Rose aus, entfernte welke Blätter. Und dann blieb sie.
Sie sprach mit ihm. Von kleinen Dingen. Von den wenigen, belanglosen Beobachtungen aus dem Alltag. Von Mara. Vom Wetter. Von der alten Frau, die im Laden immer ihre Rosen auf den Millimeter genau nach Länge auswählte.
Und eines Tages hatte es geregnet.
Nicht ein leichter, leiser Regen. Sondern dieses typische, unaufhaltsame Seattle-Schütten. Grau. Schwer. Alles durchdringend.
Anna war trotzdem dort.
Sie hockte am Grab. Der Boden unter ihr war matschig, ihre Jacke durchnässt. Das Haar klebte an ihrem Gesicht, die Jeans war schwer vom Wasser.
Aber sie blieb.
Weil sie es brauchte. Weil es der einzige Ort war, an dem sie Liam noch nahe sein konnte. Weil das Nässe und Kälte nicht mehr wichtig waren, wenn alles in ihr ohnehin leer war.
Und so saß sie dort. Stumm. Nass bis auf die Knochen.
Aber ganz nah bei ihm.
Auf dem Nachhauseweg rechnete Anna.
Nicht laut. Nicht bewusst. Es geschah einfach, irgendwo in ihr, während der Regen gleichmäßig auf sie niederprasselte.
Sie wäre noch schwanger gewesen. Achter Monat. Kurz vor dem Ende. Kurz vor dem Anfang. Vielleicht hätte sie schon kaum noch schlafen können. Vielleicht hätte ihr Rücken geschmerzt, der Bauch war sicher groß gewesen. Oder vielleicht auch nicht. Manche Frauen trugen ihr Kind klein. Dezent. Fast unauffällig.
Sie stellte sich vor, wie sie wohl ausgesehen hätte.
Ob ihre Beine geschwollen gewesen wären. Ob ihre Füße nicht mehr in ihre alten Schuhe gepasst hätten. Vielleicht wäre Mara mit ihr losgezogen, um ihr weiche Ballerinas zu kaufen. Vielleicht hätte sie beim Arbeiten öfter die Beine hochlegen müssen, Tees getrunken gegen Wasser in den Beinen, gegen Übelkeit, gegen alles, was eben dazugehört.
Sie überlegte, ob sie träge gewesen wäre. Ob sie gelacht hätte, wenn Liam sich in ihrem Bauch bewegt. Ob sie überhaupt noch im Laden gearbeitet hätte oder längst zuhause geblieben wäre.
Die Bilder formten sich von selbst.
Und während der Regen ihr Gesicht traf, unaufhaltsam, kalt, merkte Anna, dass ihre Wangen heiß waren. Ihre Tränen brannten sich einen Weg durch das kalte Wasser.
Ein leiser, glühender Kontrast zur Kälte um sie herum.
Aber das Gute an Regen, dachte sie, war vielleicht genau das: Niemand sah, wenn man weinte.
Anna kämpfte.
Nicht sichtbar. Nicht laut. Nicht so, dass jemand wie Mara es hätte bemerken können. Sie gab sich Mühe. Mehr als sie eigentlich hatte. Mehr, als irgendjemand von ihr verlangen konnte.
Sie stand morgens auf. Langsam manchmal, aber sie stand auf. Machte Kaffee, weil es so war, weil es ein Ritual war, das ihr half, den Tag in Bewegung zu bringen. Ging arbeiten. Lief den vertrauten Weg in den Blumenladen, begrüßte ihre Chefin, wechselte Worte mit Mara, falls sie kurz vorbeikam. Sprach mit Kunden. Lächelte sogar manchmal. Nicht, weil sie wirklich Grund dazu hatte. Sondern weil es nötig war. Weil es sonst zu offensichtlich gewesen wäre, wie schwer alles war.
Und Anna war nicht bereit, sich so sichtbar verletzlich zu machen.
Mara sah es nicht. Vielleicht wollte sie es nicht sehen. Vielleicht war sie froh, dass Anna scheinbar zurechtkam. Dass der Alltag wieder Platz in ihrem Leben hatte. Dass die Gespräche über Blumen und Kunden und Regen die Oberhand gewonnen hatten.
Aber Anna wusste es besser.
Tief in sich wusste sie, dass es nur eine Fassade war. Dass der wahre Kampf in ihr tobte, wenn sie allein war. Wenn es still wurde. Wenn niemand mehr etwas von ihr wollte. Dann kamen die Gedanken. Dann kam die Stimme. Diese leise, nagende Stimme, die fragte, ob sie vielleicht doch etwas falsch gemacht hatte. Ob sie es nicht hätte verhindern müssen. Ob sie versagt hatte.
Und sie wusste auch, dass dieser Tag kommen würde.
Der Tag, der von Anfang an wie ein Schatten am Horizont stand.
Der errechnete Geburtstermin. Der Tag, an dem Liam hätte kommen sollen. An dem alles anders hätte werden sollen. An dem sie ihn in den Armen halten sollte, schwer und lebendig und vollkommen.
Anna dachte nicht oft an Daten. Nicht bewusst. Aber dieses eine stand in ihr, als hätte man es in ihre Haut geschrieben. Es war immer da. In jeder Woche, die verstrich. In jedem Blick auf den Kalender. In jedem Gedanken an all das, was nicht war.
Und sie wusste: Wenn dieser Tag kam, würde alles noch einmal anders schwer werden.
Noch stiller. Noch leerer. Noch wahrer.
Und tief in sich ahnte Anna, dass es ihr vielleicht alles abverlangen würde.
4
Er kam ohne große Aufregung.
Nicht laut. Nicht plötzlich. Kein Knall, kein Vorbeben. Anna sah ihn kommen, lange bevor er wirklich da war. Und dann war er einfach da. Ganz unspektakulär. Ganz leise.
Es war ein fast normaler Morgen.
Anna war früh aufgewacht. Nicht weil der Wecker klingelte, sondern weil ihr Körper sich längst daran gewöhnt hatte, wenig Schlaf zu brauchen. Oder nicht mehr schlafen zu können. Sie stand langsam auf. Keine Hast. Keine Eile. Bewegungen, die noch schwer waren vom Schlaf, der keiner gewesen war.
Sie machte Kaffee. Ganz automatisch. Dieselben Handgriffe wie jeden Morgen. Wasser, Pulver, Tasse. Der Geruch war warm. Vertraut. Fast tröstlich.
Dann machte sie sich fertig. Zog sich an. Schal, Jacke, Tasche. Trat auf die Straße, lief den Weg zur Arbeit. Dieselben Häuser, derselbe Himmel, derselbe Rhythmus.
Der Laden war ruhig an diesem Vormittag. Kein großer Andrang. Nur das leise Summen der Kühlschränke, das Rascheln von Papier, das Klirren der Schere an der Theke.
Anna band Sträuße. Sprach mit Kunden. Gab Wechselgeld heraus. Ein Tag wie viele andere.
Bis sie kam.
Eine Frau. Nicht auffällig. Nicht laut. Eine von vielen. Aber sie trug ein Baby auf dem Arm.
Anna sah sie schon, als die Tür sich öffnete. Ein kurzer Blick. Reflexhaft. Und dann dieses Ziehen tief in ihr, fast mechanisch, wie ein Muskel, der sich an vergangene Schmerzen erinnert.
Sie zwang sich, nicht hinzuschauen. Nicht richtig. Nicht länger, als es unbedingt nötig war. Aber ihr Blick glitt trotzdem immer wieder hinüber.
Und mit jedem Schritt, den die Frau durch den Laden ging, spürte Anna, wie etwas in ihr aufstieg. Langsam. Lautlos. Und doch so gewaltig, dass ihr beinahe schwindlig wurde.
Es war Trauer. Roh. Unvermittelt. Und eine Angst, die sich kalt in ihre Glieder schob. Nicht vor der Frau. Nicht vor dem Baby. Sondern vor diesem Gefühl, das stärker war als ihr Wille, es zu verdrängen.
Ihr Hals schnürte sich zu. Ihr Brustkorb wurde eng. Sie zwang ihre Hände zur Ruhe, konzentrierte sich auf die Bewegungen. Blumen. Stiele. Papier.
Aber innerlich tobte es.
Da war dieser Gedanke: So hätte es aussehen können. So hätte sie selbst einmal durch diesen Laden gehen sollen. Mit Liam. Warm und schwer und lebendig in ihren Armen.
Stattdessen stand sie hier. Starr vor Schmerz. Und wusste kaum, wie lange sie diesen Moment noch aushalten konnte.
Die Frau ging langsam weiter. Ganz selbstverständlich. Ganz friedlich.
Und Anna blieb zurück. Mit dieser stummen, aufsteigenden Trauer, die sich fest in ihre Kehle gelegt hatte. Und einer Angst, die sie fröstelnd an Ort und Stelle hielt.
Die Frau mit dem Baby stand plötzlich vor ihr.
Anna hatte es nicht einmal richtig bemerkt. Erst als die Stimme der Frau sie erreichte, leise, freundlich, aber bestimmt, drang die Wirklichkeit wieder zu ihr durch.
"Entschuldigung... ?"
Anna blinzelte. Ihr Blick sprang hoch, weg von dem Muster der Holztheke, auf das sie unbewusst gestarrt hatte.
"Entschuldigung... ich wollte fragen, ob Sie vielleicht..."
Die Stimme der Frau wurde leicht lauter. Nicht ungeduldig. Nur bemüht, sie zu erreichen.
Anna zog scharf die Luft ein, erschrak fast über ihre eigene Abwesenheit. "Oh — oh Gott, es tut mir leid... ich war... ich hab Sie gar nicht..."
Sie räusperte sich. Fühlte, wie ihr Gesicht warm wurde. Verlegen. Entblößt.
Die Frau lächelte leicht, nachsichtig. "Kein Problem. Ich wollte nur fragen, ob Sie vielleicht einen kleinen, schlichten Strauß hätten? Nichts Großes. Einfach ein paar Blumen für meine Nachbarin. Sie hat mir gestern geholfen, als ich mit dem Kleinen hier ganz schön überfordert war."
Anna nickte schnell. Vielleicht zu schnell. "Ja... ja, klar. Natürlich. Was... was mag sie denn? Also Farben oder... oder irgendwas Bestimmtes?"
Die Frau wiegte den Kopf, sah liebevoll auf das Baby in ihrem Arm. "Ich glaube, sie mag alles, was nicht zu aufdringlich ist. Eher zart. Vielleicht etwas Frühlingshaftes."
Anna zwang sich zu einem Lächeln. "Okay... ich... ich stell Ihnen gern was zusammen. Geben Sie mir... einen kleinen Moment."
"Natürlich. Kein Stress."
Während Anna sich abwandte, Hände an den Stielen, am Papier, war da dieses eigenartige Gefühl in ihr. Eine Mischung aus Erleichterung, wieder zu funktionieren. Und diesem dumpfen Ziehen, das ihr fast den Atem nahm.
Aber sie arbeitete. Schritt für Schritt. Und vielleicht war das alles, was sie in diesem Moment tun konnte.
Es kam aus dem Nichts.
Ein Klingeln. Dumpf. Fast unauffällig. Direkt unter dem Baby. In der Jackentasche der Frau.
Ein normales Handygeräusch. Alltag. Aber für Anna war es der Moment, der alles anhielt.
Die Frau lächelte kurz verlegen. "Oh, entschuldigen Sie... das ist mein Mann. Einen Moment nur."
Dann sah sie Anna an. Geradeheraus. Freundlich. Selbstverständlich.
"Könnten Sie ihn ganz kurz halten? Nur für einen Moment. Ich krieg sonst das Handy nicht aus der Tasche."
Und noch bevor Anna etwas sagen konnte, spürte sie, wie ihr das kleine Bündel entgegengestreckt wurde. Noch warm von der Nähe der Mutter. Noch duftend nach dieser eigenen, leisen Welt aus Milch und Haut und Leben.
Anna hob automatisch die Arme. Reflex. Instinkt. Und dann war er da.
Der Moment.
Das Baby lag in ihren Armen. Ganz leicht. Ganz echt.
Und alles in ihr zerbrach.
Sie starrte es an. Sah die kleinen Hände, das leise Zucken unter dem Tuch. Diese feinen Gesichtszüge, die so unglaublich verletzlich wirkten.
Ihre Gedanken überschlugen sich.
Liam. Es hätte Liam sein sollen. Ihr Kind. Ihr Sohn. Nicht dieses fremde Baby. Nicht dieses Leben, das nicht zu ihr gehörte.
Ihre Finger zitterten. Erst kaum. Dann mehr. So sehr, dass sie es fast nicht mehr verstecken konnte.
Es schnürte ihr die Kehle zu. Ihre Beine wurden weich. Der Boden unter ihr schien sich zu verschieben.
Sie wusste nicht, ob sie weinen wollte oder schreien. Oder einfach nur verschwinden.
Aber sie stand da.
Stumm. Starr. Und hielt dieses fremde Leben in ihren Armen, während in ihr alles brach, was sie mühsam zusammengehalten hatte.
Als Anna aufsah, stand ihre Chefin plötzlich neben ihr.
Ganz still. Ganz nah. Sie wusste nicht, wie lange sie schon dort war. Aber sie war da. Und sie sah Anna an. Lange. Still. In ihren Augen spiegelte sich alles, was Anna selbst kaum noch fassen konnte.
Tränen. So viele Tränen, dass sie den Blick kaum halten konnte.
Ohne ein Wort drückte Anna ihr das Baby in die Arme. Mechanisch. Fast grob. Aber nicht gegen das Kind. Gegen sich selbst. Gegen alles, was zu viel war.
Dann drehte sie sich um und rannte.
Rannte einfach los.
Aus dem Laden. Raus auf die Straße. Blindlings. Ohne zu sehen, wohin. Autos hupten. Stimmen riefen etwas. Aber sie hörte nichts mehr. Nur das eigene Blut in den Ohren. Den eigenen Atem, der viel zu schnell ging.
Sie wusste nicht, ob sie je in ihrem Leben so schnell gerannt war.
Nach Hause. Irgendwie. Der Schlüssel zitternd in der Hand. Das Schloss, das sich nicht gleich fügen wollte. Und dann war sie drinnen.
Sie schloss die Tür. Verriegelte sie. Zog die Vorhänge zu, so fest, als könne sie damit auch alles andere aussperren. Die Welt. Die Bilder. Die Stimme in ihr.
Und dann brach sie.
Sie sank mitten im Flur zu Boden. Die Beine wollten nicht mehr. Der Körper war leer und schwer zugleich. Und endlich kamen die Tränen.
Tränen, wie sie schon lange nicht mehr geweint hatte. Laut. Haltlos. Schüttelnd.
Sie weinte, bis nichts mehr kam.
Nur Stille. Und Erschöpfung.
Anna hatte wieder stundenlang geweint.
Nicht gleich. Nicht auf einen Schlag. Es war dieses lange, haltlose, erschöpfte Sitzen geblieben. Am Boden. Mit dem Rücken an der Tür. Die Arme schwer auf den Knien. Der Kopf leer.
Irgendwann hatte ihr Körper nachgegeben. Sie war zur Seite geglitten. Langsam. Ohne Widerstand. Hatte sich auf den kalten Boden sinken lassen. Und lag jetzt dort.
Im Flur. Zusammengekauert. In sich selbst zurückgezogen. Embryohaltung.
Und fühlte nichts mehr.
Keine Wut. Keine Angst. Keine Scham. Nur diese bleierne Leere, die schwerer war als alles andere.
Draußen hörte sie es kaum, erst ganz fern, dann lauter.
Klopfen. Klingeln. Wieder und wieder.
Eine Stimme. Bekannt. Dringlich.
"Anna! Mach bitte auf!"
Es war Mara.
Ihre Stimme klang besorgt, fast panisch. "Anna, bitte! Ich weiß, dass du da bist. Deine Chefin hat mich angerufen. Sie hat mir erzählt, was passiert ist."
Das Klopfen wurde energischer. Nicht wütend. Nur verzweifelt.
"Anna, bitte lass mich nicht draußen stehen."
Aber Anna konnte nicht. Noch nicht. Vielleicht gleich. Vielleicht irgendwann. Aber in diesem Moment lag sie einfach nur da.
Ganz klein. Ganz still.
Und wartete, dass irgendetwas in ihr wieder bereit war, sich zu bewegen.
Anna bewegte sich nicht.
Nicht sofort. Nicht sichtbar. Nur ihre Lippen formten leise Worte, kaum mehr als ein Flüstern. Ein abgerissenes, gebrochenes Flüstern, das niemand hören konnte.
"Geh weg..."
Sie wiederholte es. Immer wieder. Immer gleich. Monoton. Wie ein Mantra, das sie selbst kaum bewusst wahrnahm.
"Geh weg... geh einfach weg..."
Aber Mara draußen hörte es nicht. Konnte es nicht hören. Sie redete weiter. Klopfte. Flehte. Ihre Stimme drang immer wieder durch den schmalen Spalt unter der Tür. Warm. Hartnäckig. Zu nah.
Und irgendwann kippte etwas in Anna.
Aus Leere wurde Wut. Plötzlich. Roh. Brennend. Ohne Halt.
Sie richtete sich auf. Langsam erst. Dann schneller. Wankend, aber fest entschlossen.
Sie griff nach irgendetwas auf der kleinen Kommode im Flur. Ein Kerzenhalter vielleicht. Oder eine Schale. Es war egal. Es war greifbar. Es war schwer genug.
Und dann schleuderte sie es gegen die Tür.
Mit aller Kraft. Mit aller Wut. Mit aller Verzweiflung.
Das dumpfe Aufprallen, das Splittern des Materials. Und ihre Stimme. Lauter als alles, was aus ihr seit Wochen gekommen war.
"Hau ab! MARA! LASS MICH ENDLICH IN RUHE! GEH EINFACH!"
Es hallte nach. In ihr. Im Flur. In diesem viel zu kleinen Raum.
Und dann war da Stille.
Nur ihr Atem. Schnell. Flach. Brüchig.
Und draußen Mara. Still geworden. Getroffen. Vielleicht verletzt. Aber vor allem: schweigend.
Es war, als wäre etwas in Anna gerissen.
Kein leiser Schmerz. Keine stille Trauer. Sondern Wut. Roh. Laut. Ungestüm. Längst zu lange eingesperrt.
Sie stand da. Zitternd. Atemlos. Und dann brach es aus ihr heraus.
Sie lief durch ihr kleines Haus. Ohne Ziel. Ohne Richtung. Alles in ihr brannte. Alles wollte raus.
Sie griff nach allem, was greifbar war. Ein Kissen vom Sofa, das durch das Wohnzimmer flog. Ein Stapel Zeitungen, den sie vom Tisch riss. Eine Vase, die an der Wand zerschellte. Das dumpfe, harte Klirren war fast befreiend.
Sie schob Stühle zur Seite, trat gegen eine Türe, schlug mit der flachen Hand auf die Arbeitsplatte der Küche. Immer und immer wieder. Sie schrie. Kein Wort, kein Satz. Nur diesen tiefen, rauen Laut, der mehr aus ihr herausriss, als sie wusste, in sich zu haben.
Alles musste raus. Alles, was sie nicht mehr halten konnte.
Und als nichts mehr zum Werfen blieb, als ihre Arme schwer wurden und ihr Körper zitterte, blieb sie stehen. In der Küche. Atmete schwer. Leer. Erschöpft.
Sie sank zu Boden. Langsam. Ohne Kraft. Saß mitten in den Scherben und der Unordnung, die sie selbst geschaffen hatte. Und dann kamen wieder die Tränen.
Sie weinte. Heiser. Haltlos. Ohne zu wissen, wann es aufhören würde. Weinte, bis nichts mehr kam. Bis selbst das Schluchzen sie verlassen hatte.
Irgendwann sackte sie zur Seite. Ganz langsam. Ganz leise.
Und blieb liegen. Auf dem kalten Küchenboden. Mit geschlossenen Augen. Mit leerem Kopf. Und einem Körper, der nicht mehr konnte.
Und sie schlief ein.
Einfach so. Dort, wo alles laut gewesen war. Dort, wo jetzt nur noch Stille blieb.
Die Tage danach waren zäh. Schwer wie kalter Nebel, der sich nicht vertreiben ließ.
Jeden Tag kam Mara.
Immer zur gleichen Zeit. Immer dieselbe Stimme an der Tür. Ruhig. Leise. Geduldig.
"Anna? Ich bin's."
Doch Anna öffnete nicht.
Sie saß oft einfach nur da. Auf dem Boden. Auf dem Sofa. Im Flur. In der Küche. Dort, wo der Abend sie zurückgelassen hatte. Ihre Arme um die Knie geschlungen, den Blick leer. Nicht einmal die Kraft, aufzustehen. Nicht einmal den Wunsch.
Ihre Gefühle wechselten sich ab wie das Wetter in diesen Tagen.
Trauer. So tief, dass ihr Brustkorb schmerzte.
Wut. Gegen alles. Gegen Mara. Gegen sich selbst. Gegen ihren Körper. Gegen James. Gegen die Welt, die einfach weiterging.
Selbstzweifel. Hätte sie etwas anders machen müssen? War es ihre Schuld gewesen?
Verzweiflung. Dieses bodenlose Gefühl, niemals mehr herauszufinden aus all dem.
Und dazwischen, viel zu selten, fast schamhaft: Hoffnung.
Ein kleines Flackern, das sofort wieder erlosch, sobald es zu spürbar wurde.
Mara blieb nie lange vor der Tür. Manchmal sprach sie. Manchmal stellte sie einfach nur eine kleine Tüte mit etwas zu essen vor den Eingang. Manchmal legte sie eine Karte hin. Oder einen Tee. Oder einfach nur Blumen.
Und Anna wusste es. Wusste, dass sie da war.
Aber noch konnte sie es nicht zulassen.
Noch war sie gefangen in diesem dichten Nebel aus allem, was zu viel war.
Irgendwann hatte Anna die Tür geöffnet.
Es war kein bewusster Entschluss gewesen. Kein Moment von Klarheit. Mehr ein Erschöpfungszustand. Ein Augenblick, in dem die Kraft zu widerstehen geringer war als die Kraft, den Schlüssel im Schloss umzudrehen.
Mara trat ein, ohne zu zögern.
Sie sah Anna an — blass, ausgezehrt, müde — und brauchte keinen weiteren Moment. Sie nahm sie sofort in den Arm. Einfach so. Fest. Haltend. Ohne Worte für den Anfang.