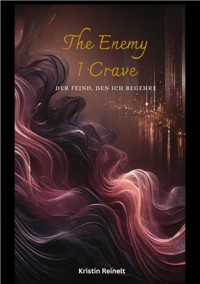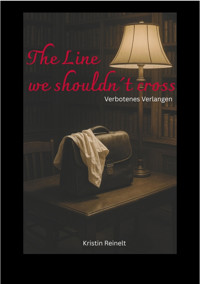6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manche Grenzen zieht man aus Vernunft. Andere, weil man weiß, wie tief man sonst fällt. Als Julian Corven neu an die Universität kommt, ist nichts mehr wie zuvor. Jung. Klug. Unverschämt gutaussehend. Der neue Literaturdozent verdreht allen den Kopf — auch Norah Winter. Doch während andere nur schwärmen, sieht Er ausgerechnet Sie. Leise. Zurückhaltend. Anders. Was niemals sein dürfte, wird zu etwas, das keiner von beiden stoppen kann: Nähe. Verlangen. Liebe. Bis ein Missverständnis alles zerstört. Norah verschwindet. Ohne ein Wort. Ohne eine Spur. Sie will ihn vergessen. Muss ihn vergessen. Doch ein Jahr später trifft sie ihn wieder — auf einer Preisverleihung. Unerwartet. Unvorbereitet. Und das Gefühl von damals brennt sich augenblicklich zurück. Kann man jemanden wirklich vergessen, den man nie losgelassen hat? Er jedenfalls nicht. Nie. Und Sie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kristin Reinelt
The Line we shouldn´t cross
Verbotenes Verlangen
Texte: © 2025 Copyright by Kristin Reinelt
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by Kristin Reinelt
www.kr-lektorat.de
Kapitel 1
Der Flur war still. Nur das gedämpfte Summen der alten Heizungsrohre begleitete ihre Schritte, während Norah Winter den Kragen ihres Mantels höher zog. Es war ein Oktobermorgen, der mehr Dunkelheit als Licht in sich trugen, und obwohl es erst kurz nach acht war, fühlte sich der Tag an wie in Watte gehüllt – grau, weich, unfertig.
Norah mochte diese Stunden. Nicht, weil sie früh aufstand, sondern weil die Welt um diese Zeit noch nicht entschieden hatte, wer sie an diesem Tag sein wollte.
Mit einem Buch unter dem Arm – Simone de Beauvoir, ein Reclam Heft, das nach getrocknetem Papier und alten Gedanken roch – schob sie die Tür zur Bibliothek auf. Der vertraute Geruch empfing sie wie eine stille Begrüßung. Hier war alles, was sie brauchte: Stille, Raum zwischen den Menschen, Wörter, die mehr sagten als Gespräche.
Sie war keine, die im Mittelpunkt stand. Aber auch keine, die sich davor drückte. Norah existierte zwischen den Gruppen, in jenem schmalen Streifen, den man nur bemerkte, wenn man genauer hinsah. Sie hörte mehr zu, als sie sprach. Und wenn sie sprach, dann überlegte sie zu lange, um mit den Lauten der anderen Schritt zu halten. Doch was sie sagte, blieb hängen. Meistens.
Später, wenn die Vorlesung begann, würde sie wie immer im dritten Stuhl von rechts sitzen. Nicht ganz vorne, nicht ganz hinten. Mit aufrechter Haltung und einem leeren Blatt vor sich, das sie erst dann beschrieb, wenn das, was gesagt wurde, durch ihre Gedanken gegangen war wie Licht durch Nebel.
Ihre Eltern hatten sie früh gelehrt, unabhängig zu sein. Vielleicht war es auch mehr eine stille Erwartung gewesen, die sie nie aussprechen mussten. Sie war Einzelkind, ein stilles, kluges Mädchen mit einem Hang zur Selbstbeobachtung. Zwischen ihr und ihrer Mutter bestand eine unausgesprochene Zärtlichkeit, die sich mehr in kleinen Gesten zeigte als in Worten. Ihr Vater war oft abwesend – räumlich wie geistig –, doch nie hart oder lieblos. Es war eine Form von Nähe, die mehr auf Respekt beruhte als auf Vertraulichkeit. Man ließ einander in Ruhe und hielt sich doch in Ehren.
Die Tür quietschte leise hinter ihr, als sie sich an ihren Stammplatz setzte. Der Bibliothekar nickte ihr flüchtig zu. Er kannte sie. Nicht beim Namen – aber als Präsenz. Wie ein Schatten, der zu bestimmten Stunden an derselben Stelle fiel.
Am Abend würde Terra sie zur Party schleppen. Wie immer. Und wie immer würde Norah zögern, dann aber mitgehen. Sie mochte Terra. Auf eine verwunderliche Weise gehörten sie zusammen – obwohl alles an ihnen gegensätzlich war.
Terra Nowack war laut, bildhübsch, sorglos. Ihre blonden Haare fielen in perfekt unordentlichen Wellen über ihre Schultern, und ihr Lachen hallte durch Gänge wie Musik. Sie war beliebt, von jener Art, die sich nie erklären musste. Nicht besonders klug, nein, aber darin lag ihr Zauber. Nichts an ihr war kompliziert. Sie war das, was sie war – und das genügte.
Norah hingegen dachte über alles zweimal nach. Über Worte. Blicke. Entscheidungen. Sie fragte sich oft, warum Terra gerade sie zur Mitbewohnerin gewählt hatte. Aber vielleicht war genau das der Grund. Norahs Welt war still, und Terra mochte den Widerhall ihrer eigenen Stimme in dieser Stille.
„Du kommst heute Abend mit, oder?“ hatte sie am Morgen gesagt, während sie barfuß durchs Zimmer trippelte, nach ihrer Jeans suchte und sich gleichzeitig die Lippen glosste.
Norah hatte mit einem Nicken geantwortet. Nicht aus Freude. Eher aus einer Mischung aus Loyalität und Neugier. Terra öffnete Türen, durch die Norah allein nie gegangen wäre. Und manchmal – nur manchmal – war es gut, sich von jemand anderem in Bewegung setzen zu lassen.
Trotzdem: Wenn sie ehrlich war, wären ihr zwei Stunden auf dem Laufband oder eine Nacht zwischen staubigen Regalen lieber gewesen. Dort konnte sie atmen. Sie selbst sein, ohne sich erklären zu müssen.
Und doch: Es gab diesen Teil in ihr, klein und kaum greifbar, der sich fragte, was sie verpassen könnte.
Vielleicht – dachte sie, während sie ihr Buch aufschlug und der ersten Satz sich wie eine Berührung in ihren Gedanken festsetzte – vielleicht war das Leben genau das: ein ständiges Schwanken zwischen dem, was man sucht, und dem, was man bereit ist zu riskieren, um es zu finden.
Der Abend kam schneller, als Norah lieb war.
Sie stand vor dem Spiegel, das Haar noch feucht vom Duschen, in ein schwarzes Oberteil gehüllt, das eher schlicht als auffällig war. Terra hatte es ihr auf das Bett gelegt – „Nur für den Fall, dass du doch mal gut aussehen willst, ohne es zu merken“ hatte sie mit einem Grinsen gesagt. Es war eines jener Kleidungsstücke, das zu viel zeigte, ohne wirklich etwas zu verraten. Der Stoff schmiegte sich weich an ihre Haut, der Ausschnitt ein Hauch zu tief, die Ärmel schmal und lang.
Norah betrachtete ihr Spiegelbild mit einer Mischung aus Skepsis und Gleichgültigkeit. Sie wirkte nicht fremd – aber auch nicht ganz wie sie selbst. Vielleicht lag es an der Art, wie das Licht über ihre Schultern strich. Oder daran, dass sie sich selbst ansah, als sei sie eine Figur in einem Text, den sie nicht geschrieben hatte.
„Beeil dich!“ rief Terra aus dem Flur. Ihre Stimme klang ungeduldig, aber nicht böse. Eher wie ein Echo von etwas, das sich ständig bewegte, nie innehielt. Terra war bereits geschminkt, parfümiert, fertig zum Ausgehen – in glänzenden Boots, einer Lederjacke und einer Aura aus Selbstverständlichkeit.
Norah schlüpfte in ihre dunkle Jeans, zog den Reißverschluss hoch und streifte sich die Jacke über. Sie ließ das Licht im Zimmer aus, als sie hinausging – nicht weil sie es vergessen hatte, sondern weil die Dunkelheit eine gewisse Ruhe in sich trug.
Die Musik war schon auf dem Weg zur Party zu hören – ein dumpfes Pochen, das sich wie ein zweiter Puls unter die Haut legte. Der Campus der UCLA lag im Zwielicht, die Bäume wirkten wie Silhouetten aus Tinte. Terra ging voraus, in leichten, zielstrebigen Schritten, ohne zurückzuschauen. Norah folgte ihr.
Los Angeles hatte eine eigene Art von Dunkelheit. Sie war nicht schwer oder bedrohlich – eher eine flimmernde Kulisse, in der alles möglich schien und gleichzeitig nichts zählte. Seit sie aus Atlanta fortgezogen war, hatte Norah oft das Gefühl, sich zwischen zwei Leben zu bewegen. Zwischen dem, was sie kannte, und dem, was sie noch nicht benennen konnte.
Im Haus angekommen, schlug ihnen Hitze entgegen. Stimmen, Parfüm, Bewegung. Menschen standen dicht beieinander, lachten, hielten Gläser in der Hand, führten Gespräche, die wie Fragmente wirkten – Bruchstücke von Sätzen, die nur für einen Moment existierten.
Norah trat einen Schritt zur Seite, suchte sich einen Platz an der Wand, zwischen einer Topfpflanze und einem Bücherregal, das vermutlich nur zur Dekoration diente. Terra war schon verschwunden – irgendwo inmitten von Gesichtern und Namen, die Norah nicht kannte.
Sie lehnte sich leicht an das Regal, beobachtete. Ein Paar in der Ecke küsste sich mit jener Verzweiflung, die nichts mit Romantik zu tun hatte. Zwei Jungen diskutierten laut über ein Spiel, das Norah nicht interessierte. Eine Frau mit rot geschminkten Lippen warf ihr einen Blick zu, der etwas zwischen Langeweile und Neugier war.
Norah blickte weg.
Sie trank nichts. Wollte nichts. Und doch war sie da – mittendrin, in einem Raum voller Stimmen, ohne selbst eine zu erheben. Ihre Gedanken glitten ab. Immer wieder. Nicht zum Buch auf ihrem Nachttisch. Sondern zu John.
John, der immer sagte, Nähe sei für ihn kein Ort, sondern eine Entscheidung. Und der dann ging.
Zuerst hatte er von der Entfernung gesprochen. Von den Kilometern zwischen Atlanta und Los Angeles. Davon, dass es schwer sei, so wenig Alltag zu teilen. Dass seine Arbeit ihn auffresse, seine Energie, seine Zeit. Und Norah hatte genickt, Verständnis gezeigt, wie man es mit Würde tut, auch wenn es weh tut.
Erst später – viel später – erfuhr sie von der anderen. Von den Nachrichten, die längst liefen, während er mit ihr telefonierte. Von einem Namen, den sie nie gehört hatte und der sich in ihr eingebrannt hatte wie eine Erinnerung, die nicht ihr gehörte.
Sie war nicht wütend gewesen. Nicht wirklich. Nur leer. Als hätte etwas in ihr zu früh aufgehört, an das Gute zu glauben.
Und jetzt stand sie hier. Inmitten fremder Menschen. Und fragte sich, ob das, was sie spürte – diese Mischung aus Gleichgültigkeit und Müdigkeit – der Anfang von etwas Neuem war. Oder nur das Echo von dem, was sie verloren hatte.
Sie ließ den Blick schweifen. Über Gesichter, die lachten, tranken, sich fanden und verloren. Und dachte: Vielleicht war das alles gar kein Neuanfang. Sondern nur eine Fortsetzung. Anders erzählt. Mit anderen Namen. Und doch denselben Fragen. Die Tage auf dem Campus begannen für Norah immer früher als für die meisten anderen. Während sich das Licht noch tastend zwischen die Gebäude schob und die Cafés ihre ersten Maschinen anwarfen, saß sie bereits im Lesesaal der Literaturfakultät – der große mit den deckenhohen Fenstern, durch die das Licht in dünnen Streifen fiel.
In diesen Stunden war Los Angeles stiller, beinah fremd. Die Stadt, die sich später in Lärm und Bewegung auflöste, wirkte für einen Moment konturiert, fast zögerlich. Und Norah mochte diesen Zustand. Er ähnelte ihrer Art zu denken – zurückhaltend, wach, nicht zu laut.
Sie hatte sich für das Literaturstudium an der UCLA entschieden, weil es eine Art leisen Widerstand bedeutete. Gegen das Erwartbare, das Praktische, das Naheliegende. Nicht, dass ihre Eltern es ihr ausgeredet hätten – aber sie hatten auch nicht gefragt, warum. Vielleicht hätten sie es nicht verstanden. Dass Wörter manchmal ein Zuhause sein konnten. Dass Geschichten Halt gaben, wenn Orte es nicht taten.
Norah war die Art Studentin, die Professoren am liebsten hätten, wenn sie sie denn bemerkten. Sie stellte keine Fragen, sie antwortete nicht spontan – aber ihre Arbeiten waren präzise, ihre Argumentationen klar, ihre Gedankengänge tief. Sie schrieb mit, immer, Seite um Seite, ohne einen Moment nachzulassen. Ihre Heftseiten wirkten wie Abziehbilder des Vorgetragenen – ergänzt durch Notizen am Rand, in kleiner, ordentlicher Schrift.
Bestnoten. Immer. Semester für Semester. Sie sprach nicht darüber. Terra hatte einmal ihre Unterlagen gefunden und ungläubig den Kopf geschüttelt. „Du bist ein verdammtes Phantom. Die Leute denken, du bist einfach nur ruhig – dabei bist du eine Maschine.“
Norah hatte gelächelt, aber nichts gesagt.
An diesem Tag aber lag etwas anderes in der Luft. Es war McCorners letzter. Professor Arthur McCorner, seit über drei Jahrzehnten das geduldige Rückgrat der Fakultät, verabschiedete sich in den Ruhestand. Ein Mann mit hoher Stirn, grauem Bart, stets mit einer abgewetzten Ledermappe unter dem Arm. Er hatte Norah nie direkt gelobt, aber sie wusste, dass er ihre Arbeiten kannte. Er hatte einmal, nach einem Seminar über T. S. Eliot, kurz innegehalten, als er ihren Essay zurückgab. Und nur gesagt: „Gut gesehen.“
Zwei Worte. Mehr nicht. Aber für Norah war es mehr gewesen als all die lobenden Randbemerkungen anderer.
Die Vorlesung war gut besucht. Selbst diejenigen, die sonst nur halbherzig erschienen, hatten Platz genommen. McCorner las nicht mehr, er sprach frei, und während er über das Ende und Neuanfang in der Literatur sprach – von Shakespeare bis Morrison –, klang es fast, als spräche er über sich selbst.
Norah schrieb nicht mit. Nicht heute. Sie hörte nur zu. Und versuchte, sich jedes Detail einzuprägen. Seine Stimme. Die Pausen. Den leichten Schatten auf seinem Hemdkragen.
Als die letzten Minuten verstrichen, hob er den Blick. „Ich wünsche Ihnen keine Klarheit. Sondern das Bedürfnis, zu fragen. Immer weiter. Das ist alles.“
Dann war es still. Keine großen Gesten. Kein Applaus. Nur Bewegung. Und Norah blieb sitzen, bis der Raum sich leerte.
Am Abend ging sie nicht ins Fitnessstudio. Auch nicht in die Bibliothek. Sie ging durch die Straßen von Westwood, ohne Ziel, ohne Eile. Die Luft war warm, das Licht hing tief zwischen den Häusern. Ihr Handy vibrierte mehrmals – wahrscheinlich Terra, die sie zu irgendeiner Party einladen wollte – aber Norah antwortete nicht.
In ihrem Zimmer setzte sie sich an den Schreibtisch. Die Fenster waren geöffnet, das Geräusch der Stadt schlich sich durch den Spalt. Sie nahm einen Stift und begann zu schreiben. Kein Essay. Kein Exzerpt. Nur Gedanken.
Was bleibt von einem Menschen, der geht? Was bleibt, wenn jemand nie wirklich nahe war, aber dennoch fehlt?
Sie schrieb über Abschiede. Über den Klang alter Stimmen. Über Lücken zwischen den Sätzen, die niemand mehr füllt.
Und irgendwann dachte sie an morgen. An den neuen Dozenten. Noch war sein Name nur ein Schild an der Tür. Keine Stimme, kein Gesicht. Sie wusste nicht, ob er jung war oder alt, klug oder nur laut.
Aber sie hoffte. Auf Intellekt. Auf Ernsthaftigkeit. Auf einen Menschen, der über Worte sprach, als wären sie mehr als Instrumente.
Vielleicht würde sie morgen wieder mitschreiben. Vielleicht auch nicht. Es war noch offen.
Doch in dieser Nacht, zwischen aufgeschlagenen Heften und offenen Fenstern, spürte sie zum ersten Mal seit Langem: Etwas in ihr war bereit. Nicht für das Neue. Aber für das, was kommen durfte.
Und das war genug.
Der Morgen begann mit einem bleichen Licht, das sich durch die halb geschlossenen Jalousien ihres Zimmers tastete. Norah öffnete die Augen langsam, als hätte auch der Tag noch nicht entschieden, ob er wirklich beginnen wollte. Sie blieb noch einen Moment liegen, atmete die Stille ein, bevor die Welt wieder zu viel wurde.
Heute würde der neue Dozent kommen.
Sie richtete sich auf, streifte das dünne Laken zurück, stand auf und ging barfuß zum Fenster. Draußen glitten Jogger über die Wege des Campus, das erste Leben zwischen den Gebäuden. Ihre Gedanken kreisten, während sie sich für den Tag vorbereitete – unter die Dusche trat, sich das Haar kämmte, die Haut mit einem kühlen Tuch abtupfte. Schwarzer Rollkragenpullover, wie fast immer. Dunkle Jeans. Unaufdringlich. Still.
Was, wenn er laut war? Dominant, charismatisch, raumfüllend? Was, wenn seine Stimme ständig etwas behauptete, ohne wirklich zu fragen? Sie stellte sich einen Mann vor mit zu weißem Lächeln, festen Schritten und Sätzen wie aus dem Lehrbuch. Jemand, der zu jung war, um Abstand zu kennen, zu klug, um noch zuhören zu wollen.
Nein, dachte sie. So einer sollte es nicht sein. Nicht für diesen Raum. Nicht für diese Literatur.
Währenddessen, an einem anderen Ort der Stadt – fern vom Campus, in einem stillen Viertel nahe Brentwood – stand Julian Corven vor einem schmalen Fenster und sah auf eine Straße, die ihm fremd war. Das Apartment war gestern bezogen worden, zumindest formal. Die Umzugskartons stapelten sich noch unausgepackt in den Ecken, auf dem Boden türmten sich Bücher, als hätten sie sich selbst sortiert: Faulkner, Baldwin, Plath, Adorno, Didion. Kein Regal. Kein Teppich. Nur ein Tisch, ein Stuhl, ein Bettgestell ohne Laken.
Er fuhr sich mit einer Hand durch das Haar, das noch feucht vom Duschen war, und schnürte die Lederbänder seiner Uhr mit fast demonstrativer Langsamkeit.
Los Angeles fühlte sich fremd an. Nicht feindlich. Nur... neutral. Nach Jahren in New York, in dem schmalen Radius zwischen Bibliothek, Vorlesungssaal und Dämmerung, war das hier eine neue Sprache. Er war hier wegen des Lehrauftrags. Wegen der Zeit. Vielleicht auch wegen des Abstandes. Chicago war weit genug weg, um nicht dauernd zurückzublicken.
Er nahm seine Tasche – schwer, gefüllt mit Manuskripten, Notizen, alten Vorlesungen – und verließ die Wohnung. Der Tag war klar. Der Himmel weit und makellos. Ein Wetter, das nicht viel von einem wollte.
Zur gleichen Zeit saß Norah bereits in ihrem Hörsaal. Zweite Reihe, ganz rechts. Der Platz war nicht gewählt, sondern gefunden worden. Wie etwas, das man nicht sucht, aber behält. Sie blätterte durch ihr Notizbuch, obwohl sie wusste, dass sie heute noch nichts schreiben würde. Nicht gleich.
Die Stühle füllten sich langsam. Stimmen, Schritte, das leichte Kratzen von Stiften. Niemand sprach über den neuen Dozenten – zumindest nicht laut. Gerüchte gab es, Namen, Spekulationen. Aber keine Substanz.
Norah ließ den Blick zur Tür gleiten, dann wieder zurück auf ihre Seiten. Irgendetwas in ihr war gespannt. Nicht unruhig. Nur wach.
Und irgendwo, zwischen dieser Erwartung und der fremden Klarheit des Morgens, war Julian unterwegs. Richtung Campus. Richtung Hörsaal. Ohne zu wissen, dass dort jemand saß, die ihn bereits ausschloss, bevor sie ihn kannte.
Die Tür zum Hörsaal öffnete sich mit einem leisen, aber bestimmten Geräusch. Nicht dramatisch, nicht auftrumpfend – nur entschieden. Julian Corven trat ein, als gehörte ihm der Raum schon seit Jahren. Groß, aufrecht, mit einer Ruhe, die nicht behauptet werden musste. Sein Blick glitt über die Reihen mit den Studierenden, ohne länger an einem Gesicht zu verweilen. Das weiße Hemd spannte sich über seine Brust und Schultern, als würde jeder Muskel darunter bewusst schweigen – sichtbar, aber nicht zur Schau gestellt. Die hochgekrempelten Ärmel legten kräftige Unterarme frei, deren Sehnen bei jeder Bewegung leicht hervortraten. Es war die Art von Körper, die sich nicht anbot, aber dennoch auffiel – so sehr, dass sich kaum jemand in seiner Nähe ganz auf den Stoff konzentrieren konnte. Die dunkle Hose war schlicht, sein Auftreten jedoch alles andere als neutral. Seine Haltung war gerade, aber nicht starr, seine Bewegungen präzise, aber unaufgeregt.
Ein kurzes Pfeifen, halb unterdrückt, durchbrach die Stille. „Heiß“, flüsterte eine weibliche Stimme in der hinteren Reihe. „Netflix-Professor“, raunte eine andere. Gelächter. Kichern. Doch Julian reagierte nicht. Kein Blick zur Seite, kein Lächeln, kein Zeichen, dass er etwas davon wahrnahm. Er kannte das Spiel. Kannte die Wirkung, die seine Erscheinung hatte. Und hatte gelernt, sie zu ignorieren.
Er stellte seine Tasche auf das Pult, legte ein Notizbuch daneben, öffnete es nicht. Seine Hände ruhten kurz auf dem Holz, dann sah er in den Raum.
„Julian Corven“, sagte er. „Ich unterrichte Literaturtheorie, Textanalyse, Geschichte, Gegenwart. Wir sprechen nicht über Autoren. Wir sprechen über Sprache. Und über das, was sie mit uns macht.“
Keine Einleitung, kein Smalltalk, keine falsche Bescheidenheit.
Dann begann er.
Er sprach ruhig, mit einer Stimme, die nicht laut war, aber durchdrang. Seine Sätze waren klar, unverschnörkelt, durchdacht. Es ging um Autorenschaft, um das Fragmentarische, um die Mechanismen der Interpretation. Keine Zitate zur Auflockerung, keine Anekdoten. Nur Sprache. Gedanke. Bedeutung.
Norah saß wie immer in der zweiten Reihe, ganz rechts. Ihr Notizbuch lag vor ihr, der Stift ruhebereit daneben. Sie hatte sich kein Urteil erlaubt, als er den Raum betreten hatte. Nicht über sein Äußeres, das zwar auffiel, aber für sie belanglos war. Schönheit interessierte sie nicht. Nicht im akademischen Raum.
Sie hörte. Auf das, was er sagte. Auf das, was er nicht sagte. Auf die Pausen zwischen den Gedanken.
Sie beobachtete ihn – nicht als Mann, sondern als Dozent.
Wie er sprach. Wie er Themen strukturierte. Wie er zwischen Begriff und Bedeutung wechselte, ohne den Faden zu verlieren. Sie schrieb nicht sofort. Zuerst wollte sie verstehen. Nicht den Inhalt, sondern die Form. Den Zugriff.
Und dann – langsam – begann sie zu notieren. Nicht Wort für Wort. Nur Fragmente. Strukturen. Eine Beobachtung über seine Gestik. Eine Formulierung, die hängen blieb: „Ein Text stellt keine Wahrheit her. Er lässt eine Möglichkeit entstehen.“
Norah hatte lange gehofft, dass der neue Dozent mehr war als Pose. Dass er Substanz hatte. Nun wusste sie: Er konnte ihr das beibringen, was sie suchte.
„Sag bitte, dass du ihn gesehen hast.“
Norah hob den Blick von ihrer Kaffeetasse. Terra lehnte mit dem Rücken gegen die Wand der kleinen Küche, das Smartphone in der einen Hand, einen Apfel in der anderen. Ihr Gesicht war ein einziger Ausdruck von übersteigerter Fassungslosigkeit.
„Wen?“
„Wen?! Norah. Den. Neuen. Dozenten.“
„Julian Corven?“, fragte Norah ruhig und nahm einen Schluck.
„Julian... Corven.“ Terra wiederholte den Namen langsam, als koste sie ihn aus. „Ich meine... das Hemd. Diese Stimme. Und seine Hände, hast du seine Hände gesehen? Die...“
„...hatten einen Stift in der Hand und haben Argumentationslinien zu Barthes aufgemacht“, unterbrach Norah.
Terra blinzelte. „Du hast inhaltlich zugehört?“
„Natürlich.“
„Während... das?“ Sie zeigte mit ausladender Geste auf einen Punkt, der offenbar alles meinte – Julian, sein Körper, sein Gang, sein ganzes Dasein.
Norah zuckte mit den Schultern. „Er spricht klar. Keine rhetorischen Ausschweifungen. Keine Anekdoten. Er lässt die Sprache für sich wirken. Das ist selten.“
„Ich schwöre dir, ich hab in der ersten halben Stunde kein einziges Wort verstanden. Ich war zu sehr damit beschäftigt, nicht permanent zu starren. Und dann... kam diese Stelle mit dem Fragment und der Perspektive...“
„Die war gut“, nickte Norah. „Weil er sie nicht erklärt hat. Er hat sie geöffnet.“
Terra ließ sich auf den Stuhl gegenüber fallen. „Du bist wirklich unverbesserlich. Da steht dieser—dieser gottgewordene Literaturdozent vorne, und du analysierst seine Methodik.“
„Weil das der Grund ist, warum ich da bin.“
„Ich auch. Aber mein Gehirn hatte... Schwierigkeiten mit dem Blutfluss.“
Norah lachte leise. Nicht überheblich. Nur wie jemand, der aus einer anderen Perspektive blickte. „Er ist kompetent. Das ist das Einzige, was für mich zählt.“
„Kompetent ist eine Beleidigung für das, was er da vorne war. Er war...“
„...strukturiert. Präzise. Und, ja, in gewisser Weise elegant.“
„Elegant.“ Terra zog eine Augenbraue hoch. „Du meinst sexy.“
Norah schüttelte den Kopf. „Ich meine: Er hat eine Form gefunden, die dem Inhalt nicht im Weg steht. Das ist selten.“
Für einen Moment war es still. Nur das Surren des Kühlschranks, das leise Ticken der Uhr.
Dann sagte Terra: „Du wirst dich verlieben.“
Norah sah sie an. Still. Mit diesem Blick, der nie etwas direkt ausschloss, aber immer in Frage stellte.
„Nein“, sagte sie leise. „Ich will etwas lernen. Alles andere interessiert mich nicht.“
„Noch nicht“, murmelte Terra.
Norah antwortete nicht. Aber etwas an ihrem Schweigen ließ die Luft dichter werden.
Die folgenden Tage mit Julian Corven als Dozent verliefen still und stetig – wie ein Fluss, der mit jedem Abschnitt tiefer wurde. Für Norah änderte sich kaum etwas. Sie saß weiterhin auf ihrem gewohnten Platz in der zweiten Reihe, rechts außen, das Notizbuch offen, der Stift bereit. Was sich veränderte, war alles um sie herum.
Der Hörsaal füllte sich. Anfangs langsam, fast unmerklich – zwei, drei neue Gesichter, ein paar Stühle mehr, die besetzt waren. Dann immer schneller. Irgendwann war der Raum voll. Kein freier Platz, keine Lücke in den Reihen. Studierende standen an den Wänden, saßen auf den Treppenstufen, lehnten an der Tür. Es war nicht Neugier, es war nicht Mode – es war Anziehung. Etwas an Julian zog die Menschen an. Vielleicht seine Stimme, vielleicht die Art, wie er sprach, wie er den Stoff atmete.
Für Norah blieb das alles außen vor. Sie hörte auf das Wesentliche. Und was sie hörte, war klar, ungeschönt, fordernd. Kein Unterricht, sondern Begegnung mit Sprache.
Julian schien die wachsende Zuhörerschaft zunächst nicht zu beachten. Er unterrichtete weiter, als säßen nur zehn vor ihm. Keine Anpassung, keine Pause. Doch an einem Mittwochmorgen, als selbst die Fensterbänke besetzt waren und das Stimmengewirr vor Beginn der Vorlesung an einen Konzertbeginn erinnerte, hielt er plötzlich inne.
Er sah auf. Nicht genervt, nicht amüsiert. Nur wach.
„Bevor wir anfangen“, sagte er, „möchte ich etwas sagen.“
Sofort war es still.
„Ich freue mich, dass so viele von Ihnen Interesse zeigen. Wirklich. Es ehrt mich. Aber dieser Kurs ist Teil des Pflichtprogramms für Literatur-Hauptfächer. Und nur für diese konzipiert.“
Ein leises Murmeln ging durch den Raum. Ein Mädchen in der dritten Reihe seufzte hörbar. Irgendwo fiel das Wort „unfair“.
Julian hob leicht die Hand. „Es geht nicht darum, jemanden auszuschließen. Aber wir werden hier Dinge lesen, analysieren und zerlegen, die Konzentration verlangen. Tiefe. Bereitschaft. Wenn Sie Literatur nur... beobachten wollen, tun Sie das bitte woanders.“
Ein enttäuschtes Raunen ging durch die Reihen. Einige standen widerwillig auf, andere blieben trotzig sitzen. Julian wartete. Schweigend.
Nach einer Minute begann die Bewegung. Einer nach dem anderen verließ den Saal. Leise, mit gesenktem Blick.
Norah hatte während der ganzen Ansprache nicht gezuckt. Nicht gelächelt, nicht gewertet. Es war nicht überraschend. Es war nur konsequent.
Sie schrieb weiter. Ein Satz aus der Einleitung, dann ein Gedanke, der nicht ausgesprochen worden war, aber im Raum hing.
Julian nickte kaum merklich, als wieder Ruhe eingekehrt war.
Dann begann er zu sprechen. Und alles andere verschwand.
Die Aufgabe wurde am Montagmorgen gestellt. Ohne Einleitung, ohne große Erklärung. Julian legte ein Blatt auf das Pult, blickte in die Reihen und sagte nur: „Textanalyse. Thema, Struktur, Wirkung. Abgabe am Freitag. Kein Zitat, das Sie nicht begriffen haben. Keine These, die Sie nicht tragen können.“
Dann begann die Vorlesung.
Für viele war es eine lästige Pflicht. Eine Note unter vielen. Ein weiterer Text, den man irgendwie überstehen, irgendwie umformulieren musste. Für Norah war es etwas anderes. Sie empfand kein Pflichtgefühl – sondern ein Bedürfnis. Der Text, den er gewählt hatte – ein Auszug aus einem Essay von Susan Sontag – war vielschichtig, glasklar und gleichzeitig flüchtig. Norah hatte sofort gespürt, dass hier nichts auf der Oberfläche lag. Jeder Satz war ein Scharnier. Jedes Wort ein Spalt zwischen Bedeutung und Behauptung.
Schon am selben Nachmittag saß sie in der Bibliothek. Ihr Notizbuch aufgeschlagen, mehrere Kopien des Textes vor sich ausgebreitet, angestrichen, mit Anmerkungen versehen. Sie las nicht nur. Sie tastete sich hinein. Schicht für Schicht. Ihre Lippen bewegten sich beim Lesen lautlos. Manchmal schrieb sie einen Satz zehnmal neu, nur um die Nuance zu erfassen, die sich zwischen zwei Formulierungen verbarg.
Die Tage vergingen, doch für Norah war es ein einziger, gedehnter Gedankenzustand. Morgens Vorlesung. Nachmittags Bibliothek. Manchmal vergaß sie zu essen. Manchmal vergaß sie die Uhrzeit. Erst wenn die Bibliothekarin leise an ihren Tisch trat und sagte: „Wir schließen gleich, Miss Winter“, sah sie auf.
„Nur noch fünf Minuten.“
Und die Frau ließ sie gewähren. Weil sie sah, was da geschah. Kein Ehrgeiz. Keine Angst. Sondern ein leiser, unbeirrbarer Hunger.
Norah versuchte nicht, Julian zu beeindrucken. Sie dachte kaum an ihn. Was sie wollte, lag im Text. Und in dem, was zwischen den Zeilen atmete. Wenn sie aufblickte, blickte sie nicht hinaus – sondern weiter hinein.
Am Donnerstagabend hatte sie vier Versionen. Keine war fertig. Jede war ein Versuch, präziser zu werden. Sie saß auf dem Boden ihres Zimmers, umgeben von Papieren. Terra kam herein, warf einen Blick darauf und sagte nur: „Du weißt, dass du es längst kannst, oder?“
Norah schüttelte den Kopf. „Noch nicht so, wie es möglich wäre.“
Am Freitagmorgen stand sie früh auf. Schrieb ein letztes Mal. Nicht anders. Aber klarer. Schnörkelloser. Näher an dem, was sie wirklich dachte.
Und als sie das Blatt ausdruckte, war da keine Erleichterung. Kein Stolz. Nur Stille. Die Art von Ruhe, die man spürt, wenn man weiß, dass man sich selbst nicht aus dem Weg gegangen ist.
Das Wochenende verstrich ohne besondere Vorkommnisse. Es war eins dieser stillen, in sich geschlossenen Wochenenden, die sich nicht dadurch auszeichnen, dass etwas passiert – sondern dadurch, dass sie einen Raum lassen, in dem man wieder zu sich selbst zurückfindet.
Norah las. Zwei Bücher, vollständig, mit Anmerkungen am Rand und kleinen Eselsohren, die sie später wieder finden wollte. Eines davon las sie im Park, zwischen den schmalen Bäumen des Campusgeländes, auf einer alten Bank mit abgeblättertem Lack. Die Sonne lag wie eine leise Decke über dem Gras, Studenten zogen vorbei, vereinzelt, als hätte das Leben selbst an Tempo verloren. Norah bemerkte sie kaum. Sie las, blätterte um, schrieb leise Notizen in ihr kleines Moleskin, legte das Buch dann auf die Knie, um einem Gedanken nachzuhängen, der sich nicht greifen ließ.
Am Nachmittag ging sie ins Studio. Drei Stockwerke unter der Bibliothek, neonbeleuchtet, funktional, ohne viel Atmosphäre. Genau das mochte sie daran. Es gab kein Dazwischen: Entweder man war da, oder nicht. Kein Gespräch, keine Ablenkung. Sie lief auf dem Laufband, stellte sich stumm zwischen die Gewichte, fokussiert, versunken. Nicht aus Ehrgeiz. Sondern weil Bewegung half, das Gelesene zu setzen.
Terra hatte das Wochenende über mehrere Pläne gemacht. Einer davon setzte sich durch. Am Samstagabend stand sie plötzlich in Norahs Tür, geschminkt, energisch, mit einem Kleid, das keinen Widerspruch duldete.
„Du kommst mit. Ende der Diskussion.“
„Ich habe nicht diskutiert.“
„Ich weiß. Genau deshalb.“
Sie gingen zu einer Party in einem Wohnheim, das Norah noch nie betreten hatte. Musik, Stimmen, grelles Licht, warme Getränke in Plastikbechern. Terra tanzte. Norah stand, lehnte an der Wand, beobachtete, blieb höflich distanziert. Sie sprach wenig, nickte gelegentlich, hörte zu, ohne sich zu beteiligen. Die Musik vibrierte in ihren Rippen, aber nicht in ihr.
Gegen Mitternacht war sie wieder im Zimmer. Sie wusch sich das Gesicht, stellte das Buch zurück auf den Nachttisch und legte sich hin. Kein Gedanke an die Party blieb. Nur ein Satz aus dem Buch von Woolf.
Am Sonntagabend, während sie ihren Tee auf dem Fenstersims abkühlen ließ, dachte sie an die bevorstehende Rückgabe der Arbeit.
Julian hatte nichts dazu gesagt. Kein Hinweis, kein Ausblick. Nur der Tag. Montag.
Würde er kommentieren? Würde er, wie McCorner, mit feiner Handschrift Anmerkungen am Rand hinterlassen? Sätze, die nicht nur kritisierten oder lobten, sondern etwas öffneten? Eine Richtung wiesen, ohne sich aufzudrängen?
Norah wusste es nicht. Und sie fragte sich, ob es überhaupt etwas über ihn sagen würde – oder mehr über sie. Ihre Hoffnung auf Tiefe. Ihre Sehnsucht nach Gegenübern, die nicht nur bewerten, sondern verstehen wollten.
Sie ging früher schlafen als sonst. Nicht, weil sie müde war. Sondern weil sie das Nachdenken in die Nacht legen wollte. Dort, wo es leiser war. Und sie selbst ein wenig auch.
Die Stunden vergingen in stiller Konzentration. Julian saß an seinem Schreibtisch, eine Tasse Kaffee längst kalt geworden neben ihm, das Licht gedämpft, die Geräusche der Stadt draußen nur gedämpftes Rauschen. Vor ihm ein Stapel ausgedruckter Hausarbeiten – alle gleich formatiert, gleich schwer, gleich versprechend. Und doch: mit jeder gelesenen Seite wich die Hoffnung einer zunehmenden Müdigkeit.
Er las. Zeile um Zeile. Manche Sätze las er zweimal, nicht weil sie besonders tief waren, sondern weil sie kaum Sinn ergaben. Allgemeinplätze, Zitate ohne Kontext, Interpretationen, die mehr wollten als sie konnten. Manchmal fragte er sich, ob der Verfasser überhaupt verstanden hatte, was er da las. Oder ob es nur Nachahmung war – das Imitat eines Gedankens.
„Der Text ist feministisch, weil die Autorin eine Frau ist“, las er leise. Seine Mundwinkel zuckten. Nicht einmal mit Zynismus. Es war einfach... zu viel und zu wenig zugleich.
Dann fiel ihm eine Arbeit in die Hände.
Die Schrift war ruhig, das Deckblatt schlicht. Er blätterte auf. Der erste Satz:
„Ein Text verlangt keine Zustimmung. Er verlangt eine Reaktion. Die Qualität dieser Reaktion entscheidet über die Tiefe unserer Lektüre.“
Julian lehnte sich zurück. Las den Satz noch einmal. Dann den nächsten:
„Sontag fordert nicht Verständnis. Sie fordert Aufmerksamkeit – auf das, was zwischen Bedeutung und Behauptung oszilliert.“
Er war still. Blätterte weiter. Seite zwei. Seite drei. Keine großen Gesten. Kein intellektuelles Muskelspiel. Nur Klarheit. Präzision. Ein Mut zur Reduktion, der selten war.
„Interpretation ist kein Besitz. Sie ist Bewegung.“
Er las die Arbeit zweimal. Nicht, weil er es musste. Sondern weil er wollte. Am Ende schloss er die Mappe, strich mit der Hand über das Deckblatt.
Norah Winter.
Der Name sagte ihm nichts. Kein Gesicht, das dazugehörte. Kein Lächeln, kein Blick, keine Stimme. Nur diese Seiten.
Er ließ die Finger einen Moment auf dem Papier ruhen, dann griff er zum Stift. Kein Rot, kein Marker. Nur Tinte. Am Rand, neben dem letzten Absatz, schrieb er ein Wort:
„Wahr.“
Dann lehnte er sich zurück. Und sah zum Fenster hinaus, wo das Licht der Stadt sich an den Scheiben brach. Es kam nicht oft vor, dass ihn ein Text aus der Bewegung holte.
Aber dieser hatte es getan.
Es war Montagmorgen. Die Luft im Hörsaal war noch kühl, die Fenster beschlagen vom Atem der Nacht. Die ersten Stimmen verstummten, als Julian den Raum betrat. Er trug wie immer seine Tasche über der Schulter, in der linken Hand ein Stapel Hausarbeiten. Kein Gruß, kein Blick zu den Reihen. Er ging geradewegs zum Pult, legte alles ab, und setzte sich halb auf die Tischkante. Kurz atmete er durch. Dann seufzte er leise – nicht gespielt, nicht übertrieben. Echt.
„Ich habe das Wochenende damit verbracht, Ihre Arbeiten zu lesen.“
Die Worte standen plötzlich im Raum. Ruhig, aber mit Nachdruck. Es war nicht der Tonfall eines enttäuschten Lehrers. Es war der eines Mannes, der sich fragte, was das alles bedeutete.
„Und ich frage mich“, fuhr er fort, „wann genau es zur Gewohnheit geworden ist, nicht zu denken. Sondern zu wiederholen.“
Ein Raunen ging durch den Saal. Nicht laut, eher wie das leichte Zusammenziehen von Haltung. Julian ließ sich nicht beirren.
„Viele dieser Arbeiten waren oberflächlich. Voller Floskeln, aus zweiter oder dritter Hand. Copy-Paste-Interpretationen, durchsetzt mit Begriffen, die nicht verstanden wurden. Da standen Sätze, die klangen wie Gedanken, aber keiner war da.“
Er sah nicht in die Gesichter. Noch nicht.
„Manche Texte wirkten, als wären sie aus Pflicht entstanden. Oder aus Angst. Und das Schlimmste: Einige wirkten, als wäre da überhaupt kein Interesse an Sprache. Als wären Worte nur Werkzeuge – nicht Möglichkeiten.“
Einige Studierende wechselten die Sitzposition. Andere starrten auf ihre Tische. Eine Unsicherheit zog durch die Reihen. Julian griff wieder nach dem Stapel, hob ein einzelnes Blatt heraus.
„Dann gab es diese Arbeit.“
Er hielt sie hoch. Ein einfacher Ausdruck, keine Farben, kein unnötiges Format. Nur Inhalt.
„So etwas will ich sehen.“
Er schlug die erste Seite auf. Begann zu lesen.
„Ein Text verlangt keine Zustimmung. Er verlangt eine Reaktion. Die Qualität dieser Reaktion entscheidet über die Tiefe unserer Lektüre“
Er hielt kurz inne. Niemand sprach. Er las weiter.
„Sontag fordert nicht Verständnis. Sie fordert Aufmerksamkeit – auf das, was zwischen Bedeutung und Behauptung oszilliert“
Und weiter.
„Interpretation ist kein Besitz. Sie ist Bewegung“
Einige der Anwesenden blickten verwirrt, andere sahen einander fragend an. Man sah es ihnen an: Die Worte kamen nicht an. Nicht wirklich. Nicht dort, wo sie wirken sollten.
Norah hingegen wurde rot. Nicht vor Stolz. Sondern vor Unbehagen. Sie machte sich klein, zog unwillkürlich die Schultern ein. Als müsste sie sich vor dem eigenen Gedanken verstecken.
Julian schlug die Arbeit zu. Seine Stimme wurde leiser.
„Wer ist Norah Winter?“
Ein kollektives Drehen der Hälse. Blicke. Und dann: alle Augen auf sie. Auch seine.
Norah hob zaghaft den Blick. Ihre Stimme versagte, aber sie hob eine Hand. Nur kurz.
Julian sah sie an. Und ging zu ihr hinunter. Keine Worte. Kein Lob. Kein Urteil.
Er reichte ihr die Arbeit. Sah sie dabei an. Einen Moment länger, als nötig gewesen wäre. Und in seinem Blick lag etwas, das keine Notiz am Rand je hätte sagen können.
Dann drehte er sich um. Ging zurück zum Pult. Und begann mit der Vorlesung.
Der Hörsaal war nach der Vorlesung leer. Der Lärm des Tages hatte sich gelegt, nur das entfernte Summen der Belüftung war geblieben. Julian saß allein am Pult, ein Stapel Papiere zur Seite geschoben, die Jacke über die Rückenlehne seines Stuhls geworfen. Die Fenster spiegelten das verblassende Licht der Nachmittagssonne – eine fast milde Stille, durchzogen von jenem leichten Flimmern, das Los Angeles in der Dämmerung zu umgeben schien.
Er war nicht geblieben, um etwas zu erledigen. Nicht wirklich. Er war einfach sitzen geblieben. Ohne bewusste Entscheidung. Und irgendwann merkte er, dass seine Gedanken immer wieder zum selben Punkt zurückkehrten.
Norah Winter.
Heute hatte er sie zum ersten Mal wirklich gesehen. Nicht nur als Namen auf einem Blatt. Nicht als Idee, nicht als Stimme auf dem Papier. Sondern als Körper im Raum, als Haltung, als Blick.
Warum war sie ihm vorher nicht aufgefallen?
Er ging die Szene noch einmal durch. Ihr Blick, vorsichtig, fast scheu, als er nach ihrem Namen gefragt hatte. Wie sie sich klein gemacht hatte, als wolle sie weniger wahrgenommen werden, nicht mehr. Und doch hatte sie sich gemeldet – leise, aber aufrecht. Kein Wort, nur eine Geste.
Und dann ihr Gesicht.
Sie wirkte wie ein Gemälde aus Licht und Stille – ruhig, zurückhaltend und dennoch von einer fesselnden Präsenz. Ihr oval geformtes Gesicht war zart und ausgewogen, mit einer weichen, fast puppenhaften Ausstrahlung, ohne künstlich zu wirken. Ihre vollen Lippen lagen entspannt, weder zu ernst noch zu einladend – einfach echt.
Die Augen, in einem kühlen, fast rauchigen Blau, waren von dichten Wimpern eingerahmt. Sie blickten aufmerksam, aber nicht fordernd – eher so, als würden sie beobachten, bewerten, aber nicht unbedingt sprechen wollen. Man spürte: Diese Frau denkt, bevor sie fühlt – und fühlt tiefer, als sie zeigt.
Ihr dunkelblondes Haar fiel lang und glatt über ihre Schultern, mit einem Mittelscheitel und einem dichten, leicht strukturierten Pony, der ihre Stirn sanft rahmte. Es war ordentlich, aber nicht starr – ein wenig wie sie selbst: kontrolliert, aber nicht verschlossen.
Gekleidet in einem schlichten schwarzen Rollkragenpullover, wirkte sie minimalistisch und zeitlos. Kein Schmuck, kein Make-up, das auffiel. Ihre Stärke lag im Ungesagten. In dem, was zwischen den Worten lebte.
Julian fuhr sich mit der Hand über den Nacken.
Er dachte länger über sie nach, als ihm lieb war. Länger, als er sollte. Und das allein war schon ein Zeichen.
Nicht für Nähe. Aber für eine Ahnung.
Dass manche Menschen nicht mit Worten beginnen.
Aber in ihnen wohnen.
„Du hast seine Augen gesehen, oder?“
Terra stand mitten im Zimmer, ein Handtuch um die feuchten Haare geschlungen, in der einen Hand ihre Bürste, in der anderen ein Becher mit irgendetwas Grünem, das sie Smoothie nannte. Ihr Blick war glühend vor Neugier, ihre Stimme voll dieser überdrehten Energie, die sie am Leben hielt.
Norah saß auf dem Bett, den Laptop auf den Knien, den Blick auf das Dokument gerichtet, das sie längst nicht mehr las.
„Wessen Augen?“, fragte sie ohne aufzusehen.
„Norah. Tu nicht so.“ Terra ließ sich dramatisch auf die Bettkante fallen. „Julian. Corven. Seine Augen. Dieses... helle Eisblau. Fast schon silbern. Und die Wimpern. Hast du die Wimpern gesehen?“
Norah zuckte mit den Schultern. „Ich achte nicht auf Wimpern.“
„Das ist gelogen. Selbst du bist nicht immun gegen dieses... akademisch verkleidete Verhängnis.“
„Er ist unser Dozent.“
„Und trotzdem hat er Augen. Zwei sogar. Komm schon. Du musst irgendwas gedacht haben, als er dir die Arbeit zurückgegeben hat. Er hat dich direkt angesehen.“
„Vielleicht“, murmelte Norah und klappte den Laptop zu. „Ich weiß es nicht mehr.“
„Du weißt es ganz genau.“
Norah lächelte kaum merklich. Dann stand sie auf, ging zum Fenster und öffnete es einen Spalt weit. Frische Luft. Bewegung. Etwas, das nicht sprach, aber spürbar war.
In Wahrheit hatte sie seine Augen sehr wohl bemerkt.
Sie waren nicht einfach nur hell. Es war dieses ruhige, unnachgiebige Blau, das mehr sah, als es zeigte. Nicht bohrend, nicht einnehmend. Sondern aufmerksam. So, wie man ein Gedicht liest, bevor man es versteht.
Sie hatte weggesehen. Nicht, weil es ihr gleichgültig gewesen wäre – sondern weil es zu viel war. Zu direkt. Zu plötzlich.
Aber sie würde es Terra nicht sagen. Nicht, weil sie ihr nicht vertraute. Sondern weil es etwas war, das in ihr blieb.
Zwischen ihr und ihm hatte es keinen Dialog gegeben. Nur ein Blick. Aber manchmal, dachte sie, war das mehr, als Worte es je sein konnten.
Kapitel 2
Die nächsten Tage verliefen unspektakulär. Keine besonderen Momente. Keine Worte, die den Raum veränderten. Nur Vorlesungen. Nur Literatur. Nur das, was gesagt wurde – und das, was dazwischen schwieg.
Julian betrat den Saal jeden Morgen zur gleichen Zeit. Still, konzentriert, in Gedanken oft schon zwei Schritte voraus. Seine Stimme trug durch den Raum, nicht laut, aber bestimmend, und sein Blick glitt über die Reihen wie ein Scanner, ruhig, gleichmäßig – bis er an ihr hängen blieb. Immer wieder.
Er sah sie an. Nicht auffällig. Nicht fordernd. Nur ein Moment, ein kurzes Verweilen, bevor er weitersprach. Doch Norah erwiderte seinen Blick nie.
Sie sah nicht auf. Nicht einmal flüchtig. Ihre Augen waren auf das Papier vor ihr gerichtet, auf das Notizbuch, das sie immer dabei hatte, den Stift zwischen den Fingern. Sie schrieb. Permanent. Lückenlos.
Es wirkte, als würde sie jedes einzelne Wort notieren, das er sagte. Aber es war mehr als bloße Abschrift. Es war eine Art des Zuhörens, die durch den Körper ging. Eine Bewegung, die Denken sichtbar machte.
Julian fiel es auf. Wie sie schrieb, ohne ihn je direkt anzusehen. Wie ihre Haltung wach war, fast angespannt, als müsste sie die Sprache auffangen, bevor sie sich verflüchtigte.
Manchmal fragte er sich, ob sie ihn wirklich nicht bemerkte – oder ob genau das ihre Form der Aufmerksamkeit war.
Für Norah aber war es ein Schutz. Nicht, weil sie Angst hatte. Sondern weil sie wusste, dass etwas zu verlieren war, sobald man einem Blick zu viel Bedeutung schenkte.
Und so hörte sie zu. Schrieb. Dachte. Tag für Tag.
Und er sah sie. Tag für Tag. Ohne zu wissen, was genau es war, das er da zu sehen versuchte.
Der Hörsaal lag in einer dieser späten Vormittagsstunden, in denen selbst das Licht durch die Fenster schwer fiel. Die Luft war träge, die Reihen halb besetzt. Einige Studierende stützten die Köpfe in die Hände, andere starrten auf ihre Bildschirme, als würden sie dort nach einem Ausgang suchen.
Julian stand vorn. Wie immer. Die Ärmel seines Hemdes hochgekrempelt, der Ton ruhig, aber klar. Auf dem Pult: ein einzelnes, zerlesenes Blatt Papier.
„Heute“, sagte er, „geht’s um T. S. Eliots 'The Love Song of J. Alfred Prufrock'.“
Kurze Pause. Vielleicht in der Hoffnung, dass der Name etwas auslöste. Nichts. Eine Fliege surrte gegen das Fenster.
„Ein Gedicht über Verlorenheit. Über das Zögern. Über die Angst, sich zu zeigen – oder überhaupt da zu sein. Es fängt so an: ‘Let us go then, you and I, When the evening is spread out against the sky Like a patient etherized upon a table...’“
Ein paar Köpfe hoben sich. Eher aus Gewohnheit als aus echtem Interesse.
„Was Eliot hier zeigt“, fuhr Julian fort, „ist ein innerer Monolog. Ein Mann, der keine Verbindung hinkriegt. Der zersplittert ist. Seine Sprache genauso. Er lebt im Vielleicht – nicht im Jetzt.“
Norah schrieb mit. Wort für Wort. Dann stoppte sie. Ihr Blick blieb an einer Zeile hängen. Sie sah nicht auf, aber ihre Stimme schnitt durch die Trägheit im Raum.
„Das greift zu kurz.“
Julian verstummte. Alle anderen auch.
„Wie bitte?“
„Ich glaube nicht, dass es um Unfähigkeit geht“, sagte sie ruhig. „Prufrock ist nicht gelähmt. Er ist über klar. Überreflektiert. Vielleicht lähmt ihn genau das – aber das ist keine Schwäche. Das ist seine Art, mit der Welt klarzukommen.“
Julian hob die Brauen. Sein Blick fand ihren. Direkt. Wach.
„Miss Winter. Schön, mal was von Ihnen zu hören.“
Ein leichtes Lächeln begleitete seine Worte. Aber es klang nicht gönnerhaft. Eher herausgefordert.
„Sie würden also sagen, Reflexion ist eine Stärke?“
„Klarheit ist eine Stärke. Und Prufrock sieht mehr, als er aushält. Er ist nicht verloren – nur zu wach.“
Julian machte einen Schritt auf sie zu. Die Stille wurde dichter.
„Er spricht in Fragmenten. Verliert sich in Bildern und Andeutungen. Das ist keine Klarheit. Das ist Ausweichen.“
„Oder Schutz“, konterte Norah. „Nicht alles, was sich verbirgt, ist schwach. Vielleicht ist Sprache sein einziger sicherer Ort.“
Kurzes Schweigen. Dann ein kaum sichtbares Nicken von Julian.
„Und wenn Sprache zur Zuflucht wird?“
Norah sah ihn an. Offen. Zum ersten Mal wirklich.
„Dann wird jedes Wort ein Ort. Und jeder Vers eine Entscheidung, nicht unterzugehen.“
Ein leiser Atemzug ging durch den Raum. Plötzlich waren alle da. Wirklich da.
Julian sah sie an. Länger, als nötig gewesen wäre. Dann drehte er sich zurück zum Pult, nahm das zerfledderte Blatt auf.
„Gut“, sagte er leise. „Dann lesen wir es nochmal. Vielleicht mit anderen Augen.“
Er hatte kaum den ersten Vers wieder aufgenommen, da sprach Norah erneut.
„Aber genau das, was Sie Flucht nennen, ist doch eine Reaktion auf eine Welt, die keine Tiefe mehr zulässt.“
Ihre Stimme war ruhig. Aber fester. Keine Frage mehr – eine Haltung.
Julian hob den Blick vom Blatt. Langsam.
„Sie meinen, die Gesellschaft zwingt zur Fragmentierung?“
„Ich meine, dass Eliot genau das zeigt. Nicht als persönliches Drama – sondern als Spiegel. Er schreibt das Zersplitterte, weil wir längst nicht mehr ganz sind.“
„Das ist eine steile These“, erwiderte Julian. Kalt, aber nicht abwehrend. „Sie lesen das Gedicht wie eine Diagnose. Nicht wie ein persönliches Bekenntnis.“
„Weil es beides ist. Persönlich ist immer auch politisch. Prufrock ist nicht nur eine Stimme. Er ist viele. Und Ihre Interpretation nimmt ihm genau das – seine Widerständigkeit.“
Ein leises Raunen ging durch die Reihen. Der Ton hatte sich verändert.
Julian trat vom Pult zurück. Verschränkte die Arme.
„Sie unterstellen mir also, ich mache das Gedicht klein?“
„Nein. Ich sage, Sie machen es unpolitisch.“
Stille.
„Miss Winter – glauben Sie ernsthaft, Eliot wollte ein politisches Gedicht schreiben?“
„Nein. Aber ich glaube, dass wir es nicht lesen dürfen, als wäre es losgelöst von der Welt. Prufrock zieht sich zurück – nicht aus Schwäche. Aus Überforderung. Und das ist ein Unterschied.“
Julian sagte nichts. Einen Moment lang.
Dann: „Und was macht das mit uns?“
Norah antwortete direkt. „Es zwingt uns, Sprache wieder ernst zu nehmen.“
Er sah sie an. Lange.
Dann ganz ruhig: „Lesen Sie.“
Sie blinzelte. „Was meinen Sie?“
„Das Gedicht. Ihre Version. Ihre Lesart. Zeigen Sie uns, was Sie darin sehen.“
Kurzes Zögern. Dann stand sie auf. Still. Ohne Show. Einfach so.
Sie ging nach vorn. Nahm das Blatt, das noch auf dem Pult lag. Strich es glatt. Schaute nicht sofort darauf. Holte einmal tief Luft.
Dann las sie:
„Let us go then, you and I, When the evening is spread out against the sky Like a patient etherized upon a table...“
Ihre Stimme war ruhig. Klar. Kein Pathos, kein Vortrag. Sie lebte jeden Vers. Nicht gespielt – gefühlt. Als kämen die Worte aus ihr, nicht vom Papier. Die Zeilen flossen nicht. Sie blieben.
Der Raum hielt den Atem an. Niemand rührte sich.
Julian hörte zu. Und mit jedem Wort spürte er, dass sich etwas in ihm verschob. Er kannte dieses Gedicht in- und auswendig. Aber so hatte er es noch nie gehört. Nicht mit dieser Nähe. Nicht mit dieser Verletzlichkeit.
Es war, als würde sie etwas zwischen den Zeilen öffnen. Etwas, das sie vorher nicht gesagt hatte – nicht im Gespräch. Nur jetzt. Mit ihrer Stimme.
Als sie fertig war, blieb es still. Sie legte das Blatt zurück. Ging langsam zu ihrem Platz. Ohne sich zu setzen. Ohne aufzublicken.
Julian sagte nichts. Sah sie nur an. Einen langen Moment.
Dann drehte er sich zur Tafel. Schrieb nichts. Dachte. Atmete ein.
„Das war’s für heute.“
Stille.
Ein Stuhl wurde gerückt. Eine Tasche geschlossen. Doch keiner sprach.
„Miss Winter – bleiben Sie bitte noch einen Moment.“
Sie nickte. Still. Die anderen verließen den Raum. Einer nach dem anderen. Ohne Eile.
Julian stand am Fenster, als die Tür hinter dem letzten leise ins Schloss fiel.
Und dann drehte er sich zu ihr um.
Julian drehte sich zu ihr um, die Hände locker in den Taschen seiner Hose, das Gesicht von einem Ausdruck getragen, der irgendwo zwischen Nachdenken und Anerkennung lag.
„Ich hatte viele Studierende in den letzten Jahren“, sagte er. „Aber keiner von ihnen hat Sprache so präzise und gleichzeitig lebendig behandelt wie Sie.“
Norah antwortete nicht. Sie stand ruhig, gerade, wartend.
„Es war erfrischend“, fuhr er fort. „Dieser Schlagabtausch. Nicht wegen der Reibung. Sondern wegen der Energie, mit der Sie das Gedicht betreten haben. Es war, als wollten Sie darin wohnen.“
Norahs Blick blieb ruhig. „Also geben Sie zu, dass ich Recht hatte?“
Ein Schmunzeln zuckte über seine Lippen. „Ich gebe zu, dass Sie mich gezwungen haben, genauer hinzusehen.“
„Das ist kein Nein“, entgegnete sie.
Julian lachte leise. Dann wandte er sich zum Tisch, griff nach einer schmalen Mappe.
„Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie gut in Literatur sind, Miss Winter…“ Er reichte ihr die Mappe. „Dann interpretieren Sie das hier.“
Norah nahm sie entgegen, ohne zu zögern. Sie öffnete sie, las die Überschrift – und zuckte nicht. Kein Blinzeln, kein Stirnrunzeln. Nur ein leiser, messender Blick.
„Bis wann?“
„Eine Woche.“
„Zwei Tage.“
Sie klappte die Mappe zu, drehte sich um und verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Julian sah ihr nach, bis die Tür hinter ihr ins Schloss fiel.
Er wusste nicht, was sie schreiben würde.
Aber er wusste, dass es ihn verändern würde.
Der Abend war still. Julian saß in seinem Arbeitszimmer, das Licht gedimmt, die Stadt hinter den Fenstern nur ein fernes Rauschen. Auf dem Tisch vor ihm lag das zerknitterte Blatt, das Gedicht, das er in- und auswendig kannte. „The Love Song of J. Alfred Prufrock“. Ein Text, der ihn seit Jahren begleitete – wie eine leise, nie ganz geklärte Frage.
Er nahm es zur Hand. Strich die Falten glatt, so wie sie es getan hatte.
Er begann zu lesen.
„Let us go then, you and I, When the evening is spread out against the sky…“
Die Worte kamen über seine Lippen, präzise, getragen von Verstand – aber nicht von Gefühl. Er hörte sich selbst, hörte das Gedicht, aber er hörte nicht sie. Nicht den Klang, den sie ihm gegeben hatte.
Er versuchte es erneut. Langsamer. Bedachter.
Doch es blieb Oberfläche. Intellekt. Ein Text, der klang wie ein Text – nicht wie eine Erfahrung.
Julian legte das Blatt ab, lehnte sich zurück. Fuhr sich mit den Fingern durch das Haar, dann über das Gesicht. Es war nicht das Gedicht, das ihn überforderte. Es war das, was sie daraus gemacht hatte.
Nur sie konnte es. Nur sie hatte diesen Ton gefunden – jenen Zwischenraum, in dem Worte plötzlich atmeten. Es war nicht nur Stimme. Nicht nur Lesart. Es war Präsenz. Und er begriff, dass das, was ihn so sehr faszinierte, nicht nur Norahs Fähigkeit war, Literatur zu durchdringen – sondern ihre Fähigkeit, sie zu werden.
Sie hatte das Gedicht nicht gelesen.
Sie hatte es gelebt.
Und er – der so viel wusste, der so oft gelehrt hatte, wie Sprache funktionierte – saß nun da und erkannte, dass er etwas Entscheidendes übersehen hatte.
Nicht jeder Text verlangt nach Analyse.
Manche verlangen nach einer bestimmten Stimme.
Und seine hatte heute nicht genügt.
Er griff nach dem Blatt, faltete es langsam zusammen, als wolle er es schützen.
Dann saß er still.
Und dachte an Norah Winter.
Norah hatte noch am selben Nachmittag mit der neuen Aufgabe begonnen. Kaum war sie in ihr Zimmer zurückgekehrt, hatte sie sich an den Schreibtisch gesetzt, die Mappe aufgeschlagen, ihre Notizen danebengelegt. Ihr Blick war klar, die Gedanken geordnet. Sie arbeitete konzentriert, präzise – nicht aus Druck, sondern aus dem Bedürfnis, dem Text gerecht zu werden.
Jetzt lag sie im Bett. Das Licht war gelöscht, nur die Straßenlaterne draußen warf einen matten Schimmer auf die Decke. Ihr Körper ruhte, doch ihr Kopf war hellwach.
Morgen würde die Vorlesung erst am Mittag beginnen. Das bedeutete: mehr Zeit. Zeit für die Bibliothek. Zeit für die Tiefe.
Und doch war es nicht der Text, an den sie gerade dachte.
Es war Julian.
Sein Blick, als er ihr die Mappe überreicht hatte. Nicht überheblich. Nicht herausfordernd im klassischen Sinn. Es war... prüfend gewesen. Nicht ob sie gut war. Sondern wie sie es war. Seine Worte klangen noch in ihr nach – dieses Lob, das sich wie eine Bewegung unter der Haut festsetzte. Und dieser Moment, in dem er sie schweigend hatte lesen lassen.
Aber heute dachte sie nicht nur an das, was er sagte. Sondern an ihn selbst.
Sein Äußeres.
Es war das erste Mal, dass sie es wirklich wahrnahm. Bisher hatte sie es ausgeblendet, vielleicht absichtlich. Doch jetzt tauchte es in ihrem Kopf auf wie ein Bild, das sich nicht mehr zurückdrängen ließ. Die Art, wie sein Hemd sich über seinen Rücken spannte, wenn er sich vorbeugte. Die feinen Linien an seinen Schläfen, die verrieten, dass er oft in Gedanken war. Die Muskeln unter dem Stoff – nicht zur Schau gestellt, aber da. Und unübersehbar.
Es passte nicht zu seinem Denken. Oder vielleicht gerade doch. Diese kontrollierte Kraft, die sich nicht in der Lautstärke seiner Stimme zeigte, sondern in der Art, wie er sprach. Wie er sich bewegte. Wie er stand.
Er war... zu viel. Und gleichzeitig genau richtig.
Norah schloss die Augen, aber die Gedanken blieben. Er war nicht nur ein Mann. Nicht nur ein Dozent. Er war ein Widerspruch in sich. Und sie wusste nicht, was gefährlicher war – seine Intelligenz.
Oder die Tatsache, dass sie ihn plötzlich schön fand.
Ein Klopfen an der Tür riss sie aus dem Gedanken. Dann öffnete sich die Tür, ohne dass sie etwas sagen musste.
„Ich wusste es!“, rief Terra und trat mit einer Selbstverständlichkeit ein, als gehörte der Raum ihr. „Du hast an ihn gedacht.“
Norah drehte den Kopf zur Seite. „Wovon redest du?“
„Julian. Das Nachsitzen. Die Szene. Deine geheime literarische Liebschaft. Ich will jedes Detail.“
Norah schüttelte den Kopf, setzte sich halb auf. „Es war kein Nachsitzen.“
„Dann nenn es anders. Private Poesie-Session mit Blickkontakt. Wie war’s?“
Norah wollte widersprechen, aber der Blick ihrer Freundin war zu erwartungsvoll. Also schwieg sie. Und das Schweigen sagte mehr, als Worte es gekonnt hätten.
Die Bibliothek war in diese besondere Stille getaucht, die nur der Vormittag kannte. Das Licht fiel milchig durch die hohen Fenster, streifte die alten Holztische, an denen vereinzelt Studierende saßen – in Bücher vertieft, in Gedanken verschwunden.
Norah bewegte sich zielstrebig durch die Regalreihen. Ihr Blick wach, der Schritt gelassen. Sie suchte eine bestimmte Ausgabe von Virginia Woolfs Essays – vergriffen, nicht digitalisiert, durch nichts zu ersetzen. Es ging ihr nicht nur um den Text. Sondern um das Papier. Den Satz. Das Gewicht der Seiten.
Sie fand das richtige Regal, kniete sich hin und strich mit den Fingern über die Buchrücken. Konzentriert, fast wie im Takt ihres eigenen Atems.
Dann hörte sie ihn. Noch bevor sie ihn sah.
Seine Schritte klangen anders. Nicht hastig, nicht zögerlich. Einfach da. Wie eine kleine Temperaturverschiebung.
Sie richtete sich auf. Langsam.
Julian stand nur eine halbe Armlänge entfernt. Kein Buch in der Hand. Kein Hallo. Nur dieser Blick – ruhig, direkt, ein bisschen zu lang.
„Verlaufen?“, fragte sie.
„Oder gefunden.“
Norahs Mundwinkel zuckten. „Klingt fast poetisch.“
„Muss an der Umgebung liegen.“
„Ich arbeite.“
„Natürlich. Wie könnte ich das vergessen.“
Sie zog eine Braue hoch. „Ironie steht Ihnen nicht.“
„Dann ist es vielleicht einfach... Interesse.“
„An mir oder an Woolf?“
Er sah kurz zu den Regalen, dann wieder zu ihr. „Im Idealfall: an der Kombination.“
„Charmant“, murmelte sie. „Fast schon gefährlich.“
„Sie wirken nicht, als würden Sie sich so leicht gefährden lassen.“
„Vielleicht tu ich nur so.“
Eine Pause. Kurz, gespannt.
„Sie haben mich überrascht“, sagte er.