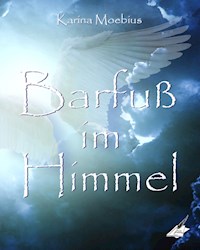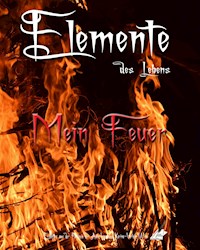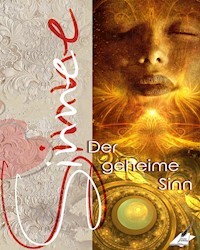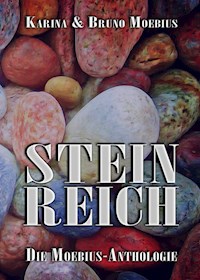
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mediagency
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Jahre und Jahrzehnte sammeln sich Erinnerungen an, die man nicht missen oder die man mit Freunden teilen möchte. Hinzu kommen noch kleine Geschichten, die man einfach aufschreiben musste und nicht für sich behalten möchte, nur, weil sie sonst keinen passenden Rahmen zur Veröffentlichung gefunden haben.Wir haben unsere Schubladen, Festplatten und Speichersticks geräumt und diese Kleinode gesammelt, um sie schön geordnet vor unseren Lesern auszubreiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEINREICH
Die Moebius – Anthologie
von
Karina & Bruno Moebius
Impressum
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
© 2021, Mediagency
Texte: © Karina Moebius, Bruno Moebius
Textbearbeitung und Layout: Karina und Bruno Moebius
Cover Design: Karina Moebius
Herausgeber: Mediagency, [email protected]
Table of Contents
Titelseite
Impressum
EINFACH TIERISCH
Alles für den Katz’
Auf den Hund gekommen
Max und Moritz
Der Wandervogel
Im Adlerhorst
Tag der offenen Tür
KINDER
Der Traum vom Fliegen
Wundersame Gartenzwergvermehrung
Alles ganz normal
KÜNSTLERSEELEN
Duett im Park
Steinreich
Ich gehe in den Keller
Sie küsst mich, sie küsst mich nicht
SO EIN THEATER
Biedermann
Jeannette
Genuss und Reue
Das Ende nach dem Ende nach dem …
LEHRREICH
Die Moebiusschleife
Begriffen?
Ein Händedruck wie Rührei
Der Neunundzwanzigste
FAMILIENGESCHICHTEN
Die Beförderung
Das Fenster zum Hof
Die Wärmestube
Schillers Locken
Pitralon ist kein Duftwasser, aber es wirkt
Im Wandel der Zeit
Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen
Was kost’ die Hetz?
Von der Magie eines Berges
BÜRO, BÜRO
Die Bosse
Ein Räucherstäbchen für Barney
Captain auf der Brücke
MYSTERIÖSES
Engel
Die Schneekugel
Eine blassblaue Scheibe
Welche Torte?
ABENTEUERLICHES
Kreuzfeuer
Ein Sprung ins Nichts
Schwimmen leicht gemacht
Mit gutem Beispiel voran
Unvergessliches Down Under
Andre Länder – andre Sitten
AUS DEM LEBEN
Tage wie dieser
Wie ein Lottosechser
Die Maske
Nur keine Panik
Pandemischer Einkauf
Luftgeschäfte
Powidltatschkerl à la Murphy
Happy Birthday
Ernesto
Eile mit Weile
Dreimal Apotheke und zurück
Balkongeflüster
Train People
Über den Autor
Über die Autorin
Bildnachweis
EINFACH TIERISCH
Alles für den Katz’
Karina Moebius
Auch ich war einmal stolze Katzenbesitzerin. Da fällt mir auf: Was ist das nur für ein unsinniges Wort? ›Katzenbesitzerin‹. Jeder der nur ein bisschen Erfahrung mit Katzen hat, weiß ganz genau, wie es sich mit den königlichen Hoheiten und ihrem Personal verhält. Also von vorne: Auch ich diente einst einem Katzentier.
Mein roter Kater aus dem Waldviertel war gleich am Anfang seines Lebens dem Tod geweiht. Der Bauer, auf dessen Hof das Miezekatz’ geboren wurde, wollte den ganzen Wurf ›eliminieren‹. So kam es – und weil einige Menschen dies zu verhindern suchten – dass ich über sieben Ecken zu einem acht Wochen alten Kätzchen kam.
Von meiner Kollegin Evi hatte ich ein paar Wochen zuvor von jenem Wurf erfahren, in dem es einen roten Kater gab, und den könne ich haben, hieß es. Schließlich hatte ich Monate zuvor verlauten lassen, dass, wenn ich mir jemals eine Katze aussuchte, es ein roter Kater sein müsse. Jetzt musste ich Farbe bekennen und das tat ich: Ich bekannte mich zu Rot. Es war zwar völlig unklar, ob das Tier das ›richtige‹ für mich wäre, ob wir zueinander passten, und daher ein bisschen riskant, ein mir völlig unbekanntes Tier zu adoptieren, und doch entschied ich in diesem Moment aus dem Bauch heraus, dass ich genau diesen roten Kater zu mir nehmen wollte.
Nun hatte ich noch reichlich Zeit, denn die Kätzchen sollten mindestens acht Wochen bei ihrer Mutter bleiben dürfen. Am Tag X wurde mir eine Handvoll rotes zappeliges Fell, das nach Heuboden duftete, ins Haus geliefert. Es eroberte mein Herz im Sturm.
Meine Wohnung war natürlich längst auf Katzentauglichkeit geprüft und alles, was nicht niet- und nagelfest war, in Sicherheit gebracht worden. Ein Katzenklo hatte seinen Platz gefunden, Katzenbaby-Futter war reichlich angeschafft und ein Bettchen bereitgestellt. Nie werde ich diesen ganz besonderen Moment vergessen, als ich das Katzenbaby zum ersten Mal in der Wohnung auf den Boden setzte und ihm erklärte, dass dies jetzt sein neues Zuhause sei. Für einen ganz kurzen Moment saß es etwas verschreckt auf dem ungewohnten Parkettboden im Vorzimmer, doch schon nach ein paar Sekunden siegte die Neugierde. Das fingerlange Schwänzchen, kerzengerade in die Höhe gestreckt, zitterte vor Aufregung. Mutig – wenn auch noch etwas vorsichtig – ging es auf die erste Erkundungstour. Nach ein paar Minuten hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, Kätzchen und Katzenklo einander vorzustellen. Es klappte in der Sekunde und Katerchen wusste von Anfang an, wo er sein Geschäft verrichten sollte.
*
Jenes Katzenkind war nicht die allererste Katze in meinem Haushalt. Für ganz kurze Zeit beherbergte ich ein Findelkind, das sich allerdings schon sehr bald – nämlich bereits nach ein paar Stunden – als wohnungsuntauglich zeigte. Damals noch in meiner ersten Wohnung, die aus einem Zimmer und Küche, ohne Türe dazwischen, bestand, büßte ich rund zwei Monate lang alle Sünden dieser Welt mit jenem kleinen Wildfang gründlich ab.
Eines Tages beim Heimkommen hatte ich ein maunzendes ungefähr sechs Monate altes Katzenkind auf dem Fensterbrett des zu meiner Wohnung gehörenden Gangfensters im Altbau gefunden. Niemand im Haus wusste, woher das Katzenkind kam, und so gewährte ich ihm Asyl. Vorübergehend mit Option auf Bleiberecht. Doch dieses Bleiberecht geriet bereits am ersten Tag erheblich in Gefahr. Der unkastrierte Kater zeigte sich wild und ganz offensichtlich überhaupt nicht sozialisiert. Täglich gab es kleinere, doch zumeist große Aufregung, weil sich das Tier völlig daneben benahm. Tischtuch und alles, was sonst noch auf dem Tisch stand, wurden beim wilden Galopp über die Tischplatte auf den Boden gefegt, die damals modernen Textiltapeten gnadenlos als Kratzbaum missbraucht und Blumentöpfe aus Jux und Tollerei – wie mir schien – von den Fensterbänken geworfen. Alles, was er in die Krallen bekam, wurde gnadenlos zerstört. Ich selbst wurde attackiert, wann immer ich am Tisch vorbeiging, denn da wartete auf dem Sessel, jedoch versteckt hinter dem Tischtuch, ein kleines Monster, das mich ansprang, kratzte und biss. Nachts war natürlich auch keine Ruhe, an Schlaf nicht zu denken. Sobald ich weggedöst war, sprang mich der verrückte Kater an, fauchte und kratzte aus heiterem Himmel und biss herzhaft zu.
Alle Recherchen, wohin das wilde Tier gehören könnte, blieben erfolglos. An jedem Baum und in jedem Geschäft im Bezirk hing ein Zettel, der darauf hinwies, dass ein Kater gefunden worden war. Leider ohne Ergebnis. Irgendwann, nach ungefähr drei Monaten guten Willens, als die heimische Situation mit ihm – trotz aller Tierliebe – nicht mehr auszuhalten war, wetterte mein damaliger Mann:»Der Kater muss weg!« Schweren Herzens brachten wir ihn ins Tierschutzhaus.
Zu dieser Zeit lebte auch Giacomo, der Singsittich, benannt nach Giacomo Casanova, bei mir. Ich hatte ihn ein paar Jahre zuvor von einer Arbeitskollegin ›geerbt‹. Bis zum Erscheinen des Katers in unserer Hausgemeinschaft erwies er sich zwar seiner Natur nach als extrem sangesfreudig, war aber ein verträglicher, recht zutraulicher Zeitgenosse. Doch plötzlich mutierte er zum ›Kampfhahn‹. Er zeigte keinerlei Respekt vor dem Katzentier und schien es zu genießen, ihn bis zur Weißglut zu reizen. Dass er vom wilden Kater nicht gefressen wurde, hatte er des Öfteren meinem beherzten Einschreiten und seiner, dem Kater haushoch überlegenen, Intelligenz zu verdanken. Ich war mir sicher, dass Giacomo am Ende doch glücklich war, als der Wildfang ausziehen musste und er wieder alleine über unser Reich herrschte.
*
Kurze Zeit später zogen wir mit unserem Vogel in eine neue Wohnung in einem anderen Bezirk. Giacomo durfte in ›seinem‹ Zimmer frei fliegen und genoss weitgehend sein manchmal doch etwas einsames Vogelleben. Eines Tages brachte mein Mann zwei junge Meerschweinchen samt Käfig nach Hause und platzierte sie im Vogelzimmer. Gespannt warteten wir die Reaktion unseres fliegenden Hausgenossen ab und waren gar nicht überrascht, dass er sich an den Neuzugängen höchst interessiert zeigte. Bald traute er sich, auf dem Meerschweinchenkäfig zu landen, beäugte die beiden Jungtiere aus der Nähe und zwitscherte ihnen etwas vor. Auch die Meerschweinchen, genannt Pepino und Violetta, fanden das lustig flatternde, singende Ding spannend und quiekten vergnügt. Also konnten wir unsere Mitbewohner ohne Sorge alleine im Raum lassen.
Eines Tages, als ich ins Zimmer kam, sah ich, dass Giacomo an der Seite des Meerschweinchenkäfigs – in Augenhöhe der Meerschweinchen – hing und seltsame, wippende Bewegungen machte. Ich schlich mich an und beobachtete eine Weile, wie der Vogel Körner herauf würgte und damit, durch die Gitterstäbe hindurch, Pepino und Violetta fütterte. Das Verhalten des Vogels erschien mir schon etwas fragwürdig, aber dass sich die beiden Meerschweinchenkinder füttern ließen, empfand ich als mittlere Sensation. Da das Miteinander meiner kleinen Schar besser funktionierte als erwartet, öffnete ich die Dachluke des Meerschweinchenkäfigs und wartete, was jetzt wohl passierte. Es dauerte keine zwei Minuten, und schon saß Giacomo mit Pepino und Violetta im Heu und hüpfte mit ihnen vergnügt herum. Von nun an blieb die Dachluke offen und der Vogel durfte seine Freunde besuchen, wann immer er wollte.Als die Meerschweinchen ein paar Monate alt waren, stellte sich heraus, dass Violetta in Wahrheit ein Violetto war. Das tat zwar meiner Liebe keinen Abbruch, doch das soziale Verhalten der zwei ›Eber‹ veränderte sich. Zum einen taten sie, was ihnen ihre Natur vorgab; sie ritten fröhlich aneinander auf. Zum anderen begannen sie kräftigst ihr Revier zu markieren. Kurz gesagt: Es stank fürchterlich. Das tägliche Reinemachen war nicht mehr ausreichend, der Käfig war ständig pitschnass. Womöglich wäre ein größerer oder ein zweiter Käfig die Lösung gewesen, doch mein Mann entschied:»Die Viecher müssen weg!«
*
Ungefähr ein Jahr später entschied ich: »Der Mann muss weg!«, und lebte fortan mit meinem Vogel in Frieden und Eintracht. Als sich eines Tages die Gelegenheit bot, ein Katzenbaby zu adoptieren, machte ich mir Gedanken, ob das jemals gut gehen könnte, denn Giacomo war zwar ganz offensichtlich sehr sozial veranlagt, aber doch einigermaßen katzengeschädigt. Ich spielte also auch diesbezüglich Risiko und wollte den Versuch wagen.
Irgendwann an jenem ersten Tag erkundete das Katzenkind natürlich auch das Wohnzimmer, jenen Raum, in dem Giacomo jetzt logierte. Als das Kätzchen in Sichtweite des Vogels kam, schien er vor Aufregung fast zu platzen. Nicht böse oder aggressiv. Im Gegenteil, er erschien mir freudig aufgeregt und fraß innerhalb kürzester Zeit die Hälfte seines Futters auf. So schien es mir jedenfalls.
Auch der Kater hatte den Vogel entdeckt und kam neugierig näher. Er saß unterhalb des Käfigs, maunzte hinauf und Giacomo zwitscherte aufgeregt hinunter. Mutig öffnete ich den Vogelkäfig; startklar, um das Katzenbaby vor einem möglicherweise wildgewordenen Vogel zu retten. Der flatterte aber zum Katzenkind auf den Boden und begann umgehend die eben aufgenommenen Körner heraufzuwürgen, um das Baby zu füttern. Ich war sprachlos. Der schlaue Vogel hatte doch tatsächlich gleich erkannt, dass hier wieder ein Baby saß, das man füttern musste. Das Baby war irritiert und blieb eine ganze Weile damit beschäftigt, die dargereichten Gaben abzuwehren. Es war einfach zu komisch.
Um dem Vogel verständlich zu machen, dass das arme Kätzchen ohne ihn hier nicht zu verhungern drohte, stellte ich einen kleinen Teller mit Katzenfutter auf den Boden und das Katzenkind machte sich sofort darüber her. Allerdings hatten wir die Rechnung ohne Giacomo gemacht, denn der erwies sich als solidarisch und wollte an dieser Mahlzeit teilhaben. Es schmeckte ihm zwar nicht und er spuckte jeden Bissen wieder aus. Doch er gab nicht auf. Er musste unbedingt mit von der Partie sein. Das Kätzchen guckte anfangs zwar etwas pikiert, doch es akzeptierte den ungebetenen Gast an seiner Futterration.
*
Am Ende eines langen und für Mensch und Katz’ gleichermaßen anstrengenden ersten Tages, brachte ich das immer noch namenlose Baby in sein Bettchen und zog mich ins Schlafzimmer zurück. Rückwirkend betrachtet frage ich mich natürlich, was ich mir dabei gedacht hatte. Mensch im Schlafzimmer, Katzenbaby draußen, konnte nur in meiner Vorstellung funktionieren. Kaum im Bett hörte ich vor der Tür das Kätzchen jammern. Das dünne noch ganz piepsige Stimmchen versetzte mir gnadenlos Stiche ins Herz. Ich war bereits nach ein paar Minuten geschlagen und holte das kleine Bündel zu mir ins Bett. Ich legte es auf die Decke und für ungefähr 60 Sekunden schien das Baby zufrieden. Dann ging es auf Wanderschaft. Es fand seinen perfekten Schlafplatz auf dem Kopfkissen – in meinem Nacken. Nicht, dass es sich angekuschelt und wir beide selig geschlummert hätten, nein, es begann umgehend zu treten. ›Milchtritt‹ hatte ich im Zuge meiner Katzenbesitzer-Bildungsmaßnahmen im Vorfeld gelesen. Das Problem wäre ja keines gewesen, hätte das Katz’ nicht noch ganz feine, nadelspitze Krallen gehabt. Mit der Zeit tat das gehörig weh. Immer wieder legte ich das Kätzchen neben mich und streichelte es, in der Hoffnung, dass es bald einschlafen möge und der schmerzhafte Spuk bald ein Ende hätte. Mitnichten! Nach dem ungefähr zehnten Versuch gab ich mich auch hier geschlagen und überließ das Katzenbaby der Illusion, an Mamis Milchquelle zu kuscheln.
Die Nacht war schlaflos und mein Nacken am Morgen feuerrot und komplett zerkratzt. Weitere Versuche an den nächsten Abenden, das Kätzchen aus dem Schlafzimmer auszusperren, scheiterten genauso wie der erste und das Katzenkind durfte weiterhin in meinem Nacken schlummern. Doch ein kleines bisschen klüger war ich schon geworden. Im Kleiderschrank fand sich ein altes Kapuzen-Shirt. Damit war ich in der Nacht zwar nicht sehr schön, aber dem Miez’ war es egal und vor allem durfte er jetzt ohne Störung in meinem Nacken liegen und aus Leibeskräften treten.
Am Morgen unseres zweiten Tages bekam das Katerle endlich seinen Namen. Irgendwie hatte es den Weg auf meinen Schreibtisch geschafft und nun inspizierte es ausgiebigst den Computer. Letztlich schlummerte es friedlich auf der Tastatur. So erhielt mein neuer Mitbewohner seinen Namen nach einer damals schon mehr als zwanzig Jahre alten Programmiersprache. Pascal …
Pascal entwickelte sich zu einem liebenswürdigen und verschmusten Kater. In seinen Kinder- und Jugendjahren erlebten wir einige Abenteuer miteinander, auf die ich gerne verzichtet hätte. Offensichtlich gehörten sie aber zum Erwachsenwerden dazu. Ich musste mehrere ›Rettungsaktionen‹ durchführen, weil das Katzenkind in seinem Übermut regelmäßig den Vorhang bis zur Decke hinauf geklettert war, den Weg hinunter aber nicht mehr finden konnte und panisch zum Steinerweichen schrie.
850 Gramm Katze hatten es auch geschafft, das – zugegeben ein bisschen wackelige – Bücherregal zum Einsturz zu bringen. Wie das passieren konnte, ist mir bis heute rätselhaft. Zum Glück trug der Kater nur so etwas wie ein ›Veilchen‹ davon. Ein Leben hatte er also bereits im Alter von ein paar Wochen verjubelt. Ich verbrachte die Nacht damit, Pflanzen zu retten, deren Töpfe zerbrochen waren, das Regal wieder aufzubauen, Bücher herumzuräumen und den Dreck wegzuputzen. Glücklicherweise hatte ich stets fachkundige Hilfe zwischen meinen Beinen. Zwischendurch wurde das geschwollene Katzenauge mehrfach mit Kamillentee und Bachblüten behandelt.
Vogel und Katz’ vertrugen sich recht gut; zusammen ließ ich die beiden aber nur, wenn ich dabei war und die Situation überwachen konnte. Sicherheitshalber … Giacomo hatte seinen Drang, den Kater zu füttern, nie abgelegt, und als dieser größer wurde, versuchte der Piepmatz aus irgendeinem mir unbekannten Grund, die heraufgewürgten Körner zwischen den Zehen des Katers zu deponieren. Der Kater wiederum saß eine Weile gelassen da und ließ das Prozedere über sich ergehen. Wenn es ihm irgendwann zu bunt wurde, setzte er sich auf und schüttelte die Pfote – mit tatsächlich angewidertem Gesichtsausdruck – ab. Ich lache heute noch über seine Mimik.
Pascal wurde älter und es kam, was kommen musste: Wir schritten zum Kastrationstermin. Als die Tierärztin die Ordinationstür öffnete, erwartete sie, dass sie den Katzenkorb in Empfang und ich im Warteraum Platz nehmen würde. Da hatte sie sich aber geirrt.
»Was, Sie wollen dabei sein?«, fragte sie ungläubig. »Ja, wenn Sie ein bisschen Blut sehen können, habe ich nichts dagegen. Sie könnten mir sogar helfen!«
Und so half ich tatkräftig mit, meinen Katzenfratz zu kastrieren, indem ich die Hinterbeine auseinanderhielt. Die Aktion lässt mich allerdings heute noch innerlich aufschreien und ist sicher nichts für zartbesaitete Menschen. Bald darauf wackelte ich tief erschüttert mit dem noch schlummernden Katz’ im Korb nach Hause.
»Springen sollte er halt heute noch nicht!«, wurde mir als weiser Ratschlag mit auf den Weg gegeben. Wie ich das anstellen sollte, darüber erhielt ich keine Auskunft. Sicherheitshalber richtete ich dem Kater ein Bettchen auf dem Wohnzimmerfußboden neben der Couch und legte mich erschöpft auf ebendiese. Mittlerweile war Pascal wach geworden und wollte unbedingt zu mir hoch. Also nahm ich den noch taumeligen Kater, legte ihn mir vorsichtig auf den Bauch und wir beide schliefen völlig erledigt ein. Irgendwann wachte ich auf, weil ich eine seltsame Empfindung hatte. Warm und nass. Zu meiner übergroßen Freude war die Blase des Katers ob der Narkose etwas inkontinent. Mich beschlich der Verdacht, dass dies die Rache für meine tatkräftige Unterstützung bei der Kastration war …
Wie es zu erwarten war, wurde Pascal mit der Zeit ein wenig ruhiger. Aber eben nur ein kleines bisschen. Er lernte zu apportieren, galoppierte durch die Wohnung wie ein Haflinger und malträtierte seinen Kratzbaum. Um die närrischen fünf Minuten, die so ein Kater zwischendurch haben kann, sinnvoll zu nützen, entwickelten wir das Spiel des ›Fünf-Minuten-Intensivbalgens‹. Dazu zog ich mir einen alten, fast ellbogenlangen Motorradhandschuh an, und losging eine wilde Rauferei auf dem Fußboden. Pascal lernte schnell, dass er jetzt ohne Rücksicht kratzen, beißen und mit den Hinterbeinen strampeln durfte. Zweimal täglich reichte aus, um einen halbwüchsigen Kater in Zaum zu halten. Ich lache heute noch über seinen Gesichtsausdruck und Körperhaltung, wenn ich ›unseren Raufhandschuh‹ anzog. Große Augen, spitze Nase, verdrehte Ohren, Katzenbuckel, Schwanz und Haare wie Antennen aufgestellt hüpfte er seitwärts und erwartete meinen Angriff. Manchmal ließ ich ihn ›gewinnen‹, was er nach der kurzen Schlacht regelmäßig mit einer Stunde Intensiv-Schmusens honorierte.
*
Irgendwann in jenen Jahren zog ein neuer menschlicher Partner bei mir ein. Er mochte zwar Kater und Vogel recht gern, doch begeistert war er über die tierischen Mitbewohner nicht gerade, denn sie machten Dreck. Vor allem der Vogel. Doch da hatte der Mann Pech gehabt. Sein ständiges Wettern: »Der Vogel muss weg!«, stieß auf meine tauben Ohren. Uns gab es nur zu dritt. Punkt.
*
Pascal liebte das Spiel ›Flugkatzi‹, wozu ich ihn über Kopf hochhob und mit wohldosierter Kraft durch die Wohnung warf. Für einen Augenblick segelte er wie ein Flughörnchen durch die Luft, um dann gut gefedert aufzuspringen und sofort den nächsten Flug einzufordern. Ich schaffte es nie, ihn damit müde zu machen, denn es war immer ich, die irgendwann die Arme nicht mehr heben konnte und ›Nein‹ sagte. Das Katzentier hätte vermutlich noch Stunden weitermachen können.
Eines Tages, als ich zum Einkaufen gehen wollte, fand ich den Kater im Einkaufskorb. Und nein, er hatte überhaupt keine Lust, aus dem Korb zu steigen. Er krallte sich an und ließ sich partout nicht herausheben. In meiner Verzweiflung begann ich Korb samt Kater zu schaukeln und hoffte, dass es ihm unangenehm werden würde und er freiwillig sein enttarntes Versteck verließ. Falsch gehofft. Er liebte die Schaukelei und schnurrte, was das Zeug hielt. Künftig wurde Pascal täglich zumindest einmal geschaukelt. Manchmal verschwand er im Einkaufskorb und schrie laut nach mir, damit wir doch endlich wieder ›Sturmboot‹ spielen mochten.
Weil wir durch den lebhaften und meist sehr nachtaktiven Kater zu wenig Schlaf bekamen, war irgendwann die Zeit gekommen, ihn tatsächlich hartherzig vom Schlafzimmer zu entwöhnen. Wahrscheinlich war es für mich schwieriger als für mein Katzenkind. Mein Freund trug seinen Teil zum konsequenten Durchhalten dieser für mich unmöglichen Aktion bei. Doch schon nach einigen Tagen funktionierte es tadellos. Der Katz’ blieb zwar aus dem Schlafzimmer ausgesperrt, durfte aber nachts über den Rest der Wohnung allein herrschen. Morgens aber, wenn der Wecker klingelte, ließ ich ihn zu mir ins Bett und wir zelebrierten die beliebten fünf Minuten ›Morgenschmusen‹ im Bett. Leider wusste Pascal bald – auch am Wochenende – ganz genau, wann es sechs Uhr war …
Manchmal erwarteten mich am Morgen Überraschungen in Form von kleineren bis mittleren Zerstörungen, fabriziert durch einen gelangweilten Kater. Der Schaden hielt sich in Grenzen und ich konnte ganz gut damit leben. Mein Freund weniger. Nur eine Überraschung hätte ich mir gerne erspart: Eines Nachts musste ich zur Toilette, tappte im Dunkeln barfuß durchs Vorzimmer und … Autsch! Ich war auf meinen Kaktus gestiegen, der auf mysteriöse Weise seinen Weg vom Fensterbrett auf den Fußboden vor der Schlafzimmertür gefunden hatte. Es war wohl der einzige Moment, in dem ich mein Katzentier hasste. Fast hätte es sein zweites Leben verbraten. An den Verletzungen meiner Fußsohle laborierte ich wochenlang. Schmerz lass nach!
»Die Viecher müssen weg!«, stieß trotz allem einmal mehr auf taube Ohren.
Tatsächlich verbraucht hatte Pascal sein zweites Leben an jenem Tag, als er ungewollt seinen Weg auf den ungeschützten Balkon fand und in der allgemeinen Aufregung abstürzte. Zu unserem Glück wohnten wir im ersten Stock und unter dem Balkon befand sich Rasen. Ich schätze, der Kater hielt den Flug von oben für eine Erweiterung des beliebten ›Flugkatzi‹-Spiels, war dann aber doch etwas überrascht, sich in einer völlig fremden Umgebung wiederzufinden. Es war gar nicht einfach, den erschrockenen Kater einzufangen, doch mit gutem und beruhigendem Zureden gelang es mir, mein Baby zu bergen und nach Hause zu bringen. Während der wenigen Meter von unterhalb des Balkons bis zur Eingangstür und in den ersten Stock, klammerte er sich wie ein verschrecktes Kind an mich. Doch in dem Moment, als er wieder heimischen Boden unter den Pfoten hatte, tat er, als ob nichts gewesen wäre, und hüpfte vergnügt herum. Meine eigene Aufregung hatte sich erst nach zwei Tagen gelegt.
Die meisten Katzeneltern haben sich wohl mehr als nur einmal die Frage gestellt, was tun, wenn man wegfahren möchte. Zum Glück war dies mit meinem Katzenkind absolut kein Problem, denn es erwies sich als äußerst pflegeleicht und fremdelte in fremder Umgebung maximal fünf Minuten. Danach war das neue Territorium annektiert und solange reichlich Futter verabreicht wurde, war die Katzenwelt heil geblieben. Auch die Rückkehr ins eigene Heim konnte problemlos vollzogen werden.
Einmal, als wir einen kleinen Urlaub antreten wollten – er sollte ohnehin nur sieben Tage dauern –, wurde Pascal zu einer Freundin gebracht und Giacomo erhielt einen Pflegeplatz bei meinen ›Schwiegereltern‹. Was niemand erwartet hatte, war, dass sich der Schwiegervater total in den Vogel verliebte und ihn gar nicht mehr hergeben wollte. Der alte Herr verbrachte fast den ganzen Tag im Vogelzimmer und unterhielt sich mit ihm. Worüber genau sie sprachen, haben sie mir nie verraten. Die Sympathie beruhte jedenfalls auf Gegenseitigkeit; die beiden alten Zausel verstanden sich prächtig. Mein Freund unterstützte den Antrag seines Vaters, den Vogel behalten zu dürfen, vehement. Er hätte es dort ja viel besser, weil den ganzen Tag reichlich Ansprache da wäre, die wir ja nicht bieten konnten. Dermaßen gekonnt manipuliert, sagte ich zu. Giacomo blieb noch lange Zeit – bis an sein seliges Ende im hohen Alter von vierundzwanzig Jahren – in seinem neuen Zuhause.
Der Vogel war weg – mein Freund hatte gewonnen.
*
Ich weiß nicht, wie oft ich »Der Katz’ muss weg!« gehört hatte. Doch in diesem Fall ließ ich mich auf keine Diskussionen ein. Der Kater blieb, der Mann ging. Aus heutiger Sicht war das auch gut so. Damals heulte ich wochenlang, doch ich hatte einen liebevollen Gefährten, der mir nicht von der Seite wich und meinen Kummer durch aufopfernde Zuwendung zu vertreiben suchte. Ich honorierte seine Treue damit, dass er wieder bei mir im Schlafzimmer schlafen durfte. Nach ein paar Monaten war der große Schmerz dahin und Pascal und ich genossen wie in unseren ersten Jahren das traute Zusammensein ohne störende Zwischenrufe.
*
Mein roter Schmusebär war natürlich die wichtigste Person im Haushalt; er musste überall dabei sein und alles wissen. Jedwede Aktivität wie Kochen oder Putzen wurde streng überwacht und zwischen meinen Beinen hilfsbereit unterstützt. Nur den Staubsauger mochte er nicht so gern. Da verzog er sich freiwillig – meistens in den Einkaufskorb.
Als Baby liebte er es, meine Beine in Kniehöhe anzuspringen, und den Rest des Weges in meine Arme hochzukrabbeln. Als erwachsener Kater sprang er mir – sobald ich mich in einer leicht gebückten Haltung befand – auf den Rücken oder auf Schulter. Besonders beliebt war dies immer dann, wenn ich mir, über die Badewanne gebeugt, die Haare wusch. Dann machten es sich fünf Kilo Kater auf meinem Rücken bequem und verfolgten interessiert die Pritschelei in der Badewanne. Auch die leicht gebückte Haltung über dem Waschbecken – beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste – war ein Anreiz, dem Pascal nicht widerstehen konnte. Angespornt vom Surren der Zahnbürste sprang er vom Badewannenrand auf meinen Rücken, um von dort sein eigenes Spiegelbild anzuschnurren. Gelegentliche Kratzspuren nahm ich mehr oder weniger gelassen hin.
Ganz besonders interessant erschien aber ein Vollbad meinerseits. Der Katz’ schlich auf dem Badewannenrand um mich herum und beobachtete jede Bewegung ganz genau. Manchmal saß er auch nur da, entspannte sich und schnurrte. Dabei sank sein Schwanz immer tiefer, bis er ins Wasser tauchte. Das wiederum war ihm höchst unangenehm und es bedurfte einer ausgiebigen Putzaktion. Doch einmal passierte etwas für uns beide extrem Unangenehmes. Der Schwanz des dösenden Katers sank tiefer, um irgendwann im Badewasser unterzugehen. Pascal erschrak, hüpfte hoch, rutschte ab und landete unter Wasser. Er strampelte panisch, ich schrie, hüpfte meinerseits erschrocken auf und rettete den Kater aus dem Wasser. Mit dem nassen und immer noch strampelnden Kater im Arm sprang ich aus der Badewanne und schloss die Badezimmertür, damit mir das nasse Ungeheuer nicht die ganze Wohnung versauen möge. Erst danach setzte ich das völlig entsetzte Tier auf den Boden und rubbelte es ausgiebig mit meinem Badetuch trocken. Irgendwann entließ ich Pascal zur weiteren Fellpflege aus dem Badezimmer. Der Blick in den großen Spiegel über Waschbecken lehrte mich das Gruseln. Ich war vom Hals bis zu den Beinen zerkratzt und blutete, als wäre ich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Jetzt begann es auch wehzutun. Nun war ich eine ganze Weile damit beschäftigt, meine Wunden zu versorgen und im Anschluss das Badezimmer wieder sauber zu machen. Als ich endlich fertig war und mich im Wohnzimmer auf der Couch niederlassen wollte, lag der Katz’ zusammengerollt auf meinem Platz und schlief völlig entspannt.
Dieser Platz war es auch, um den wir jahrelang ›kämpften‹.
Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause kam, gab es ein ganz bestimmtes Ritual. Der erste Schritt war, dem hungrigen Katzenkind etwas zu essen zu geben. Dann zog ich mich um und ging meistens zur Toilette. Bis zu diesem Zeitpunkt war die dargereichte Mahlzeit bereits verdrückt und der Kater saß vor der Klotüre und begehrte Einlass. Den habe ich ihm trotz aller Liebe nie gewährt, ein paar Minuten musste er es noch ohne mich aushalten. Dann ging ich, verfolgt vom Kater, ins Bad, und wusch mir die Hände. Wenn ›wir‹ fertig waren, standen wir vor der Badezimmertür, sahen einander an, einer sagte ›LOS!‹ und wir beide rannten durch das Vorzimmer in den Wohnraum. Das Spiel hieß: ›Wer als Erster auf der Couch ist‹. Natürlich hatte ich keine Chance gegen den Vierbeiner. Triumphierend erwartete er mich auf ›meinem‹ Platz auf der Couch. Er liebte dieses Spiel und wir spielten es jahrelang fast täglich.
*
Mein kleiner Schnurrbär steckte seine Nase überall ungefragt hinein und sah aufmerksam nach dem Rechten. So musste ich zum Beispiel sehr vorsichtig sein, wenn ich die Eingangstür aufmachte, denn so schnell konnte ich nicht schauen, war der Katz’ draußen und bereits im zweiten Stock. Nicht nur einmal sammelte ich den maulenden Kater ein und verfrachtete ihn wieder in die Wohnung. Ich glaube, mit dieser Aktion wollte er verhindern, dass ich morgens zur Arbeit ging. Ab und zu, wenn ich den Katz’ aus dem oberen Stockwerk geholt, in der Wohnung eingesperrt hatte und danach zur Arbeit ging, erwartete mich beim abendlichen Nachhausekommen eine kleine Protestüberraschung.
Doch eines Abends, als ich von der Arbeit müde die Wohnungstür aufschließen wollte, klebte ein Zettel daran.
»Pascal ist bei Frau Benedikt« Bei Frau Benedikt? Wie konnte denn das passieren und warum ausgerechnet bei Frau Benedikt? Wir kannten einander zwar und grüßten freundlich, wenn wir einander trafen, aber das war auch schon alles. Wie um Himmels willen ist mein Kater ausgerechnet bei ihr gelandet? Am nächsten Tag recherchierte ich Folgendes:
Wie auch sonst so gerne, war mir der Katz’ beim Verlassen der Wohnung entschlüpft. Mit dem erheblichen Unterschied, dass ich es diesmal nicht bemerkt hatte.
Natürlich dauerte es nicht besonders lange, da saß das arme verlassene Katzenkind auf der Türmatte und weinte bitterlich. Dies rief umgehend meine Nachbarin von vis-à-vis auf den Plan. Sie nahm Pascal zu sich und versorgte ihn ›mit dem Nötigsten‹. Sie selbst war Mutter von fünf Katzentieren, und so kam es ihr auf einen mehr oder weniger auch nicht mehr nicht an. Mein Alphatier übernahm umgehend die Herrschaft über die Nachbarskatzen sowie deren Terrain. Dummerweise musste Nachbarin Nicole ausgerechnet an diesem Tag selbst weg und wollte das Findelkind nicht unbeaufsichtigt mit ihrer eigenen Meute in der Wohnung lassen. Dies konnte ich gut nachvollziehen. Nicht auszudenken, was die beim Revierkampf alles hätten anstellen können.
Unter normalen Umständen wäre der unerwartete Hausgast zu Nachbarin Inge ins Erdgeschoß weitergereicht worden. Auch Inge hatte eine Katze und darüber hinaus kannte sie meinen Pascal von diversen Babysitterdiensten recht gut. Unglücklicherweise war sie zum Zeitpunkt, als Nicole gehen wollte, nicht zu Hause. Also wurde bei der Nachbarin auf Tür Nummer 1 im Erdgeschoß angefragt. Die neunzigjährige alte Dame war überfordert, da sie keine Ahnung hatte, was sie mit einer Katze in ihrer Wohnung anfangen sollte. Letztlich hat sie sich aber doch erbarmt, das Waisenkind eine Weile aufzunehmen. Nachbarin Nicole gab also den Kater mitsamt eines kurzfristig für ihn hergerichteten Besucher-Katzenklos ab und ging ihren Geschäften nach. Natürlich wurde das arme Katzerl auch im neuen Quartier ›mit dem Nötigsten‹ versorgt. Was sich ansonsten im Domizil der alten Dame abgespielt hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass sofort nach Heimkehr der Nachbarin Inge diese mit dem Herrn Katz’ beglückt wurde. Dort verhielt es sich ähnlich wie einen Stock höher bei Nicole. Der Katz’ wurde ›mit dem Nötigsten‹ versorgt und übernahm umgehend die Herrschaft über Mensch und Tier. Hauskatze Simba verzog sich schmollend und fauchte vom Schlafzimmerkasten. Leider musste auch Inge nach ein paar Stunden wieder weg. Die alte Dame von Tür Nummer 1 wollte sie nicht mehr behelligen, Nicole war auch noch nicht zu Hause und daher fand der Kater mitsamt Katzenklo seinen Weg zu Nachbarin Benedikt. Selbstredend, dass das arme Katzenkind auch dort ›mit dem Nötigsten‹ versorgt wurde.
So kam ich also abends heim und fand die Nachricht von Frau Benedikt an der Tür. Diese war sichtlich erleichtert, als ich mein Balg abholte und nach Hause verfrachtete. In meiner Unwissenheit über die Ereignisse des Tages versorgte ich voll schlechtem Gewissen den armen Buben ›mit dem Nötigsten‹. Ausgehungert, wie er war, fraß er für drei. Danach rollte er sich zusammen und schlief erschöpft bis zum nächsten Morgen. Kein Wunder bei so viel Aufregung an nur einem Tag …
*
Pascal war nun schon über sieben Jahre bei mir, doch mein Leben hatte sich mittlerweile stark verändert. Ich war beruflich sehr eingespannt und machte die eine oder andere Dienstreise. Mein armes Baby musste immer öfter über Nacht alleine bleiben, weil sich eine Tagesreise zeitlich nicht ausging. Ich überlegte hin und her, ob eine zweite Katze eine gute Lösung wäre, konnte mich dazu aber nicht so schnell entschließen.
Irgendwann fasste ich den Entschluss, die Wohnung zu renovieren. Jetzt stellte sich als Erstes die Frage, wie ich das mit dem Katz’ im Haus bewerkstelligen könnte. Als ich mit meiner Nachbarin Nicole darüber sprach, erzählte sie, dass auch ihre Mutter sich mit dem Gedanken trug, eine zweite Katze aufzunehmen. Der Kater der Mutter war so wie Pascal sieben Jahre alt. Er stammte aus Nicoles Rudel und war nun sehr einsam und unzufrieden, weil er seine Freunde vermisste. Also fragten wir bei ihrer Mutter an, ob sie Pascal für vier oder fünf Wochen beherbergen wolle, damit ich renovieren könnte. Mutti war von dieser Idee begeistert und bald schon brachte ich meinen Liebling zu ihr. Wir hatten keine Ahnung, wie zwei gleichaltrige, einander fremde Kater aufeinander reagieren würden, und ließen es auf einen Versuch ankommen. Die Buben verstanden sich auf Anhieb und ich konnte in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen renovieren.
Bis die Wohnung endlich fertig war, waren bereits sechs Wochen vergangen. Nicoles Mutter hatte angefragt, ob Pascal nicht bei ihr bleiben könnte, weil sich die beiden Kater so gut verstanden und so lieb miteinander waren. Mich traf fast der Schlag, doch ich wollte es mit ihr bei einem Kaffee besprechen. So besprachen wir und dabei beobachtete ich die beiden Kater, die miteinander spielten und aneinandergekuschelt schliefen. Nun hatte ich die Wahl: Mein geliebtes Katzenkind wieder zu mir zu nehmen, damit ich mich nicht so alleine fühlte, wenn ich daheim war, oder ihm zu erlauben, dortzubleiben, wo er nicht alleine und ganz offensichtlich glücklich und nicht so einsam wie bei mir war.
Pascal durfte bleiben und mir steigen heute noch, nach mehr als zwanzig Jahren, Tränen in die Augen, wenn ich an diese Entscheidung – möglicherweise die härteste meines Lebens – denke.
*
Pascal lebte mit seinem Freund ungefähr zehn Jahre bei Nicoles Mutter. Am Anfang besuchte ich ihn ab und zu, doch ich merkte bald, dass ich längst nicht mehr Bezugsperson war, und das tat sehr weh. Also beließen wir es bei gelegentlicher Berichterstattung durch Nicole. Jahrelang träumte ich immer wieder von meinem Baby und weinte jedes Mal – genau so wie jetzt gerade– bittere Tränen.
Irgendwann, vor ungefähr zehn Jahren, informierte mich Nicole, dass Pascal eingeschläfert werden müsse, weil es ihm schon länger nicht mehr gut gehe. Er war nun über siebzehn Jahre alt und hatte Probleme mit den Nieren. Nein, ich wollte nicht dabei sein und verkroch mich an jenem Tag heulend zu Hause …
So gerne hätte ich wieder ein Katzenkind in meiner Obhut! Mein mittlerweile ungewöhnliches und kreatives Leben ist dafür aber eher ungeeignet. Es wäre unmöglich, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wegzuräumen. Zu viele Bilder, Bücher und sonstiger Schnickschnack zieren die Wohnung. Ein Musiker mit seinen zahlreichen Instrumenten, tonnenweise technischem Equipment und rund eintausend Kabeln, lebt an meiner Seite. Die Wohnung wäre ein riesiger – und gefährlicher – Abenteuerspielplatz für ein Katzentier. So viel Abenteuer brauche ich in meinem Alter auch wieder nicht. Außerdem – so tröste ich mich selbst – könnte keine Katze der Welt den rothaarigen Rabauken von einst ersetzen …
Auf den Hund gekommen
Karina Moebius
Ich bin ein Katzenmensch. Nach Genuss der vorigen Geschichte ›Alles für den Katz’‹ sollte das jedem klar geworden sein. Hunde wiederum sind mir lieb, aber so lieb nun auch wieder nicht. Natürlich wird jedes greifbare Exemplar gestreichelt und geknuddelt – sofern es sich lässt –, es wird versorgt oder, wenn es denn aus irgendwelchen Gründen doch einmal sein müsste, auch Gassi geführt. Vor einigen Jahren aber sollte ich mich ungewollt mit dem Zeitgenossen ›Hund‹ etwas intensiver auseinandersetzen müssen:
Alles begann ganz harmlos: Eine Freundin erzählte mir, dass eine gemeinsame alte Bekannte ein Wollgeschäft eröffnen wollte – von mir gar nicht weit weg. Das Eröffnungsdatum stand bereits fest und an jenem Tag war ich eine der ersten Besucherinnen. Der ›Wollsalon Sunshine Loop‹ ist schon seit Langem ein Geschäft in der Wiener City, nahm aber damals seinen Anfang im Haus meiner Bekannten. Von nun an verbrachte ich eine Menge Zeit im Wollsalon und aus der einstmaligen Bekanntschaft wurde langsam Freundschaft. Meine Freundin war und ist nicht nur begnadete Strickerin, sondern auch Architektin, und irgendwann half ich, die ich in jenen Jahren immer knapp bei Kasse war, im Architekturbüro aus.
Zur Belegschaft gehörten – nebst ein bis drei zweibeinigen Mitarbeitern – die schwarz-weiße meist etwas miesepetrige Katze Moneypenny und Amor, der in die Jahre gekommene wunderschöne rote Setter. Das Büro im Souterrain des Wohnhauses meiner Freundin wurde von Moneypenny gerne als Schlafplatz genutzt. Gelegentlich auch als Katzenklo. Trotz aller Putzattacken und offener Fenster konnte ein leichter Mief dem Raum nie ganz ausgetrieben werden.
Amor war unauffällig. Mit seinen fast dreizehn Jahren verschlief er die meiste Zeit, stieg manchmal mühsamst die Stufen zum Büro hinunter, um nach dem Rechten zu sehen, und wenn er hinaus musste, gab er kurz Laut. Dann eilte ich aus dem Souterrain nach oben, um den Hund hinauszulassen, eilte zurück an meinen Arbeitsplatz und wiederholte die Prozedur, wenn er sein Geschäft erledigt hatte und wieder lautstark Einlass begehrte.
Was soll’s? Bewegung ist gesund.
Alles hätte so schön sein können, doch von einem Tag auf den nächsten kam es anders.
Ich wurde direkt an der Gartentür von einem schwarzbraunen Fellknäuel begrüßt, das kläffend an mir hochsprang. Ich durfte ein neues Familienmitglied begrüßen: Hamfry, Gordon Setter, drei Monate alte, überschäumende, nicht zu bremsende Energie.
Mei, liab! Aber beruhigt sich der auch wieder?
Nein, so schnell sollte er sich nicht beruhigen und die Stimmung im Haus erfuhr eine dramatische Veränderung. Meine Freundin ist ja von ihrem Naturell her nicht unbedingt die Ruhe in Person und ich hatte den Eindruck, dass sie der kleine schwarze Teufel des Öfteren bis an ihre Grenzen trieb. Es hörte sich jedenfalls so an … Ich kann nicht mehr benennen, was der Hund alles anstellte, was er alles zerstörte. Weder die Schuhe des Hausherrn noch gerade fertiggestrickte Socken waren vor ihm sicher. Schon gar nicht frisch eingegrabene Blumenzwiebeln oder Himbeersträucher.
Meine Geduld mit dem kleinen Monster hielt sich in Grenzen – vielmehr war sie sehr schnell erschöpft. Ich hätte diesen Hund erwürgen können. Neben meiner Arbeit durfte ich öfter auch noch Hundebabysitten. Grundsätzlich ja fein, wer darf das schon?
Aber muss der so schlimm sein?
Ich erinnere mich, dass der Hausherr irgendwann mit ihm zur ›Welpenschule‹ ging und dass er mitsamt seinem offensichtlich untragbaren Welpen dort hinausflog.
Moneypenny, die meine Arbeit früher gerne auf meinen Knien dösend überwacht hatte, blieb für einige Zeit unsichtbar. Sie wollte anscheinend mit all dem hier nichts zu tun haben. Irgendwann gewöhnte sie sich schließlich doch an die Anwesenheit des Ungeheuers, blieb aber ständig auf der Hut. Sie kam auch wieder zurück auf meine Knie und schnurrte mich freundlich an. Doch an jenem Tag, als Hamfry ins Büro stürmte und die Katze auf meinem Schoß bzw. vice versa die Katze das Ungeheuer sah, musste ich es ausbaden. Der Hund bellte hysterisch eine Oktave höher als sonst und stürzte auf uns zu, die Katze fauchte, stieß sich unter Einsatz ihrer Krallen von mir ab und sprang auf den Tisch, rutschte auf losen Blättern ein Stück dahin und nahm dann doch lieber die Route unter den Tischen zum Ausgang. Innerhalb eines Augenblicks flogen Zettel, schwappte Kaffee und jaulte meinereiner auf. Der Schmerzensschrei ging allerdings im allgemeinen Tohuwabohu, nämlich dem Gepolter des Papierkorbs, der durch die Gegend flog, als Hamfry mit Gebell der kreischenden Katze nachgaloppierte, unter. Moneypenny verschwand durch die Katzenklappe und Hamfry rotierte davor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm von draußen die Stinkekralle zeigte.
Katzenkrallen in den Oberschenkeln sind nicht so prickelnd und ich sollte noch ein paar Tage beim Duschen Freude daran haben …
Eines Tages bescherte mir Hamfry eine besondere Morgengabe. Suncica war bereits unterwegs; den Hund hatte sie daheim gelassen, weil ich ja sowieso in Kürze zur Arbeit kommen würde. Als ich vor Arbeitsantritt die Stiegen zum Souterrain hinunterstieg, wunderte ich mich über den beißenden Gestank. Was war denn da los? War irgendetwas mit dem Kanal nicht in Ordnung?
Ach, du Sch…
Im wahrsten Sinne des Wortes. Hundedurchfall auf nüchternen Magen ist nicht sooo toll. Die ungarische Mitarbeiterin im Architektenbüro, die es zwar geschafft hatte, das Fenster zu öffnen, danach aber über den Haufen gestiegen war und jetzt im Gestank an ihrem Arbeitsplatz saß, sah mich erwartungsvoll an.
Es war also an mir – ganz offensichtlich –, die Riesensauerei zu bereinigen. Bravo! So etwas hatte ich mir immer schon gewünscht. Und:
Wie, bitte, kann ein einzelner Hund so viel kacken?
Hamfry freute sich unendlich über meine Anwesenheit, und während ich die weiche Hundekacke in einen Kübel schaufelte, sprang er mich übermütig an und versuchte, mich abzuschlabbern.
Wie, bitte, tötet man einen Hund schnell und schmerzlos?
Ähnlich sprunghaft ging es zu, als ich einmal Ablage machte und einen Ordner ganz unten im Kasten verstaute. Während ich – bereits mit leichten Ermüdungserscheinungen in den Oberschenkeln – vor dem Kasten kauerte und den Ordner in die übervolle Reihe stopfte, kam das Untier auf mich zu, sprang mich mit voller Wucht von der Seite her an, und dank meiner instabilen Position landete ich auf dem Rücken – mit dem schlabbernden Hund über mir.
Wäh! Geh weg!
Ähnlichen Gefahren setzte ich mich immer wieder aus, wenn ich über die Hunde steigen wollte, die gelegentlich neben meinem Schreibtisch auf dem Boden lagen und pennten. So leise konnte ich gar nicht sein, dass sie nicht just in jenem Moment aufsprangen, in dem ich mit nur einem Bein auf dem Boden stand und mit dem anderen im Begriff war, über sie hinwegzusteigen. Nicht nur einmal kämpfte ich mit einem Hund zwischen den Beinen verzweifelt um mein Gleichgewicht.
Eine Zeit lang fühlte sich der alte Amor durch den Jungspund im Haus ganz offensichtlich angespornt und gewissermaßen verjüngt. Manchmal erschien er wesentlich agiler als früher, manchmal hatte ich aber auch das Gefühl, dass er seinen Übermut bitter bereuen musste und ihm nach einer Spielattacke alles noch mehr wehtat als früher. Manchmal nervte Hamfry aus lauter Langeweile gehörig, während Amor döste, manchmal nervten sie mich auch gemeinsam. Eine Episode ist mir noch ganz deutlich in Erinnerung:
Der Hund kläffte. Nein, in Wahrheit waren es beide Hunde, die irgendwo oben im Wohnzimmer tobten und bellten. Suncica war im Haus und daher maß ich dem Krach im Oberstübchen wenig Bedeutung zu. Etwaiger Kollateralschaden lag nicht in meiner Verantwortung.
Wenn’s ihr zu viel wird, lässt sie ganz bestimmt einen Ordnungsruf los …
Plötzlich klingelte mein Telefon.
»Kann bitte jemand den Amor reinlassen?«
Klar – kann ich.
Etwas verwundert, weil ich das Gekläffe räumlich so falsch zugeordnet hatte, sprang ich auf, quetschte mich am dicken Kollegen Pepi vorbei, stolperte die Stufen zum damaligen Wollsalon hoch und kam atemlos an der Eingangstür an. Doch dort war kein Hund zu sehen, stattdessen aber von noch weiter oben zu hören.
Was ist jetzt? Sind die doch schon im Wohnzimmer?
Etwas zögerlich wollte ich mich schon wieder zurückziehen, doch dann kam mir der Gedanke, dass Amor ja durch den Garten und die Stiegen hoch zur Terrassentür gelaufen sein könnte und von dort Einlass ins Wohnzimmer begehrte.
Der Arme! Dem tut eh die Hüfte so weh!
Also lief auch ich durch den Garten, die Stiegen hoch und ja, da stand er, der schon leicht grummelige alte Hund, und sah mich vorwurfsvoll an. Ich hatte mich räumlich also nicht wirklich vertan. Um ein paar Meter maximal.
»Ich bin ja schon da! Reg dich ab!« Schwungvoll wollte ich die Tür öffnen, doch leider war sie von innen versperrt. Damit hatte ich nicht gerechnet. »Bleib schön da, Amor! Hast g’hört?«
Ich sauste die Stiegen hinunter, durch den Garten zur Eingangstür hinein, stolperte im Vorraum über die von Hamfry malträtierten Schuhe des Hausherrn, sprang die Stufen in den ersten Stock hoch, flog fast über den fein säuberlich zusammengeschobenen Teppich.
Wo ist eigentlich Hamfry?, fiel mir spontan ein. Warum nur?
Endlich erreichte ich die Terrassentür vom Wohnzimmer aus und öffnete in bester Absicht und … kein Hund mehr da. Aber ich vernahm Hundegekläffe. Von unten.
Also: Terrassentür zu, über Hundespielzeug hinweg durchs Wohnzimmer – den Teppich kannte ich ja schon –, Stiegen hinunter und gleich wieder über die Latschen gestolpert. ›Dinner for One‹ kam mir in den Sinn und entlockte mir ein Schmunzeln. Schnell riss ich die Eingangstür auf.
Kein Hund. Der kläffte wieder. Aber oben.
Mittlerweile war ich genervt und vom ungewohnten Sprint auch schon etwas erledigt. Also, ›same procedure‹ wie gerade vorher. Ich öffnete die Terrassentür und wundersamerweise hüpften gleich zwei Hunde vor mir herum. Vielmehr hüpfte einer und der andere sah mich bitterböse an. Also gut, beide Hunde durften herein und im Wohnzimmer toben. Auftrag erledigt.
Ich schaute kurz im Chefinnenbüro vorbei, gab Ezzes zu einem wichtigen Brief und trollte mich wieder nach unten in Richtung Arbeitsplatz. Interessanterweise erwarteten mich vor der Eingangstür zwei schwanzwedelnde Hunde, die sooo gerne hinaus wollten.
Ohne mich, ihr Pfeifen …
Das schwarze Monster hielt alle auf Trab und niemand konnte seiner Herr werden. Niemand? Wirklich niemand? Die Ausnahme hieß Cookie.
Cookie, die schwarze Labradordame gehörte zu Uschi, die immer wieder zu uns in den Wollsalon kam. Amor und Hamfry freuten sich sehr über Cookies gelegentliche Besuche und zu dritt ging die Wilde Jagd durch den Garten. Während sich Amor und Cookie schnell wieder beruhigten, konnte Hamfry kein Ende der Freude finden und sprang und tobte immer noch. Doch Cookie Wunderhund – wie sie gerne genannt wurde und immer noch wird – zeigte Hamfry sehr deutlich, wo die Grenzen des Erträglichen lagen. Wir stellten fest, dass sie ihn erzog. Um nachhaltige Wirkung zu hinterlassen, hätten Cookie und Uschi letztlich doch öfter kommen müssen. Aber zumindest war für eine Weile ein Ansatz von Ruhe zu spüren.
Die Monate im Architekturbüro hielten fast täglich Überraschungen für mich bereit und nicht zuletzt bleibende Erinnerungen.
In jener Zeit, als ich noch rauchte, ging ich ungefähr alle zwei Stunden in den Garten, um mir eine Zigarettenpause zu genehmigen. Die Hunde waren natürlich mit von der Partie. Zumindest Hamfry, denn Amor verschlief immer wieder mal, um dann bei unserer Rückkehr beleidigt dreinzuschauen.
Während ich so dastand und paffte, schleppte mir das Ungeheuer immer wieder Spielzeug in Form von mehr oder weniger zerbissenen Bällen oder irgendwelchen abgelutschten Plastiktieren an. Immer in der Hoffnung, dass ich es ihm möglichst weit weg werfe und er hinten nach galoppieren konnte. Und das tat ich dann natürlich so gut und weit, wie ich es eben konnte.
Knirsch! – Aauutsch!!!
Was auch immer da gerade passiert war, meine Schulter schmerzte höllisch und wollte gar nicht mehr aufhören. Es dauerte eine Weile, bis sich der Schmerz legte und die Schulter nur noch bei ›blöden‹ Bewegungen wehtat. Das sollte zwei bis drei Jahre so bleiben.
Wie das im Leben eben so ist: Die Dinge verändern sich. Amor ging über die Regenbogenbrücke, ein neuer Welpe – Bond – kam ins Haus. Irgendwann war mein Job getan und der Wollsalon übersiedelte in ein Stadtgeschäft. Meine Freundin trennte sich von ihrem Mann und mit ihm zog auch das schwarze Ungeheuer aus. Letztlich schrieb ich ein Kinderbuch, in dem Hamfry als Freund des kleinen Drachen eine sympathische Rolle bekam und auf ein paar Bildern verewigt wurde.
Die Schulter tut mittlerweile nur noch gelegentlich weh, doch eine kleine Einschränkung ist geblieben. So wird mir das Untier wohl für immer und ewig in Erinnerung bleiben und Hunde werden auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala weiterhin auf Platz drei, hinter Katzen und Vögeln, rangieren.
Allerdings gibt es zwei Ausnahmehunde, die ich wirklich gerne mag: Einer davon ist Cookie Wunderhund.
Max und Moritz
Karina Moebius
Ist es nicht erstaunlich? Vielmehr: Ist es nicht traurig? Wenn heutzutage ein Bauer seine neugeborenen Kälbchen bei der Mutterkuh belässt, so ist das sogar eine Schlagzeile wert. Gerade habe ich eine solche Schlagzeile gelesen und mich daran erinnert, dass ich selbst schon aus einer Zeit stamme, in der das ganz normal, das natürlichste aller Dinge, war.
Meine Eltern hatten ein Zimmer auf einem Bauernhof gemietet und jedes Wochenende und den gesamten Sommerurlaub verbrachten wir auf dem ›Berghof‹. Aus welcher Zeit dieser Name stammte, war ungewiss. Der Berghof lag jedenfalls nicht in Berchtesgaden, sondern nahe einem kleinen Kaff in Niederösterreich.
Als Kind war das natürlich immer eine Sensation, wenn es auf Jungtiere gab. Ob Schweinderl, Küken, junge Kätzchen oder Kälbchen, alle hatten eine magische Anziehungskraft und ich verbrachte meine Zeit im Stall, auf dem Heuboden oder auf der Weide und ich konnte das Band zwischen Muttertieren und Kindern immer wieder hautnah miterleben.
Es war irgendwann Anfang der Siebzigerjahre, da gab es zwei Stierkälbchen auf dem Hof. Max und Moritz. Mit ihnen verbrachte ich Wochenende für Wochenende auf der Weide. Dabei habe ich gelernt, dass auch Rinder Erinnerungsvermögen besitzen. Es schien, als ob Max und Moritz jeden Freitag schon auf mich warteten. Kaum angekommen, tobten wir zu dritt über die Wiese, während die beiden Mutterkühe und die Tanten das Spektakel zwar aufmerksam, aber relativ gelassen verfolgten. Ich denke, auch sie erkannten mich.
Dem Sommer sollte in jenem Jahr ein strenger Winter folgen und wir fuhren nicht auf den Hof, weil man nur noch mit dem Traktor auf den Berg hinaufkonnte.
Erst im Frühjahr verbrachten wir unser erstes Wochenende wieder beim Bauern. Wir erfuhren, dass Moritz den Winter nicht überlebt hatte, weil er bei einem kurzen Freigang auf dem Eis im Auslauf ausgerutscht, gestürzt war und sich dabei ein Bein gebrochen hatte. Moritz wurde vom Fleischhauer geholt … Eine schauderbare Vorstellung!
Max ging es gut. Er war zu einem stattlichen Jungstier herangewachsen und ich wollte unbedingt zu ihm auf die Weide.
»Lieber nicht!«, sagten die Bauern.
»Auf gar keinen Fall!«, beharrten meine Eltern.
Doch mir, in meinem jugendlichen Übermut – ich war gerade einmal dreizehn oder vierzehn Jahre alt –, war das egal. Ich ging auf die Weide und da stand Max ungefähr fünfzig Meter von mir entfernt und schnaubte in meine Richtung. Ich erinnere mich, dass ich mit ihm redete und er plötzlich den Kopf hob und die Ohren spitzte. Sofern man das bei Rindern so sagen kann. Nach einem Moment rannte er in Höchstgeschwindigkeit auf mich zu. Ehrlich, ich wusste in diesem Augenblick auch nicht, wie ich dran war, und flüchtete sicherheitshalber über den Zaun. Wenige Meter vor mir bremste sich Max ein, kam dann langsam auf mich zu. Ich redete immer noch auf ihn ein – oder schon wieder – und er hörte zu und ließ sich erst einmal zwischen den Ohren kraulen. Ich war und bin sicher, dass er mich erkannt hatte, obwohl alle behaupteten, dass das nicht sein konnte.
Nun, so unbeschwert wie ein Jahr zuvor tobte ich mit ihm nicht mehr über die Wiesen. Er brachte wohl schon vierhundert Kilogramm auf die Waage und ein freundschaftlicher Schubser seinerseits hätte fatale Folgen für mich haben können. Immerhin, so schlau war ich mittlerweile auch. Ich erinnere mich aber, dass meine Eltern und auch die Bauern den Kopf schüttelten und gar nicht glauben konnten, dass unsere Freundschaft den Winter überdauert hatte.
An einem Wochenende im Sommer kamen wir wieder auf den Hof und Max war nicht mehr da. Der Fleischhauer hatte auch ihn geholt. Ich heulte mindestens eine Woche durch und mir wird heute noch ganz schwummerig, wenn ich daran denke …
Damals habe ich es als relativ ›normal‹ hingenommen, dass die süßen Tierbabys irgendwann ihr Leben aushauchen müssen, um uns als Nahrung dienen. Trotzdem fand ich es gruselig, dachte aber nie wirklich darüber nach. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich Fleisch nie besonders mochte, und es wundert mich heute, warum es noch mehr als dreißig Jahre dauern sollte, bis ich mich davon endgültig losgesagt hatte.
Ja, früher einmal, da hatten die meisten Tierbabys zumindest eine unbeschwerte, wenn auch kurze, Kinderzeit und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was es für sie bedeutet, dass sie heutzutage in Massen nur zu einem einzigen Zweck geboren werden: dem Gefressenwerden!