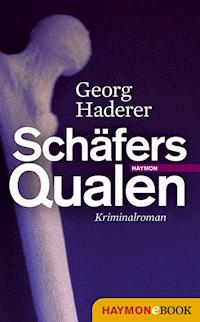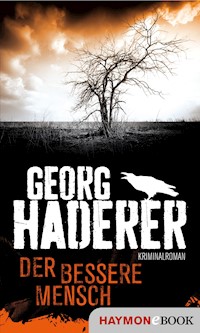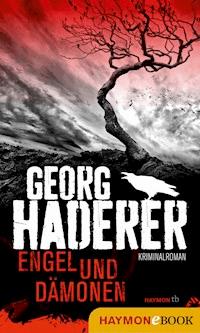Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schäfer-Krimi
- Sprache: Deutsch
EIN MÖRDER ZURÜCK IN DER FREIHEIT. EIN ORT IN AUFRUHR. EIN BÖSES GEHEIMNIS. Es brodelt im beschaulichen Dienstort von Major Schäfer: Frederik Bosch, vor 26 Jahren für den Mord an der siebenjährigen Susanna Paulus verurteilt, hat sich nach seiner Entlassung aus der Haft ausgerechnet bei Schaching, wo das Verbrechen einst geschah, niedergelassen. Seine Rückkehr sorgt unter den Bewohnern für Empörung. Die werden sich schon beruhigen, ist Schäfer überzeugt. Doch dann kommen ihm Andeutungen zu Ohren, die Boschs Schuld in Frage stellen. Er beginnt nachzuforschen und stößt auf Ungereimtheiten und ignorierte Indizien. Und immer wieder auf einen angesehenen Bürger namens Luis Strommer, der offensichtlich etwas zu verbergen sucht. PACKEND, ÜBERRASCHEND UND VON BEISSENDER KOMIK Georg Haderers neuer Kriminalroman: ein literarisches Kaleidoskop aus skurrilen Charakteren, einem ebenso genialen wie abgedrehten Ermittler, schrägen Begegnungen und psychischen Ausnahmezuständen. ************** "Die Krimis von Georg Haderer sind wie ein Mosaik aus Spannungsliteratur, Unterhaltung, Charakterstudie und Gesellschaftskritik." "Eine kleine Provinz in großem Aufruhr: Ein Jäger wird erschossen, ein angeblicher Kindermörder zieht zurück in sein Heimatdorf. Das können die Bewohner nicht zulassen und wollen den Entlassenen im wahrsten Sinne des Wortes beseitigen. Aber was hat sich damals und heute wirklich zugetragen? Mit unerwarteten und dramatischen Wendungen zieht Georg Haderer die Leser in seinen Bann." "Heißer Lesetipp: Fesselnd, ironisch und mit viel Wortwitz - Georg Haderer schreibt Krimis vom Feinsten!" ************** GEORG HADERERS KRIMINALROMANE MIT MAJOR SCHÄFER: * Schäfers Qualen * Ohnmachtsspiele * Der bessere Mensch * Engel und Dämonen * Es wird Tote geben * Sterben und sterben lassen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Haderer
Sterben und
sterben lassen
Kriminalroman
1.
Wie der Mann dort auf dem Baumstumpf saß: mit zittrigen Fingern an einer Zigarette saugend, in eine graue Wolldecke gehüllt, die ihm einer der beiden Sanitäter übergelegt hatte, blass und verstört, ein Häuflein Elend, bemitleidenswert. Ein Glück für ihn. Sonst hätte Schäfer wohl längst einen schweren Ast aufgehoben und ihn totgeschlagen. Dieses Arschloch. Wer zu blöd war, einen Läufer von einem Wildschwein zu unterscheiden, sollte nicht mit einem Gewehr in den Wald gelassen werden. Restalkohol wahrscheinlich oder wärmender Morgenschnaps; von diesen grenzdebilen Kreaturen stieg doch keine nüchtern in den Geländewagen, wenn es zum Halali und Herumballern ging.
»Null Komma null«, merkte Inspektor Plank fast schüchtern an und hielt Schäfer das Testgerät hin.
»Ist wahrscheinlich auch sein IQ«, murrte der und trat zwei Schritte zurück, weil ihm der Gestank von Erbrochenem in die Nase stieg. Beim ersten Versuch, seinen Atemalkohol zu messen, hatte sich der Jäger auf Planks Schuhe übergeben, beim zweiten hatte ihn ein Hustenanfall außer Gefecht gesetzt, erst der dritte war erfolgreich gewesen.
»Ich will eine Blutprobe«, wandte Schäfer sich an den Notarzt, der nun auf ihn zukam und sich die Einweghandschuhe abzog.
»Würde ich lieber warten, bis er ein bisschen stabiler ist.«
»Stabil, hm«, murrte Schäfer und deutete mit dem Daumen über seine Schulter, wo in etwa zwanzig Metern Entfernung unter einer Aludecke ein Mann lag, aus dessen zerfetzter Oberschenkelarterie ein paar Liter Blut in den Waldboden gesickert waren. »So wie der da hinten, oder?«
»Lassen Sie Ihren Grant nicht an mir aus«, erwiderte der Arzt ohne merkbare Erregung in der Stimme.
»Tschuldigung«, Schäfer hob den Blick zu den Baumwipfeln. Er atmete tief durch und versuchte sich auf das Hämmern des Spechts zu konzentrieren, der dort oben unbekümmert seinem Tagwerk nachging. Wenn hier wer stabil werden musste, dann er selbst, gestand er sich ein. Dafür könnte er losrennen, eine halbe Stunde, bis er die Wut und den Hass herausgeschwitzt hätte, die in ihm brodelten. Er könnte auch den Arzt um irgendein Beruhigungsmittel bitten. Oder er könnte den Ast aufheben, auf dem er stand, und.
»In einer Stunde sind sie da«, sprach Inspektorin Auer ihn an.
»Wer?«
»Der Dobrits vom LKA und die Spurensicherung«, Auer steckte ihr Handy ein und wartete offenbar auf Anweisungen.
»Passt … Scheiße«, fluchte Schäfer, als das fremde Handy in seiner Jackentasche abermals läutete. Er nahm es heraus, sah aufs Display, Sylvia, er wartete, bis es verstummt war, und steckte es wieder ein. »Hat sich der Erwin gemeldet?«
»Ja, aber der ist mit der Familie in der Wachau und …«
»Schon klar.«
»Soll ich, vielleicht … weil ich sie doch kenne, die Frau Thurner und …?«
»Nein«, Schäfer schüttelte den Kopf, ließ seine Zähne ein paar Sekunden gegeneinander reiben und entfernte sich fünfzig Meter vom Zentrum des Geschehens. Drei Anrufe innerhalb einer Stunde. Das hieß wohl, dass Sylvia Thurner sich Sorgen machte. Oder dringend etwas brauchte. Zu Hause war sie nicht, das hatten Plank und Auer überprüft. Vielleicht wartete sie irgendwo auf ihren Mann. Krank vor Angst, dass Günther beim Joggen einen Herzinfarkt erlitten haben könnte. Nein, kein Infarkt, Frau Thurner, wo denken Sie hin, Ihr Mann war doch noch keine Vierzig und bei bester Gesundheit, ups, habe ich jetzt war gesagt? Verdammt. So lange er nicht wusste, wo oder in welchem Zustand sie war, wollte er Sylvia Thurner nicht anrufen und ihr mitteilen, dass ihr Ehemann vor einer guten Stunden verstorben war. Weil ihn ein Jäger mit einem Wildschwein verwechselt und ihm eine Kugel in den Oberschenkel geschossen hatte. Vielleicht saß sie gerade hinter dem Lenkrad, 160 auf der Autobahn, weil sie es gar nicht mehr erwarten konnte, bei ihm zu sein. Scheiße. Schäfer hob einen Fichtenzapfen auf, riss eine Schuppe heraus, steckte sie in den Mund und kaute auf ihr herum. Bitter. Er wollte rauchen. Doch damit würde er die Keine-vor-Mittag-Vereinbarung brechen, die er erst vor zwei Wochen mit sich selbst getroffen hatte. Ausnahmen in besonders belastenden Situationen hatte er sich keine zugesagt – mit so einem Selbstbetrug würde er es als Polizist nie schaffen, mit dem Rauchen oder Trinken aufzuhören. Er bemerkte zwei junge Männer und eine Frau in farbenfroher Sportkleidung, die ihre Mountainbikes zögerlich in seine Richtung schoben. Er ging ihnen entgegen und machte sie darauf aufmerksam, dass es sich hier um polizeiliches Sperrgebiet handelte.
»Was ist denn passiert?«, wollte die Frau wissen.
»Ein Unfall«, Schäfer drehte sich kurz weg und spuckte das bittere Holzstück aus, »von euch hat nicht zufällig wer eine Zigarette da, oder?«
»Doch, aber nur Tabak und …«, meinte einer der beiden Männer und wurde umgehend rot im Gesicht.
»Ich hab früher selber gedreht«, antwortete Schäfer und hielt fordernd seine rechte Hand auf.
»Ja, ich hab halt nur«, der Mann zog den Zipp seiner Bauchtasche auf, gab Schäfer eine Packung Tabak und Zigarettenpapier in XXL. »Nur Papier für große Männerhände«, ergänzte Schäfer, nahm ein Blatt, riss es entzwei und legte Tabak drauf. »Sonst denken meine Kollegen noch, dass ich hier einen Joint rauche.«
»Ist da wer gestorben?«, ließ die Neugier der Frau nicht locker, nachdem Schäfer seine immer noch verdächtig große Zigarette angezündet bekommen hatte.
»Ja«, Schäfer blies eine dichte Rauchwolke nach oben, die sich jedoch hartnäckig über ihren Köpfen hielt. Tiefdruck. Ein kräftiger Regenschauer, der wäre ihm jetzt ganz willkommen. »Könnt ihr eh alles morgen in der Zeitung lesen«, meinte er im Weggehen, klemmte sich die Zigarette zwischen die Lippen, nahm sein Handy sowie das des Toten heraus und übertrug die Nummer von dessen Frau.
»Frau Thurner? … Major Schäfer hier … Darf ich fragen, wo Sie sich gerade aufhalten? … Ja, Frau Thurner, es geht um Ihren Mann … es hat einen Unfall gegeben und … es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das sagen muss, Frau Thurner, aber … Ihr Mann ist leider verstorben.«
2.
Kurz vor drei Uhr nachmittags kam er nach Hause. Sich sofort umzuziehen und laufen zu gehen, wie er es sich im Wald und dann auf dem Posten erwartungsfroh ausgemalt hatte, reizte ihn nun überhaupt nicht mehr. Er ging in die Küche, trank einen halben Liter gespritzten Traubensaft, lehnte an der Spüle und starrte Löcher in die Luft. Zwei Stunden hatte er gemeinsam mit einem Kollegen vom Landeskriminalamt den Schützen einvernommen. Und ihn dann nach Hause gehen lassen. Schließlich gab es außer Schäfers Zorn nichts, was eine Verhaftung rechtfertigte. Nichts, was für einen Vorsatz sprach – wieso hätte er, Wolfgang Kappl, denn absichtlich auf Günther Thurner schießen sollen? Ja, sie hatten sich gekannt, flüchtig, wie man sich auf dem Land eben kennt, wenn man sich nicht näher kennt, aber Streit hätte es zwischen ihnen nie gegeben, auch nichts, um das sie sich streiten hätten können, wieso bitte hätte er denn absichtlich auf den schießen sollen?, hätte er auf irgendjemanden absichtlich schießen sollen? Kappl war 53 Jahre alt, geboren und wohnhaft in Schaching, Inhaber eines kleinen Speditionsbetriebs, der in den letzten paar Jahren drei Mal am Konkurs vorbeigeschrammt war – aber damit war er in der Gegend nicht allein. Fast dreißig Jahre verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Seit zwanzig Jahren besaß er eine Jagdberechtigung, noch nie war es zu einem Zwischenfall gekommen. Und was war heute anders gewesen? War etwas anders gewesen? Hatte er Medikamente genommen, die seine Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigten? War am Vortag oder im Laufe der Nacht etwas vorgefallen, das ihn außergewöhnlich belastet hatte, so dass er womöglich unkonzentriert gewesen war? Nein, nein, nein, nein. Wie oft musste er denn das noch wiederholen: Er hatte ein Wildschwein im Visier gehabt und keinen Menschen. Er hatte das Tier verfehlt und die Kugel hatte versehentlich, aber wie oft musste er das denn noch erzählen.
Schäfer schüttelte heftig den Kopf, als wollte er die Reste eines bösen Traums loswerden. Er machte sich einen Kaffee, stellte fest, dass die Milch aus war, und ging auf die Terrasse. Im Garten hüpften zwei Amseln umher und pickten in der braunen, matschigen Masse unter dem Kirschbaum nach Verwertbarem. Der Rasen – falls dieser Begriff noch zulässig war – sah nach dem misslungenen Experiment aus, eine künstliche Moorlandschaft anzulegen. Braungelb klebte das schlaffe Gras auf der Krume, darunter schlängelten sich wie Geschwülste die Aufschüttungen der Wühlmäuse, am Gartenzaun gesellten sich ein paar Maulwurfshügel dazu. Unberechenbares Luder, diese Natur. So sehr Schäfer die zunehmende Verwilderung des Gartens im vergangenen Jahr gefallen hatte: Jetzt fehlten nur noch ein paar herumliegende Doppelliter-Weinflaschen sowie eine ausgediente Waschmaschine und er würde im Ort als Mann im freien Fall gelten. Und wessen Arme waren schon stark genug, einen 46-jährigen Fall dieses Kalibers aufzufangen, ohne sich selbst mit in den Abgrund zu reißen. Herr Schrödinger spazierte mit seinem Hund vorbei, blieb am Gartenzaun stehen.
»Ja ja, da gibt’s ganz schön was zu tun«, meinte er lächelnd.
»Ja«, Schäfer machte ein paar Schritte in den Garten hinaus, worauf sich seine Hausschuhe sofort voll Wasser sogen. »Am Wochenende habe ich eh ein paar Freigänger aus Stein da, die erledigen das.«
»Und wie … und wer …«
»War nur ein Scherz«, winkte Schäfer ab, »ich hab schon einen Gärtner bestellt.«
»Ah! Immer wieder fall ich auf Sie herein, Herr Major!«, theatralisch mit dem Kopf schüttelnd machte Schrödinger einen Abgang.
Eine halbe Stunde später schob Schäfer einen Einkaufswagen durch den Baumarkt und bemühte sich, inmitten all der zielstrebig wirkenden Heimwerker, Schwarzarbeiter und Kampfgärtnerinnen nicht allzu hilflos zu erscheinen. Was trieben diese Menschen hier? Was taten sie mit diesen Massen an Zementsäcken, Spitzhacken, Schlagbohrmaschinen, Farbfässern, Plastikrohren, Armaturen … böse Ahnungen stiegen in ihm auf, Bilder von heimlich ausgehobenen Kellern, ausgebauten Verliesen, verschleppten Kindern – Schluss jetzt, er war hier, um seinem Polizistenleben etwas entgegenzusetzen, nicht, um es noch mehr aufzublähen. Bei den Baustoffen vorbei, dann rechts, geradeaus und da, wo Sie die Lampen sehen, noch einmal rechts: die Gartenabteilung. Alleine die Menge an Dingen, die Schäfer bekannt erschienen, überforderte ihn, ganz zu schweigen von all denen, die er nicht zuordnen konnte. Also kapitulierte er, packte in den Einkaufswagen, was ihm brauchbar erschien, und damit würde er eben bewerkstelligen, was möglich war.
Nachdem er den Kofferraum eingeräumt hatte, querte er den Parkplatz und betrat den Supermarkt. Suchte alle Taschen nach dem Einkaufszettel ab. Der wohl irgendwo zwischen Gartentisch und Baumarktkassa verloren gegangen war. Langsam zog er durch die Korridore, seine Augen scannten die Warenmassen, während das Gehirn versuchte, sich an die Worte auf dem gelben Zettel zu erinnern. Vor den Tiefkühlschränken kam Schäfer neben einem Mann in seinem Alter zu stehen, den er flüchtig kannte; zumindest die Adresse und dass von dort im letzten Jahr des Öfteren besorgte Nachbarn wegen lautstarker Streitereien inklusive wüster Drohungen angerufen hatten. So heillos überfordert, wie der Mann nun vor den Fertiggerichten ausharrte, war die Scheidung nun wohl endgültig. Schäfer nickte einen Gruß, ging rasch weiter, verwarf alle Gedanken an den verlorenen Zettel und füllte den Einkaufswagen nach Gutdünken. Die Impulsgondel, erinnerte er sich an diesen perversen Begriff, den er Jahre zuvor in einem Fachmagazin für Marketing aufgeschnappt hatte, das versehentlich im Postkasten seiner Wiener Wohnung gelandet war. Vielleicht würde die drohende Vergammelung der Lebensmittel, die er eben sammelte, seinem Sozialleben einen wichtigen Impuls geben, sinnierte er, während Frau Plaschg von der Feinkost einen riesigen geselchten Schweineschenkel auf die Wurstschneidemaschine hievte. Eine gute Gelegenheit, eine Einladung zum Abendessen auszusprechen. Stichwort Ablaufdatum. Sich wieder einmal die Frage stellen, ob sein Junggesellenleben immer noch zufriedenes Alleinsein oder schon bitter machende Einsamkeit war.
Aber wen sollte er so spontan anrufen? Marlene? Ein Zwiespalt. Einerseits hatte er sie sehr gerne; hatte sie vom ersten Augenblick an gemocht, als er ihr vor gut einem halben Jahr begegnet war. Sie arbeitete als Betreuerin für ein Heim der Lebenshilfe in einem Nachbarort und kümmerte sich dort mit drei Kolleginnen um gut zwanzig Menschen, die aufgrund verschiedener geistiger und körperlicher Beeinträchtigungen nicht alleine für sich sorgen konnten. Eine davon, eine 40-jährige Frau mit Down-Syndrom, büchste allerdings gerne aus, zog sich, sobald sie ihren Betreuerinnen entkommen war, Hose und Unterhose aus, lief freudig kreischend durch die Gegend, fummelte an ihrer Vagina herum und liebte es, Personen männlichen Geschlechts an sich zu drücken. Da sie kräftig war wie ein Fleischhauer, rief dieses Verhalten immer wieder die Exekutive auf den Plan. So hatte Schäfer zuerst eine wollüstige Gudrun kennen gelernt, die – kaum war er aus dem Streifenwagen gestiegen – auf ihn zugestürmt kam, ihn umklammerte und ihren Unterleib an ihm rieb; und kurz darauf Betreuerin Marlene, ein wandelndes Lachen, eine menschliche Sonne, die den Wunsch auslöste, sie zu umarmen und sich an ihrem Frohsinn zu wärmen.
Zwei Wochen später hatte er sich tatsächlich dazu durchringen können, sie anzurufen und zu einem Spaziergang einzuladen. Spaziergang? Na ja, die Vorstellung, in einem der örtlichen Cafés oder Restaurants mit ihr zu sitzen, hatte ihn beklemmt. Nicht der anderen Leute wegen, ganz bestimmt nicht, hatte er ihr versichert; es fiel ihm leichter zu reden, wenn er sich bewegte; vielleicht hatten ihn aber auch die unzähligen Stunden bei Vernehmungen so weit gebracht, dass er einer quasi unbekannten Person, der er länger als zehn Minuten gegenüber saß, nur mit Misstrauen begegnen konnte.
Zwei Tage später hatte Marlene ihn zum Abendessen eingeladen. Er hatte eine Flasche hinterhältigen spanischen Rotweins mitgebracht und war bis zum Frühstück geblieben. So weit, so unkompliziert. Bis er ein paar Wochen später in ihrem Bett von seinem eigenen Schreien wach geworden war, schweißnass und mit grässlichen Bildern im Kopf. Ob er schlecht geträumt hatte, wollte sie klarerweise von ihm wissen, und wovon. Irgendeinen Blödsinn, antwortete er. Du hast schon viele schlimme Dinge gesehen, oder?, fuhr sie fort, nachdem sie sich aufgesetzt und die Nachttischlampe angeschaltet hatte. Und er: Hm. Wegen deinem Beruf früher, bei der Mordkommission, gab sie nicht auf, drückte seinen Kopf sanft von ihrem Brustbein weg, so dass er quasi gezwungen war, sie anzusehen, wenn er nicht den Eindruck eines stereotypen Polizisten erwecken wollte, der sein privates Horrorkabinett strikt für sich behielt. Aber die Crux an der Sache war: Er behielt es nicht nur lieber für sich, er wurde launisch und bissig, wenn jemand ihn drängte, sich zu öffnen. Supervision, Rebriefing, Krisenintervention und was sonst noch alles ihm und seinen Kollegen nach besonders belastenden Erlebnissen zur Verfügung stand: Er achtete diese Maßnahmen und die Menschen, die sich dafür einsetzten; doch ihm selbst war es nie gelungen, daraus Nutzen zu ziehen. Abgetrennte Gliedmaßen, verweste Leichen, tote Kinder … was hatte er davon, sich diese Scheußlichkeiten absichtlich in Erinnerung zu rufen? Die Scheiße gehörte begraben. Und wenn sie nach oben quoll: Dann war Alkohol noch immer das beste Mittel, um sie schnellstmöglich hinunterzuspülen.
Frauen und ihr Wunsch nach Offenheit, nach Reden, Reden, Reden. Sollten sie. Untereinander. Es ging doch nicht um die Wahrheit, nicht um Vertrauen, emotionale Intelligenz oder sonst einen der Begriffe, mit denen die entsprechenden Magazine mehr heiße Luft bliesen als die Trockenhauben, neben denen sie lagen. Schäfer wusste doch, warum Frauen ihn attraktiv fanden: Er stand für Schutz und Stärke, für Macht und Kontrolle. Eine Polizeiuniform alleine macht Schultern automatisch ein paar Zentimeter breiter. Und das sollte er sich dann Satz für Satz zunichtemachen? Welcher Frau, die halbwegs bei Verstand war, würde denn gefallen, was er da preiszugeben hätte: die Ängste, die Depressionen, die Wut, der regelmäßig wiederkehrende Alkoholmissbrauch, ganz zu schweigen von den Dingen, die er in seinem letzten Jahr in Wien verbrochen hatte. Er selbst hielt es schon irgendwie aus mit sich und seinen Dämonen; aber dass jemand anderer an seiner Oberfläche so lange kratzte, bis der ganze stinkende Dreck darunter zum Vorschein kam, wollte er nicht zulassen.
Und so hatte er – noch bevor Marlene ihn tatsächlich gedrängt hätte, sein Innenleben preiszugeben – die Beziehung langsam abkühlen lassen; Ausreden erfunden, SMS später oder gar nicht beantwortet, es vorgezogen, für einen gestörten Einzelgänger gehalten zu werden. Du hast es wieder einmal verbockt, sagte er sich, als er in der Schlange an der Kassa stand und an den Einkäufen der Menschen vor ihm hochrechnete, welche unglaublichen Mengen an Alkohol der Österreicher im Schnitt am Wochenende trank. Erstaunlicherweise schien Marlene ihm sein Verhalten wenig bis gar nicht übel zu nehmen. Liefen sie sich zufällig über den Weg, lachte sie ihn an, redete mit ihm, als ob er nie etwas falsch gemacht hätte. Vielleicht sah sie in ihm ja auch einen Lebenshilfe-Fall. Für sein Selbstwertgefühl war diese Vorstellung nicht gerade förderlich.
Die Sachen aus dem Baumarkt ließ er im Kofferraum. Trug nur die beiden Einkaufstaschen mit den Lebensmitteln in die Küche und begann mit dem Einräumen. Als er fertig war, hatte er so viel Schinken, Essiggurken, Olivenbrot, Käse, Salzmandeln und Müslikekse im Magen, dass sein Vorhaben, zum Abendessen ein Steak zu braten, keinen Fürsprecher mehr fand. Er goss eine Kanne Melissentee auf, griff sich eine Bezirkszeitung vom Altpapierstapel und ging ins Bad. Während die Wanne volllief, saß er auf einem Holzschemel, nippte am Tee und blätterte durch den Chronikteil. Wie eine Komödie: der Bericht über den Bauern, der vor drei Wochen kurz vor Anpfiff eines lokalen Fußballspiels mit seinem Traktor an den Rand des Spielfelds gefahren war und gedroht hatte, es zu verwüsten, wenn er nicht sofort sein Geld bekäme. Damit richtete er sich an den Trainer der Heimmannschaft, der ihm im Zuge eines Brennholzverkaufs 500 Euro schuldig geblieben war. Während Schäfer und Plank mit der Hand am Pfefferspray den violettköpfigen und schwer alkoholisierten Bauer in Schach hielten, fuhr der Trainer zum Bankomat. Das Spiel begann mit einer halben Stunde Verspätung, endete mit einem 5:2-Sieg für die Heimmannschaft; am Abend kam es in einem nahegelegenen Wirtshaus zu einer Schlägerei zwischen gegnerischen Fans, zu der die Polizei ebenfalls ausrücken musste. Bei der Festnahme eines Beteiligten, der sich partout nicht beruhigen wollte, brach Schäfer diesem zwei Finger; daran trug allerdings sicher auch der cholerische Bauer Schuld.
3.
Kurz vor vier erwachte er auf seiner Couch. Im Bademantel, einen grässlichen Geschmack im Mund, den Kopf umwölkt von bösen Traumschwaden. Er war im Zick-Zack durch den Wald gelaufen, alle paar Meter hatte eine Kugel in nächster Nähe eingeschlagen, der Schweiß, der ihm in die Augen gelaufen war und ihn beinahe blind gemacht hatte, war rot gewesen. Nicht gerade originell, aber für einen deprimierenden Sofaschlaf ausreichend. Er überlegte, ins Schlafzimmer zu wechseln und dort sein Glück zu versuchen. Wozu. Er ging ins Bad, duschte heiß-kalt und zog sich an. Kurz darauf landete das Steak, das er eigentlich für den Vorabend gekauft hatte, in siedendem Olivenöl, gefolgt von zwei Eiern und reichlich Tabasco. Danach hatte er Magenschmerzen, die er mit einem doppelten Espresso und zwei Zigaretten niederrang. Rauchend stand er auf der Terrasse und lauschte. In seinem ersten halben Jahr hatte er der nächtlichen Stille hier misstraut; hatte immer wieder mit der Zunge in die Nacht geschnalzt oder sich lautstark geräuspert, um zu sehen, ob sich irgendwelche lauernden Bestien aufschrecken ließen. Doch abgesehen vom Rufen eines Käuzchens, dem Schnofen eines werbenden Igels oder den Kampfschreien zweier Katzen gab die Dunkelheit hier wenig her. Und Schäfer hatte begonnen, sich damit anzufreunden.
Deshalb verzichtete er auch darauf, das Auto zu starten; schob es schwer schnaufend in die Garage und begann, die Einkäufe aus dem Baumarkt auszuräumen. Demnächst müsste er hier ausmisten, sagte er sich; den ganzen Krempel, den sein Vormieter, Chefinspektor Stark, hinterlassen hatte, dazu seinen eigenen, damit er den Wagen endlich zur Gänze unterbringen konnte. Doch das hatte er sich seit seinem Einzug mindestens einmal im Monat vorgenommen; ab November einmal die Woche, ab dem ersten Schnee jeden Tag. Ein ganzes Jahr nun. Und großteils war es friedsam vorbeigezogen. Nicht wie die letzten Jahre in Wien, die über ihn gekommen waren wie das Heer des Dschingis Khan; eher wie eine Karawane am Horizont, deren Vorwärtsbewegung man kaum wahrnimmt, die man zeitweise sogar für eine Fata Morgana hält. Vielleicht solltest du dem Frieden zu trauen beginnen. Die Garage aufräumen, den Garten herrichten, das wären auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung.
Wieso zum Teufel hatte er Blumentöpfe gekauft? Hätte er sich davor in der Garage umgesehen, wäre ihm aufgefallen, dass Stark an die zwanzig davon zurück gelassen hatte. Großteils unbenutzt, wie Schäfer konstatierte. Hatte der alte Postenkommandant von Schaching irgendwann die gleichen Ambitionen gehegt? Das Haus und den Garten verschönern, zu einem wahren Heim zu machen, einem sicheren Nest, nein, zu einem Fuchsbau, in den man sich nach dem Kampf mit den Bösewichten zurückzieht. Wobei Kampf und Bösewichte für die Mehrzahl der hiesigen Delikte etwas übertrieben war. Vom Thron der Kriminalarbeit in der Einheit für Gewaltverbrechen war Schäfer heruntergestiegen, respektive gestürzt, um jetzt den Stall sauber zu halten. Alkolenker, Vandalismus, häusliche Gewalt, Diebstähle … Kleinvieh, das immerhin genug Mist machte, um seine Anstellung zu rechtfertigen. Außerdem hatte er es vergangenen Sommer über Wochen mit einem Wahnsinnigen zu tun gehabt, wie diese Kleinstadt wohl noch nie zuvor einen gesehen hatte. Wobei er fast den Eindruck gewonnen hatte, dass die Einheimischen auch ihn selbst irgendwo, irgendwie für dieses Unheil verantwortlich machten. Na ja, wundern wird man sich ja wohl noch dürfen: Kein halbes Jahr da, der Herr Major aus Wien, und dann schon so was, so was Unglaubliches, so was, so, Gegenwart: hinaus mit den Tontöpfen in den Garten.
Während Schäfer den Garten mit dem Rechen von seinem fauligen Wildwuchs befreite, kam ihm eine Idee. Etwas Außergewöhnliches, Großes, höchst Individuelles; gewiss mit viel Arbeit verbunden, manuell als auch geistig, aber eben ein Projekt, das er sein Eigen würde nennen können. Er stellte den Rechen an den Kirschbaum und ging ins Haus. Aß eine Banane und ließ sich dann mit einer Tasse Kaffee und einem Kollegblock am Gartentisch nieder. Hallo, Amsel, auch schon auf, murmelte er, während er einen Plan zeichnete, aus dem ein Außenstehender nicht so bald schlau werden würde.
Er hörte ein Auto in die Einfahrt kommen. Was war das? Post? Polizei? Mit dem Spaten in der Hand trollte er sich um die Ecke, wenig neugierig, wer ihn in seinem Werk störte.
»Oha«, rief Schäfer aus, als er Chefinspektor Bergmann aus dem Wagen steigen sah, seinen ehemaligen Assistenten aus Wien.
»Ich hätte also doch noch einmal anrufen sollen.«
»Nein«, meinte Schäfer nach einem Zögern, »wir haben ausgemacht … Frühstücken und danach Radfahren… ich habe nur nicht damit gerechnet, dass Sie schon so früh …«
»Punkt sieben«, Bergmann öffnete den Kofferraum und nahm eine Papiertasche heraus. »Länger will ich mit dem Frühstück nicht warten, Zitat Major Schäfer. Was machen Sie mit dem Spaten? Feindabwehr?«
»Arbeiten.«
Obwohl es noch eine Spur zu kühl war, wollte es sich Schäfer nicht nehmen lassen, im Freien zu frühstücken. So hatte er sein Projekt im Auge; das hielt seine Motivation aufrecht, die er ansonsten zu verlieren fürchtete.
»Hat das einen bestimmten Grund, dass Sie die Blumentöpfe in der Erde eingraben?«, wollte Bergmann wissen.
»Sicher.«
»Aha … soll ich raten?«
»Bitte«, antwortete Schäfer mit vollem Mund.
»Sie wollen vermeiden, dass die Wühlmäuse an die Wurzeln von irgendwelchen Pflanzen kommen, die Sie irgendwann …«
»Nicht schlecht … aber falsch.«
»Sie bauen Fallgruben für … Marder?«
»Interessant … aber falsch.«
»Also machen Sie irgendwas, das sich jeder menschlichen Logik entzieht.«
»Im Gegenteil. Das wird ein Bewässerungssystem.«
Bergmann zog die Augenbrauen hoch, setzte zu reden an, räusperte sich.
»Interessant«, meinte er schließlich.
»Interessant«, wiederholte Schäfer verächtlich, »das haben wahrscheinlich auch die freundlicheren Nachbarn von Noah gesagt, als er mit der Arche angefangen hat.«
Bergmann schwieg, aß eine Semmel, löffelte ein Ei, trank seinen Tee.
»Noah kann keine freundlichen Nachbarn gehabt haben. Die wären sonst auch gerettet worden.«
»Haarspalterei … Sie verstehen einfach das Konzept nicht.«
»Sicher. Das soll wie bei Topfpflanzen funktionieren, mit diesen kleinen Tonkegeln, wo ein Schlauch in ein Gefäß mit Wasser hängt«, meinte Bergmann, »Sie füllen Wasser in die Töpfe, damit sie Feuchtigkeit an die Umgebung abgeben.«
»Genau.«
Abermals schwieg Bergmann.
»Sie suchen etwas, um mir mein Projekt madig zu machen«, sagte Schäfer angespannt.
»Nein.«
»Doch, tun Sie … nur sagen Sie es nicht.«
»Ich bin nur gespannt, was daraus wird … wenn zum Beispiel der Boden im Winter friert …«
»Sie können mir gerne helfen«, rief Schäfer, der die Gartenarbeit wieder aufgenommen hatte, während Bergmann in einer der beiden Sonntags-Zeitungen blätterte, die er mitgebracht hatte.
»Hm … jetzt weiß ich, wieso mir der Name bekannt vorgekommen ist«, Bergmann hielt die Zeitung hoch.
»Was für ein Name?«
»Thurner … der Jagdunfall von gestern …«
»Unfall, ja genau«, murrte Schäfer und fluchte, als ihm einer der Blumentöpfe beim Versenken ins Erdreich zerbrach.
»Zukünftige Archäologen werden sich die Köpfe darüber zerbrechen, was in diesem Garten einst getrieben worden ist …«
»Fahrlässige … Tötung … war das!«, wütete Schäfer weiter. »Wenn mir nicht seit einer Woche das Knie so weh täte, wäre ich wahrscheinlich selber gestern früh im Wald laufen gewesen und …«
»Waren Sie beim Arzt?«, fragte Bergmann, rhetorisch, nur um das Thema zu wechseln.
»So schlimm ist es auch nicht, ich lege eh Topfenumschläge auf … diese … wenn es nach mir ginge, müssten 50 Prozent der Jäger ihre Waffen abgeben, weil sie nicht damit umgehen können … Trotteln.«
»Und mindestens die Hälfte der Autofahrer ihr Fahrzeug«, meinte Bergmann süffisant. Manchmal war es die beste Strategie, Schäfer in seinem Zorn noch weiter aufzustacheln, so dass er quasi überhitzte und die gesamte negative Energie in einem lauten Knall verpuffte. Freier Himmel und ein gewisser Sicherheitsabstand waren gegeben – also war es einen Versuch wert.
»Ja ja, spotten Sie nur … aber was ist ein BMW mit 220 PS in den Händen von einem 20-jährigen Provinzdeppen anderes als eine tödliche Waffe, hä?«
»Die zwei toten Frauen letzte Woche? Ich hab’s gelesen … tragisch, ja.«
»Und wenn der sich wenigstens nur selbst umbringt, aber nein, da müssen zwei völlig Unschuldige draufgehen und er, der Arsch, der überlebt.«
»Haben Sie die Frauen gekannt?«
»Ja, na ja, vom Sehen, zwei Schwestern … waren davor bei der Chorprobe … da wo dieses Arschloch mit hundert Sachen überholt hat, war ein Siebziger und doppelte Sperrlinie … und wissen Sie, was der drei Tage später auf seiner Dings, was der auf Facebook postet?«
»Nein.«
»Gelobt sei die deutsche Sicherheitstechnik!«
»Screenshot machen und an den Staatsanwalt schicken«, meinte Bergmann, »vielleicht trägt’s zu einer Haftstrafe bei.«
»Mach ich vielleicht wirklich … so eine Drecksau … was sind das für Eltern, die solche Monster aufziehen?«
»Wieso können Sie überhaupt in seinen Facebook-Account schauen? Ich hab geglaubt, Sie weigern sich da mitzumachen?«
»Ich habe meine Quellen …«
»Quellen? … soll entweder heißen, dass Sie den Freund Ihrer Nichte, diesen Computerfreak, zu halblegalen Taten angestiftet haben oder wieder Spitzel rekrutieren … hoffentlich keine Minderjährigen!«
»Spitzel«, Schäfer schnaubte verächtlich aus, »ich pflege einen vertrauensvollen Kontakt zu ein paar Jugendlichen, die so wie ich in einer rechtschaffenen Gemeinde leben möchten.«
»Ah, rechtschaffen … und? Haben Sie auch einen Namen für die Gang? Schäferhunde? Schäfchen?«
»Spotten Sie nur … ich hab schon zwei Meth-Dealer dank deren Hilfe schnappen können … was da in letzter Zeit mit diesem Gift abgeht, davon haben Sie überhaupt keine Ahnung!«
»Sapperlot, und was gibt’s als Gegenleistung? Haben Sie Marihuana entkriminalisiert?«
»Meine Dankbarkeit und Anerkennung«, Schäfer pfiff ein paar Takte eines Marsches; für Bergmann ein untrügliches Zeichen, dass sein ehemaliger Chef etwas zu verbergen hatte.
»Passen Sie nur auf, dass Sie den Bogen nicht überspannen«, Bergmann zündete sich eine von Schäfers Zigaretten an.
»Seit wann rauchen Sie tagsüber?« Schäfer warf den Spaten ins Gras, wusch sich die Hände am Gartenschlauch, gesellte sich zu Bergmann und nahm ebenfalls eine Zigarette.
»Nur wenn ich frei habe.«
»In Ihrem Alter denkt man normalerweise ans Aufhören und fängt nicht damit an.«
»Pff … ich habe zwanzig Jahre wie ein Mönch gelebt.«
»Eh, vor allem was die Vorliebe für fesche junge Männer betrifft.«
»Ich habe wenigstens Sex … oder haben Sie Ihre …«
»Nein, wir treffen uns nicht mehr.«
»Schade, sie war nett. Marlene, oder?«
»Ja, ist sie … was wollten Sie vorher wegen dem Thurner sagen?«
»Hä? Ach so«, Bergmann nahm die Zeitung und schlug den Artikel auf. »Seine Frau, das ist doch die Politikerin, oder?«
»Landesrätin, ja, warum?«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«
»Sicher, Kollege Friedmann war auf Familienausflug in der Wachau, jetzt hab ich den Todesengel spielen dürfen … hat’s aber eh mit Fassung getragen, nach außen hin zumindest … wieso?«
»Nur so«, Bergmann zuckte mit den Schultern.
»Sie können es nicht lassen, oder?«
»Was denn?«, fragte Bergmann mit Unschuldsmiene.
»Bei jedem Vorfall hier heroben … fast habe ich das Gefühl, als hoffen Sie, dass mir wieder so eine Scheiße passiert wie letztes Jahr.«
»Überhaupt nicht«, meinte Bergmann entrüstet, »ich nehme halt Anteil und …«
»Ich geh mich umziehen«, raunte Schäfer, »haben Sie eine Fahrradpumpe dabei? Meine Reifen sind ziemlich luftlos.«
»Luftlos«, murmelte Bergmann und rief dann, »ja, hab ich.«
»Haben Sie schon gehört, wer sich in Ihrem Revier ansiedelt?«, fragte Bergmann, während sie gemächlich nebeneinander herfuhren.
»Wenn Sie den Bosch meinen, ja, der ist schon letzte Woche hergezogen … woher wissen Sie das?«
»Ich war am Mittwoch in Garsten wegen einer Befragung … der Lusser hat’s mir erzählt.«
»Unser Lusser? Der sitzt immer noch ein?«
»Wieder … mehr als ein halbes Jahr hat er’s nicht ausgehalten, ohne wen niederzuschlagen.«
»Unglaublich, wie viel hat der jetzt schon drauf?«
»23 Jahre, mit 52.«
»Dabei wäre der eigentlich ziemlich vif«, meinte Schäfer, »und drei Lehrabschlüsse hat er auch schon.«
»Jo eh, Hähr Inschpekta«, imitierte Bergmann, »oba des Tembarament, des hoaße Bluad!«
»Und der war mit dem Bosch in einer Zelle?«
»Sicher nicht … stellen Sie sich vor, was der Lusser mit einem macht, der eine Siebenjährige umgebracht hat …«
»Ja«, meinte Schäfer verächtlich, »könnte ich ihm in so einem Fall nicht einmal verübeln … warum der Arsch wieder hier herzieht, geht mir auch nicht ein … der kann sich ja nur verstecken … und Arbeit bekommt er hier sowieso keine bei der Vorgeschichte.«
»Vielleicht weil er sonst nirgends hin kann?«
»Dann soll er den Hof halt verkaufen und woanders hingehen statt hier alte Wunden … statt hier böses Blut zu machen.«
»Einen Hof hat der?«, wunderte sich Bergmann.
»Ja … hat ihm der zweite oder dritte Mann von seiner Mutter vererbt.«
»Und sie? Seine Mutter?«
»Ist schon vor ein paar Jahren gestorben«, antwortete Schäfer, »tot gesoffen, was man so sagt.«
»Wie alt ist der Bosch jetzt? 40?«
»18 war er, wie er die Kleine umgebracht hat, 27 Jahre ist er gesessen.«
»Hat er irgendwelche Auflagen?«
»Soweit ich weiß nicht«, Schäfer räusperte sich mehrmals und spuckte in den Straßengraben. »Ein freier Mann mit einer zweiten Chance.«
»Wenn er nach Kanada geht, vielleicht.«
»Würde ich ihm sogar den Flug zahlen«, erwiderte Schäfer und steigerte das Tempo.
4.
»Ist ja wohl nachvollziehbar, dass ich da in einem Zwiespalt bin, oder?«, meinte Friedmann, während er den Streifenwagen in einer Ausweiche parkte und den Motor abstellte.
»Eh«, Schäfer stieg aus und ging langsam auf die weiß furnierte Pressholztafel zu, die irgendjemand in der Nacht von Sonntag auf Montag an zwei Holzstangen geschraubt und gut zwanzig Meter neben der Bundesstraße ins Feld gestellte hatte. Achtung! 250 m links. Hier wohnt der Kindermörder Frederik Bosch.
»Schaut nach einer Tischplatte aus«, Friedmann stellte sich neben Schäfer und rüttelte an der Tafel. »Ordentlich versenkt … alleine schaffst du so was nicht.«
»Wenn dein Zwiespalt zu groß ist, kann ich das Teil auch alleine abreißen«, Schäfer trat gegen eine der Stangen, was die Tafel nur leicht zum Wackeln brachte.
»Das Aufstellen habe ich gemeint«, Friedmann lehnte sich mit dem Rücken gegen die andere Stange und stemmte seine Absätze ins Erdreich. Zehn Sekunden später lag die Tafel auf dem Boden. Dieser Mann muss in einem vorigen Leben ein Elefant in Hannibals Heer gewesen sein, dachte Schäfer. »Aber als Vater … ich hab zwei Töchter … da siehst du solche Sachen mit anderen Augen.«
»So ein Schwachsinn«, Schäfer bückte sich, griff sich eine Stange, fixierte die Tafel mit dem rechten Fuß und brach sie aus der Verschraubung. »Ich muss keine Kinder haben, damit mich so was ankotzt.«
»Zwischen Ankotzen und Angst haben ist aber schon noch einmal ein Unterschied.«
»Ja«, gab Schäfer zu, worauf sie die Tafel hochhoben, zum Auto trugen und in den Kofferraum packten, der sich jetzt nicht mehr schließen ließ. »Das ist mir schon klar … aber was soll ich machen?«
Was sollte er denn machen? Die Tafel stehen lassen und hoffen, dass sie ein paar Leute zu einem Lynchmob inspirieren würde, der mit Mistgabeln, Sensen und Fackeln zu Boschs Hof zog? Die Situation war beschissen, das musste ihm niemand erklären; doch aus rechtlicher Sicht war sie eindeutig: Bosch hatte seine Strafe abgesessen, zwölf Jahre in einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher, fünfzehn weitere Jahre im normalen Vollzug inklusive Therapie. Laut der zuständigen Kommission und dem Richter war er nun fähig und willens, ein Leben in Freiheit zu führen, ohne eine Gefahr für seine Umwelt darzustellen. Unter den gegebenen Umständen war der Begriff Freiheit allerdings eine Farce. Wie stellte sich der Scheißkerl das vor? Keine fünf Kilometer entfernt von dem Ort zu leben, wo er ein siebenjähriges Mädchen umgebracht hatte. Inmitten von Menschen, denen ohne Zweifel sogar ein Bus voll Asylwerber aus Tschetschenien lieber wäre als so ein, so ein …
»Da hat’s aber einer besonders eilig«, Friedmann deutete mit dem Kinn über Schäfers Schulter hinweg, wo in etwa einem halben Kilometer Entfernung ein schwarzer SUV eine schmale Straße herunterraste.
»Wenn er auf das Stoppschild auch noch pfeift, fassen wir ihn uns«, meinte Schäfer und begann langsam, von zehn rückwärts zu zählen.
»Das ist der Strommer Luis«, sagte Friedmann, nachdem der Wagen ohne stehenzubleiben in die Kreuzung eingefahren war und in hohem Tempo auf sie zufuhr.
»Der war mir immer schon sehr sympathisch«, murrte Schäfer, stellte sich auf die Straße und hob den Arm.
»Tut mir leid«, meinte Strommer jovial, nachdem er schwungvoll vor dem Streifenwagen eingeparkt hatte und aus seinem Porsche Cayenne gestiegen war, »ich hab euch nicht gesehen.«
»Uns dürfen Sie auch gerne übersehen«, erwiderte Schäfer, »aber das Stoppschild da hinten, das ist immer gleich beleidigt, wenn wer nicht stehen bleibt und kurz Hallo sagt.«
»Ah, das … ja, da würde eine Vorfahrtstafel sicher auch reichen … Servus Erich, alles klar bei dir? Den Mädels geht’s gut?«
»Alles bestens«, erwiderte Friedmann, »hast es eilig?«
»Na ja, weißt eh, wie’s ist, von einem Termin zum nächsten.«
»Dann schauen wir lieber ganz schnell nach, ob die Sicherheitsausrüstung komplett ist, oder?«, schlug Schäfer vor.
»Ach so«, Strommer schaute etwas verwirrt von Friedmann zu Schäfer und ging zum Kofferraum. »Ja ja, Ordnung muss sein.«
»Aha«, Schäfer griff in den Kofferraum und holte ein Gewehr hervor, »Standardausrüstung bei Geschäftsterminen, oder?«
»Der Luis … der Herr Strommer ist Jäger«, brachte Friedmann schnell ein.
»Ja, blöd von mir«, Strommer grinste, »ich war gestern mit einem Freund jagen und da hab ich sie am Abend, weil’s spät geworden ist …«
»Verstehe«, sagte Schäfer, ohne den Mann anzusehen, führte den Repetierhebel am Gewehr zurück und entnahm zwei Patronen. »Dass Waffe und Munition beim Transport separat aufzubewahren sind, wissen Sie eh, oder?«
»Ja, freilich, mach ich normalerweise eh, nur …«
»Weil’s spät geworden ist«, Schäfer legte das entladene Gewehr zurück in den Kofferraum. »Wo kommen Sie eigentlich gerade her?«
»Wie, jetzt? Vom … oben, vom Reininghaus seinem Hof.«
»Wo jetzt Frederik Bosch wohnt.«
»Ja, leider«, meinte Stromer, »ich würde ihm den Hof eh sofort abnehmen.«
»Abnehmen wie …«
»180.000 hab ich ihm geboten!«, Strommer ging zur Beifahrertür, öffnete sie energisch, nahm einen Metallkoffer heraus und hielt ihn am Griff in die Höhe wie eine Trophäe. »Bar auf die Hand, wenn er seine Sachen packt und sofort verschwindet!«
»Auch nicht übermäßig«, meinte Friedmann, »mit dem Grund dabei und dem Wald dahinter.«
»Ah, das war eine Verhandlungsbasis … bis 250 wäre ich auf jeden Fall gegangen«, Strommer warf den Koffer auf den Rücksitz und knallte die Tür zu.
»Aber?«, wollte Schäfer wissen.
»Nichts aber … er verkauft nicht, um keinen Preis, hat er gemeint … so ein Arschloch, ein präpotentes!«
»Ich hoffe, dass Sie sich zu keinen unüberlegten Aktionen hinreißen haben lassen«, meinte Schäfer und klopfte an die Rückscheibe des Wagens.
»Ah wo, wegen so einem …«
»Machen Sie sich nicht die Hände schmutzig?«
»Ich muss jetzt weiter«, Strommer blickte fragend von Schäfer zu Friedmann.
»Werfen Sie das nächste Mal 50 Euro in den Klingelbeutel und die Sache ist erledigt«, meinte Schäfer.
»Was?«, fragte Stromer verblüfft, »ah so, wegen dem, ja, passt … aber da müsste ich für das Kirchendach, das ich quasi alleine bezahlt habe, eh noch ziemlich was gut haben, oder? Ha ha, nichts für ungut, Herr …«
»Major Schäfer.«
»Ja, genau, Schäfer, ja, Servus Erich, grüß mir die Sonja!«
»Was ist, worauf wartest du?«, Schäfer sah Friedmann an, der gedankenverloren die Hand am Zündschlüssel hatte, ohne ihn zu drehen.
»Sollen wir hinauffahren?«
»Wohin, zum Bosch? Was tun? Ihm die Tafel ans Haus montieren?«
»Schauen, ob alles in Ordnung ist wegen …«
»Wegen dem Strommer? Sicher nicht«, wehrte Schäfer ab, »wenn ich mich da jetzt schon auf eine Verdachtsermittlung einlasse, nur weil der beim Bosch oben war, kann ich gleich Personenschutz abstellen.«
»Wie du meinst«, Friedmann zuckte mit den Schultern und startete den Wagen.
»Kennst du den Bosch eigentlich von früher?«, wollte Schäfer wissen, nachdem sie ein paar Minuten schweigend ihren Gedanken nachgegangen waren.
»Hm? … Ja, vom Sehen hab ich ihn gekannt und was man halt so geredet hat«, Friedmann seufzte, »und dann natürlich wie die Geschichte mit dem Mädel passiert ist … Tatortsicherung, bei der Festnahme war ich auch dabei. Mein erster Mord und dann gleich so was …«
»Hmh«, machte Schäfer und ließ das Fenster hinunter, »so was ist schon hart, ja.«
»Danach habe ich mir schon ein halbes Jahr überlegt, ob ich mir das weiter antun soll.«
»Da bin ich jetzt ehrlich froh, dass du dich so entschieden hast.«
»Mir ist einfach nichts Besseres eingefallen«, meinte Friedmann und erlaubte sich ein Lächeln.
5.
Zurück am Posten ging Schäfer wie jeden Montag die ungeklärten Straftaten des vergangenen Monats durch; ob neue Hinweise eingegangen waren, ob sich seit der letzten Durchsicht ähnliche Delikte zugetragen hatten, ob er oder einer seiner Kollegen vielleicht etwas übersehen hatten, ob sich seine eigene Perspektive durch den wiederholten Blick auf die Akten und den zeitlichen Abstand änderte, ob ihm vielleicht die Gnade eines Geistesblitzes zuteil wurde, so dass er mit angewinkelten Armen und geballten Fäusten aus seinem Büro stürmen und laut: Heureka! Ich hab’s! schreien konnte. Wobei die meisten der aktuellen Delikte sich mit so einem Maß an Pathos wohl nicht ganz vertrugen, wie er sich mit Blick auf den Bildschirm eingestehen musste. Heureka, ich weiß, wer dem alten Schöpf Zucker in den Tank seines Rasenmähers geschüttet hat? Voller Stolz kann ich verkünden, wer die Telefonzelle am Bahnhof demoliert hat?
Einen Fall wollte er allerdings tatsächlich so schnell als möglich aufklären: Seit fast zwei Monaten trieben sich ein oder mehrere Sprayer in Schaching und neuerdings auch in zwei Nachbargemeinden herum, die zahlreiche Gebäude mit Hakenkreuzen, SS-Runen und diversen faschistischen Parolen versehen hatten. Nachdem erste Befragungen nichts erbracht hatten, meldete Schäfer den Fall dem Bundesverfassungsschutz. Da von den dortigen Beamten erfahrungsgemäß mehr als einer auf dem rechten Auge blind war, erwartete sich Schäfer keine Unterstützung; doch wenn den Schmierereien schwerwiegendere Delikte folgen sollten, wenn demnächst ein Haus mit türkischen Bewohnern brannte, musste er sich wenigstens nicht vorwerfen lassen, nichts unternommen zu haben. Erneut ging er die Beweisfotos durch, versuchte, aus den Adressen der beschmierten Häuser irgendeinen Rückschluss zu ziehen; blickte auf ein ihm bislang unbekanntes Bild, die Seitenwand der Kirche, Sieg Heil und ACI.
»Auer!«, rief er gegen die Glaswand, die sein Büro von den Amtsräumen trennte.
»Jawoll!«, fünf Sekunden später stand die Inspektorin vor Schäfer und schlug die Fersen zusammen.
»Wann ist das passiert?«, Schäfer drehte den Bildschirm um 90 Grad.
»Steht eh drunter«, Auer beugte sich vor, »Samstag Nacht … der Messner hat es Sonntag Früh gemeldet.«
»Das ist mir jetzt aber nicht mehr Wurscht«, Schäfer trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. »Vorschläge?«
»Vielleicht meldet sich ja diesmal auf den Aufruf in der Zeitung wer«, meinte Auer vorsichtig. Und während Schäfer sie mit seinem berüchtigten Ist-das-wirklich-alles-was-dir-dazu-einfällt-Blick bedachte: »Weil sie wahrscheinlich aufgeschreckt worden sind, ist doch möglich, dass sie wer gesehen hat.«
»Wieso aufgeschreckt?«
»Sie sind nicht fertig geworden«, Auer deutete auf den Bildschirm. »ACI, das hätte sicher ACAB werden sollen, oder?«
»All cops are bastards? Jetzt wird’s auch noch persönlich«, knurrte Schäfer und vergrößerte das Bild. »Nimm dir bitte noch einmal eine Stunde und schau die Internetforen durch … da weißt du eh besser, wo sich was abspielt.«
»Geht in Ordnung«, Auer stand auf, »auf Facebook gibt’s übrigens schon eine Gruppe gegen Frederik Bosch, gegründet von …«
»Stopp!«, Schäfer zeigte der Inspektorin seine Handinnenfläche. »Von unserem heimatliebenden Gemeinderat Aribert Rauch.«
»Albert heißt der, oder?«
»Eh … hätte mich ja gewundert, wenn diese braune Krätze sich einmal nicht auf Kosten von einem Außenseiter profilieren will … wenn irgendwas ganz Wüstes auf der Seite auftaucht, meldest du’s mir.«
»Ja … sicher«, meinte Auer zögerlich.
»Keine Sorge, bleibt alles unter uns«, erwiderte Schäfer, der Auers Bedenken nachvollziehen konnte. Wenn sich jemand wie Rauch regelmäßig als Ordnungshüter und Sittenwächter aufspielte, dabei hetzte, log und verleumdete, ohne dafür belangt zu werden, konnte er in der Regel auf ein starkes Netzwerk vertrauen. Auf Seiten der Exekutive tat er sich dafür logischerweise mit Vertretern der AUF zusammen, der einflussreichen freiheitlichen Polizeigewerkschaft. Sich mit dieser anzulegen war gerade bei jungen Polizisten eine sichere Karrierebremse. Und Inspektorin Auer war neben Schäfer die Einzige in der Inspektion, die nicht Mitglied der AUF war. Hornig, mit 57 der Älteste von ihnen, gehörte dem rechten Lager aus fester Überzeugung an – wenn man dem alten Sack eine Hitlerrede vorspielte, in der Rrrecht und Orrrdnung vorkam, bekam er wahrscheinlich eine spontane Erektion. Friedmann war nach Schäfers Ansicht alleine deshalb bei der AUF, weil schon sein Vater dabei gewesen war und diese Zugehörigkeit über ihn gekommen war wie das Weihwasser über einen unwissenden Täufling. Auch bei Plank tippte Schäfer mehr auf soziale Adaption denn auf irgendeine politische Überzeugung. Wer wegen einer Mehlallergie als Bäcker aufhören musste und dann über eine Zwischenstation als erfolgloser Webdesigner zur Polizei kam, tat sicher gut daran, sich seinen älteren Kollegen anzupassen. Umso mehr hatte sich Schäfer gewundert, als er erfahren hatte, dass Inspektorin Auer nicht bei der freiheitlichen Polizeigewerkschaft war. Ihr oftmals martialisches Auftreten bei Einsätzen, die Vorliebe für Schnürstiefel und Barett sowie ein paar sehr grenzwertige Aussagen über ausländische Täter waren für Schäfer eindeutige Indizien gewesen. Er hatte sich getäuscht. Mit so einem Chauvinistenverein will ich nichts zu tun haben, hatte sie erwidert, als er sie einmal wie nebenbei darauf angesprochen hatte. Pluspunkt für Auer. Die allerdings im Gegensatz zu Schäfer noch nicht die Erfahrung gemacht hatte, dass man über die Seilschaften zwischen Gewerkschaft, Politik, Medien und manchen Wirtschaftstreibenden gerade deswegen stolpern und böse fallen konnte, weil man nichts damit zu tun haben wollte.
Schäfer stand auf, ging zum Waschbecken und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Beschissene Politik. Sobald er ihren hohlen Phrasen und dem populistischen Geplärre zu nahe kam, ballten sich ihm die Fäuste, knirschte er mit den Zähnen, begann er diese korrupten, gierigen und rückgratlosen Lumpen zu verwünschen, in deren Schlangengrube er selbst vor einigen Jahren gefallen war. Schluss damit, sagte er sich und trank gierig zwei Glas Wasser. Vom Schreibtisch meldete sein Handy mit einem Piepsen, dass ihm bald der Strom ausginge. Hab dich doch gestern erst aufgeladen, murmelte Schäfer und blickte aufs Display. Das Batteriesymbol zeigte fast hundert Prozent. Schäfer setzte sich und schaltete die Schreibtischlampe an. Oha, unterschlagenes Beweismaterial, sagte er sich grinsend, als er das Handy von Günther Thurner erblickte, das er vergangenen Samstag im Wald an sich genommen hatte. Er überlegte einen Moment, dann rief er vom Festnetz Sylvia Thurner an. Landete nach mehrmaligem Läuten auf ihrer Mailbox und teilte ihr mit, dass er ihr gerne das Handy ihres Mannes zurückgeben würde.
Sehr beherrschte Frau, diese Thurner, dachte er, während er absichtslos das digitale Telefonbuch des Toten durchging. Keine Tränen, kein Wutausbruch, totale Gefühlskontrolle, so musste man wohl zwangsläufig sein oder werden, wenn man sich einen Landesratposten bei den Schwarzen antat. Schäfer wechselte zur Anrufliste. Sein letztes Gespräch hatte Günther Thurner am Abend vor seinem Tod kurz nach neun mit einem Luis geführt. Neun Minuten und zwölf Sekunden. Luis wie Luis Strommer?, fragte sich Schäfer. Gut möglich, schließlich war Sylvia Thurner dessen Nichte. Er ging die Liste bis zum letzten erfassten Gespräch durch, das vier Wochen zuvor geführt worden war. Legte das Handy beiseite, schaute ein paar Sekunden ins Leere und nahm es abermals in die Hand. Fünf Anrufe in vier Wochen, notierte Schäfer für sich. Zumindest am Telefon dürfte sich das Ehepaar Thurner nicht mehr allzu viel zu sagen gehabt haben.
6.
Auch wenn es höchst unwahrscheinlich war, dass ihr auf dem Weg zur Eingangstür jemand über den Weg lief, der sie erkannte, blieb Sylvia Thurner so lange im Wagen sitzen, bis der Parkplatz menschenleer war. Lächerlich, dachte sie, als sie die Stiege in den dritten Stock nahm. Da rede ich im Landtag groß daher von einer besseren psychosozialen Versorgung; dass es genau so normal sein soll, einen Therapeuten aufzusuchen, wie zum Frauenarzt zu gehen; und selber schleiche ich mich da hinein, als ob es etwas Illegales wäre. Zweiter Stock, Cevik, Korn und Mitterer, da bleibst du jetzt wieder stehen, bis oben die Tür aufgeht und der Termin vor dir herauskommt. Wartest brav, bis er in den Lift gestiegen ist, dann darfst du hinein. Es ist so erbärmlich; ja, ja, Onkel Luis, warum rede ich nicht mit dir, ich kann doch über alles reden mit dir, du bist doch immer da für mich, egal, was es ist, Mädel!, da musst du doch nicht zu so einer, ich kenn dich doch viel besser als sonst wer, ja, natürlich weiß ich, dass du mich gleich nach der Geburt gehalten hast, weil der Papa nicht da war, das hast du mir oft genug erzählt, dass du in der ersten Sekunde gewusst hast, dass ich eine echte Strommer bin, zum Glück nach deiner Schwester gekommen bin und nicht nach meinem Vater, weil wir Strommer, wir wissen, wo unser Platz in der Welt ist, und den nehmen wir uns auch, ach scheiß doch drauf, ich mag nicht mehr.
»Möchten Sie einen Tee?«, fragte die Therapeutin, nachdem sie Thurner eine weiche, warme Hand hingehalten hatte.
»Gerne«, Sylvia Thurner lächelte freundlich, ging ins Behandlungszimmer und setzte sich in einen der beiden apfelgrünen Polstersessel. Ein paar Sekunden starrte sie auf ein Acrylgemälde an der gegenüberliegenden Wand, das wohl einen glühenden Frauenkörper darstellen sollte, dann nahm sie ihre Handtasche, holte das Handy heraus und aktivierte die Lautlosfunktion.
»Bitte schön«, meinte die Therapeutin leise, während sie den Tee in die Tasse goss, dann setzte sie sich, legte die Hände im Schoß übereinander und sah Thurner mit Augen an, die wohl wärmstes Mitgefühl ausdrücken sollten.
»Danke, dass Sie mich so schnell eingeschoben haben.«
»Natürlich, dafür bin ich doch da.«
»Ja«, Thurner nippte an ihrem Tee und atmete seufzend aus.
»Ja«, meinte die Therapeutin, nickte fast unmerklich und schob die Taschentücher, die auf dem Tisch zwischen ihnen lagen, zu Thurner. »Wie geht’s Ihnen denn?«
»Hm«, Thurner zuckte mit den Schultern und zog die Lippen nach oben. »Den Umständen entsprechend.«
»Können Sie schon trauern?«
»Ff«, machte Thurner. Was sollte diese Frage? Musste sie trauern? Wollte sie überhaupt trauern? Wer wusste denn besser als die Frau ihr gegenüber, dass sich ihr Mann und sie in den letzten zwei Jahren völlig auseinander gelebt hatten? Dass die Liebe erloschen war? Darum hatte sie getrauert, lange genug, wie sie meinte, aber jetzt? Jetzt war Günther endgültig weg und sie empfand … gar nichts? Heute Morgen war ihr das Haus leer vorgekommen; die Stille, in der sie am Küchentisch gesessen war, nachdem sie den Anrufbeantworter gelöscht hatte; da hatte sie angefangen, sich in eine Trauer hineinzufühlen, sich den Verlust zu vergegenwärtigen, wie man so schön sagt. Doch dem stand schnell wieder der Abend vor ein paar Monaten gegenüber, an dem sie entdeckt hatte, dass sich ihr Mann regelmäßig in einem Laufhaus gleich nach der Grenze vergnügte, von wegen Hausbesuche, Herr Heilmasseur, Arschloch Nuttenficker! Sogar zu einem Waldspaziergang hatte er diese tschechische Hure getroffen! »Ich weiß es nicht … es ist alles so …«
»Überwältigend?«
»Vielleicht … nein, es ist mehr so, als ob ich gar nichts fühle.«
»Weil der Schmerz noch zu groß ist. Weil Sie sich selbst davor schützen.«
»Ich weiß nicht … vielleicht sind auch einfach keine Gefühle mehr übrig.«
»Sie waren über zehn Jahre verheiratet.«
»Ja, eh«, erwiderte Thurner launisch und wandte den Blick zum Fenster.
»Sie sind wütend.«
»Nein, ja … keine Ahnung«, Thurner griff sich rasch ein Taschentuch und schnäuzte sich zurückhaltend. Ja, sie war wütend. Aber jetzt gerade auf diese blöde Kuh, von der sie sich endlich befreien musste. Fast drei Jahre kam sie schon hierher, und was hatte es gebracht? Die hatte doch studiert. Die musste doch irgendwann zum Kern der Sache vordringen, oder? Aber inzwischen war sie schon so weit, dass sie sich selbst einredete, der Ärger über die Unfähigkeit ihrer Therapeutin wäre eine Projektion, die eigentlich wem anderen galt. Wem denn? Ihrem treulosen Vater? Ihrer unfähigen Mutter? »Mein Onkel, der …«
»Ja?«
»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er zurzeit meine einzige echte Beziehungsperson ist, verstehen Sie?«
»Und das ist Ihnen zu wenig.«
»Ja, nein, doch, weil … es ist einfach so, dass bei meiner Arbeit …«
»Dass Sie eine Rolle spielen?«
»Ja, sicher … aber das machen in der Politik eh so gut wie alle«, Thurner seufzte und ließ die Schultern sinken.
»Was ist denn mit der Vorstellung, dass Sie in Ihren alten Beruf zurückkehren? Das war doch einmal Ihr Wunsch, oder?«
»Alter Beruf, ts … ich habe nicht einmal die Facharztausbildung fertig«, meinte Thurner verächtlich.
»Ja, aber Sie sind erst siebenunddreißig … und schon Landesrätin … mit Ihrem Ehrgeiz und Ihrem Potenzial …«
»Ja, eh«, meinte Thurner. Mit meinem Potenzial. Wirst du doch nicht als Kinderärztin am Land versauern! Die Leute mögen dich, die vertrauen dir, das merkst du doch, oder? Ja eh, Onkel, die Leute mögen mich. »Nur … zur Zeit habe ich keinen Kopf für so was … im Herbst sind die Wahlen und …«
»Wollen Sie das oder Ihr Onkel?«
»Ich natürlich«, erwiderte Thurner, »mein Onkel natürlich auch, aber …«, sie schloss die Augen. Ich will raus hier. Ich mag nicht mehr mit dir reden, weil du eh nichts kapierst, ich mag nichts denken, ich hasse das alles hier.
7.
Mit Daunenjacke und Wollmütze der abendlichen Kühle trotzend saß Schäfer an seinem Gartentisch und verschlang eine sehr großzügige Polizistenportion Spaghetti Carbonara. Hatte er sich auf dem Nachhauseweg im Ristorante Chianti einpacken lassen. Wo er beim Betreten des Lokals sogar kurz überlegt hatte, sich einen Tisch zu nehmen – doch war dies einer der Abende, an dem Gesellschaft die Einsamkeit nur größer machte. Kauend starrte er in den Garten und dachte an die Katze und den Raben, die im Vorjahr bei ihm gelebt hatten. Wieso hatte er eigentlich kein Foto von den beiden gemacht? Kein einziges, du Idiot! Wer – außer Bergmann und Sanders, die die beiden verrückten Tiere selbst gesehen hatten – würde ihm diese Geschichte in zehn Jahren noch glauben? Außerhalb des Dienstes war schließlich auch er nicht davor gefeit, als seltsamer Junggeselle mit noch seltsameren Anekdoten zu gelten. Was war denn überhaupt fotografisch bezeugt von seinen letzten zehn, zwanzig, dreißig Jahren?, setzte er seine sentimentale Reise fort. Abgesehen von den Bildern im Familienalbum, Klassenfotos, die Maturareise, einige Feierlichkeiten, die paar Urlaube, die er mit seinem Bruder, Freunden oder Frauen verbracht hatte – allerdings waren auch von diesen Aufnahmen so gut wie keine in seinem Besitz. Also, wo waren die Bilder, bei denen man in Erinnerungen schwelgen durfte? Würden nur die Medienfotos bleiben? Das, was das Internet ausspuckte, wenn er sich selbst googelte: Pressekonferenzen, Beförderungen, Verleihungen, Angelobungen – er mit vom Blitzlicht geblendeten Augen, mit erschöpftem Gesicht, weil er wochenlang auf Mörderjagd gewesen war, mit falschem Lächeln, weil er den verschwitzten Händedruck von diesem Idioten von Innenminister, von dieser Hyäne von Innenministerin ertragen musste, in Galauniform und mit entgleister Miene, weil irgendein Empfang nur betrunken zu ertragen gewesen war … das war der Major. Aber wo war er, der Mensch Schäfer? Kurz überlegte er, die selbst erzeugte Melancholie bis zu einem Tränenausbruch zu steigern, der als Spannungslöser manchmal fast so gut funktionierte wie Alkohol; dann leerte er sein Weinglas in einem Schluck und räumte den Tisch ab.
Zehn Minuten, nachdem er sich vor dem Fernseher eingerichtet hatte, klopfte das schlechte Gewissen an. In der Garage standen ein Birnbäumchen, ein weiß blühender Oleander, zwei Rosenstöcke (Sommerwind und Queen Elisabeth), eine Passionsblume, ein Winterjasmin, winterharte Alpenveilchen, ein Rhododendron sowie verschiedene Nutzkräuter (Verbene, Rosmarin, Salbei). Wenigstens gießen könntest du uns, du Faulsack, schrien sie durch die Wände. Schon gut, murmelte Schäfer und drehte den Fernseher ab.
Er holte einen alten Norwegerpullover aus dem Schlafzimmer und ging in die Garage. Als erstes machte er sich an die Rosen. Füllte zwei Tontöpfe zur Hälfte mit Erde, grub mit den Händen eine Mulde und setzte – zog Arbeitshandschuhe über – und setzte die Blumen ein. Dann kümmerte er sich um den Oleander und die Passionsblume vor. Nachdem er die Pflanzen allesamt gut gewässert hatte, nahm er den Spaten, eine kleine Handschaufel und einen Sack Erde, klemmte sich im Bücken das Kistchen mit den Alpenveilchen unter die Achsel und ging in den Garten. Wohin mit dem Zeugs, fragte er sich und versuchte sich zu erinnern, was der Verkäufer ihm geraten hatte. Egal. Wenn die am Berg überlebten, konnte an der Hausmauer nicht viel schief gehen. Nach einer Zigarettenpause fing er zu graben an. Kniete dann über dem neu erschaffenen Beet, war so zufrieden mit sich, so versunken in sein Tun, dass er das Auto in der Einfahrt nicht hörte, die Türglocke ebenso wenig, schlussendlich gewaltig erschrak, als plötzlich ein Paar Frauenbeine auf hohen Absätzen und in grauen Seidenstrümpfen neben ihm auftauchten.
»Entschuldigung!«, stieß Frau Thurner aus, erschrocken über Schäfers Schrecken, »ich habe geläutet und …«
»Mein Fehler«, erwiderte Schäfer, der sich mit schmerzenden Knien erhob, die rechte Hand ausstreckte und sofort wieder zurückzog. »Tschuldigung, Erde … ich war jetzt ganz weggetreten …«
»Sollte ich vielleicht auch einmal probieren«, meinte Thurner und lächelte.
»Was?«
»Gartenarbeit … zum Abschalten.«
»Ach so, ja«, Schäfer tippte sich an die Stirn und lotste seinen Gast zur Terrassentür. Warum hatte er ihr auf die Mailbox gesprochen, dass sie das Handy auch bei ihm zu Hause abholen konnte, wenn er überhaupt keine Lust auf fremden Besuch hatte. »Ich habe ja selber gerade damit angefangen, also nicht nur heuer, überhaupt … ähm, wollen Sie ein Glas Wein oder …«
»Gern«, antwortete sie zu Schäfers Überraschung und Missfallen. Auch das noch. Ihm wäre es lieber gewesen, das Handy los zu werden und gleich im Garten weitermachen zu können.
»Rot oder weiß?«
»Weiß«, erwiderte sie und musterte sein Wohnzimmer.
»Nehmen Sie Platz«, meinte Schäfer etwas unbeholfen und ohne auf eine konkrete Sitzgelegenheit hinzudeuten. Frau Landesrätin. Die Couch oder eins der beiden abgewetzten Lederfauteuils? Der Esstisch war vollgeräumt, besser am Küchentisch? Verdammt, wieso schämte er sich plötzlich?
»Hier okay?«, fragte sie und saß schon in einem der Fauteuils.
»Sicher … ich geh mir nur schnell die Hände waschen.«
Zumindest über den Wein wird sie nicht lästern können, dachte Schäfer, als er Thurner ein Glas vom besten Riesling einschenkte, den er im Keller gefunden hatte. Die Hände waren sauber, der muffige Norweger gegen einen feinen Kaschmir-Seide-Pullover eingetauscht, stilvoller konnte er es binnen so kurzer Zeit nicht geben. Musste er auch nicht; war ja nicht so, dass er sie verführen wollte.
»Ich wollte mich ohnehin noch einmal bedanken dafür, dass Sie am Samstag so einfühlsam waren«, meinte Thurner und hielt Schäfer das Glas zum Anstoßen hin. »Zum Wohl.«
»Zum Wohl«, erwiderte Schäfer leicht betreten. Einfühlsam, das klang in seinen Ohren schon intim. Was hatte er denn getan als seinen besten Hundeblick aufzusetzen und ein paar eingeübte Phrasen abzuspulen? Er nahm einen Schluck und flüchtete in die Küche, um das Handy zu holen.