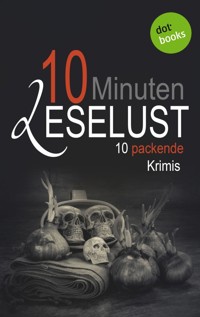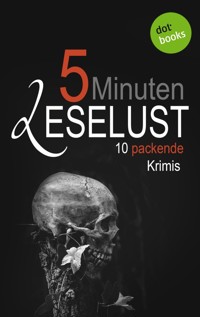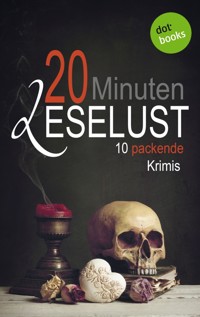Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Schnee knirschte unter ihren Füßen, und sie malte sich aus, dass eine ganze Heerschar blondgelockter Engel einmal tief in ihr Schaumbad gepustet und den Bäumen und Sträuchern weiße Krönchen aufgesetzt hatten. In den Fenstern spiegelten sich im flirrenden Lichterspiel die Kerzen der Weihnachtsbäume." Draußen wird es kalt, der Schnee beginnt zu fallen. Kerzen werden angezündet, es duftet nach Bratäpfeln und Zimt und wir machen es uns mit einer Tasse heißem Tee am Kamin gemütlich. Dies ist die Zeit für ein gutes Buch – und die Zeit für besinnliche Geschichten: über Familienbande und Nächstenliebe, über Sternenstaub und Weihnachtswunder. Zauberhafte Adventsgeschichten über die großen und kleinen Wunder der Weihnachtszeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Draußen wird es kalt, der Schnee beginnt zu fallen. Kerzen werden angezündet, es duftet nach Bratäpfeln und Zimt und wir machen es uns mit einer Tasse heißem Tee am Kamin gemütlich. Dies ist die Zeit für ein gutes Buch – und die Zeit für besinnliche Geschichten: über Familienbande und Nächstenliebe, über Sternenstaub und Weihnachtswunder.
Zauberhafte Adventsgeschichten über die großen und kleinen Wunder der Weihnachtszeit.
Über die Herausgeberin:
Barbara Gothe, Jahrgang 1960, lebt in Reinbek vor den Toren Hamburgs und arbeitet seit vielen Jahren als Redakteurin und Herausgeberin.
***
Originalausgabe Dezember 2013
Copyright © 2013 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nicola Bernhart Feines Grafikdesign, München
Titelbildabbildung: © by-studio - Fotolia.com
ISBN 978-3-95520-499-0
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Sternenstaub und Weihnachtswunder an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Barbara Gothe, Hrsg.
Sternenstaub und Weihnachtswunder
Zauberhafte Adventsgeschichten
dotbooks.
Eine schöne Bescherung
von Friederike Costa
„Halleluja!“, frohlockte es an der Tür.
Susanna brauchte gar nicht hinzusehen, das war Jonas, ihr Vierzehnjähriger, und bestimmt kein Engel! Er warf sich mit einem herzhaften Schwung auf seinen Stuhl, stützte den Kopf in beide Hände und begann zu kippeln. „Muss der Häuptling heute eigentlich arbeiten?“, fragte er.
„'türlich!“, antwortete Benjamin, der gerade dazugekommen war und mit schnellem Blick das Nahrungsangebot auf dem Frühstückstisch überprüfte. „Ich glaub, das reicht nicht!“, rief er in Richtung Küche, setzte sich und erklärte seinem um fast zwei Jahre älterem Bruder: „Die rasen doch heute alle noch zur Bank, heben ihre letzten Mäuse ab und kaufen ein, was sie alles noch vergessen haben.“ Er griff sich mit spitzen Fingern eine Scheibe Wurst, stopfte sie sich in den Mund und mampfte: „Wenn die Bank am Heiligen Abend nich' offen hätte – mannomann, da würde ja glatt die ganze Wirtschaft zusammenbrechen!“
Susanna stellte den Kaffee auf den Frühstückstisch. Fertig – oder hatte sie noch was vergessen?
„Ketchup!“, erinnerte Jonas.
„Ketchup, wozu?“
„Für auf mein Ei!“
Susanna schüttelte es bei dieser Vorstellung, aber sie brachte das Ketchup, weil es ja doch keinen Sinn hatte, ihren Söhnen etwas ein- oder auszureden. Sie waren von Geburt an im schwierigen Alter und völlig taub auf allen Ohren. Ganz besonders auf dem für mütterliche Ratschläge und Wünsche!
Susanna rief nach dem Rest der Familie. Das waren Lea, die siebenjährige Tochter, die vergleichsweise zu ihren Brüdern noch recht harmlos war, Oma – Johannes' Mutter – und Johannes, der Häuptling, wie ihn seine Söhne nannten.
Johannes war ein ganz normaler Ehemann und Familienvater, der tagsüber die Brötchen ran schaffte und dafür abends seine Ruhe haben wollte. Denn er arbeitete ja schließlich den ganzen Tag! Aber sonst war er in Ordnung.
„Endlich!“, rief Benjamin, als alle am Tisch saßen. „Bis ihr kommt, hängt einem ja der Magen bis zur Schuhsohle!“ Und dann schaufelte er sich Brennstoff auf den Teller – viel mehr bedeutete Nahrung für ihn derzeit nicht, wie es schmeckte war egal, Hauptsache ganz viel!
„Man tut sich nich' so viel auf'n Teller!“, belehrte ihn Lea prompt.
„Was tut man nicht im Keller?“, fragte Oma nach. Sie hörte schlecht – wenigstens meistens.
„Nicht so viel auf den Teller!“, schrie Johannes und deutete auf Benjamins Teller.
Oma nickte. „Ganz recht Junge, iss nur, damit was aus dir wird!“
Benjamin grinste in die Runde. Und weil man schon mal beim Thema war, wollte er wissen, was es am Abend geben würde.
„Karpfen, wie jedes Jahr“, sagte Susanna.
„Och“, machte Jonas. Und dann voll Abscheu, gedehnt: „Kaaarpfen! Beim Roland gibt's aber Würstl und beim Kevin auch.“
„Bei uns gibt's Karpfen.“
„Warum?“
„Weil Oma und Johannes Karpfen essen wollen, das weißt du doch.“
„Aber ich will Würstl, und die Lea auch. Warum müssen wir uns immer nach der herrschenden Minderheit richten?“
„Weil wir in einer demokratischen Familie leben“, antwortete Johannes trocken und warf Susanna einen Blick zu der sagen sollte: Karpfen und Würstl, das muss doch zu machen sein!
Natürlich war das zu machen. Alles war zu machen! Und wie viel zusätzliche Arbeit sie damit haben würde, war ja unwichtig! Danach krähte kein Hahn! Überhaupt, wer hatte denn in all den Jahren, seit sie Ehefrau und Mutter war, auch nur ein einziges Mal danach gefragt, wie sie Weihnachten feiern wollte? Was sie essen wollte? Niemand, nein, denn Mütter haben ja wohl keine Wünsche! Oder?
Susanna war plötzlich ganz schön sauer. Wenn sie nur an den Christbaum dachte. Mit roten Kugeln und Silberlametta musste sie ihn schmücken, denn so hatte es Oma ein Leben lang gehalten, so musste es auch bleiben, egal ob ihr das gefiel oder nicht! Obwohl Susanna Fisch nicht mochte, gab es selbstverständlich Karpfen, darauf bestand Johannes. Denn ohne Karpfen ist das doch kein richtiges Weihnachten! Und dann die Geschenke, die sie immer bekam! Wenn sie da nur an letztes Jahr dachte.
Von Johannes einen Radiowecker, der alle fünf Minuten surrte: „Damit du uns morgens immer pünktlich wecken kannst!“ Sie hatte nämlich ein paar Mal den Wecker ausgedrückt und war dann wieder eingeschlafen. Und Johannes konnte es sich nun mal nicht leisten, zu spät zur Arbeit zu kommen!
Von Jonas hatte sie eine Fahrradpumpe bekommen, obwohl sie doch selbst eine besaß – Jonas allerdings nicht: „Vielleicht kann ich ja dann deine alte kriegen?“
Von Oma sechs Geschirrtücher, von Benjamin ein Asterix und von Lea einen Lippenstift in deren Lieblingsfarbe – ein ganz abscheuliches Rosa. Susanna musste ihn dann am ersten Weihnachtstag in die Kirche anlegen. Die Blicke der übrigen Kirchgänger sagten alles ... Susanna trieb es jetzt noch die Schamröte ins Gesicht, wenn sie daran dachte. Lea hatte sich den Lippenstift dann zum Kinderfasching geborgt und ihn Gott sei Dank nie mehr zurückgegeben.
Und auf all diesen Päckchen war etwas von Liebe gestanden. ‚Meiner lieben Mami, ‚Für die liebste aller Mamis‘ oder ‚Für meine geliebte Susanna‘. Bei so viel Liebe muss man dann doch gerührt danke sagen, oder?
Muss man wirklich? fragte sich Susanna plötzlich. Vielleicht war sie heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden, vielleicht hatte ihre Gutmütigkeit aber auch ganz einfach ihre Grenzen erreicht. Jedenfalls beschloss Susanna, während sie ihren Kaffee trank und die anderen die Würstchen-Karpfenfrage erläuterten, ihrer Familie dieses Jahr ein unvergessliches Weihnachten zu bereiten …
Nach dem Frühstück sauste sie durchs Haus, um notdürftig Ordnung zu machen, wo ihre Familie sehr gründlich Unordnung gemacht hatte. Dann fuhr sie in die Stadt. Zum ersten Mal gehörte sie zu den Leuten, die noch am 24. Dezember Geschenke einkauften und vor den Kassen in den Lebensmittelläden in endlosen Reihen anstehen mussten. Aber während sich die Leute ringsum über die langen Schlangen ärgerten und ihrem Vordermitleidenden ungeduldig den Einkaufswagen in die Fersen rammten, schien Susanna die Ausgeglichenheit in Person zu sein. Sie sang sogar ganz leise ein Weihnachtslied vor sich hin. Den traditionellen Text änderte sie allerdings ab. „O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie blau sind deine Schleifen ...“ Sie entdeckte ihre Nachbarin in der anderen Reihe, winkte, rief ihr zu: „Guten Tag, Frau Müller, und fröhliche Weihnachten!“, und bekam nur ein finsteres Nicken zur Antwort. Susanna verstand gar nicht, warum die so griesgrämig dreinsah. Na ja ...
Dann wieder nach Hause, Geschenke einpacken, den Christbaum schmücken, den Tisch decken, das Essen vorbereiten.
Irgendwann erschien Jonas‘ Kopf in der Küchentür. „Hier riecht es aber komisch, was is'n das?“
„Würdest du mir bitte Kartoffeln aus dem Keller holen?“, antwortete sie mit einer Gegenfrage, denn erfahrungsgemäß war ein Auftrag dieses enormen Ausmaßes die sicherste Möglichkeit, ihn am Topfkucken zu hindern.
Prompt trat er den Rückzug an. „Kann nicht, muss unbedingt erst noch ...“, nuschelte er und war auch schon weg.
Später richtete sie Johannes und den Kindern etwas Hübsches zum Anziehen hin, zog sich selbst um und sammelte die Geschenke der Familie ein, um sie unter den Christbaum zu legen. Dazu summte sie ein Lied und war ganz zufrieden.
Pünktlich um 18 Uhr war die ganze Familie versammelt. Gestriegelt und gebügelt, die Kinder mit glänzenden Augen, Johannes ganz abgeklärtes Familienoberhaupt, Oma mit gespitztem Mund, und Susanna hatte immer noch dieses auffällig penetrante Lächeln auf den Lippen.
Sie schlüpfte ins Wohnzimmer, zündete die Kerzen an, legte die Weihnachtsplatte auf und ließ das Glöckchen klingeln. „Hereinspaziert!“, rief sie fröhlich und öffnete weit die Tür.
Betretenes Schweigen, Blicke wurden getauscht.
„Hübsch, nicht wahr?“, flötete Susanna.
„Na ja“, meinte Johannes und räusperte sich.
„Wo sind denn die roten Kugeln!“ rief Oma entsetzt. „Und das Lametta! Solange ich denken kann ...“
„Und was Süßes hängt auch nicht dran!“, fiel ihr Lea ins Wort.
„Hauptsache, es liegt was drunter“, meinte Johannes beschwichtigend, mit Seitenblick auf seine Frau, aus bedrohlich zusammengekniffenen Augen.
„Also mir gefällt er!“, sagte Susanna und betrachtete zufrieden ihren Baum, der mit großen, hellblauen Seidenschleifen, silbernen Kugeln und weißen Wachskerzen geschmückt war.
„Nun ja, wenn's dir gefällt ...“, meinte Johannes dann großmütig und tätschelte Susanna wie einer armen Kranken den Arm. „Sollen wir dann mal?“
„Au ja, prima!“ Sofort stürzte Benjamin auf die Geschenke los, aber Susanna erwischte ihn gerade noch am Arm und hielt ihn fest.
„Die Geschenke“, sagte sie und lächelte warm, „die lassen wir noch liegen. Wir essen zuerst.“
„Oooch! Warum erst essen? Haben wir doch sonst auch nie gemacht!“
„Warum? Das kann ich dir sagen!“, sagte Susanna und sah von einem zum anderen. „Wisst ihr, wie ihr mir am Heiligen Abend immer vorkommt? Wie die Wölfe! So macht ihr euch über die Geschenke her. Und ich? Ich sammle zerknülltes Papier ein, verschwinde in die Küche, um das Futter ranzuschaffen, das ihr dann achtlos in euch reinschaufelt, um möglichst schnell wieder bei den Geschenken zu sein. Und um mich kümmert sich niemand mehr, ich werde in der Ecke abgestellt. Nein, heute essen wir zuerst, unterhalten uns dabei gemütlich, und erst wenn ich in der Küche fertig bin – ihr könnt mir ja vielleicht helfen, dann geht's schneller! – öffnen wir gemeinsam unsere Geschenke.“
„Irgendwie hat eure Mutter schon Recht“, kam ihr Johannes zu Hilfe. Aber der Seitenblick, mit dem er sie bedachte, sprach Bände! Ganz geheuer war Susanna ihm nicht. Wahrscheinlich litt sie an dieser modernen Krankheit – wie hieß die doch noch? Hausfrauensyndrom oder so ähnlich. Ob das gefährlich war? Er nahm seinen jüngeren Sohn an der Schulter und rief aufgesetzt gutgelaunt: „Na, also los dann, an den Tisch, zuerst wird gemütlich gegessen!“
Als Susanna die Spätzle brachte, verstummte das Gespräch, das ohnehin nur im Flüsterton geführt wurde. Wahrscheinlich wollte man ihre offensichtlich überspannten Nerven schonen. Spätzle zu Karpfen und Würstl?
Sie schmunzelte, ging wieder in die Küche, brachte die große Terrine. Dann setzte sie sich, nahm den Deckel ab und lächelte zufrieden in die Runde.
„Was is'n daaas?!“
„Iiii!“
„Susanna! Also das geht nun aber wirklich zu weit!“ Johannes blies die Backen auf. „So lange ich denken kann, gab's Karpfen am Heiligen Abend!“ Beinahe hätte er mit der Faust auf den Tisch geschlagen. „Ich mag keine Zunge, das weißt du doch!“
„Und ich mag keinen Karpfen, das weißt du auch. Trotzdem musste ich fünfzehn Jahre lang Karpfen zu Weihnachten essen.“
„Als Frau passt man sich eben den Wünschen seines Mannes an“, sagte Oma spitz.
„So, tut man das?“, entgegnete Susanna nicht minder spitz.
„Und unsere Würstl!?“, rief Jonas in die peinliche Stille hinein.
Susanna sah schweigend von einem zum anderen, dann wünschte sie guten Appetit und begann zu essen. Ihr schlechtes Gewissen – und es war sehr, sehr schlecht! – überspielte sie mit fröhlichem Geplauder, Augenzwinkern und witzigen Anekdoten aus ihrer Kindheit. Dazu aß sie mit Appetit und trank sogar ein ganzes Glas Wein. Und trotz anfänglicher Proteste schien es ihrer Familie nun doch recht gut zu schmecken. Jedenfalls war am Ende kein Stückchen Zunge mehr übrig.
Als Susanna abräumen wollte, wurde sie von Benjamin sanft aber bestimmt auf ihren Stuhl gedrückt: „Lass nur Muttilein, wir machen das schon!“, und drei eilfertige Sprösslinge trugen in Nullkommanix das Geschirr in die Küche, schwemmten es ab und schichteten es in die Spülmaschine. Da sieh mal einer an!
„Hast du noch mehr Überraschungen auf Lager?“, fragte Johannes verärgert, als sie alleine waren.
Susanna spitzte den Mund zu einem Schmunzeln. „Nur noch eine.“
„Aha. Und es stört dich gar nicht, dass du uns allen das Weihnachtsfest verpatzt?“
Etwas lauter als beabsichtigt antwortete Susanna: „Es ist schließlich auch mein Weihnachtsfest! Ich wollte nur, dass ihr euch darüber einmal Gedanken macht.“
„Bist du böse?“, fragte Lea, die gerade aus der Küche kam, kleinlaut.
„Nein, nein.“ Susanna küsste sie und sah in die Runde. „Also, dann können wir ja jetzt unsere Geschenke aufmachen.“
Benjamin hielt fragend Susannas Geschenk hoch, eine ledergebundene Ausgabe von Hesses gesammelten Werken. „Was is'n das? Märchen etwa?“
„Nein, das ist Literatur“, antwortete Susanna.
„Und was soll ich damit?“
„Och, ich dachte, du könntest mir das ja mal leihen, und dann heb' ich's für dich auf, bis du groß bist.“ Susanna hatte inzwischen Benjamins Geschenk ausgewickelt, rief begeistert: „Wie hübsch! Eine CD von Georgy Boy – wer ist denn das?“
„Mein Lieblingssänger!“, erzählte Benjamin begeistert. „Und den gibt's nich' mehr und darum war es ganz schwer, 'ne CD von ihm aufzutreiben. Dachte, vielleicht kann ich die ja mal ...“ Plötzlich brach er ab und blätterte verlegen in Hesses Werken.
„Leihen?“, hakte Susanna nach. „Aber klar doch, mein Sohn!“
Sie sah zu Jonas, der nun ein Flakon ;Chloe‘ aus dem Papier wickelte und beeilte sich, sein Geschenk auszupacken. „Ein Taschenmesser!“, rief sie entzückt. „Ich weiß schon, das kann man gut beim Camping gebrauchen und auf Schulausflügen und so.“
Jonas schluckte, er sah schnell weg und drehte verlegen am Verschluss des Parfums.
Susanna nahm das Päckchen von Johannes und machte ein verschmitztes Gesicht. „Lass mal raten – da ist bestimmt ein Eierkocher drin, damit du morgens endlich dein Viereinhalbminutenei bekommst! Weil ich doch immer die Eier vergesse ... siehst du!“ Sie hielt strahlend einen Eierkocher hoch.
„Susanna ...“
„Ja Johannes?“
„Lass es gut sein. Ich glaube, wir haben alle verstanden.“
Jonas und Benjamin nickten beschämt. Susanna lächelte, gab Benjamin die CD, bekam dafür den Hesse, tauschte Jonas' Taschenmesser gegen das Parfum ein und sagte zu Johannes: „In dem Päckchen für dich ist eine blaue Handtasche, passend zu meinem Mantel. Wehe, wenn du sie behalten willst, dann stelle ich den Eierkocher morgen auf sieben Minuten ein!“
Endlich war das Eis geschmolzen. Johannes lachte laut los, die Kinder lachten und sogar Oma. „Das hätte mir mal einfallen müssen“, meinte sie. „Wenn ich eine neue Handtasche brauchte, dann musste ich ...“ Sie verstummte verlegen.
„Dann musstest du?“, fragte Susanna neugierig. Aber Oma spitzte nur den Mund und hüllte sich in Schweigen.
Susanna verstand schon. Sie lächelte und küsste Oma, dann küsste sie Johannes und sagte: „Bei euch muss man schon mit dem Scheunentor winken, ehe ihr was begreift – aber trotzdem ... euch würde ich gegen nichts auf dieser Welt eintauschen!“
Zauber einer Weihnachtsnacht
von Irina Levin
Verstaubte Nostalgie. Verschlissener Samt. Blinde Spiegel. Auf dem Fenstersims eine Weihnachtskrippe mit einem Christkind aus Zuckerguss. Überall Advent, überall Wien mit seinen zwölf Grad minus, in denen nicht nur die Finger, sondern auch die Gefühle erfroren.
Miriam umklammerte die heiße Kaffeetasse. Die Finger erwärmten sich, nicht aber ihr Herz. Das fror weiter, zitterte, bibberte und klopfte bis zum Hals. Es hatte sich noch keinen Augenblick lang beruhigt, seit sie die Koffer gepackt und eine Woche vor Heilig Abend ihre Familie verlassen und einfach nach Wien gefahren war. Wie damals hatte sie sich in der kleinen, schmuddligen Pension einquartiert, deren Wirtin nach zweiundzwanzig Uhr im Flanellnachthemd auf einer Liege im Frühstückszimmer weinselig vor sich hinschnarchte. Vor zwanzig Jahren hatte Miriam die Pension ausgesucht, weil sie billig war, heute, weil sie jedes Detail ihrer großen Liebe herauskramen und in die Gegenwart zurückholen wollte.
Sie seufzte, trank einen Schluck Kaffee und beobachtete den alten Mann, der im Halbschatten mit sich selbst Schach spielte. Sie hatte einen Fehler gemacht. Große Lieben sollte man genießen, aber nicht heiraten. Denn eines hatten sie mit diesem Wiener Kaffeehaus gemeinsam. Sie verstaubten, weil man irgendwann mit dem Polieren aufhörte.
„Du kannst doch nicht einfach nach Wien fahren – kurz vor Weihnachten!“ Roberts Stimme legte sich vorwurfsvoll über die Kaffeehausstille. Erst am vergangenen Abend hatte er das zu ihr gesagt, und jetzt war es schon Erinnerung.
„Ich brauche Abstand, ich muss nachdenken...“
„Worüber?“
„Über uns. Über unser Zusammenleben.“
„Daran kannst du doch nichts auszusetzen haben ...“
Nein, Robert war sich nicht einmal bewusst, dass der Zauber ihrer ersten Begegnung längst dem Alltagsgrau gewichen war. Nichts als Nebel, und sie sehnte sich so nach der Sonne.
„...wir reden nicht mehr miteinander.“
„Wir reden den ganzen Tag.“
„Wir schlagen mit Worten die Zeit tot.“
„Ich liebe dich, Miriam.“
Ja, sie liebten sich, und doch hatten sie einander in den vergangenen zwanzig Jahren verloren. Kein Miteinander mehr, sondern nur noch ein Nebeneinander. Am Frühstückstisch, vor dem Fernseher, im Bett. Sie war jetzt zweiundvierzig Jahre alt und hatte begriffen, dass sie noch etwas anderes vom Leben erwarten konnte als Falten und Rheuma.
„Du kannst doch die Kinder nicht allein lassen.“
„Lisa und Tim sind erwachsen. Den Weihnachtsabend wollen sie ohnehin mit Freunden feiern.“
„Und ich? Was wird aus uns?“
Sie wusste es nicht. Das Kaufhaus gegenüber blinkte wie das Raumschiff Enterprise auf seiner Fahrt durch die Galaxis. Der Schachspieler schmunzelte, weil er gegen sich gewonnen hatte.
Miriam zahlte, lief gleich darauf durch die Straßen Wiens und entfernte sich immer weiter von sich selbst. Im Stephansdom mit seiner weihnachtlich entrückten Welt wurde sie etwas ruhiger und zündete eine Kerze an. Über die Fußgängerzone perlte der Wiener Walzer, eine alte Frau stopfte Papiertaschentücher in ihr Saxophon und spielte verhaltenen Jazz. Walzer und Jazz. Feuer und Wasser. Miriam und Robert.
Mit Einkaufslisten im Kopf und schweren Taschen in den Händen hetzten die Menschen an ihr vorbei, hetzten von Geschäft zu Geschäft. Miriams Hände waren leer, dieses Jahr würde es keine Geschenke geben. Nicht für sie und nicht für Robert, nur für die Kinder ...
Sie ging weiter, folgte fast automatisch den Walzerklängen und blieb schließlich abrupt stehen. Der Akkordeonspieler, der sich mit verzücktem Lächeln Johann Strauss hingab, hatte die orientierungslosen Pupillen eines Blinden. Alles um ihn herum war grau und trostlos. Bis auf zwei Farbtupfer. Der eine Farbtupfer war die gelbe Binde an seinem rechten Arm, und der zweite ein Plakat, über das die Neonkaskaden der gegenüberliegenden Bar zuckten. Es kündigte David Copperfield den großen Illusionisten und Magier an.
Miriam warf ein paar Schillinge in den Hut des Blinden, und während sie in das Plakat versunken dastand, breiteten sich Wärme und Licht in ihr aus. Die Nebelwand der vergangenen Jahre wich und die Erinnerung kam leicht und hell. Damals vor zwanzig Jahren war sie auch verliebt gewesen und unglücklich und einsam ...
Den ganzen Abend war sie durch Wien geirrt, auf der Flucht vor sich selbst, vor dem dumpfen Schmerz in ihrem Herzen, in ihrem ganzen Körper. Markus, ihre erste Liebe hatte sie wegen einer anderen verlassen. Dabei hatten sie zusammen Weihnachten feiern wollen – in Wien. Es war Heilig Abend. Sie war in Wien und sie war allein. Stille Nacht, heilige Nacht mit ihren hellerleuchteten Fenstern in den hohen alten Großstadthäusern. Lichtvierecke – golden umrahmten sie anheimelnde Familienszenen vor dem Weihnachtsbaum und schlossen den Betrachter aus, der verlassen im Dunkeln stand und fror.
Miriams Nerven vibrierten, sie hielt dieses Licht nicht mehr aus. Sie wollte sich verstecken, vor den weihnachtlichen geschmückten Schaufenstern, den funkelnden Bäumen, den über die Straßen gespannten Sterngirlanden. In einem großen, leeren Hinterhof blieb sie stehen, lehnte sich erschöpft an eine Mülltonne und beobachtete die Schneeflocken. Wie weiße Blüten fielen sie vom Himmel und legten ihre eigenen Beete an – dieses Weihnachten ließ auch keine Gefühlsduselei aus, verdammt ...
Sie schloss die Augen, tastete nach ihrem Taschentuch, wischte sich die Tränen ab und glaubte plötzlich einen Blick zu spüren.
Sie blinzelte und hätte fast aufgeschrieen beim Anblick des Mannes, der nur ein paar Meter von ihr entfernt stand und sie beobachtete.
Dann wurde ihr klar, dass er kein Gespenst sondern geschminkt war. Sein Gesicht war weiß und der lächelnde Mund tiefrot. Die Augen umrahmte ein Kranz aufgemalter Wimpern. Und trotzdem war er kein Clown, wie sie ihn aus der Kinderzeit kannte. Er war ein ...
„Ich bin Zauberer und lade Sie in mein magisches Reich zu einem Lächeln und zu einer Tasse Glühwein ein.“ Er bückte sich, malte eine Rose in den Schnee, hielt sie plötzlich in der Hand und überreichte sie ihr. „Voila, eine Rose ohne Dornen, denn Tränen gehören nun einmal nicht zum Weihnachtsabend.“
Die Rose in ihrer Hand duftete. Irgendwo spielte jemand Klavier. Stille Nacht, heilige Nacht, gespickt mit falschen Tönen. Doch der Tonfall des Zauberers war genau das, was sie jetzt nötig hatte. Er war warm, fast zärtlich, und sie folgte ihm in das alte Theater, als hätte sie keinen eigenen Willen mehr. Es roch nach Puder, Schminke und ein wenig muffig nach alten Mauern.
„Was machen Sie denn hier ganz allein und noch dazu heute Abend?“, fragte Miriam.
„Ich zaubere Ihnen mit Glühwein“, er reichte ihr eine Tasse, „ein Lächeln aufs Gesicht!“
„Alkohol statt Zauberstab?“ Sie lächelte tatsächlich.
„Manchmal ist jedes Mittel erlaubt. Voila, da ist die Bühne und noch dazu im richtigen Licht.“
Gleich darauf ergoss sich ein Scheinwerferinferno über die leere Bühne. Es funkelte, flirrte und flammte. Dagegen wirkte der Zuschauerraum wie das geöffnete Maul eines Raubtiers, bereit Miriam zu verschlingen. Sie trat einen Schritt zurück. Jetzt wusste sie, woher das Lampenfieber der Künstler kam. Das unersättliche Publikum war schuld daran. Sie hörte Applaus, obwohl niemand klatschte. Musik, obwohl der untalentierte Pianist zu spielen aufgehört hatte. Magie vermischte sich mit Illusion. Akrobaten und Hamlet, die schillernde Welt des Schauspiels und des Varietés.
„Wovor haben Sie Angst?“ Der Zauberer hatte Bernsteinaugen, die sie jetzt aufmerksam ansahen.
Sie dachte nach. Eine ernste Antwort auf eine ernst gemeinte Frage. „Vor der Liebe? Vor dem Leben?“
„Sie müssen die Welt verzaubern. Lächeln Sie das Leben an, und es lächelt zurück.“
„Für mich verzieht es nicht einmal die Mundwinkel.“
„So schlimm?“ Das Gold aus seinen Bernsteinaugen schwand. „Dabei ist Einsamkeit nur eine Illusion. Wer einsam ist, verschließt die Augen vor dem Leben. Wien, ja die ganze Welt ist voll von Menschen, die denken wie Sie. Jetzt in dieser Sekunde. Sie sind allein, unglücklich und glauben, der Schatz am Ende des Regenbogens sei für sie unerreichbar. Dabei müssen sie nur die Augen öffnen und nach ihm greifen. Öffnen Sie die Augen, und strecken Sie die Arme aus ...“ Er zwinkerte ihr zu. „Vielleicht hilft ein bisschen Zauberei?“
„Oder Glühwein.“ Sie fühlte sich schon besser, leicht, beschwingt, verzaubert, in dem alten Gemäuer mit seinen tausend Gesichtern. Wirklichkeit oder Traum. Sie konnte es kaum mehr unterscheiden.
Sanft griff der Zauberer nach Miriams Arm und zog sie in die Mitte der Bühne. Seine Hände wurden zu Instrumenten, die seltsam losgelöst von seinem Körper, die „zauberhaftesten“ Dinge taten. Mit Seidentüchern, die aus dem Nichts auftauchten, entfachte er ein Feuerwerk aus Lichtreflexen und Farben. Glaskugeln lagen plötzlich in seiner Hand. Sie sprühten, wechselten die Farben, tauchten in die Dunkelheit ein- und wieder auf.
Miriam war fasziniert, mehr noch, sie war gebannt von dem Mann, der sich jetzt voll auf sie konzentrierte. Sie nicht mehr losließ.
Er schüttete Sand in die hohle Hand, blies hinein und plötzlich stand sie inmitten eines Sterntalerregens.
„Denk immer daran, Hoffnung kann Staub in Sterntaler verwandeln“, sagte er zärtlich.
Eigentlich hatte sie ihm nicht von Markus und ihrem verwundeten Herzen erzählen wollen. Jetzt tat sie es doch. Sie redete sich alles von der Seele, er hörte zu und führte sie dabei immer tiefer in eine Welt voller Glanz, voller Illusionen, in eine Welt, in der Sternschnuppen und Sterntaler vom Himmel fallen.
Sie wusste noch immer nicht wie der Mann unter der Schminke aussah und doch hatte sie das Gefühl, ihn schon seit langer, langer Zeit zu kennen.
„Wie ist dein Name, großer Zauberer?“
„Heute habe ich keinen Namen, und morgen, morgen werde ich ein anderer sein und ein anderes Leben führen.“
„Aber warum denn?“
Er antwortete nicht, nahm sie nur in den Arm und küsste sie leicht. Sie wusste nicht, warum ihr Herz plötzlich wie ein kleiner Akrobat einen Salto Mortale schlug, ahnte jedoch, dass sie sich verliebt hatte. Verliebt in einen Zauberer ohne Namen, ohne Gesicht.
„Seltsam“, sagte sie, „vor ein paar Stunden wusste ich nicht, dass es dich gibt. Und jetzt ...“
„Zeit bedeutet nichts. Nicht für einen Zauberer. Und manchmal kann eine Nacht ein ganzes Leben sein ...“
Irgendwann verließen sie das alte Theater. Arm in Arm gingen sie durch die stillen weihnachtlichen Straßen. Es schneite, glitzerte, und es war, als habe der Weihnachtsmann einen Sack voll Nostalgie über der Stadt ausgeschüttet, während Miriam im Theater war. Oder hatte der Zauberer Wien verzaubert? War das Glück, das sie jetzt ganz tief in sich spürte, Illusion? Oder war aus Illusion schon Wahrheit geworden, in dieser Weihnachtsnacht?
Sie blieben vor der kleinen, schäbigen Pension stehen, läuteten die Wirtin aus ihrer Weinseligkeit. Der Zauberer berührte noch einmal mit dem Finger Miriams Lippen, und im nächsten Augenblick war er im Dunkel einer Gasse verschwunden.
„Wollen'S am Boden anfrieren oder reinkommen?“, holte die Wirtin Miriam in die Wirklichkeit zurück. Und den Bruchteil einer Sekunde fragte sie sich, ob sie alles nur geträumt hatte. Dann sah sie den Sternenstaub auf ihrem dunklen Mantel und erinnerte sich: „Hoffnung kann Staub in Sterntaler verwandeln.“
Die Neonkaskaden der gegenüberliegenden Bar zuckten noch immer über das Plakat von David Copperfield. Der Blinde spielte nicht mehr Walzer, sondern „Leise rieselt der Schnee.“
Hoffnung kann Staub in Sterntaler verwandeln. Miriam lächelte. Das hatte sie all die Jahre vergessen, und sie hatte vergessen, dass der Zauberer Robert gewesen war.