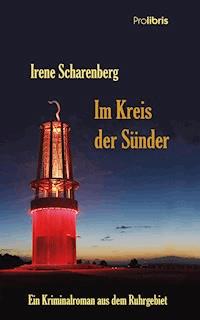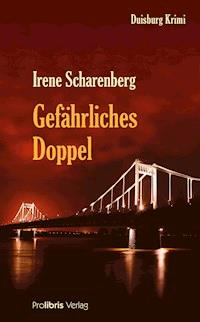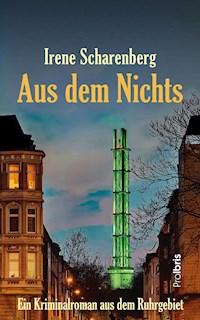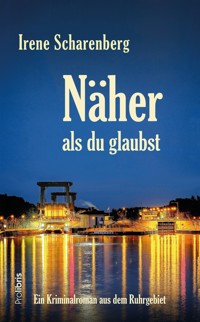Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Danksagung
Irene Scharenberg
Stirb zweimal
Inselkrimi
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Fantasie der Autorin. Ebenso
die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind Straßen und Schauplätze auf Norderney und in Norden. Die Norderneyer Kur- und Rehabilitationsklinik
am Deich entstammt ebenfalls der Fantasie der Autorin.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2019
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelfoto:
© Bildagentur PantherMedia / Stephan Sühling
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-209-6
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-198-3
www.prolibris-verlag.de
Die Autorin
Irene Scharenberg ist in Duisburg aufgewachsen und hat hier Chemie und Theologie
für das Lehramt studiert. Vor einigen Jahren hat sie die Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt. Seit 2004 sind zahlreiche ihrer Kurzgeschichten in
Anthologien und Zeitschriften erschienen und in Wettbewerben ausgezeichnet
worden. 2009 gehörte die Autorin zu den Gewinnern des Buchjournal-Schreibwettbewerbs, zu dem mehr
als 750 Geschichten eingereicht wurden.
Irene Scharenberg ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie lebt am Rande des Ruhrgebiets in Moers. In ihrer alten Heimat
Duisburg spielen sechs Kriminalromane mit den beiden Ermittlern Pielkötter und Barnowski. 2018 hat die Autorin ihre Liebe zu der Insel mit der
Leidenschaft fürs Schreiben verbunden. Nach »Tödliches Bad« und »Im Schatten des Leuchtturms« spielt auch »Stirb zweimal« auf Norderney.
Für meine Familie
Prolog
Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Angelina hatte so ängstlich geklungen, geradezu verzweifelt. Nein, panisch. Ihre eigentlich so
weiche Stimme, die mich vom ersten Moment an fasziniert hatte, war mir so
schrill erschienen, als gehöre sie überhaupt nicht zu ihr.
»Ich habe einen Fehler gemacht«, hatte sie in einem Tonfall erklärt, der mich weit mehr alarmiert hatte als die unterschwellige Panik. »Einen unverzeihlichen Fehler, für den ich jetzt büßen muss.«
»Nein!«, hatte ich geschrien, dann hatte sie das Gespräch beendet.
Ich schaute auf meine Armbanduhr. Seit Angelinas Anruf waren gerade einmal
dreizehn oder vierzehn Minuten vergangen, aber die kamen mir inzwischen vor wie
eine kleine Ewigkeit. Zudem lagen noch einige Kilometer vor mir, bis ich sie in
die Arme schließen konnte … sofern alles gutging.
Du musst es schaffen, du musst es schaffen, hämmerte es unaufhörlich hinter meiner schweißnassen Stirn. Schließlich hatte sie mich angerufen, nicht ihren geliebten Zwillingsbruder, nicht
ihren Liebhaber, nicht die Polizei. Deshalb durfte ich jetzt nicht versagen.
Wenn ich nur rechtzeitig kam, würde alles wieder gut werden. Wir könnten ganz neu anfangen, in einer Stadt, in der uns keiner kennt. Schneller,
schneller dröhnte es in meinem Kopf. Mein Wagen raste mit Landstraßengeschwindigkeit durch das Wohnviertel. Schneller, Schneller.
Endlich hatte ich mein Ziel erreicht. Mit quietschenden Reifen bog ich von der
Straße ab und sauste die Einfahrt hoch. Ich stoppte mit einer Vollbremsung vor der
Doppelgarage neben Angelinas roten Mazda und hechtete aus dem Auto zur Haustür. In der Dunkelheit stolperte ich die drei Stufen aus Granitstein nach oben.
Der Bewegungsmelder oder die Lampe am Vordach schien defekt zu sein. Als meine
Hand nach dem Knauf fasste, stellte ich zu meinem Erstaunen fest, dass die
Eingangstür einen Spalt breit offenstand. Ein ganz schwacher Lichtschein drang nach draußen. Mein Pulsschlag beschleunigte sich. Während ich die schwere Konstruktion aus Stahl und Bleiglas weiter nach innen drückte, versuchte ich, den Kloß herunterzuschlucken, der sich plötzlich in meinem Hals gebildet hatte.
»Angelina!«, rief ich heiser. »Angelina!«
Ich erhielt keine Antwort, und die Stille schien mich zu erdrücken wie der Deckel eines Grabes, in dem ich lebendig begraben lag. Vorsichtig
schaute ich noch einmal nach hinten, als drohe von dort Gefahr. Eine schmale
Mondsichel kam gerade hinter einer Wolke hervor, beleuchtete kurz den Vorgarten
und verschwand dann wieder, verschluckt von der nächsten dicken Wolke. War Angelina etwa ins Freie geflüchtet? Hatte die Haustür deshalb aufgestanden? Und was bedeutete das?
»Angelina!«, schrie ich ein letztes Mal mit brüchiger Stimme. Entweder konnte oder wollte sie mich nicht hören oder sie war nicht in der Lage, mir zu antworten. Nein, was ich mir da
gerade ausmalte, musste ich schleunigst aus meinem Kopf verbannen. Während mein Herz einen Schlag lang auszusetzen schien, beschloss ich, meine
Strategie zu ändern. Zwar wäre ich am liebsten losgerannt, um nach ihr zu suchen, aber ich wollte lieber
vorsichtig sein und mich erst einmal umsehen. Lautlos ging ich nun durch den
Flur. Der schwache Lichtschein, den ich schon am Eingang bemerkt hatte, kam aus
der ersten Etage. Mit angehaltenem Atem schlich ich die Treppe hoch. Der Kloß in meinem Hals wuchs von Stufe zu Stufe. Wenn ich jetzt noch einmal rufen würde, käme wahrscheinlich nur ein leises Krächzen heraus. Meine verschwitzte Hand hielt sich am Geländer fest, als sei das Holz der Rettungsanker für einen Ertrinkenden.
Als ich endlich oben in der ersten Etage stand, zitterten meine Knie. Ich sah
mich um. Obwohl mir das Haus vertraut war, wirkte alles so furchtbar fremd. Die
Türen auf der rechten Seite, die zum Bad und dem Gästezimmer führten, waren verschlossen, ebenso die auf der Linken, hinter denen die beiden
Schlafräume lagen. Das Licht kam aus Angelinas Büro am Ende des Flurs. Für einen kurzen Moment geriet ich in Versuchung, noch einmal ihren Namen auszustoßen, entschied mich jedoch dagegen. Wenn sie wirklich hier in ihrem Arbeitszimmer
saß, würde ich ihr sowieso in wenigen Sekunden gegenüberstehen oder … Das Herz schlug mir bis zum Hals. Während ich mich sehr langsam in Richtung Büro bewegte, als spiele die Zeit nach der rasenden Autofahrt nun keine Rolle
mehr, rannen Bäche von Schweiß meinen Rücken hinunter. Dabei war mir kalt, eiskalt. Ich stieß die leicht geöffnete Tür weiter auf, so dass ich einen Teil des Zimmers sehen konnte, wagte kaum zu
atmen, behielt die Klinke in der Hand.
Zuerst fiel mein Blick auf den leer geräumten alten Eichenschreibtisch, ein Erbstück von ihren Eltern. Darüber hing ein typisches Urlaubsfoto von Angelina und mir bei einem Segeltörn im Mittelmeer vor drei Jahren. Auf dem schwarzen Bürostuhl hinter dem Schreibtisch saß niemand. Voller Angst suchte ich den Boden ab. Das Muster des Perserteppichs
verschwamm vor meinen Augen. Jeder Muskel in mir war angespannt, die
Ungewissheit zerrte an meinen Nerven. Benommen hielt ich mich an der Klinke
fest, dann drückte ich die Tür mit Wucht vollständig auf. Ich starrte nach rechts zu dem kleinen gläsernen Beistelltisch mit zwei weißen Ledersesseln. In dem vorderen saß Angelina. Ihr Kopf lag auf der Tischplatte. Das Glas hatte sich rot gefärbt, rot wie ihr Haar.
Mein Schrei zerriss die unheimliche Stille. Der Kloß in meinem Hals schien sich gelöst zu haben. Wie von Sinnen brüllte ich immer wieder Angelinas Namen. Ich war unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Wie in Trance bewegte ich mich vorwärts, bis ich Angelina erreichte. Ich berührte ihren Körper, ihr Haar. Blut klebte an meinen Fingern, aber das störte mich nicht. Erst als meine Tränen es verdünnten, erwachte ich aus meiner Erstarrung. Mit zitternden Händen zog ich mein Smartphone aus meiner Hosentasche und rief die Polizei an.
1
Doktor Salzbach sah Kommissar Willibald Pielkötter durchdringend, vielleicht auch ein wenig tadelnd an. Pielkötter fühlte sich unwohl, nicht wegen des Blickes, sondern weil er befürchtete, der Arzt könne ihm eine sehr unerfreuliche Mitteilung machen. Er hatte ihn gestern zu
seinem kleinen Büro im Verwaltungstrakt der Norderneyer Kur- und Rehabilitationsklinik am Deich
bestellt. Seitdem hatte Pielkötter diesem Termin mit innerer Unruhe entgegengefiebert.
»So einen Aufruhr, wie Sie ihn hier veranstaltet haben, gab es in unserer Klinik
bisher noch nicht. Dem Mörder eine Falle stellen, Verhöre, Verhaftung. Alle Achtung …« Salzbach hob die Arme und seufzte, was auf Pielkötter seltsam theatralisch wirkte, dann lehnte sich der Arzt in seinem Sessel zurück. »Nun, das macht Ihnen so schnell keiner nach. Erst recht nicht in Ihrem
gesundheitlich angeschlagenen Zustand.« Er räusperte sich und schaute nun noch eine Spur ernster drein. »Womit wir direkt beim Thema wären. Also, dass diese Ermittlungen Ihrer Gesundheit geschadet haben, muss ich
Ihnen wohl nicht groß erklären. Das wissen oder spüren Sie sicher selbst am besten. Und das verwundert auch nicht. Schließlich haben Sie laut den Eintragungen in Ihrer Akte wichtige Therapiestunden
zugunsten Ihrer Recherche ausfallen lassen. Das hat weder Ihrer Psyche noch
Ihrer Schulter wirklich gutgetan.«
Bei dem Wort Psyche verzog Pielkötter unwillkürlich das Gesicht. Warum hackte der Salzbach auf seinem Gemütszustand herum? Ihm reichte es, seine Schulter wieder frei zu bewegen und
seinen Dienst aufzunehmen. Dann würde er so ausgeglichen sein, dass die meisten Menschen davon nur träumen konnten. Zudem störte ihn, dass der Arzt ihm nun doch eine kleine Moralpredigt hielt, nachdem er
gerade noch verkündet hatte, er selbst wisse ja am bes0ten, was bei seiner Reha bisher
schiefgelaufen sei.
»Die neue Klinikleitung wäre Sie natürlich genauso liebend gerne losgeworden wie unser alter Chef Professor Doktor
Schwarzenberg«, unterbrach Salzbach mit verändertem Tonfall seine Gedanken. Fast klang er ein wenig amüsiert. »Aber ich als Ihr behandelnder Arzt habe darauf bestanden, dass Sie bleiben. Ich
habe durchgesetzt, dass Ihre Rehabilitationsmaßnahme um vier Wochen verlängert wird. Und ich lege Ihnen dringend ans Herz, diese Zeit zu nutzen. Nur so
haben Sie eine Chance, wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert zu werden.«
Das saß. Die Worte musste Pielkötter erst einmal auf sich wirken lassen. Er würde sie analysieren, Silbe für Silbe und daraus seine Schlüsse ziehen. Aber eigentlich wusste er ja, dass sein Arzt Recht hatte und er sich
glücklich schätzen konnte, dass Salzbach sich bei der Klinikleitung für ihn stark gemacht hatte. Chance, hatte er gesagt. Also war nicht alles
verloren.
»Noch einmal ganze vier Wochen«, sagte Pielkötter mehr zu sich selbst, dann presste er »Danke« hervor: »Danke, Herr Doktor Salzbach, dass Sie sich für mich eingesetzt haben.«
»Ich stand übrigens schon vorher auf Ihrer Seite«, erklärte der Arzt zu seinem Erstaunen. »Weil ich die Umstände von Schröders Tod nicht vertuschen wollte, habe ich mächtig Ärger mit meinem Vorgesetzten bekommen. Damals habe ich geglaubt, es ginge nur um
den Ruf der Klinik, heute weiß ich, es stand viel mehr auf dem Spiel. Aber lassen wir diese schreckliche
Geschichte ruhen. Ab morgen gilt Ihr neuer Therapieplan und …«
Salzbach stoppte seinen Redefluss und Pielkötter war ihm dankbar dafür. Er wusste ohnehin, was der Arzt ihm mitteilen wollte, und er hatte den festen
Vorsatz, seine Chance zu nutzen. In diesem Augenblick war er sogar davon überzeugt, dass es ihm nicht schwerfallen würde, alle Anweisungen genau zu befolgen. Schließlich ging es auf Norderney normalerweise sehr friedlich zu, und dass hier in den
nächsten vier Wochen ein weiterer Mord passieren würde, war mehr als unwahrscheinlich. Obwohl …
»Gut, das wär’s für heute. Ich habe mit Ihnen alles Nötige besprochen. Viel Erfolg! Es liegt nur an Ihnen.« Pielkötter vernahm Salzbachs Stimme wie aus der Ferne. Der Arzt hatte sich bereits
erhoben. Er beugte sich zu ihm hin und reichte ihm eine leicht gebräunte feingliederige Hand. »Der nächste Termin bei mir steht in Ihrem Therapieplan, den Sie morgen erhalten.«
Pielkötter verabschiedete sich. Ehe er sich umdrehte, registrierte er zum ersten Mal
das Durcheinander von Papierstapeln und Akten auf Salzbachs monströsem Schreibtisch und dann diesen hässlichen Wackeldackel, den er einst auf Kofferraumablagen gesehen hatte, meist
neben einer Rolle Toilettenpapier mit gehäkeltem Überzug. Unwillkürlich schüttelte Pielkötter den Kopf, weniger über den merkwürdigen und in seinen Augen äußerst kitschigen Schreibtischschmuck, sondern mehr darüber, dass er ihm erst ganz zum Schluss aufgefallen war. »Du lässt nach, alter Junge«, murmelte er draußen auf dem Gang leise.
Wenig später schaute Pielkötter sich in seinem Zimmer um, als sähe er das Mobiliar zum ersten Mal. Das Bett an der linken Wand, die beiden
Sessel an dem kleinen runden Tisch vor dem Fenster neben der Balkontür, die blaugrün gemusterten Übergardinen. Dabei war ihm das Zimmer schon fast zur zweiten Heimat geworden. So
lange wie hier hatte er bisher in keinem Hotel und in keiner Pension
zugebracht. Missmutig setzte er sich auf die Matratze und trommelte mit den
Fingern der rechten Hand auf dem Nachttisch herum. Das Gespräch mit Doktor Salzbach hatte ihn sehr aufgewühlt.
Noch einmal vier Wochen Rehaklinik auf Norderney. Nichts gegen die Insel, aber
er vermisste seine Frau Marianne und seinen Dienst bei der Duisburger Kripo, wo
er für Mordermittlungen zuständig war. Wie gerne würde er sich wieder über die flapsige Art seines jungen Mitarbeiters Bernhard Barnowski aufregen, dem
er im Laufe der Jahre oder besser gesagt, während der gemeinsamen Fälle, doch erheblich nähergekommen war? Am schlimmsten jedoch empfand er die weitere Ungewissheit. Würde seine verletzte Schulter jemals so weit genesen, dass er seine Arbeit im
Duisburger Präsidium wieder aufnehmen konnte? Pielkötter erinnerte sich an den Vorschlag seines Sohnes Jan Hendrik, als Dozent zur
Polizeihochschule zu wechseln. Sein Mund verzog sich zu einem verächtlichen Grinsen. Der Rat war sicher gut gemeint, aber eine Lehrtätigkeit kam für ihn nicht infrage. Er brauchte das Wittern, das Aufnehmen einer Spur, das allmähliche Hineinwachsen in das Denken des Täters. Gerade das machte seinen Beruf so interessant, das konnte kein Vortrag über vergangene Fälle ersetzen. Spürsinn konnte man ohnehin nicht erlernen. Okay, vielleicht hatte er im Laufe der
Zusammenarbeit mit seinem jungen Untergebenen Barnowski einiges bewirkt, aber
sie arbeiteten schließlich seit etlichen Jahren bei der Verfolgung ganz unterschiedlicher Verbrecher
zusammen – erfolgreich!
»Du hast dir die Sache mit der Verlängerung selbst eingebrockt«, sagte er laut zu sich selbst.
Natürlich konnte er nicht wissen, wie anders die Heilung verlaufen wäre, wenn er sich darauf konzentriert hätte, die Beweglichkeit seiner Schulter wiederzuerlangen, statt den Mord an einem
Mitpatienten aufzuklären. Trotzdem wäre es für seine Gesundheit sicher besser gewesen, er hätte alle Therapiestunden absolviert und sich nicht um das plötzliche Verschwinden seines Tischnachbarn Wolfgang Schröder gekümmert und seinen Mörder aufgescheucht.
Mitten in seine Gedanken hinein klingelte das Telefon.
»Weißt du inzwischen Genaues?«, hörte er Mariannes erregte Stimme. »Ich habe schon einige Male versucht, dich auf deinem Smartphone zu erreichen,
aber du hast das Gespräch nie angenommen.«
»Ja, ich bin auch gerade erst von dem Termin bei Doktor Salzbach zurück.«
»Und, was hat er gesagt?«
»Verlängerung für vier Wochen.«
»Freust du dich?«
»Wieso?«, fragte er irritiert.
»Dann besteht doch Hoffnung, sonst würde die Krankenversicherung das nicht bezahlen und die Beihilfe sowieso nicht.«
»Ich vermisse dich«, ging er nicht darauf ein, dabei kam ihm eine solche Gefühlsäußerung nur äußerst selten über die Lippen. Was war nur mit ihm los? Hatte ihn das Gespräch mit dem Arzt so sehr aufgewühlt?
»Dagegen kann man etwas tun, Herr Kommissar.« Seine Frau lachte. »Als erste Hilfsmaßnahme werde ich dich wieder besuchen und bringe mein Notfallköfferchen mit.«
»Und was ist da drin?«
»Wird nicht verraten. Aber hier ein Tipp: Du bekommst rote Ohren davon.«
Pielkötter musste schmunzeln. Anscheinend hatte sich Marianne auch verändert. Früher hatte sie nie so mit ihm rumgeflachst. Oder war das so lange her, dass er es
bereits vergessen hatte?
»Du, Marianne, ich muss jetzt runter zum Mittagessen. Wenn du magst, rufe ich
dich am Abend noch einmal an.«
»Ich bitte sehr darum. Und guten Appetit!«
Heute war allgemeiner Anreisetag und er war schon ein wenig gespannt, wen man im
Speiseraum an seinen Tisch setzen würde. Auch die beiden Zimmer rechts und links neben seinem würden neu belegt. Jedenfalls nahm er sich vor, sich nicht mehr so abweisend zu
verhalten wie Wolfgang Schröder gegenüber. Vielleicht hätte er das Schlimmste verhindern können, wenn er ihm nur etwas besser zugehört und sich für sein Problem interessiert hätte. Dass seine Wiedergutmachung lediglich darin bestanden hatte, den Mord an
ihm aufzuklären, nagte ziemlich an ihm.
2
Sören Hinrichsen starrte nachdenklich vor sich hin. Er saß an einem niedrigen Couchtisch in einem breiten Ledersessel. Neben ihm stand
eine altmodische Stehlampe mit Stoffschirmchen aus den Fünfziger- oder Sechzigerjahren, die überhaupt nicht zu der ansonsten recht modernen Einrichtung passte. Warum er sich
nicht von diesem antiquierten Möbelstück trennen mochte, verstand er selbst nicht. Allenfalls sein Unterbewusstsein
mochte wissen, was ihn damit verband. Vielleicht hatte er darunter in seiner
Kindheit einst ein geliebtes Stofftier erhalten, sein erstes Matchboxauto oder
ein anderes tolles Geschenk. Aber um die Vergangenheit ging es jetzt nicht.
Schließlich hatte man ihm und seinem Bruder Knuth heute ein erhofftes Erbe vor der Nase
weggeschnappt. Das war sehr ärgerlich, auch wenn er nicht wie Knuth von einem Unrecht überzeugt war und allein deshalb weniger wütend darüber war als Knuth.
Sören stierte vor sich hin. Im Geiste spulte er noch einmal das Streitgespräch ab, das soeben stattgefunden hatte. »Du willst die Sache also einfach auf sich beruhen lassen«, hatte Knuth wütend getönt. »Akzeptierst brav, dass dieser Erbschleicher uns auf hinterhältige Weise bestiehlt.«
»Natürlich begeistert mich das genauso wenig wie dich«, hatte er mit einer Stimme geantwortet, die ebenfalls ärgerlich klang. »Aber was sollen wir machen? Wir sind doch bereits in Berufung gegangen.« Seufzend stand er auf, lief zum Fenster und starrte in den Garten hinaus, den kürzlich ein Landschaftsgärtner im japanischen Stil mit hübschen, großen Ziersteinen gestaltet hatte. »Im Gegensatz zu dir versuche ich einfach zu akzeptieren, was nicht zu ändern ist«, redete er gegen die Scheibe. »Und das Urteil ist nun einmal nicht mehr anfechtbar. Das musst auch du einsehen.«
»Pah! Du hast gut reden«, schnaubte Knuth. »Deine finanzielle Situation sieht ja auch wesentlich rosiger aus als meine. Der
Geschenkeladen in bester Lage auf der belebten Einkaufsstraße wirft wohl einiges ab, dazu das schicke, gutbesuchte Café. Du kannst es dir leisten, deine Angestellten mal für dich arbeiten zu lassen. So wie heute Morgen. Da kann man leicht darüber hinwegsehen, dass in unserem Land Gerechtigkeit und Rechtsprechung zuweilen
weit auseinanderklaffen.«
Mit zornesrotem Gesicht hob er sein halb volles Saftglas, leerte es in einem Zug
und knallte es so hart auf den Tisch, dass es zu zersplittern drohte.
»Du übertreibst«, entgegnete Sören, wobei er zunächst offenließ, ob er die Geste oder die Einstellung seines Bruders meinte. »Möchtest du noch etwas zu trinken?«
»Nein, verdammt, ich möchte mein rechtmäßiges Erbe. Ich bin es einfach leid, von irgendwelchen miesen Jobs abhängig zu sein. Sobald die Saison vorbei ist, brauchen sie nur noch einen
Bruchteil der Kellner und dann kann ich mich wieder nach einer neuen Arbeit
umsehen. Ich habe das satt, es steht mir bis hier.« Mit der rechen Hand fuhr er sich ans Kinn. »Und die Erbschaft hätte mir ermöglicht, aus dieser elenden Tretmühle herauszukommen. All die dämlichen Sprüche nicht mehr anhören zu müssen: Herr Ober, wann gedenken Sie endlich, unser Essen zu servieren? Der Wein hätte aber etwas kälter sein können. Der Kaffee ist ja lauwarm. Hat der Koch heute eigentlich seinen freien …«
»Ich verstehe das ja, aber fairerweise solltest du zugeben, dass du überhaupt nicht weißt, ob Onkel Gerd dir oder uns wirklich etwas hinterlassen wollte. Sehr eng war
unser Verhältnis ja nicht gerade. Oft besucht haben wir ihn jedenfalls nicht.«
»Mit Sicherheit war mein Kontakt zu ihm besser als der von diesem Immobilienhai
Immenhoff.«
»Das kannst du ebenso wenig beurteilen wie der Richter. Laut Testament hat Onkel
Gerd nun mal Immenhoff die begehrten Grundstücke und die drei Häuser vermacht und nicht uns.«
»Du misst diesem elenden Zettel wirklich eine Bedeutung bei? Einem
handschriftlichen Testament? Handschriftlich! Kein Notar! Und das bei unserem überkorrekten Onkel, der selbst die Restaurantrechnungen aufbewahrte, die er nicht steuerlich absetzen konnte. Ich sage
dir eins: Wenn Gerd diesem Fiesling wirklich etwas hätte vererben wollen, dann wäre er …«
»Hör endlich auf! Du wiederholst dich. Alle deine Argumente hast du mir schon zig
Mal vorgekaut und ich kann sie nicht mehr hören. Zudem führt das ganze Lamentieren zu nichts. Mario Immenhoff hat den Prozess nun einmal
gewonnen. Ich bin sicher, das Verfahren wäre anders ausgegangen, wenn wir seine leiblichen Kinder gewesen wären. Aber wir sind nun einmal nur die Neffen. Und deshalb könnte ein Freund ihm durchaus nähergestanden haben als entfernte Verwandte.«
»Freund?«, spie Knuth förmlich aus. »So nennst du dieses miese Stück Dreck? Unser Onkel war niemals mit dem befreundet. Vielleicht hat er sich von
Immenhoff Koks oder willige Mädels besorgen lassen, aber das war’s dann auch.« Knuth schlug seine Hand mit einer theatralischen Geste vor die Stirn. »Ja, genau! So war es. Der Immenhoff hat ihn high gemacht und ihn anschließend mit dösigem Kopf das Testament schreiben lassen. Dass ich darauf nicht gleich gekommen
bin!«
»Du spinnst doch. Wieder so eine von deinen abstrusen Theorien. Ich kann mir kaum
vorstellen, dass Gerd freiwillig Drogen zu sich genommen hätte. Da hat mir deine Idee mit dem Erpressen ja noch besser gefallen. Nur … beweisen kannst du weder die eine noch die andere Vermutung. Und ich bin
ziemlich sicher, dass nichts davon stimmt. Tatsache ist einfach: Wir wissen
nicht, wie Gerd zu Immenhoff stand. Punkt. Aus. Ende.«
»Das hättest du wohl gern. Der elende Erbschleicher sowieso.«
Knuth war mit einer Miene von seinem Sitz hochgesprungen, als hätte man ihm in die edelsten Teile getreten. »Im Gegensatz zu dir bin ich nicht bereit, mir das bieten zu lassen.«
»Was willst du denn unternehmen?«, hatte er gefragte und dabei versucht, möglichst neutral zu klingen, um die Wogen zu glätten.
»Das weiß ich noch nicht, aber ich bin sicher, mir fällt bald etwas ein, und dann möchte ich nicht in Immenhoffs Haut stecken.«
Sören fühlte sich gefangen in diesem hitzigen Gespräch, obwohl sein Bruder ihn schon vor einer halben Stunde verlassen hatte.
Seufzend stand er aus seinem Sessel auf und lief ruhelos in seinem Wohnzimmer
hin und her. Während er sich vorstellte, wo Knuths blinde Wut hinführen könnte, wischte er sich mehrmals mit der Hand über die Stirn, als wolle er die Bilder in seinem Kopf dadurch verscheuchen.
3
Pielkötter saß in einem kleinen Stuhlkreis mit insgesamt sechs Patienten. Gruppentherapie, er
verzog das Gesicht, als hätte man ihn gezwungen, ein Glas Essigreiniger zu trinken. Einzelsitzungen bei
Katharina Fallersleben waren schlimm genug, aber seine Probleme vor einer Horde
fremder Leute breitzuwalzen, stieß bei ihm auf erheblichen inneren Widerstand, zumal er das alles schon in den ersten Wochen in der Klinik über sich hatte ergehen lassen müssen. Zudem verspürte er nicht die geringste Lust, sich mit den Schwierigkeiten völlig unbekannter Menschen auseinanderzusetzen. Natürlich kannte er das in seinem Beruf zur Genüge, aber dann befand er sich im Dienst und nicht in einer Rehaklinik, die sich
besser um seine kranke Schulter kümmern sollte als um sein seelisches Gleichgewicht.
»Zunächst einmal möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Gesprächskreis begrüßen«, eröffnete die Therapeutin die Sitzung. Die Frau von Mitte zwanzig mit rot gefärbten Haaren hätte locker als seine Tochter durchgehen können. Obwohl Pielkötter sich normalerweise nicht viel aus Kleidung machte, wirkte ihre hässliche giftgrüne Jacke, deren Knöpfe sie abzusprengen drohte, auf ihn sehr negativ. »Ich heiße Juliana Meinertshagen und ich bin Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt
Gruppentherapie. Ihre Namen stehen auf den Schildchen, die ich für Sie angefertigt habe. Die heften Sie sich bitte gleich an.«
»Ich möchte mich aber gerne richtig vorstellen«, bemängelte Magdalena Kiesewetter. Zumindest stand die Anrede auf dem Schild, das
eine etwa vierzig- bis fünfzigjährige Dame mit verkniffenen Gesichtszügen unschlüssig in ihren Händen hielt. »Sonst können die anderen mich gar nicht richtig einschätzen. Es ist ja sehr wichtig, welche Leidenschaften und Fähigkeiten man hat.«
Juliana Meinertshagen starrte Magdalena Kiesewetter zunächst stumm an. Konnte oder wollte die Therapeutin nicht darauf eingehen? »Dazu bekommen Sie später noch Gelegenheit«, antwortete sie erst, nachdem wahrscheinlich niemand mehr aus der Runde mit
einer Reaktion gerechnet hatte.
Und dieser weibliche Grünschnabel sollte ihm und den anderen Patienten weiterhelfen? Niemals! Irgendwo
hatte er einmal gelesen, dass ein Therapeut seine Schäfchen maximal so weit brachte, wie er selbst gekommen war. Wie Pielkötter die junge Dame in ihrem unvorteilhaften Outfit so einschätzte, konnte das unter Umständen für die Teilnehmer der Runde einen erheblichen Rückschritt bedeuten.
Da war Katharina Fallersleben schon ein anderes Kaliber. Und Mark Milton erst,
den er zunächst für einen Serientäter gehalten und der sich als exzellenter Psychologe erwiesen hatte. Der Mann
besaß wenigstens Lebenserfahrung im Gegensatz zu dieser Tussi.
»Wie schon erwähnt, sind wir insgesamt eine Gruppe von sechs Teilnehmern«, riss Juliana Meinertshagen ihn aus seinen Gedanken. »Zwei Frauen, Lena Maus und Magdalena Kiesewetter, und vier Männer, Björn Teinert, Oliver Hesseholt, Thorsten Sperling und Willibald Pielkötter. Eine gute Kombination, wie ich finde. In der einen Sitzung wird die Hälfte ihr Problem vorstellen und beim nächsten Mal ist dann die andere Hälfte dran.«
»Aber wenn einer von uns sehr viele Schwierigkeiten hat, müsste dem doch mehr Zeit eingeräumt werden, alles darzulegen«, wandte Björn Teinert ein. Der burschikos wirkende gut dreißigjährige Mann mit einem blonden Bürstenschnitt hatte sich bereits im Gang den andern Gruppenteilnehmern
vorgestellt. »Und dann passt Ihre Einteilung nicht mehr.«
Pielkötter konnte nicht recht einschätzen, ob Teinert das fürsorglich meinte oder Juliana Meinertshagen einfach nur hochnehmen wollte.
Vielleicht sogar beides.
»Das werden wir dann sehen«, entgegnete die Therapie-Tussi spitz, wobei sie in einem übergroßen Jutebeutel herumkramte, anstatt ihre Schäfchen anzusehen. Endlich hatte sie den gesuchten Gegenstand gefunden. »Ich habe hier einen kleinen roten Rettungsring«, fuhr sie fort, als hielte sie einen großen Schatz in ihren Händen.
Pielkötter malte sich lieber nicht aus, welchen überflüssigen Schnickschnack sie noch mitgebracht hatte. »Aus Erfahrung weiß ich, dass niemand gerne damit beginnen möchte, sein Problem vorzustellen.« Der Grünschnabel und Erfahrung, dachte Pielkötter und brummte in sich hinein. »Deshalb habe ich mir etwas überlegt. Ich setze mich mit dem Rücken zu Ihnen und werfe den Rettungsring über meine Schulter. Derjenige, in dessen Nähe er fliegt, fängt ihn bitte auf.«
»Aber Sie wissen doch genau, wie wir sitzen«, wandte Björn Teinert ein. »Dann könnten Sie ja gleich bestimmen, wer drankommen soll, und können auf Ihr Spielchen verzichten.«
»Bravo!«, rutschte es Pielkötter heraus.
»Ja, ja natürlich«, entgegnete Juliana Meinertshagen, während sich eine leichte Röte bis zu ihrem Haaransatz hochzog. »Selbstverständlich habe ich daran gedacht. Deshalb tauschen Sie bitte Ihre Plätze, sobald ich mich nach hinten gedreht habe.«
Juliana Meinertshagen hatte Pielkötter kurz sogar etwas leidgetan, aber durch die nachgeschobene unglaubwürdige Rechtfertigung hatte sie den kleinen Sympathiepunkt direkt wieder
verspielt.
Die Therapeutin drehte den Teilnehmern also den Rücken zu und bis auf Björn Teinert und Pielkötter tauschten alle die Plätze. Das Prozedere erinnerte ihn, einfach zu sehr an einen Kindergeburtstag, als
dass er dabei mitmachen wollte. Nachdem sich alle wieder hingesetzt hatten,
warf Juliana Meinertshagen den Ring und Oliver Hesseholt fing ihn auf.
»Na also, es geht doch«,sagte Juliana Meinertshagen sichtlich erleichtert. »Nun, Herr Hesseholt, schildern Sie uns bitte Ihr Problem.«
»Problem?« Der Angesprochene wirkte irritiert. »Es sind mehrere.«
»Dann greifen Sie am besten das für Sie Wichtigste heraus.«
»Aber die hängen doch alle irgendwie zusammen.«
»Dann fangen Sie einfach mit dem an, das Ihnen gerade einfällt.« Inzwischen klang Juliana Meinertshagens Stimme leicht genervt.
»Meine Frau … also, wir, ich denke, wir haben uns etwas auseinandergelebt. Wir unternehmen
kaum noch etwas zusammen und …«
»Haben Sie darüber schon einmal mit Ihrer Frau gesprochen?« Juliana Meinertshagen lächelte nun siegessicher, als hätte sie den weiteren Verlauf der Sitzung im Griff. Wenn Sie sich da mal nicht täuschte.
»Ja und nein.«
»Was denn jetzt?«
»Ich habe es einige Male versucht, aber Susanne hat immer abgeblockt. Sie hat
gemeint, die Schwierigkeiten bilde ich mir einfach nur ein.«
»Wann haben Sie Ihre Frau denn das letzte Mal so richtig geküsst?«, fragte Björn Teinert.
»Also … also, wirklich … das ist mir jetzt doch etwas zu intim.«
»Herr Teinert, ich muss doch sehr bitten«, schritt Juliana Meinertshagen ärgerlich ein.
»Was ist das denn hier?«, konterte Teinert. »Eine Spiel- und Plauderstunde oder eine Therapie, in der wir die Probleme
wirklich angehen. Und in diesem Fall muss eine solche Frage erlaubt sein.« Juliana Meinertshagen klappte den Mund auf, als wolle sie etwas einwenden, aber
Teinert redete einfach weiter. »Auf Ihrem Informationsblättchen stand ausdrücklich, dass aktive Teilnahme erwünscht ist und dass jeder, ich betone noch einmal jeder, weil Sie das extra unterstrichen haben, den Therapieverlauf positiv
beeinflussen kann.«
Pielkötter schmunzelte, diese Sitzung war gar nicht so langweilig, wie er sie sich
vorgestellt hatte.
»Man sollte schon auf die Gefühle der anderen Rücksicht nehmen«, schnaubte die Therapeutin. »Herr Hesseholt möchte auf Ihre Frage nicht antworten und basta.«
»Das ist sein gutes Recht, aber genauso gut ist es meins, die Frage zu stellen.«
»Ich finde, wir sollten jetzt wieder sachlich werden und uns auf das eigentliche
Problem von Herrn Hesseholt konzentrieren.« Meinertshagens Stimme klang eisig.
»Das letzte Mal zusammen geschlafen haben wir vor einem halben Jahr«, warf Hesseholt völlig überraschend in die Runde und alle Augen richteten sich auf ihn.
»Aber Sie wären schon gerne öfter mit Ihrer Frau zusammen?«, meldete sich Pielkötter zum ersten Mal zu Wort. »Und vorher war das anders bei Ihnen?«
»Ja genau. Und plötzlich meidet sie mich, erscheint erst im Schlafzimmer, wenn ich längst eingeschlafen bin. Na ja, auch tagsüber hat sie immer irgendetwas vor. Nicht einmal mehr in Urlaub fahren will sie
mit mir. Wahrscheinlich, weil sie fürchtet, mir dort nicht so gut ausweichen zu können.«
»Dann haben Sie wirklich ein Problem«, bemerkte Teinert. »Sie bilden sich das nicht ein, egal was Ihre Frau behauptet.«
»Schreiben Sie Ihrer Frau Gedichte«, schlug Magdalena Kiesewetter vor. »Ich kann Ihnen da gerne behilflich sein. Auf dem Gebiet der Lyrik bin ich
Expertin.«
Pielkötter verdrehte die Augen. Was sollte der Schwachsinn? Jetzt kam Hesseholt gerade
ein wenig aus sich heraus, erzählte der Gruppe wahrscheinlich etwas, das er noch niemandem mitgeteilt hatte,
und die Frau fing von Gedichten an!
»Wollen Sie noch ein weiteres Problem ansprechen?«, fragte Juliana Meinertshagen und sah demonstrativ auf die Uhr. »Sie haben ja mehrere, die miteinander zusammenhängen, wie sie selbst erwähnten«, schob sie hinterher, nachdem etliche Augenpaare sie erstaunt, irritiert oder
gar ärgerlich angeblickt hatten. »Selbstverständlich werden wir uns damit noch eingehender beschäftigen. In der ersten Sitzung jedoch reißen wir die Probleme nur kurz an, damit …«
»… Ihre Planung nicht durcheinandergerät«, wurde sie von Teinert unterbrochen. »Kein bisschen flexibel. Ohne Rücksicht auf die Patienten. Anscheinend sind wir hier Nebensache, dabei sollte es
doch um uns gehen, oder nicht?«
Während Juliana Meinertshagen nach passenden Worten suchte, verfärbte sich erneut ihr Gesicht. »Wenn Sie meine Kompetenz anzweifeln, steht es Ihnen frei, die Gruppe zu
wechseln.«