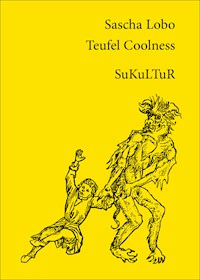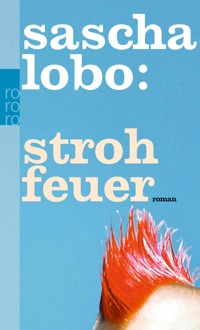
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geld, Projekte, Spaß – für Stefan ist das Leben ein aufregendes, wildes Spiel. Die New Economy mit ihren Verheißungen kommt ihm gerade recht. Hier kann er sich ausprobieren, dem Erfolg nachjagen, seine Ideen verwirklichen. Mit Freunden, die bald keine mehr sind, gründet er eine Agentur. «Habt ihr schon Marktrecherche gemacht? Konkurrenzanalyse? So was halt?» – «Ach Quatsch, hat Bill Gates etwa erst mal nachgefragt, ob jemand anders Microsoft gründen will?» Stefan versucht, den Boom für sich auszunutzen. Er glaubt, das ganz große Ding zu machen – und merkt nicht, wie ihm immer mehr entgleitet. Auf einmal geht es nicht mehr nur um Spaß, sondern um Liebe, nicht mehr nur um Karriere, sondern um das Leben. Alles steht auf dem Spiel. Sascha Lobo war selbst Start-up-Unternehmer. Sein rasanter Debütroman ist nicht nur ein Schlüsselwerk zur New Economy, er ist eine fesselnde Geschichte über Verlockungen und Verluste – und über die Lebensgier an sich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sascha Lobo
Strohfeuer
Roman
Ein bloßer Projektenmacher ist demnach etwas Verächtliches. Durch seine verzweifelte Vermögenslage so in die Enge getrieben, daß er nur durch ein Wunder befreit werden oder umkommen muß, zermartert er sein Gehirn nach solch einem Wunder vergebens und findet kein anderes Rettungsmittel als, indem er, einem Puppenspieler gleich, der Puppen hochtrabende Worte reden läßt, dieses oder jenes Nichts als etwas noch nie Dagewesenes hinstellt und als neue Erfindung ausposaunt, sich ein Patent darauf verschafft, es in Aktien theilt und diese verkauft. An Mitteln und Wegen, die neue Idee zu ungeheurer Größe anzuschwellen, fehlt es ihm nicht; Tausende und Hunderttausende sind das Geringste, wovon er spricht; manchmal sind es sogar Millionen, bis schließlich der Ehrgeiz eines ehrlichen Dummkopfs sich dazu verlocken läßt, sein Geld dafür hinzugeben.
Daniel Defoe
Like it’s 1999
Im Spätsommer 1999 wartete ich auf das Fin-de-siècle-Gefühl, von dem ich gelesen hatte. Es blieb aus. Stattdessen kam Lena. Ich sah sie bei einem Kongress, den sie organisierte, zufällig hinter der Bühne. Es war beeindruckend, wie sie ein Dutzend Helfer herumkommandierte. Sie schien in jedem Augenblick zu wissen, was wann wie und wo von wem zu tun sei.
Sie war klein, blond, sehr hübsch und ignorierte mich. In einem ruhigeren Moment sprach ich sie an. «Hallo.»
«Hallo.»
Ich hatte mir nichts zurechtgelegt, sondern verließ mich auf mein Gespür für Situationen. Ich war ein Meister darin, Nuancen in Mimik, Gestik und Aussprache von anderen Menschen wahrzunehmen und geschickt und schnell darauf zu reagieren. Ich konnte Gesichter lesen. Aber in ihrem «Hallo» steckte nichts, was mir weiterhalf.
«Du organisierst also diesen Kongress?»
«Ja. Aber was hast du hinter der Bühne zu suchen?» Ihre Gleichgültigkeit drohte in Ablehnung umzuschlagen.
«Ich, also, ich habe vor… demnächst lasse ich auch eine Veranstaltung organisieren, und ich dachte…»
«Interessant. Aber wir haben jetzt alle zu tun, vielleicht können wir heute Abend bei der Party darüber sprechen.»
Sie ließ mich stehen.
Am Abend kehrte ich zum Veranstaltungsort zurück, einem alten Fabrikgebäude, verziert mit Lichteffekten und Laserprojektionen. Lena stand in einem schulterfreien Sommerkleidchen auf dem Hof der Fabrik und trank Bier aus der Dose. Ich war begeistert – gerade auch von mir selbst: meinem Mut und meiner Spontaneität – und ging lächelnd auf sie zu. «Hi. Na, den Kongress einigermaßen überstanden? Ich wollte nur nochmal…» Dann fiel mir auf, dass sie ein Funkgerät mit Headset trug und jemandem zuhörte. Unsere Beziehung hatte noch nicht einmal begonnen und war schon geprägt von unvollendeten Sätzen. Betreten stand ich neben ihr, hörte das Gemurmel aus dem Gerät, ohne es zu verstehen, und betrachtete sie. Ihr rotes Kleid, ihre Schultern, in ihrer Hand die Bierdose, das schwere Funkgerät, dazu die langen blonden Haare, ihr teilnahmsloser Blick aus blauen Augen an mir vorbei. Ich verliebte mich.
Eigentlich hatte Lena auf dem Kongress nichts mehr zu tun, wollte aber ständig informiert werden, ob alles wie geplant ablief. Aus amüsiertem Interesse an meiner offensichtlichen Zuneigung widmete sie mir diejenige Hälfte ihrer Aufmerksamkeit, die nicht vom Headset beansprucht wurde. Ich redete und redete, scherzte, wie im Taumel feuerte ich eine Anekdote nach der anderen ab, erlebte, ausgeschmückte, ausgeborgte, erfundene – ich hatte ihr Ohr, ihr eines Ohr jedenfalls, aber ich wollte auch ihr Herz. Tief in der Nacht, als ich ihr schon drei-, viermal ein Lachen hatte entlocken können, verabschiedete sie sich überraschend. Irritiert gab ich für den Abend auf, zum Abschied packte ich sie fest an der Schulter. Sie zuckte zurück, ich lockerte den Griff nicht, es war unsere erste Berührung. Ich ließ erst los, als mich ihr verstörter Blick traf. «Oh, sorry. Sorry.»
«Hm.»
«Bis bald.»
«Vielleicht.»
Am nächsten Morgen war Herbst. Als ich aus dem Haus ging, konnte ich meinen Atem sehen. In den kommenden Wochen versuchte ich häufiger, mich mit Lena zu verabreden, was sie mit freundlichen Worten ablehnte. Irgendwann gab sie mir doch eine Chance, mit der Begründung, noch niemand habe so viele Absagen so charmant aufgenommen wie ich. Wir trafen uns. Ihr anfänglicher Widerwille löste sich in Gesprächen darüber auf, was man vom vergangenen Jahrtausend zu halten hatte und was man von sich und dem kommenden Jahrtausend erwartete. Wir kamen zusammen – aber nur versuchsweise, wie sie betonte. Sie verriet mir, der Moment unserer Berührung sei der entscheidende gewesen. Sie habe den Eindruck gehabt, ich hätte, dem Zusammenbruch nahe, mit letzter, verzweifelter Kraft halten wollen, was schon entronnen war. Meine Mischung aus Schwäche und Trotz habe bei ihr eine Mischung aus Interesse und Mitleid erzeugt. Ihre Analyse stieß nur auf mittelgroße Freude bei mir, obwohl ich wusste, dass sie recht hatte. Oder weil ich wusste, dass sie recht hatte.
Bei einem Kneipenbesuch stellte ich meine neue Freundin Lena einem größeren Bekanntenkreis vor. Mit Philipp, einem selbständigen Berater, mit dem ich an verschiedenen Projekten gearbeitet hatte, verstand sie sich sofort. Philipps selbstgesetzte Aufgabe zu solchen Anlässen war, die Leute um sich herum zum Lachen zu bringen. Das vertrug sich gut mit Lenas Anspruch, unterhalten zu werden. Ihr gegenüber saß Sandra. Bis ich mit Lena zusammengekommen war, hatte ich mich gelegentlich mit Sandra getroffen, die beiden Frauen ignorierten sich offensiv. Das bestimmende Thema der Runde war die Silvesterfeier 1999 auf 2000.Die meisten wussten noch nicht, wo sie feiern wollten. Gemeinsam mit Philipp, Sandra und Kathi, einer brünetten Wienerin, entschloss ich mich an diesem Abend, eine Millenniumsfeier auszurichten. Es war Oktober, viel Zeit blieb nicht mehr.
In den folgenden Tagen mieteten wir eine leere Fabriketage voller Elektronikschrott an. Die Entsorgung war Teil des Mietdeals, zur Party würde eine Hundertschaft alter Monitore als Dekoration dienen. Wir träumten eher, als dass wir planten, wollten Kameras aufhängen, die Bildschirme anschließen und auf diese Weise eine Medieninstallation schaffen, bei der man überall beobachtet werden würde. Irgendwann kam die Frage auf, wie man Einladungen und Kasse organisieren sollte. Philipp rief in die Runde: «Internet!»
Internet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich kaum Kontakt mit dem Netz gehabt. Obwohl ich Technologie liebte und schon Mitte der Neunziger das Handy als ideales Werkzeug für Privatleben und Arbeitsorganisation entdeckt hatte, war mir das Internet egal. Ich verstand nicht, wozu es gut sein sollte, denn jeder, den ich fragte, kam nach wenigen Sätzen auf Kochrezepte zu sprechen. Ich kochte nicht – also brauchte ich kein Internet. Statt E-Mails, die mir durchaus sinnvoll zu sein schienen, schrieb ich lieber SMS.
Wir verständigten uns darauf, dass man sich für die Silvesterparty auf einer Website verbindlich anmelden und vorab das Eintrittsgeld überweisen müsse. Also führte an einer Mailadresse kein Weg mehr vorbei. Ich kaufte einem Freund einen alten Laptop von Apple ab. Und schon nach ein paar Tagen war ich so begeistert von E-Mails, dass ich jeden Tag Dutzende Organisationsmails in die Runde schickte, gespickt mit Wortspielen und Doppeldeutigkeiten, die an die beiden Frauen gerichtet waren. Kathi litt charmanter als irgendjemand sonst unter der Mühsal der Welt. Sie konnte sich bei allem, was sie tat, ärgerlich aufreizend bewegen, wenn sie wollte. Sie wollte andauernd. Sandra war groß, schlank und hatte kurze, dunkle Haare. Sie hatte ein etwas burschikoses, aber sehr schönes Gesicht und konnte äußerst fordernd sein. Ihren mit fester Stimme vorgetragenen Worten wollte man nicht widersprechen. Beide Frauen – ich redete von ihnen abwechselnd als «Girls» oder «Mädchen» – reizten mich sehr, die Liebe zu Lena hatte das nicht geändert.
Ende November hatten sich über hundert Leute angemeldet, unser Ziel von insgesamt zweihundert Besuchern lag durchaus in Reichweite. Wir hatten Freunden Bescheid gesagt, ein paar Mailinglisten angeschrieben und uns ansonsten auf Mundpropaganda verlassen. Mitte Dezember kam Philipp aufgeregt zu einem Organisationstreffen. «Wir haben eine Situation! Gestern haben sich noch mehr Leute angemeldet!»
«Ja und? So soll’s doch sein, ich meine…»
«Hundertsechzig! Gestern haben sich einhundertsechzig verbindlich angemeldet!»
Wir einigten uns darauf, die Situation auf uns zukommen zu lassen. Am nächsten Tag nahmen wir das Anmeldeformular von der Website. Über Nacht hatten sich fünfhundert weitere Gäste eingetragen. Fast alle hatten das Geld bereits überwiesen. Wir beschlossen, die siebenhundertfünfzig Angemeldeten in die für dreihundert Personen geeignete Fabriketage zu lassen und das Beste zu hoffen.
Neben der Kongress-Organisation und gelegentlichen Promotionjobs arbeitete Lena als Produktionsleiterin bei einem kleinen Radiosender, wo ich sie häufig besuchte. Dort saß an der Eingangspforte Tag und Nacht ein bebrillter Pförtner mit einer dampfenden Tasse Tee. Ich hatte den Mann im Verdacht, zwei bis vier sehr ähnliche Männer zu sein. Aber da er immer die gleiche Brille trug und immer gleich freundlich grüßte, kam ich nicht dahinter.
Wenige Tage vor der Millenniumsfeier erzählte mir Lena, dass sie in der Silvesternacht beim Radio würde arbeiten müssen. Ich tat, als sei ich enttäuscht. Dabei passte es mir ganz gut, die Silvesterfeier nicht unter den Augen meiner Freundin verbringen zu müssen. Der größte Teil meiner üblichen Partybeschäftigung bestand aus intensivem Flirten.
Am Abend des 31.Dezember 1999 sammelten sich ab neun die Menschen vor dem Treppenhaus der Fabriketage. Ein halbprofessioneller DJ – vermutlich der einzige, der noch zu buchen gewesen war – sollte die ganze Nacht hindurch House auflegen. Die Party füllte sich. Um zehn war es voll, halb elf unangenehm voll, und kurz vor elf beschwerten sich die ersten Gäste, dass es zu voll sei. Wir redeten uns raus, die Leute würden sich nur ungünstig verteilen, und öffneten einen Raum, der ursprünglich als Getränkelager diente. Überall war es feucht und heiß. Die Kleidung klebte am Körper. Der Boden war bedeckt mit Scherben, Luftschlangen, Flaschenetiketten und einem grünlichen Schleim, der sich aus dem mürben Kunstharz-Bodenbelag und verschüttetem Bier zusammensetzte. Philipp, Kathi, Sandra und ich trafen uns zur Lagebesprechung in einem kleinen Kämmerchen hinter dem DJ. Philipp war betrunken und hektisch, wir drei anderen waren nur betrunken. Er brachte kaum ganze Sätze heraus. An diesem Abend war er zu nichts mehr zu gebrauchen. Wir schickten ihn wieder raus.
Ich sagte: «Ich fahr gleich zu Lena in den Sender. Zwölf will ich bei ihr sein. Hab ich versprochen.»
«Ins neue Jahrtausend reinknutschen, wa?», sagte Sandra.
«Ja.»
«Und aus dem alten Jahrtausend rausknutschen, was ist damit?» Kathi schaute uns nacheinander an. Sandra warf die Tür zu und stellte sich vor Kathi hin. Die beiden verschwitzten Girls umarmten sich und versanken in einem Zungenkuss. Ich drückte mich dazu, als schon ein paar feuchte Kleidungsstücke auf dem Boden lagen, und wurde ohne größeren Widerwillen aufgenommen. Wir gerieten ins Vögeln.
Als die Musik draußen ausgestellt wurde, unterbrachen wir, Irritation. Ein Countdown aus siebenhundertfünfzig Kehlen setzte ein: «Zehn, neun, acht…»
«Fuck!», sagte ich.
«Allerdings», sagte Sandra.
Wir lachten und zogen uns hastig an und stolperten aus der Kammer in die allgemeine Umarmung hinein. Wir fielen nicht auf, mittlerweile waren unsere Gäste nicht mehr feucht, sondern nass. Es tropfte von der Decke – kondensierter Schweiß.
«Indoor-Regen!»
Ein Dutzend Umarmungsversuche wehrte ich mit einem Grinsen ab, schlug mich zum Treppenhaus durch und ging runter auf die Straße. Weil kein freies Taxi zu finden war, stieg ich in mein Auto, einen goldenen Golf 2, und raste – immerhin vom Vögeln trotz des vielen Biers einigermaßen klar im Kopf – durch menschenvolle, aber autoleere Straßen zum Radiosender. Ich schnappte mir die Champagnerflasche aus dem Kofferraum, rannte zum Empfang und klingelte Sturm. Der Pförtner erkannte mich wieder und öffnete.
Gegen 0.30Uhr stand ich vor der Glasscheibe von Lenas Studio, verschwitzt, frierend von der Autofahrt durch die Kälte, den Champagner in der Hand, zerknirscht. Lena schaute mich durch die Scheibe an, ohne zu lächeln oder irgendeine andere Reaktion zu zeigen. Ich ging hinein. «Ich bin zu spät.»
«Hab ich gemerkt, ja.»
«Lass uns einfach so tun, als würde es erst um eins anfangen. Wie wär das denn?»
«Hm.»
«Ich wollte doch so gern mit dir ins 3.Jahrtausend reinknutschen. Wir fangen einfach um kurz vor eins an. Ist das nicht super?»
«Super ist anders, aber wir können’s ja mal versuchen. Du riechst komisch.»
«Ja. Diese Schweißhölle von Party. Da tropft’s von der Decke, keiner ist mehr trocken.»
Alle paar Minuten drückte Lena ein paar Knöpfe. Ich taumelte mit meinen Gedanken hin und her zwischen der frischen Erinnerung an die nackten, verschwitzten Frauen, die grünschleimige Party und der passenden Aufmunterungsstrategie vor Ort. Wir redeten über die belanglose Musik, der übliche Silvestermix der Popbourgeoisie: «Live is life», «Living in a box» und das in dieser Nacht allgegenwärtige «Party like it’s 1999». Um kurz vor eins öffnete ich die Champagnerflasche, zählte laut von zehn herunter und küsste Lena genau zur null auf den Mund. Sie erwiderte den Kuss zu ungefähr einem Drittel. Das Telefon klingelte in ihre Drittelherzigkeit hinein. Der Pförtner war dran und wollte etwas wissen. Wir schwiegen eine Weile vor uns hin, dann machte ich ein paar Scherze über den Millennium-Bug, der bis dahin ausgeblieben war – abgesehen von einem japanischen Planetarium, wo der Strom ausgefallen war, wie die Nachrichten meldeten. Auch nach dem soundsovielten Schluck Champagner wurde für uns beide die Situation nicht angenehmer. Ich umarmte Lena noch einmal, machte ein bedrücktes Gesicht und bat sie, nach der Schicht noch auf die Feier zu kommen. Sie antwortete nicht, aber immerhin schien sie nicht mehr sauer zu sein.
Durch Rauchschwaden und Eisregen fuhr ich zurück. Die Party tobte noch immer, der grüne Schleim hatte sich mit den Luftschlangen, Servietten und Kartoffelsalat zu einem stinkenden Amalgam verdickt, das allen an Schuhen und Hosen klebte. Ein paar Betrunkene schoben in der Ecke Matschballen zusammen und warfen sie in die Menge, beinahe wäre es zu einer Schlägerei gekommen. Kathi und Sandra waren leider nirgends zu sehen, auch nicht im Kämmerlein. Im Getränkelager war es etwas ruhiger, weil dort keine Lautsprecher aufgestellt waren. Ich lehnte mich zur Erholung kurz an die Wand. Ein Zwei-Meter-Mann mit schwarzen Locken und einer Narbe quer über die Stirn baute sich vor mir auf. Er lachte mich an. Ich musste zurücklachen.
«Eure Party? Echt gut. Ich meine, so richtig gut. Und ich kenn mich aus! Ich mach auch Events.»
«Danke.» Mit kurzer Verspätung erkannte ich ihn. Er hieß Thorsten und gehörte zum weiteren Bekanntenkreis von Sandra. Er hatte den Ruf, ein windiger Geschäftsmann zu sein. Sandra hatte mal von einem seiner Deals erzählt, bei dem er Optionen auf Solaranlagen verkaufte. Im Voraus konnte man zu einem festgesetzten Preis den Strom einzelner Tage kaufen – eine Art Wette auf das Wetter an diesem Tag. War es sonnig, machte man Gewinn, wenn es wolkig war, ein wenig Verlust, und wenn es regnete, war praktisch alles verloren. Ich erinnerte mich, damals beeindruckt gewesen zu sein von der Verbindung aus Investition, Glücksspiel, Umweltgeblubber und Gier.
Thorsten kam schnell auf seine beruflichen Erfolge zu sprechen. «Ich hab jetzt in einer Werbeagentur angefangen. Ist der Hammer.»
«Hammer?» Ich fürchtete, mein Interesse für die Geschäftspraktiken von Thorsten würde nicht ausreichen, um mir Agentur-Anekdoten anzuhören. Aber abwürgen wollte ich Thorsten auch nicht, weil er mir mit seiner abschreckenden Aura die anderen Smalltalk-Ritter vom Leib hielt. Während er redete, sprangen meine Gedanken im Dreieck zwischen Lena, Kathi und Sandra. Ob die beiden hinterher wieder in die Kammer gegangen waren? Inzwischen wurde mir das Gespräch doch zu anstrengend, ich wollte es beenden. Thorsten nicht. «Kommunikation ist halt der Anfang von allem. Ich hab ein Konzept geschrieben, das hab ich dem Chef gezeigt. Ist voll drauf abgefahren.»
«Soso.»
«Und zwar: ein Brutkasten für junge Firmen im Internet. So eine Art Labor. Lab.» Thorsten sprach «Lab» sehr lang gezogen und betont amerikanisch aus.
«Ah, Internet. Ist ja modern, gerade.» Er schien meine Ironie nicht zu bemerken. «Ja, total! Irre viel Geld im Markt. Du sagst nur laut eine Idee, und schon zwingen sie dich, ein Start-up zu gründen.»
«Start-up?» Ich ahnte, was gemeint war, hatte das Wort aber noch nie vorher gehört.
«Start-up. Ein junges Internet-Unternehmen.»
«Jetzt, wo du es sagst, fällt mir alles wieder ein.»
Thorsten schien immun gegen jede Art von Sarkasmus oder Ironie zu sein. Während ich überlegte, ob das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft war, lobte er sich weiter selbst, als wolle er nicht nur mich, sondern auch sich von seiner Hechtartigkeit überzeugen.
«Die Strategie von dem Lab geht so: Wir beteiligen uns an den Start-ups. Investieren und so. Dann – zack! – kriegen wir als Gegenleistung auch den Auftrag für die Kommunikationsentwicklung. Werbung, PR, Online, all of it.»
«Wow.»
«Kracher, oder?»
«Ich kann das nicht einschätzen. Internet und ich, wir kennen uns nur so vom Sehen. Bis jetzt läuft da nichts.»
«Haha. Witzbold. Dabei könnten wir Leute wie dich gut gebrauchen. Verkäufertypen, die überzeugen können. Selbst wenn sie keine Ahnung haben, wovon!» Er lachte. Und ich war verwirrt. Thorsten schätzte mich so ein, wie ich ihn eingeschätzt hatte. Meine Selbstwahrnehmung war die des charmanten Vermittlers zwischen den Fronten, zwar zu Zeiten unverschämt, aber doch mit viel Selbstironie und Freundlichkeit ausgestattet und selbstbewusst, aber uneitel.
«Ich glaube, dass wir Leute wie dich gebrauchen könnten in der Agentur. Denk mal drüber nach. Und echt danke für die Party!»
«Unecht danke für das Gespräch», dachte ich. Aber sein Job-Angebot klang gerade interessant genug, damit ich es mir merkte. Thorsten stolperte in den Nachbarraum. Eine Handvoll Leute stürzte sich auf mich. Sie umarmten mich ebenso euphorisch wie nass und wünschten mir zwei Dutzend frohe neue Jahre. Nach wenigen Minuten ertrug ich es nicht mehr und verzog mich auf die Toilette, die zu meiner Überraschung frei war. Ich schloss mich ein und versuchte, meine Nase so weit wie möglich zwischen meine Beine zu stecken, um den Geruch von Kathi und Sandra zu erhaschen.
Der Unfall
Ein paar Tage später hatte sich die Stimmung zwischen mir und Lena dank eines Lächelmarathons der Sorte «treuherzig» wieder verbessert. Manchmal vergaß sie sogar ihren vorwurfsvollen Blick, wenn sie mit mir redete. Leider – ich hatte es einfach nicht mehr ausgehalten, niemand konnte so wirkungsvoll wie ein angeschossenes Reh schauen wie Lena – hatte ich am Neujahrsmorgen beim Frühstück ein halbes Geständnis abgelegt, oder ein Achtelgeständnis, und eine kleine Knutscherei mit Kathi auf der Silvesterparty zugegeben. Auf Sandra war Lena seit dem Abend in der Kneipe eifersüchtig, deshalb hatte ich sie ausgespart. Lena schien irgendwie erleichtert zu sein, dass es wenigstens einen einigermaßen schlimmen Grund für mein Zuspätkommen zur Jahrtausendwende gab und ich sie nicht nur einfach so vergessen hatte.
Am fünften Januar wollten wir am frühen Abend zu einer Party fahren, waren in bester Laune und scherzten und schäkerten, während ich das Auto über die Straßen steuerte. Gleichzeitig mit einer Hand den Wagen zu führen und zu reden war für mich der Inbegriff der Souveränität. Lena saß auf dem Beifahrersitz, ich fasste ihr ans Knie und lachte sie an.
Der linke Vorderreifen touchierte die Bordsteinkante des Mittelstreifens. Das Lenkrad, das ich mehr berührt als festgehalten hatte, wurde herumgerissen. Der Wagen drehte sich um hundertachtzig Grad. Ein Krachen und ein Knall waren zu hören. Das alles ging mich nichts an, befand ich im Moment des Crashs. Ich sah Lenas süßes, zurückhaltend geschminktes Gesicht, wie es sich in Zeitlupe zur Fratze verzog, die Augen aufgerissen, die Lippen auf der einen Seite geöffnet, auf der anderen Seite zugekniffen. Die Sehnen am Hals waren angespannt, der Sturz nach vorn, ihr vibrierendes Gesicht, die Stirn auf die Klappe des Handschuhfachs zufliegend, dann brachial zurückgehalten vom Gurt, den Nacken unnatürlich nach vorn klappend, immer weiter, bis das Kinn auf der Brust aufschlug, sich langsam Zentimeter um Zentimeter in die obersten Rippen bohrte. In diesem einen Sekundenbruchteil, der sich mir einbrannte, hing Lena vorne in den Gurt gepresst, schien schwerelos über dem Sitz zu schweben, den Körper verbogen und zusammengedrückt, ein blondes, zartes Mädchen, in der Gewalt des Aufpralls, eine soziale Plastik für einen winzigen Augenblick.
Als wir am nächsten Vormittag aus dem Krankenhaus entlassen wurden, hatte ich Angst vor Lenas Vorwürfen, aber nichts kam. Sie drückte sich nur schweigend an mich, etwas ungelenk wegen der Halskrause. Lena hatte ein Hals-Nackenwirbel-Trauma, ein paar Tage sah sie aus wie ein Hund, der seine Wunde nicht ablecken darf und deshalb einen Trichter trägt. Mir fehlte nichts. Zunächst. Auf dem Weg nach Hause wurde mir dann klar, was der Unfall bedeutete: Ich hatte kein Auto mehr. Ein Reifen war geplatzt, die Achse gebrochen, wirtschaftlicher Totalschaden. Mein Auto war mein Wohnzimmer gewesen. Kleidung und Getränke im Kofferraum, Grundnahrungsmittel wie Mars und Snickers im Handschuhfach, ein Radio mit Kassettendeck, fünf Dutzend Tapes mit sorgfältig zusammengemischten Songs und das Schiebedach. Autos ohne Schiebedach waren für mich am Rande der Existenzberechtigung. Jetzt hatte ich weder Schiebedach noch die Tonne Blech darunter, mit der man von A zu jedem anderen Buchstaben fahren konnte, wenn man wollte.
Die öffentlichen Verkehrsmittel hätte ich längerfristig kaum ertragen. Busfahren war mir seit den Studententagen zuwider. In die U-Bahn ging ich nur mit Sonnenbrille, Mütze und Kopfhörern, um möglichst wenig von meinem direkten Umfeld mitzubekommen. Ich brauchte ein Auto. Ohne Auto war ich behindert. In meiner persönlichen Entfaltung empfindlich gestört. Ich hatte vor mir selbst ein Recht auf ein Auto. Leider hatte ich kaum Geld, jedenfalls nicht genug, um auch nur einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Lena war noch ein bisschen schwach und klagte über Übelkeit, deshalb brachte ich sie ins Bett. Sie war schon eingeschlafen, als ich sie fragte, ob ich ihr ihren Lieblingstee kochen sollte. Dann überlegte ich, wie ich Geld für ein Auto verdienen könnte.
Anfang Februar hatte ich einen Termin bei der Werbeagentur, in der Thorsten arbeitete: Förster, Tobler, Kirk. Ich hatte noch nie in einer Agentur gearbeitet. Dafür hatte ich einen Freund, dem eine kleine Agentur gehörte. Vor dem Termin gab er mir einen dreistündigen Intensivkurs Werbung und Internet. Er schrieb die wichtigsten Begriffe auf, ich lernte alles auswendig. Am nächsten Tag stand ich vor einem eindrucksvollen Bau am Wasser. Im Innern des Gebäudes gab es vier Oberflächentypen: schwarzer Lack, weißer Lack, gebürsteter Stahl und Glas. Die Wände waren weiß, der Boden schwarz lackiert. Die phantastisch aussehende Empfangsdame brachte mich in den Konferenzraum im ersten Stock. «Felix, Thorsten und Kerstin warten schon auf dich, Stefan.»
Ich war irritiert, dass sie mich mit Namen ansprach. Sie lächelte.
«Wahnsinnsbüro habt ihr hier.» Ich wollte sie in ein Gespräch verwickeln, um an sie heranzukommen. Ihre Locken fielen ihr bei jeder Bewegung von Neuem um den Hals, und ich wollte das auch tun.
«Ja. Sieht toll aus, aber es ist sooo unpraktisch. Hier muss jeden Tag zweimal gewischt werden! Morgens ist die Putzfirma eh da, und dann wischen sie nochmal mittags. Felix sagt immer: ‹Wer schön sein will, muss wischen›, kicher.» Sie sagte tatsächlich «kicher». Ich war mir nicht mehr so sicher, ob ich an sie heranwollte. Aber dann waren da wieder diese Locken. «Wie ist die Stimmung so? Ich meine, hier in der Agen…»
«Suuuuuuupi! Wirklich! Alle sind soooo froh, hier zu arbeiten, echt, hab ich noch nie erlebt. Wenn du Samstagabend halb acht gehst, sitzen noch alle da und worken. Toll, ne?»
Ich ließ ihren Redeschwall an mir vorüberziehen und genoss den Blick auf ihre Beine. Wir kamen an den schweren Flügeltüren des Konferenzraums an. Sie bemühte sich, beide Seiten gleichzeitig zu öffnen, war aber zu schwach, um gegen die Türhydraulik eine Chance zu haben. Hinreißend. Die Flügel hatten sich kaum zehn Zentimeter voneinander entfernt. Ich sah durch den Spalt und war geblendet, weil die Sonne durch das Glaspanorama über den schwarzlackierten Tisch direkt in unsere Richtung schien. Das Empfangsgirl mühte sich, kämpfte, wollte dabei aber cool wirken. Bekam sie die eine Seite unter Kontrolle, ging der andere Türflügel wieder zu und umgekehrt. Die Leute drinnen schienen ein Einschreiten nicht einmal in Erwägung zu ziehen, und ich half ihr auch nicht, um meine Überlegenheit zu beweisen. Freundlichkeit gegenüber Hilfskräften war hier fehl am Platz. Dann gab sie den Kampf auf und ließ einen Flügel zurückfahren, um den anderen öffnen zu können. Ich schob mich an ihr vorbei ins Licht.
Felix Förster, Gründer und Geschäftsführer der Agentur, begrüßte mich überschwänglich. «Stefan! Toll, dass du da bist. Thorsten hat uns schon so viel von dir erzählt. Und jetzt lernen wir uns endlich mal kennen.»
«Ja, freut mich auch, dass wir…»
«Setz dich, ich stell dir mal alle vor.»
«Wenigstens meinen ersten Satz hätte ich gern ausgeredet», dachte ich, sagte aber nichts.
«Thorsten kennst du ja. Der hat eine Kometenkarriere bei uns gemacht, sag ich dir. So geht’s hier mit den High Potentials. Die kommen zu uns, die werden was bei uns, die bleiben bei uns. Wir sind ’ne Art große Familie – ich weiß, das sagt jeder, aber bei uns stimmt’s einfach. Ist so. Frag mal Kerstin! Die ist die Beste, ohne Kerstin würde hier nichts laufen, gar nichts, echt.» Seine Stimme überschlug sich. «Sie ist die Agenturmutti. Hat alles unter Kontrolle, frag sie, wann das Agenturbier geliefert wird, weiß sie sofort! Kerstin – wann wird das Agenturbier geliefert?»
«Donnerstags. Am frühen Abend.»
Felix bemerkte nicht den Raureif in Kerstins Stimme, und ich ahnte, dass sich diese Szene schon häufig genau so abgespielt hatte.
«Und warum, Kerstin?»
«Weil Bier freitags am wichtigsten ist.»
«Sie weiß einfach alles, Stefan, siehste, ich hab’s dir gesagt. Unsere Kerstin. Kennst du jetzt ja auch. Lass uns talken. Wie kriegen wir das zusammen hin? Ich meine, unseren Inkubator?»
Ich versuchte, mir die Begriffe auf der Merkliste zu vergegenwärtigen. Inkubator war nicht dabei. Das Wort kannte ich aus dem biologischen Kontext, assoziierte es mit «Brutkasten» und wusste daher in etwa, was gemeint war. Trotzdem wollte ich mich vorsichtig herantasten. «Wie wollt ihr den Inkubator denn aufstellen?»
«Haha, Kerstin, siehst du, stellt gleich die richtigen Fragen, der Mann. Ex-zel-lent! Thorsten, du hast kein Stück übertrieben.»
Thorsten musste mich als Genie angepriesen haben. Ich nahm mir vor, vorsichtig zu sein, damit keine Diskrepanz aufkam zwischen dem, was er erzählt haben mochte, und dem, was ich mir spontan ausdenken würde. Die Wahrheit kam sowieso nicht in Frage, dazu hatte ich zu wenig Erfahrung, außerdem waren wir in einer Werbeagentur. Als Kommunikationsprofi durfte man natürlich lügen.
Meine ersten Aufträge hatte ich Mitte der neunziger Jahre bekommen, weil ich überall herumerzählt hatte, ich sei Trendscout. Ich fand das Wort cool. Es hörte sich nach jemandem an, den man fragt, was gerade hip ist. So jemand wollte ich sein. Irgendwann rief eine Agentur an. Ein Kunde hatte ihnen gesagt, sie sollten einen Trendscout engagieren. Die Leute hatten über Umwege von mir gehört. Meine Berufspraxis bestand zu dieser Zeit darin, das Wort «Trendscout» flüssig aussprechen zu können.
Ich hatte abweisend getan und mich dann nach Art und Volumen des Auftrags erkundigt. Die Anruferin, die Assistentin der Geschäftsführung, hatte keine Ahnung und verband mich deshalb mit einem Berater, der ebenfalls keine Ahnung hatte. Der stellte mich durch zu einem anderen ahnungslosen Berater. Niemand konnte die Frage beantworten, welchen Inhalt das Projekt haben sollte. Am Ende sprach ich mit dem Geschäftsführer, der es eilig hatte und mit den Worten eröffnete: «Sie helfen uns also aus der Patsche mit diesem Trendscouting!» Es ging darum, herauszufinden, wie der Nachfolger eines sehr erfolgreichen Parfums aussehen könnte. Ich las in einer Fachzeitschrift nach, wie das genau funktionieren sollte, Trendscouting. Viel fand ich nicht heraus. Einen Bekannten, der in einer Agentur arbeitete, fragte ich nach den Erwartungen. Er erklärte mir, dass am Ende eines Arbeitsprozesses immer ein Booklet stand. Und dass man Leute befragen musste, am besten in Fokusgruppen. Also schrieb ich auf einem geliehenen Computer fünf oder sechs Seiten voll mit Begriffen, Methoden, Behauptungen und Schlussfolgerungen, und zwar in einer logisch erscheinenden Struktur, grafisch ansprechend aufbereitet. Auf Anraten des Bekannten schrieb ich am Ende einen fünfstelligen Preis drunter, alles darunter nehme man nicht ernst in dieser Branche. «Eine tolle Branche!», dachte ich und erfand die Summe 16450,– DM. Mein erstes Angebot war fertig. Es wurde angenommen, ohne dass jemand ein Wort über das Geld oder das Vorgehen, die Strategie oder die vielen ausgedachten Behauptungen verloren hätte. Ich rief acht Freunde zusammen, beim Bier malten wir uns aus, was eine Fokusgruppe wohl so erzählen würde. Ich schrieb alles auf, klebte Fotos von meinen Freunden dazu und ergänzte es mit plausibel erscheinenden Flunkereien. Das fertige fünfzigseitige Booklet las sich geschmeidig, weil es keinerlei Rücksicht auf die Realität nehmen musste. Die Agentur und auch der Kunde waren begeistert. Kommunikation war meine Branche.
Jetzt saß ich Felix Förster und seinen Mitarbeitern Kerstin und Thorsten gegenüber. Noch redete Felix, aber in wenigen Sekunden würde er aufhören. Er schwärmte uns von seiner «Big Vision» vor. Dann musste ich «delivern». Dieses Wort hatte ich irgendwo aufgeschnappt und fand es grauenvoll und wunderbar zugleich.
Ich deliverte. Ich redete fünf Minuten, in denen ich wiederholte, was Felix Förster gesagt hatte, bereinigt um den wirren Quatsch und versehen mit laut ausgerufenen Aufzählungsnummern. Außerdem sagte ich «wir», wenn es um den Inkubator ging. Durch Felix’ Ausführungen wusste ich, dass es sich um eine Art Brutstätte für Geschäftsideen im Internet handeln musste. «Erstens! Wir entwickeln eine Strategie wie folgt:…»
Drei Tage später war mein erster Arbeitstag.
Der Katzenaugen-Krieg
Nach meinen Stärken gefragt, tat ich oft, als wäre mir die Frage unangenehm. Das stimmte zwar nicht, aber die meisten Gesprächspartner erwarten, dass man so reagiert. Ich bildete mir etwas darauf ein, solche Erwartungen bestätigen zu können. Voraussetzung dafür war meine Fähigkeit, Gesichter zu lesen – beinahe so wirkungsvoll wie Gedanken lesen, wenn man es so gut beherrschte wie ich. Es ist den meisten Menschen unmöglich, in einem Gespräch keine Reaktion zu zeigen. Selbst wenn man sich einbildet, mit unbewegter Miene zuzuhören, spiegelt sich in der Körpersprache und vor allem im Gesicht wider, was man denkt und fühlt. Und weil ich Gesichter lesen konnte, konnte ich auch Menschen manipulieren.
Mit ungefähr zehn Jahren bemerkte ich zum ersten Mal, dass es mir Spaß machte, die Reaktionen anderer vorherzusehen und zu beeinflussen. In dieser Zeit war auf dem Schulhof das Murmelspiel die Hauptbeschäftigung. Meine Noten waren die gesamte Schulzeit über hervorragend, aber die soziale Anerkennung im Klassenverband musste ich mir immer wieder erkämpfen, weil ich einer der Jüngsten war und nicht besonders sportlich.
Beim Murmeln und dem dazugehörenden Murmeltausch ergaben sich Gelegenheiten, mich in der Gruppe zu behaupten und das Manipulieren zu üben. Meinen ersten Trick, auf den ich sehr stolz war, nannte ich den «Katzenaugen-Krieg». Das Wort Krieg war übertrieben, genau genommen sogar falsch, denn es handelte sich um einen Bluff. Aber ich mochte Alliterationen sehr gern, außerdem fühlte sich mein Schulalltag durchaus wie Kampf an – wenn das auch sonst niemand bemerkte. Der «Katzenaugen-Krieg» war nur möglich geworden, weil es bei uns eine festgelegte Rangordnung der verschiedenen Murmelqualitäten gab. Am wenigsten wert waren die Katzenaugen. So nannten wir die Murmeln aus durchsichtigem Glas mit einer farbigen Welle darin. Die Farben waren wohl zufällig, es gab rote, grüne, blaue, sogenannte gelborange und mehrfarbige in großer Zahl. Der Spielwarenhändler neben der Schule hatte eine große, ungeordnete Kiste davon. Die Katzenaugen kosteten fünf Pfennig. Die Murmeln der nächsthöheren Stufe nannten wir Ölis, weil sie glänzend dunkel waren. Sie schillerten in vielen Farben und kosteten zehn Pfennig. Dann kamen die vollfarbenen Glasmurmeln, die matt schimmerten und in fünf oder sechs Farben für fünfzehn Pfennig zu haben waren. Sie hießen Farbis. In eine ähnliche Kategorie fielen die Spaghetti, die von feinen Linien durchzogen waren. Die oberste Stelle der Rangfolge belegte die Perlenmurmel oder kurz: Perle. Sie war echten Perlen nachempfunden, hatte eine etwas andere, wohlgeschliffene Oberfläche und glänzte vielversprechend, wenn man sie in die Sonne hielt. Nur dann konnte man auch sehen, ob dunkle Einschlüsse darin waren. Wir hielten die Perlen mit den meisten Einschlüssen für die wertvollsten. Der Stolz der ganzen Klasse war eine Perlenmurmel mit sieben zählbaren Einschlüssen, die alle paar Wochen in spektakulären Murmelturnieren den Besitzer wechselte, wo sie jeweils als Hauptpreis ausgeschrieben war.
Die Wechselkurse zwischen den Murmeln waren, unabhängig von den Preisen, präzise festgelegt und änderten sich nie; die Grundwährung waren Katzenaugen. Ein Öli war drei Katzenaugen wert, ein Farbi konnte je nach Beschaffenheit vier oder fünf Katzenaugen wert sein. Eine Perle ohne Einschlüsse war zehn Katzenaugen wert, danach war alles Verhandlungssache. Eine Perle mit drei Einsprengseln brachte in jedem Fall mehr als vierzig Katzenaugen. Alles oberhalb von vier Einschlüssen galt als absoluter Sonderfall. Normale Deckenlampen waren zu schwach, nur mit Hilfe der Sonne konnte man sich von der Zahl der dunklen Punkte in der Murmel und damit von ihrem Wert überzeugen. Alle zwei Wochen ließen sich fünfzehn Jungs und drei oder vier mitmurmelnde Mädchen dabei beobachten, wie sie eine einzelne Murmel im Kreis herumreichten, jeder sie vors Auge führte, einen kurzen Kommentar laut in die Runde sprach und versuchte, anerkennend zu pfeifen, was den wenigsten gelang.
Weil niemand zehn Minuten schweigend auf die Murmelbegutachtung warten wollte, entstand am Rande dieser Versammlungen ein Basar, wo Murmeln zu den üblichen Kursen getauscht wurden. Bei einer dieser Gelegenheiten entstand die Idee zu meinem Katzenaugen-Krieg aus einem Missverständnis heraus. Ein Junge namens Mario bot mir gelborange Katzenaugen und einen Farbi für eine beschädigte, aber schön glänzende Perle. Ich verstand ihn falsch und dachte, er würde mir goldorange Katzenaugen anbieten. Der Fehler klärte sich schnell auf, aber ich mochte das Wort goldorange sehr gern.
Die Sonne schien mir auf die Hand und leuchtete in das gelborange Katzenauge. Mit etwas gutem Willen sah es im Sonnenlicht tatsächlich aus wie goldorange. Das Murmelglas war von minderer Qualität und hatte ein paar Lufteinschlüsse. Die Farbwelle schien sich im Innern von der Glasoberfläche leicht abzulösen. Dort wurde das Sonnenlicht gebrochen, und das Funkeln und Glitzern verstärkte den Goldorange-Effekt.
«Goldorange Katzenaugen!», dachte ich. «Die wertvollsten Murmeln überhaupt, goldorange Katzenaugen!» Ich war begeistert von meiner Idee, ich hatte etwas entdeckt, das die Murmelwelt von Grund auf veränderte – ich musste nur noch die anderen davon überzeugen.
Am folgenden Tag zerschlug ich mein Sparschwein, stahl fünfzig Mark aus der Pfandgeld-Kasse in der Küche und hielt damit fast einhundert Mark in meinen Händen. Damit ging ich nach der Schule zum Murmelhändler. «Guten Tag, ich hätte gern die goldorangen Katzenaugen.»
«Hallo, junger Mann. Goldene haben wir nicht. Nur orange.»
«Nein, da sind auch goldorange mit dabei! Wirklich! In der Sonne kann man sie unterscheiden.»
«Ach was, das sind doch alles die Gleichen. Aber gut, Junge, sammle sie dir raus. Fünf Pfennig das Stück, weißt du ja. Oder willst du für die goldenen mehr bezahlen, hahaha!»
Ich ging an die Murmelkiste und begann zu wühlen. Über eine Stunde brauchte ich, um die Quelle, aus der sich die gesamte Schule bediente, vollständig von allen gelborangen Katzenaugen zu säubern. Es waren eintausend Stück, für die mir der Händler vierzig Mark abnahm. Für das restliche Geld kaufte ich zweihundert Perlenmurmeln, die jeweils fünfzig Pfennig kosteten, aber bei der Menge bekam ich ordentlich Rabatt.
Der Transport der Murmeln nach Hause war für mich nur schwer zu bewältigen, immerhin wog der große Murmelsack aus Stoff, den mir der Händler dazugeschenkt hatte, jetzt bestimmt zehn Kilogramm. Alle paar Meter musste ich ihn absetzen. In meinem Zimmer untersuchte ich unter der Schreibtischlampe die gelborangen Katzenaugen und wählte diejenigen mit einem hohen Orangeanteil aus, weil sie am ehesten goldorange wirkten. Als Kontrast behielt ich auch einige, die besonders viel Gelb mitbekommen hatten. Stunden später lagen sieben fast gelbe Katzenaugen auf der einen Seite – und die zwanzig goldorangesten Katzenaugen auf der anderen. Ich war glücklich und verteilte sie in zwei Murmelbeutel, in einen dritten kamen gut dreißig Perlen.
In der großen Pause am nächsten Tag versuchte ich mit Thomas ins Gespräch zu kommen. Er war sitzengeblieben und zählte deshalb zu den am meisten respektierten Jungs in der Klasse. Als Murmelbewerter war er eine Instanz, die dann besonders wichtig wurde, wenn es darum ging, die genaue Zahl der Einschlüsse einer Perle festzulegen. Sogar im Sonnenlicht konnte man oft nur erahnen, was sich im Inneren der Murmel befand. Günstigerweise kannte Thomas kein anderes Gesprächsthema als Murmeln und begrüßte mich mit entsprechenden Neuigkeiten. «Ich habe jetzt eine Perle mit fünf!», sagte er triumphierend. Das Wort «Einschlüsse» ließen wir weg, das hörte sich erwachsener an, fanden wir.
«Nein, echt? Zeig mal!»
«Hab ich nicht dabei, die ist zu Hause, die trag ich doch nicht den ganzen Tag mit mir rum.»
«Klaro. Woll’n wir was tauschen?»
«Och, was hast’n so im Angebot?»
«Paar neue Perlen, vorhin erst gekriegt. Noch nicht mal die Einschlüsse geprüft, war ja keine Sonne.»
«Toll. Zeig mal.»
Wir saßen auf der niedrigen Holzbegrenzung des Spielplatzes. Ich griff in die Hosentasche und holte eine Handvoll Murmeln heraus, darunter zehn Perlen, aber auch das goldenste Katzenauge, das ich hatte finden können. Ich warf sie betont achtlos in den Sand, Thomas stürzte sich drauf, aber stutzte, als er das Katzenauge sah. «Hä? Und das Katzenauge? Warum denn das?»
«Ach das goldorange, nein, gib mal her, das nicht.»
«Goldorange, Quatsch, das ist doch gelborange.»
«Nein, nein, halt mal ein gelboranges von dir dagegen.»
«Hab grad nur Ölis, Farbis und zwei normale Perlen.»
Wegen des geringen Werts spielten wir kaum noch mit Katzenaugen, deshalb war es üblich, sie nicht mit in die Schule zu bringen, sondern zu Hause zu horten, als gläserne Reserve.
«Warte, ich glaube, ich hab eine dabei.» Ich griff in die andere Tasche, in der sich Katzenaugen in verschiedenen Farben befanden – und das gelbste Katzenauge aus meinem tausend Murmeln großen Bestand. Thomas hatte die Perlen beiseitegelegt und verglich mit großen Augen die beiden Katzenaugen. «Stimmt irgendwie. Die eine ist so gelb, die andere eher so… na ja, schon irgendwie goldorange. Mehr so orange, aber…»
«Nein, halt die mal ins Licht, die funkelt nochmal ganz anders, richtig goldorange.»
Die Sonne schien nur schwach durch die Wolken, aber zusammen mit meinen Worten reichte es, um Thomas von der Existenz der goldorangen Katzenaugen halbwegs zu überzeugen. Ein Rest Misstrauen blieb, aber mein Plan sah vor, den auch auszuräumen.
Zwei Tage später saßen wir wieder zusammen, Thomas packte fünfzehn Katzenaugen aus, allesamt gelborange. Ich riss begeistert die Augen auf und untersuchte die Murmeln eingehend. Dann bot ich ihm dreißig Perlen. Er traute seinen Ohren nicht. «Dreißig Perlen für, für, für… fünfzehn gelborange Katzenaugen?»
«Neeeee – die sind goldorange!»
«Alle?»
«Ja, alle, siehst du das nicht?»
Ich zählte bereits die Perlen ab. Thomas nickte langsam. «Doch, ja. Nicht leicht zu erkennen, aber geht schon. Wollte nur wissen, ob du’s auch sehen kannst.»
«Klaro.» Ich legte die ertauschten Katzenaugen mit der Behutsamkeit eines ehrfürchtigen Kindes in einen eigenen Murmelbeutel, schob die dreißig Perlen zu ihm hin und ging fort. Die Katzenaugen-Kriegslist ging schon am nächsten Tag auf. Immer wieder kamen Klassenkameraden mit gelborangen Katzenaugen zu mir und wollten sie gegen Perlen tauschen. Ich hielt sie jedes Mal gegen das Licht und zahlte dann im Verhältnis zwei zu eins aus. Am darauffolgenden Montag begann die Stufe zwei des Krieges. Als in der großen Pause zwei Klassenkameraden Katzenaugen gegen Perlen tauschen wollten, bekam der erste für fünf Katzenaugen fünf Perlen. Beim zweiten untersuchte ich die Murmeln eingehend, drehte und wendete sie gegen das Licht und sagte: «Jetzt schummle mal nicht, das sind gelborange Katzenaugen, die sind nichts wert.»
«Aber die hab ich gegen fünf Ölis und eine Perle getauscht, das sind…»
«Kennst du etwa den Unterschied nicht zwischen gelborangen und goldenen Katzenaugen? Bist du doof oder was? Behalt mal schön deine gelborangen, die sind ja gar nichts wert.»
Die beiden trugen ihre Verwirrung in die murmelbegeisterte Klasse hinein, was für einigen Tumult sorgte. Nach der Schule kam eines der Murmel-Mädchen vom Spielwarenhändler mit der Botschaft zurück, es gäbe «überhaupt kein einziges goldoranges Katzenauge mehr, ich hab die ganze Kiste durchgewühlt!».
Ich ging direkt nach Hause und ließ die Klasse mit ihrer Irritation allein. Am nächsten Tag in der ersten großen Pause umringten mich mehrere Klassenkameraden und verlangten Aufklärung, was nun gelborange Katzenaugen seien und was goldorange, wo da der Unterschied wäre. Ich ließ mir die Katzenaugen geben, griff nach kurzem Suchen eine heraus. «Das hier ist eine goldorange, das ist ja klar. Können wir ja mal vergleichen.» Ich zog meine gelbste Vergleichsmurmel heraus, und tatsächlich war auf den ersten Blick ein Unterschied zu erkennen. Ein Raunen ging durch die Gruppe. Ich ließ die Vergleichsmurmel wieder in die Tasche gleiten und zog aus den Katzenaugen der anderen eine zweite Murmel heraus mit der Behauptung, dass dieses zweite Katzenauge ein deutlich gelboranges sei. Es wurde mir ganz ohne Beweis geglaubt.
Durch die Verwirrung, die unerwartete Knappheit von gelborangen wie auch goldorangen Katzenaugen im Spielzeuggeschäft und den kleinen Goldrausch, den ich mit meinen abstrusen Wechselkursen verursacht hatte, war eingetreten, was ich mir gewünscht hatte: Ich war die neue Bewertungsinstanz für Murmeln geworden – letztlich konnte nur ich mit Sicherheit sagen, ob es sich bei einem Katzenauge um ein goldoranges, wertvolles Exemplar handelte oder ein fast wertloses gelboranges. Wann immer jemand meine Expertise anzweifelte, zog ich je nach Bedarf mein gelbstes oder mein goldenstes Katzenauge heraus, im Kontrast konnte ich jedes Urteil beweisen.
In den folgenden Wochen genoss ich meinen Status. Um meine Position zu stärken, band ich Thomas mit ein, indem ich sein Urteil – er riet einfach – stets stützte, während ich in unregelmäßigen Abständen alle anderen des Fehlurteils in beide Richtungen überführte. Dass auf gewohntem Weg kein Nachschub an goldorangen Katzenaugen erworben werden konnte, war von großem Vorteil. So konnte ich mit Tauschgeschäften die im Umlauf befindliche Menge der goldorangen und gelborangen Katzenaugen kontrollieren. Ich kam zwar kaum noch zum Murmeln, was ich schade fand, hatte mich jedoch zum geachteten Murmelbankier entwickelt.