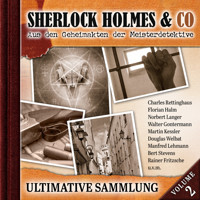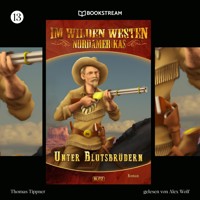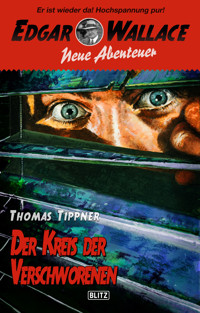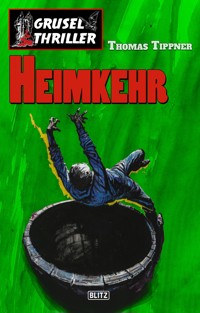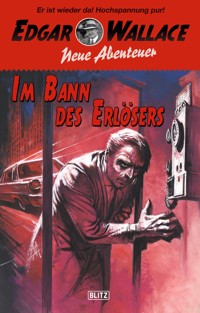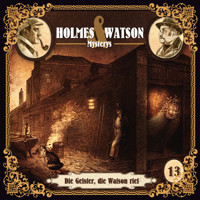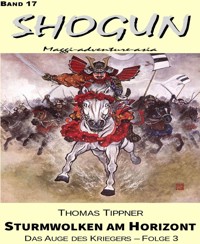
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Immer rätselhafter werden die Vorgänge im Shogunat des Inselreiches und in der Provinz Jo-Ko-Ho. Und in den weiten Steppen des Festlandes braut sich eine neue Gefahr zusammen. Ein grausamer Herrscher schließt die Reitervölker des Steppenlandes zusammen.
„Sturmwolken am Horizont“ ist der dritte Band der auf sechs Bände angelegten Miniserie „Das Auge des Kriegers.“
Die beiden ersten Bände sind ala Shogun 12 znd Shogun 15 erschienen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sturmwolken am Horizont
Das Auge des Kriegers Teil 3
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorspann
Shogun – Band 17
Thomas Tippner – Sturmwolken am Horizont – Das Auge des Kriegers, Folge 3
1. eBook-Auflage – September 2015
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Masayuki Otara
Lektorat: Armin Bappert
Das Auge des Kriegers
Folge 3
Sturmwolken am Horizont
Thomas Tippner
1
Die Schmerzen waren unbegreiflich. Im ersten Augenblick hatte Faru geglaubt, dass er ohnmächtig zusammenbrechen würde, als die breite Klinge von Ruju ihm den kleinen Finger von der Hand trennte. Da war der Schock gewesen, der ihm bis in die Knie fuhr, und sie so weich werden ließ, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Dann war da die Erkenntnis gewesen, dass ihm gerade ein Stück von seinem Körper abgeschnitten worden war.
Und die Angst – die panische, alles beherrschende Angst, die seine Gedanken erfasste, sie unter Feuer setzten, und ihn nicht dazu kommenließ, einmal klar zu denken.
Da war nichts mehr in ihm, an das er sich halten konnte.
Nichts – gar nichts. Eine Leere, die ihn erfüllte, seinen Kopf wie ein schwarzes Tuch umschloss und ihn dann erst wieder durch die sich langsam verziehenden, dunklen Schleier schauen ließ, als er den Schmerz begriff, der von seiner Hand in den Unterarm fuhr.
Noch immer hielten die Männer ihn fest, und das obwohl Faru sich nach hinten drückte, und am liebsten zusammengebrochen wäre.
Das aber ließ sein Körper nicht zu.
Er bekam alles mit.
Jede einzelne Stimme, jeden Geruch, jede Bewegung.
Es war ihm plötzlich, als hätte sein eben noch eingeschlossener und abgedunkelter Geist sich geöffnet. Da war der kleine, geduckte Mann, mit der weichen, sich einschmeichelnden Stimme, der Ruju etwas fragte. Und da waren die beiden Kerle, die ihn hielten. Der linke roch unangenehm nach Knoblauch, während der andere etwas Liebliches ausströmte, das Faru irrwitziger Weise an Seife erinnerte.
»Bringt ihn fort«, sagte Ruju plötzlich, nachdem Faru die Augen geschlossen hatte, und gepresst atmete. Am liebsten hätte er seine verletzte Hand genommen, sie an die Brust gedrückt, und mit der gesunden umschlossen.
Aber auch das ließen die beiden Männer nicht zu.
Sie reagierten auf den Befehl, wie es sich für Männer gehörte, die ihrem Anführer blindlings gehorchten, und sie waren so grob, wie Faru es immer angenommen hatte. Ja, er erinnerte sich daran, wie er mit Hamato darüber redete, wie sie sich ausmalten, wie Wilde und Freie leben konnten.
Er erinnerte sich, wie Hamato abfällig meinte, dass diese Leute nur wussten wie man fraß, säuft, es mit einer Frau treibt, und rohe Gewalt ausübte.
Und genau so kamen sie ihm jetzt vor.
Genau so war es, wie sie es besprochen hatten und ebenso packten sie ihn, zogen ihn zurück, und warfen ihn auf den nassen Boden.
Faru kam nicht einmal mehr dazu zu schreien.
Er schlug einfach nur wie ein durchnässter Sack Reis zu Boden.
Faru blieb liegen – nicht dazu in der Lage sich zu rühren.
Er lag nur da, die Augen geschlossen, die verletzte Hand umklammert, in der Hoffnung endlich alles überstanden zu haben.
Das aber war nicht der Fall…
…da er am Kragen seines zerschlissenen Hemdes gepackt wurde, und man ihn über den Boden zog, hin zu dem kleinen, von Wind und Wetter ungeschützten Käfig, in dem er die letzten Tage schon zugebracht hatte.
Da warfen sie ihn hinein, als wäre er ein räudiger, kleiner Köter, den man mit Schlägen und Fußtritten besänftigen konnte.
Sie schlossen ihn ein, nachdem er platt auf den Rücken gefallen war, sich halb auf die Seite drehte und leise jammerte…
…und Hamato dafür verfluchte, dass er ihn überredet hatte, die Reise anzutreten.
*
Der Schatten hatte sich geregt, und bemerkt, dass etwas nicht so war wie früher. Da war plötzlich etwas in sein Bewusstsein gedrungen, ähnlich eines Lichtstrahls, der durch ein trübes, wolkenverhangenes Grau gestoßen war.
Er war frei…
…irgendwie. Er lebte und war doch nicht real.
Der Schatten spürte, dass sich in ihm etwas zu regen begann, und er begriff, dass es Gedanken waren, die da durch seinen Kopf zu sprießen anfingen, vergleichbar mit kleinen, aus der Erde ragenden Tulpenknospen, die sich schüchtern, ja, beinah ängstlich der Sonne entgegen drehten.
Es war ihm, als würde er sich befreien…
…und noch etwas war da.
Etwas Bekanntes, etwas Bedrohliches.
Der Schatten nahm eine Form an – ähnlich eines Pfeils, der auf ein Ziel abgeschossen worden war.
*
Faru war es nicht möglich zu sagen, wie lange er schmerzgeplagt geschlafen hatte. Immer wieder war er aufgewacht, von einem blitzhaften Schmerz aus seinem Dämmerzustand gerissen, der in seinem Handgelenk explodierte und ihn glauben ließ, seine Hand würde in Flammen stehen. Hinzu, zu den Schmerzen, kamen die unentwegt durch das kleine Lager schwebenden, sich in seine Ohren bohrenden Stimmen. Stimmen, die sich einerseits höhnisch, andererseits aggressiv anhörten.
Da mischten sich Laute unter die Worte, die Faru noch nie gehört hatte, und er war sich sicher, als er mal wieder erwachte und sich nur langsam orientieren konnte und davon überzeugen musste, dass er nicht träumte, dass es fremde Zungen waren, die hier sprachen.
Jetzt, wo er wieder aus dem Schlaf gerissen wurde, er wieder erwachte und betete, dass er doch einen Albtraum erlebte, hörte er den jungen, geduckt gehenden Mann sagen: »Die Wilden, immer diese Wilden. Fressen wollen sie, aber wenn sie mal die Hand voll machen sollen, dann weigern sie sich!«
Faru versuchte erst hinter den Sinn der Worte zu kommen, um es dann gleich wieder bleiben zu lassen.
Er merkte sofort, dass er an Grenzen stieß, die er niemals für möglich gehalten hatte.
Er war ein intelligenter, ein aufgeklärter Mann, der genau wusste, wo die Grenzen seines Reiches lagen, der wusste, wie man sich auf einem Fest verhielt, oder wie man um eine junge Dame warb.
Hier aber, in dem Augenblick, da begriff er, dass er in eine Welt hineingestoßen worden war, die völlig widersprüchlich war.
Hier gab es keine Regeln, keine Normen – oder besser gesagt, keine Regeln und Normen, in denen er sich sicher bewegen konnte.
Wann hatte man schon einmal davon gehört, dass einem der Finger abgeschnitten wurde, nur damit man an Informationen kam?
Das hörte man von anderen – von den Gegnern, die man zu bekämpfen versuchte.
Und das war das nächste Problem – Faru konnte die Männer nicht zuordnen, die ihn eingesperrt hatten.
Sie sprachen die allgemeine Sprache von Jo-Ko-Ho, und bewegten sich doch in ihren Schatten.
Freie waren es ebenso wenig, wie Männer der Kriegsherren, die dabei waren, unaufhörlich auf Jo-Ko-Ho zumarschieren, um ihre eigene Position zu stärken, um die Würde des Kaisers zu erlangen.
Faru blinzelte, versuchte sich aufzurichten, und ließ es bleiben, als er merkte, wie nass und durchweicht seine Kleidung war, und wie der Schmerz durch seine Hand fuhr.
Noch immer hatte er nicht begriffen, was ihm da gerade widerfahren war. Noch immer hoffte er, wenn er an seiner Hand herunterschaute, dass der kleine Finger noch da war. Und dann sah er sie doch – die verkrustete, noch nässende Wunde, und den kleinen, gelblichen weißen Schimmer seines aus der Wunde ragenden Knochens.
»Mach die Augen auf«, befahl der geduckte Mann, während er umständlich an dem Strick herumhantierte, der die Käfigtür verschlossen hielt.
»Sind offen«, flüsterte Faru, »will nur nichts sehen.«
»Verstehe«, kicherte der kleine Kerl, und fluchte dann so lästerlich, dass Faru ein entsetztes Lächeln über die Lippen huschte. Ein Lächeln, das ihm einerseits gut tat, andererseits aber auch erschreckte. Gut tat es ihm, weil er spürte, dass sein Leid, sein Elend, alles Schlimme, das ihm widerfahren war, doch auch untergehen und vergessen werden konnte. Andererseits erschreckte es ihn, weil er dadurch verstand, dass er im Hier und Jetzt war. In einer Situation die er weder verstand noch kontrollieren konnte. Außerdem gesellte sich noch das Entsetzen hinzu, da er niemals im Leben damit gerechnet hätte, dass solche Worte, in solchen Zusammenhang aus ein und demselben Mund dringen konnten.
Dann, als die Tür endlich aufschwang, kicherte der geduckte Kerl wieder, und meinte: »Haben dir ganz schön den Arsch versohlt, feiner Bursche, wie?«
»Sie haben mich in einem unachtsamen Moment überrascht«, gab Faru zu. Dabei betonte er jedes Wort so, dass der kleine Mann gar nicht anderes konnte, als beeindruckt von dem zu sein, was Faru sagte.
Der Respekt, den Faru sich erhoffte durch eine ausgeglichene und fein formulierte Ausdrucksweise zu erlangen, erhielt er nicht.
»Bist ein vornehmes Kerlchen wie – musst aber trotzdem kacken, wie alle anderen auch«, bekam er als Antwort um die Ohren geworfen, und errötete wieder.
»Ich bin Faru, Sohn des…«
»Blablabla«, winkte der kleine Mann ab, und warf Faru ein abgeschnittenes, in der Mitte trocken gewordenes Stück Brot zu. »Jetzt bist du nichts anderes, als eine unvollständige Schweinehälfte. Und so behandele ich dich auch. Glaub ja nicht, dass mich irgendein Titel beeindruckt. Tut er nicht. Titel sind was für Burschen, die sich das Leben leisten, aber nicht verdient haben.«
Faru wollte wieder etwas sagen, wurde aber ebenso schnell unterbrochen, wie die anderen Male zuvor auch.
Und so ließ er einen Wortschwall über sich ergehen, der ihn nach und nach in ein unüberhörbares, nervenzerreißendes Quietschen erinnerte, dem er beim besten Willen nicht mehr folgen konnte.
Deswegen griff er nach dem Brot, betrachtete es, und schüttelte angewidert den Kopf. Der Kleine bekam das mit, unterbrach seinen Redeschwall für einen kurzen Augenblick und meinte: »Was besseres findest du hier nicht. Ist beste Qualität – war sie auf jeden Fall, vor zwei Tagen.«
»Ich habe keinen Hunger.«
»Essen solltest du schon«, entgegnete der Kleine und redete dann wieder wild durcheinander, plapperte davon, dass er Farus Hand betrachten sollte, dass er für ihn zuständig war, und herausfinden sollte, was Hamatos Freund überhaupt hierher getrieben hatte.
Und so begriff Faru, dass er in dem ganzen Redeschwall gar nicht darum ging, ihn zu unterhalten, sondern an Informationen heranzukommen. Ebenso bemerkte er, dass der kleine Kerl zwar unentwegt redete, dabei aber alles ganz genau beobachtete.
Da war nur mal ein kurzer Seitenblick, ein forschender Blick, der Farus Reaktionen genau beobachtete.
Schließlich, als der Redeschwall über Faru hereingebrochen war, wie ein plötzliches Gewitter, ebbte es auch ab, als wäre es niemals gewesen.