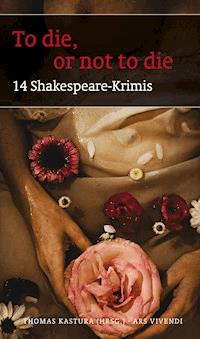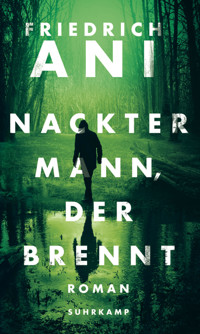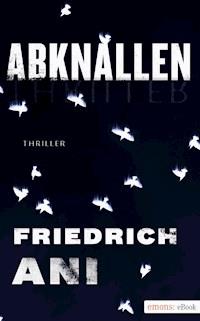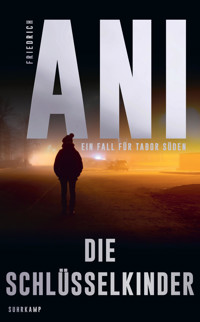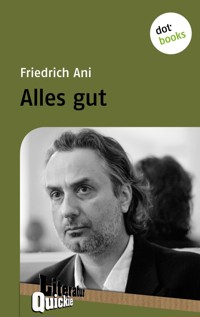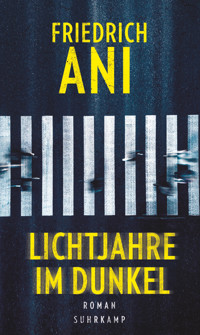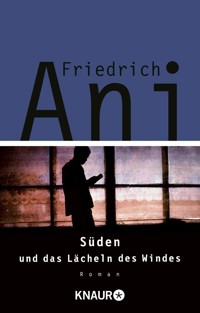
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Süden und das Lächeln des Windes: Ein packender Krimi über die obsessive Liebe eines Jungen und ihre verheerenden Folgen Tabor Süden und das Dezernat 11 stehen vor einem rätselhaften Fall: Ein siebenjähriger Junge ist von zu Hause weggelaufen, nachdem seine Eltern beschlossen hatten, ihn von seiner großen Liebe, einem kleinen Mädchen, fernzuhalten. Die Besessenheit des Jungen hatte ein solches Ausmaß angenommen, dass die Eltern beider Kinder keinen anderen Ausweg sahen, als sie streng zu trennen. Doch nun ist der Junge verschwunden und die Eltern in Panik. Friedrich Ani, Meister des psychologischen Kriminalromans, zeichnet in Süden und das Lächeln des Windes ein einfühlsames Porträt der sogenannten kleinen Leute und ihrer Schicksale. Mit feinem Gespür für die Abgründe der menschlichen Seele entführt er den Leser in die bayerische Provinz und lässt Tabor Süden auf Spurensuche gehen. Ein fesselnder Krimi, der weit über die Grenzen des Genres hinausgeht und lange nachhallt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Friedrich Ani
Süden und das Lächeln des Windes
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein neunjähriger Junge verliebt sich in ein kleines Mädchen und ist so besessen von seiner Liebe, dass die Eltern beider Kinder beschließen, sie streng getrennt zu halten, ehe Schlimmeres passiert. Aus Verzweiflung läuft der Junge von zu Hause weg. Doch zur Verblüffung von Kommissar Tabor Süden scheint das Verschwinden ihres Kindes die Eltern wenig zu beunruhigen …
Inhaltsübersicht
Ich arbeite auf der [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Ich arbeite auf der Vermisstenstelle
der Kripo und kann meinen eigenen Vater
nicht finden.
Tabor Süden
1
Der Junge rannte auf den Wald zu, als wäre der Rottweiler des Bauern Erpmaier hinter ihm her, nach dem er, so schnell er auch lief, wie in vorauseilender Panik Ausschau hielt: Seine Blicke flitzten über den Hof, zu jedem Tor, zu jeder Tür, von einem Gebäude des Anwesens zum nächsten, vom Hühner- und Schweinestall zum Kuhstall, vom Geräteschuppen zum Silo, vom Wohnhaus zum Anbau mit den Ferienwohnungen. Und jedes Mal, wenn der Junge den Kopf drehte, schlugen ihm Haarspitzen in die Augen, denn seine Mütze war verrutscht, und er hörte die Worte seiner Mutter wieder – »Morgen gehst du zum Sinner, und wehe nicht!« –, und dann verscheuchte in der Dunkelheit des frühen Winterabends ein böses Bellen seine Gedanken. Er durfte nicht stehen bleiben. Er musste schneller rennen, an der Holzgarage für die Traktoren vorbei zum Waldweg, hügelan. Auf einer Wurzel, die sich aus der Erde schlängelte, rutschte er aus, ruderte mit den Armen, fand wieder Halt in der feuchten Luft und versuchte dabei den Kopf gesenkt zu halten und den glitschigen Stellen auszuweichen. Doch die Finsternis kam ihm auf einmal so dicht und unheimlich vor, dass er glaubte, von ihr geblendet zu werden.
Das Bellen hörte nicht auf. Aus der Tiefe des schwarzen Nichts, das ihn umgab, rollte es auf ihn zu, und er wusste, wenn er auch nur eine Sekunde innehielt, würde Rocko ihn packen und zerfetzen.
Kein Hund in Taging bellte wie der Rottweiler von Erpmaier Ludwig senior, es war das Bellen eines alten blutrünstigen, verfetteten Köters, den nicht nur die Kinder im Dorf fürchteten. Mindestens fünfmal hatte er in den vergangenen Jahren Spaziergänger angefallen, die das blumengeschmückte, bemalte, gutshofartige Anwesen betrachten wollten und dabei zu nah an seine Hütte herangetreten waren. Zwei Frauen hatte er lebensgefährlich verletzt, und die Erklärung, warum er daraufhin nicht eingeschläfert worden war, vermuteten die Leute in der Tatsache, dass Erpmaier senior den Opfern, die beide aus Taging stammten, hohe Entschädigungssummen gezahlt hatte, angeblich mehr als hunderttausend Mark. Der Vater des alten Erpmaier war Bürgermeister gewesen, sein Sohn hatte sich zu einem wohlhabenden Großbauern entwickelt, dessen Bruder ebenfalls Bürgermeister und dessen Sohn zumindest Bürgermeisterkandidat geworden war. Für Erpmaier senior war Rocko eine Art heilige Kuh, das bekam jedes Kind im Dorf spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten eingebläut, und dazu die Warnung, das Tier unter keinen Umständen zu reizen oder mit ihm zu spielen, ganz gleich, wie zutraulich es gelegentlich wirken mochte.
Für den Jungen, der in jener Dezembernacht durch den Wald den Gibbonhügel hinauflief und laut keuchte, gehörte Rocko zum festen Inventar seiner Albträume, dabei hatte der Hund ihm bisher nichts getan, er bekam ihn überhaupt selten zu Gesicht, obwohl seine Eltern vor einem Jahr in ein Haus gezogen waren, das nur dreihundert Meter vom Erpmaierhof entfernt lag. Sein Herz schlug, als wolle es seinen Körper sprengen, unter der rotblauen Pudelmütze sammelten sich Schweißschlieren, und am liebsten hätte er den Reißverschluss seines Anoraks aufgezogen und sich die Mütze vom Kopf gerissen.
Aber er musste weiter, schneller und noch weiter nach oben, auf dem matschigen Weg, den er vom Sommer her kannte. Er wusste genau, wo der Weg endete, auf einer Lichtung, von der aus man bis zu den ersten Häusern des Dorfes sehen konnte, was er gewiss nicht tun würde. Denn er wollte nie wieder dorthin zurück. Nie wieder.
Erst als er die Lichtung fast erreicht hatte – jedenfalls bildete er sich das in der undurchdringlichen Dunkelheit ein –, bemerkte er die Stille.
Alles, was er hörte, war sein eigenes Keuchen und, wenn er dies mit zusammengepressten Lippen unterdrückte, ein leises Tropfen, weit entfernt, und ein Rascheln wie von besonders feinen Blättern. Kein gespenstisches Bellen mehr, kein heiserer Fluch eines verfluchten Hundes.
Erschöpft und gleichermaßen aufgewühlt lehnte der Junge an einem Baum, atmete mit offenem Mund und zitterte vor Aufregung. Er hatte es geschafft. Er dachte: Ich habs geschafft. Und dann, nur einen Moment später, nach einem kurzen Horchen und einem schnellen Blick, der nicht weiter reichte als bis zu einem umgestürzten Stamm, dessen mächtiges Wurzelwerk schwarz aufragte, dachte er: Und jetzt? Schlagartig fühlte er sich nicht mehr wie befreit, sondern in höchstem Maß befangen und ratlos. Er krallte die Finger in die morsche Rinde, alle zehn, und presste den Rücken gegen den nassen Baum, als wolle er eine Tür aufstemmen und dahinter verschwinden. Es war, als würde sein Übermut, der ihn vorangetrieben und in einen Zustand von Unfurcht versetzt hatte, sodass er noch vor einer Minute, wenn es hätte sein müssen, mit Rocko den Kampf aufgenommen hätte, im lehmigen Laubboden versickern und einen Feigling zurücklassen, der schlotternd vor Angst zu weinen begann.
Er merkte nicht, wie ihm die Tränen über die erhitzten Wangen liefen. Sein ganzer Körper, von den Füßen bis zu den Schultern, zitterte, und er versuchte still zu stehen, er ballte die Hände zu Fäusten und presste die Lippen wieder, so fest er konnte, aufeinander, er drückte die Schuhe in die Erde, weil er hoffte, seine Knie würden dann zur Ruhe kommen. Stattdessen zitterten sie noch mehr und er dachte: Vielleicht bin ich in ein Stromnest getreten, und der Strom kriecht in mich rein wie eine Million elektrischer Ameisen, und mein Herz wird explodieren, und ich werd sterben, allein im Wald, und Rocko wird mich riechen und finden und fressen.
Vor Angst vergaß er Luft zu holen. Dann riss er den Mund auf und keuchte wie vorhin, als er den steilen Hang hinaufgerannt war. Jetzt hatte er einen salzigen Geschmack im Mund und er wusste sofort, woher. Hastig wischte er sich mit beiden Händen über die Augen, übers Gesicht, seine Hände waren schmutzig, und er stand bis zu den Knöcheln in schmierigem Laub, die Jeans klebten an seinen Waden und seine Kopfhaut juckte unter der Mütze, aber er traute sich nicht zu kratzen. Er traute sich nicht einmal die Hand zu heben oder wenigstens einen Schuh aus dem Dreck zu ziehen, er traute sich nicht den Kopf zu drehen, weder auf die eine noch auf die andere Seite, er traute sich nicht zu atmen. In Sekundenabständen sog er die Luft durch die Nase ein, als dürfe er nicht das geringste Geräusch verursachen, als sei genau dies der Trick um aufzuwachen, endlich aufzuwachen.
Doch ich wachte nicht auf. Ich wachte nicht auf, weil ich nicht schlief. Ich war wirklich im Wald, ich war wirklich von zu Hause weggelaufen, in der Nacht zum sechsten Dezember. Die Dunkelheit hüllte mich in einen Mantel aus Angst, und ich weinte ohne Unterlass. Ich war zehn Jahre alt und warum ich ausgerissen war, konnte ich auch Jahre später nie überzeugend erklären. Erst heute, wenn ich an jenen Vermisstenfall zurückdenke, der uns im Dezernat 11 mehrere Tage lang beschäftigt hatte – wieder war es Dezember gewesen und wieder war es um ein Kind gegangen, sogar um zwei Kinder –, scheint mir, ich könne das Kind, das ich damals war, allmählich begreifen, in seinem Handeln, in seiner Besessenheit, in seiner Furcht, die nichts mit dem Wald und seiner schwarzen Gegenwart zu tun hatte.
Erst heute, nachdem ich aus dem Polizeidienst ausgeschieden bin und versuche, wozu auch immer, meine Erinnerungen zu sortieren, bilde ich mir ein, eine Verbindung zu erkennen zwischen den Vermissungen von Sara und Timo, die wir zu klären hatten, und mir, Tabor Süden als Jungen, und ich bin ein wenig erleichtert über die unerwartete Annäherung an mein vergangenes Ich, wenngleich ich mit der Person, der mein Verhalten damals den größten Schmerz zugefügt hatte, dieses bescheidene Glück nicht mehr teilen kann.
In jener Nacht jedoch, der Nikolausnacht, dachte ich ausschließlich an meinen eigenen Schmerz, ich dachte mit aller Macht an ihn, ich konzentrierte mich auf nichts anderes. Und so gelang es mir der Dunkelheit und den Geräuschen der Stille zum Trotz den Baum, an den ich mich klammerte, zu verlassen und meinen Weg in nördlicher Richtung fortzusetzen, langsam, einen Schritt nach dem anderen, über die grasbewachsene, unebene Lichtung, parallel zum Waldrand, in dem fahrigen Licht eines Mondes, den die Wolken in dem Augenblick freigaben, als ich mich umsah, um mich zu versichern, dass mir tatsächlich niemand folgte.
Nur die Stimme meiner Mutter ging mir nicht aus dem Kopf, die ganze Nacht, den ganzen Weg über. Bis zum ersten Schrei einer Krähe im dämmernden Morgen hörte ich meine Mutter aus ihrem Schlafzimmer rufen: »Morgen gehst du zum Sinner, und wehe nicht!«
2
Herr Süden?«
»Ja.«
»Kann ich Sie sprechen?«
»Nur zu.«
»Unter vier Augen, es ist sehr wichtig.«
»Ist jemand verschwunden?«
Die Frau antwortete nicht. Ich wartete ab. Meine Kollegin Sonja Feyerabend, mit der ich das Büro teilte, hatte einen dicken Wollschal um den Hals gewickelt und eine Eukalyptusaura, sie hustete ständig, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, die darin bestand, pausenlos auf die Tastatur ihres Computers einzuhacken, vermutlich, um möglichst schnell fertig zu werden und nach Hause gehen zu können. Ihre Stirn glänzte von Schweiß, und ich fragte mich, ob er von ihrem hektischen Schreiben kam, das nicht enden wollte, oder ob sie sich in einer Art Grippedelirium befand. Mehrmals hatte ich versucht sie anzusprechen, aber sie reagierte nicht, es schien, als würde sie mich nicht hören, als würde sie niemanden hören oder etwas wahrnehmen.
»Herr Süden?«
»Ja?«
»Ich muss Sie dringend sprechen.«
»Worum gehts denn …« Ich sah auf den Block mit dem Namen, den mir Erika Haberl, die Sekretärin der Vermisstenstelle, durchgegeben hatte. »… Frau Berghoff.«
»Das möcht ich am Telefon nicht sagen.«
»Können Sie ins Dezernat kommen?«, fragte ich.
»Ich kann hier nicht weg«, sagte sie. »Zwei Mitarbeiter sind krank, ich muss an der Rezeption bleiben. Bitte, Herr Süden …«
Ich sagte: »Sie arbeiten in einem Hotel.«
»Hotel ›Aurora‹ in Schwabing.«
»Das kenne ich.«
»Bitte kommen Sie.«
»Nein«, sagte ich.
Wieder verstummte sie. Ich beobachtete Sonja, die anscheinend an einem imaginären Tippwettbewerb teilnahm, ihre Finger hackten und zuckten, ihre braunen halblangen Haare klebten ihr im Nacken, so stark schwitzte sie, und sie hatte rote Flecken im Gesicht.
»Sonja?«
Ihre Hand huschte zur Maustaste, dirigierte sie, flitzte zurück und das Klacken ging weiter. Sonja musste blinzeln, weil ihr Schweiß in die Augen rann.
»Ich heiß Susanne.«
»Bitte?«, sagte ich.
»Ich heiß Susanne Berghoff«, sagte die Frau am Telefon, »nicht Sonja.«
»Ja«, sagte ich und hörte am Ende der Leitung ein Telefon klingeln und verschiedene Stimmen.
»Ich hab neue Gäste«, sagte Frau Berghoff. »Ich ruf gleich noch mal an. Sie müssen mir helfen, Herr Süden. Ich hab viel über Sie gelesen …«
»Wer ist verschwunden, Frau Berghoff?«
»Niemand«, sagte sie und legte auf.
»Fertig.« Sonja schnippte mit den Fingern und sah mich aus glasigen Augen an.
»Schleichen Sie sich«, sagte ich. »Gehen Sie ins Bett.«
»Alle Widerrufe erledigt«, sagte sie, als habe sie mich nicht verstanden. »Die Kollegen vom LKA haben keinen Grund mehr uns anzuschnauzen.« Sie betrachtete ihren Computer wie eine Trophäe. Und tatsächlich beugte sie sich vor und lächelte das Ding an. Sie grinste nicht, sie lächelte, als säße dort ein Mensch, der gemeinsam mit ihr Großes vollbracht hatte.
»Sehr gut«, sagte ich.
»Was?«, sagte sie.
»Soll ich Sie nach Hause fahren?«
»Nein.« Sie stand auf, schwankte und hielt sich an der Stuhllehne fest. »So ein Mist. Mir ist schwindlig. Außerdem verdurste ich gleich.«
Ich goss Mineralwasser in ein Glas und reichte es ihr. Sie trank es in einem Zug aus.
»Schaffen Sie es allein?«, fragte sie.
Ich sagte: »Was genau?«
Sie holte Luft, zog ihren Mantel an, nahm die Umhängetasche vom Stuhl und sah sich um, als habe sie vergessen, wo sich die Tür befand.
»Ich kann Sie in Ihrem Wagen nach Hause fahren«, sagte ich. »Und dann nehme ich ein Taxi zurück.«
»Ich fahr selber«, sagte sie etwas zu laut, was sie aber nicht zu bemerken schien.
»Gute Besserung«, sagte ich.
Sie zog den Mantel enger zu und wickelte den Schal noch fester um den Hals. Es war nicht zu übersehen, dass sie gleichzeitig fror und schwitzte.
Als sie auf den Flur hinaustrat, kam ihr, mit dunklen Tränensäcken im knochigen Gesicht, mein Freund und Kollege Martin Heuer entgegen, eingehüllt in eine türkisfarbene Daunenjacke.
»Servus«, sagte er und hielt Sonja die Glastür auf, die ins Treppenhaus führte.
»Hallo«, sagte Sonja mit magerer Stimme.
»Bist krank?«, fragte er.
Sie antwortete ihm nicht. Martin und ich sahen ihr hinter der Glastür zu, wie sie auf den Lift wartete und dann, weil es ihr zu lange dauerte, mit vorsichtigen Schritten die Treppe hinunterging, die Hand ums Geländer geklammert wie eine gebrechliche Frau.
»Die hats sauber erwischt«, sagte Martin. Er kam von einer Vernehmung in einem Vermisstenfall, von dem wir nicht annahmen, dass er uns lange beschäftigen würde. Es ging um einen Mann, der eines Nachts nicht nach Hause gekommen war, die Familie befand sich in Aufruhr und bildete sich die fürchterlichsten Dinge ein, während wir schon nach den ersten Gesprächen von einer Beziehungssache ausgingen, das hieß, wir hatten Hinweise auf eine außereheliche Beziehung erhalten, die der Ehemann offenbar eine Weile ungestört genießen wollte. Zwei Tage später tauchte er wieder auf und behauptete, er habe mal einige Zeit für sich sein und über sein Leben nachdenken müssen. Seine Frau tat so, als würde sie ihm glauben, und wir schickten einen Vermisstenwiderruf ans Landeskriminalamt, damit die Kollegen den Namen im INPOL-System löschen konnten.
»Ich bin immer wieder verblüfft, in was für einer Lügenwelt manche Familien leben«, sagte Martin, bevor er anfing, das Protokoll seiner Vernehmung zu schreiben. »Und noch mehr beeindruckt mich, wie professionell sie ihre Lügen verkaufen, ich fall immer wieder drauf rein.«
Mein Telefon klingelte.
»Hier ist noch mal Frau Berghoff.«
»Grüß Gott, Frau Berghoff«, sagte ich.
»Es geht um meinen Sohn.«
Also fuhren Martin und ich in die Herzogstraße zum Hotel »Aurora«, um uns eine Geschichte erzählen zu lassen, von der wir zunächst nicht erwarteten, dass sie der Wahrheit entsprach.
»Sie müssen mir glauben«, sagte Susanne Berghoff mehrere Male hintereinander. »Mehr weiß ich auch nicht. Ehrlich.«
Was sie nicht wusste, war, wo ihr Sohn sich aufhielt. Timo war neun Jahre alt, und weder Martin noch ich konnten uns an eine Mutter erinnern, die, obwohl sie offenbar keine Ahnung hatte, wo sich ihr Kind herumtrieb, derart geringe Anstrengungen unternommen hätte seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Ihre größte Sorge schien zu sein, jemand könne von Timos Verschwinden erfahren, und anfangs hielt ich es für möglich, dass sie uns nur deswegen informiert hatte, damit wir dies verhinderten und nichts weiter. Susanne Berghoff wirkte vollkommen auf sich fixiert.
Aber wir drängten sie nicht. Wir ließen sie reden.
»Er ist schon öfter weg … Das macht er schon mal … Er ist sehr selbstständig …«
Wir saßen im Aufenthaltsraum des kleinen Hotels an einem Tisch mit einer grünen Decke, über die eine zweite, weiße gebreitet war. Alle zwölf Tische sahen gleich aus, unter dem Fenster mit den bodenlangen Stores stand ein langer Tisch, auf dem Tassen und Teller ordentlich aufgereiht waren. Der Raum war niedrig und dunkel, an der Decke brannte eine Lampe mit einem beigen Stoffschirm, die ein Licht verbreitete, das mich müde machte. Vielleicht lag es auch an der trockenen Luft und an der Art, wie Susanne Berghoff sprach. Sie war neunundzwanzig, wie wir später erfuhren, aber als wir sie das erste Mal trafen, schätzte ich sie auf mindestens fünfunddreißig. Sie war sehr schlank, eigentlich dürr, und stark geschminkt, sie wirkte überarbeitet und nervös, sie kam mir vor, als denke sie außer an sich selbst an eine Menge Dinge, die sie unter keinen Umständen preisgeben wollte. Immer wieder ging ihr Blick zur Tür, als erwarte sie jemanden, dann schaute sie uns mit verkniffenem Gesicht an, überlegte, wägte die Worte ab, strich die Tischdecke glatt, faltete die Hände und nahm sie wieder auseinander.
»Warum sagen Sie nichts?«, fragte sie.
Martin, der ihr gegenüber saß, zuckte mit der Schulter. Ich stand in der Nähe des Fensters, die Arme verschränkt, und hätte gern das Fenster geöffnet, um durchzuatmen, was auch Timos Mutter nicht geschadet hätte.
Sie schüttelte den Kopf. Dann rieb sie den Zeigefinger am Daumen wie jemand, der von Geld spricht. Sie bemerkte es nicht.
»Sie glauben, ich verschweig Ihnen was«, sagte sie.
»Ja.«
»Das stimmt nicht.«
»Können wir Ihren Mann in Wolfsburg anrufen?«, fragte Martin.
Sie hatte uns erzählt, ihr Mann nehme im VW-Werk an einem schwierigen Einstellungstest teil, bei dem Personen, die bisher nichts mit Autos zu tun hatten, zu Monteuren umgeschult würden und darüber hinaus fähig sein sollten, in einer Gruppe zu arbeiten. Darauf basiere das neue Konzept des Unternehmens, das von den Arbeitern verlange, eine bestimmte vorher vereinbarte Menge von Fahrzeugen fertig zu stellen, und zwar für einen Pauschallohn, wobei sich die konkrete Arbeitszeit nach der Erfüllung des Produktionssolls richte, und je perfekter die Abstimmung im Team funktioniere, desto schneller werde das Ziel erreicht und desto höher der Stundenlohn für jeden Einzelnen.
Mit großem Eifer hatte Susanne Berghoff von dem Konzept erzählt, so weit sie es verstanden oder ihr Mann es ihr erklärt hatte. Sie schien stolz auf seinen Elan und seinen Willen zu sein, diese Prüfungen zu schaffen, an denen ungefähr vierzigtausend Kandidaten aus ganz Deutschland teilnahmen. Bevor er arbeitslos wurde, war Hajo Berghoff Abteilungsleiter in einer Filiale von CompuLine gewesen, einer Kette von Spezialgeschäften für Hard- und Software, Netzwerkinstallationen, elektronische Archivierungen, EDV-Technologien und eine Reihe von Serviceleistungen. Vor acht Monaten war die Münchner Filiale geschlossen worden. Alle Versuche Berghoffs, auf seinem Fachgebiet einen anderen Job zu finden, scheiterten, er fand keine Firma, die neue Leute einstellte.
»Er ist so gut«, sagte seine Frau, »er kann Ihnen die kompliziertesten Dinge auf dem Computer erklären, es gibt Kunden, die rufen immer noch bei ihm an, weil sie seine Hilfe brauchen. Aber davon können wir natürlich nicht leben. Außerdem will er wieder richtig arbeiten, zehn, zwölf Stunden am Tag, das braucht der, da blüht er auf, da ist er in seinem Element.«
Sie hatte zur Tür gesehen und den Kopf geschüttelt, als müsse sie sich mit Nachdruck daran erinnern, dass es im Moment um etwas anderes ging.
»Sie können ihn anrufen«, sagte sie jetzt. »Aber Sie werden ihn nicht erreichen. Er schaltet sein Handy natürlich ab. Er weiß auch nicht mehr als ich. Ehrlich.«
Martin schrieb etwas auf den Block, den er vor sich liegen hatte.
Dann sah er die Frau an. »Ich frag Sie noch mal: Warum wollen Sie Ihren Sohn nicht als vermisst melden? Warum haben Sie keine Angst, dass ihm was zugestoßen sein könnte, wieso …«
»Aber ich hab ja Angst«, sagte sie laut zu mir. »Deswegen hab ich Sie ja angerufen, Sie finden doch die Leute immer, Herr Süden …«
»Ihr Sohn ist neun«, sagte ich und ging zum Tisch. Vielleicht brachte mich die Bewegung etwas in Schwung. »Er ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen, Sie rufen bei uns im Dezernat an, Sie machen sich Sorgen …«
»Ja, ja«, sagte sie, den Blick starr auf mich gerichtet.
»… und wir sind hier, Frau Berghoff. Und jetzt reden Sie offen mit uns, sagen Sie uns, was Sie vermuten, sagen Sie uns, warum Sie nicht wollen, dass Ihr Mann von all dem erfährt, sagen Sie …«
»Das stimmt doch gar nicht.« Wieder rieb sie nervös den Finger am Daumen und zog die Stirn in Falten, während sie den Tisch anstarrte. »Ich hab ihm nicht … Er hat keine Zeit für so was, er muss diesen Job kriegen und das schafft er auch. Das schafft er auch. Er schafft das.«
»Ja«, sagte ich.
Mit einem Ausdruck tiefer Erschöpfung sah sie mich an. »Herr Süden …« Sie stockte wie am Anfang unseres Besuchs, als sie von ihrem Jungen erzählte und nach jedem halben Satz eine Pause machte, als wolle sie abschätzen, ob sie womöglich schon zu viel preisgegeben hatte.
»Ja?«, sagte ich.
»Könnt ich … entschuldigen Sie …« Sie hatte sich für eine Sekunde an Martin Heuer gewandt. »Könnt ich Sie … Ich würd gern mit Ihnen allein sprechen, Herr Süden, geht das? Ist das möglich? Ich hab … Das ist nicht gegen Sie …« Diesmal sah sie meinen Kollegen etwas länger an.
»Warum?«, sagte ich. »Ich berichte ihm sowieso alles, wir arbeiten zusammen. Sie können ihm ebenso vertrauen wie mir, Frau Berghoff.«
»Das weiß ich«, sagte sie. »Ja, ja … Es wär mir nur lieber … egal …«
»Das ist kein Problem«, sagte Martin und stand auf und steckte seinen Block ein. »Ich warte drüben im Café.« Er verließ das Zimmer. Ich blieb am Tisch stehen. Susanne sah zu mir herauf.
»Möchten Sie sich nicht hinsetzen?«, sagte sie.
Ich sagte: »Ich stehe lieber.«
Ich machte einen Schritt zur Wand und lehnte mich vorsichtig an.
Susanne Berghoff verfolgte jede meiner Bewegungen. Allmählich ärgerte mich ihre Verzagtheit, entweder sie fing endlich an die Wahrheit zu sagen, oder ich würde gehen. Ich wurde fürs Suchen bezahlt, nicht fürs Vielleichtsuchen. Nur weil sich anscheinend herumgesprochen hatte, nicht zuletzt durch Berichte in den Zeitungen, die nach einigen Vermisstenfällen erschienen waren und in denen ich zwangsweise und ungefragt vorkam, dass ich jemand sei, »mit dem man reden konnte«, fand ich noch lange kein Vergnügen daran, in engen Zimmern herumzustehen und jemandem die Beichte abzunehmen. Es stimmte, zuhören fiel mir leichter als reden, ich übte Schweigen seit meiner frühen Jugend, und während der zwölf Jahre meiner Arbeit in der Vermisstenstelle hatte ich gelernt, Stunde um Stunde Lügnern zuzuhören. Offenbar hatte ich tief in mir ein Reservoir an Geduld, das auf eine für mich manchmal beängstigende Weise unerschöpflich schien, doch ich wurde mürrisch und verschlossen, wenn ich den Eindruck bekam, jemand nutzte mein Schweigen aus. Damit meine ich nicht, ob mich jemand anlog oder auszutricksen versuchte oder mir, aus welchen Gründen auch immer, Geheimnisse seines Lebens anvertraute, die mich nicht das Geringste angingen, oder mich mit einer Meinung überschüttete, die mich nicht interessierte. Was mich in die Abwesenheit trieb war, wenn jemand mich als wandelndes Testlabor für taktische Experimente mit seiner Seele benutzte, jemand, der sich vor seinen eigenen Explosionen fürchtete und deshalb einen anderen brauchte, um diese auszulösen und selbst möglichst unbeschadet davonzukommen. Wer mich mit einem Arzt, Psychiater oder Priester verwechselte, für den blieb ich unerreichbar, ich konnte nichts für ihn tun und ich versuchte es nicht einmal.
»Sie müssen mir glauben«, sagte Susanne Berghoff, »ich wollt nicht, dass er wegläuft, ich wollt nur, dass er tut, was ich ihm sag, ich wollt ihn nicht verprügeln, ich wollt ihm nur sagen, dass es so nicht geht, dass das nicht geht … Und dann hab ich ihn so verprügelt, dass er geblutet hat, Herr Süden …«
Ich sagte: »Vielleicht hat er es verdient.«
Vor Schreck zuckte sie mit den Beinen und schlug sich das Knie an der Unterkante des Tisches an.
»Sie mussten es vielleicht tun«, sagte ich.
»Das ist doch nicht Ihr Ernst.« In die Anspannung in ihrem Gesicht mischte sich Empörung, die sie ein wenig aus ihrer Lethargie befreite.
»Warum nicht?«
»Sind Sie für die Prügelstrafe? Sie sind doch Polizist. So was dürfen Sie doch nicht sagen, das dürfen Sie doch nicht.«
Ich schwieg.
»Er hat geblutet, Herr Süden.« Sie stemmte die Hände auf den Tisch. Ihre Finger wirkten weiß und unwirklich. »Im Gesicht hat er geblutet und an den Händen, die hat er doch vors Gesicht gehalten, er hat sich die Hände vors Gesicht gehalten, weil ich ihn so fest geschlagen hab …«
»Womit?«
»Bitte?«
Sie war völlig verwirrt.
»Womit haben Sie ihn geschlagen?«