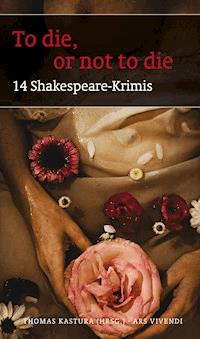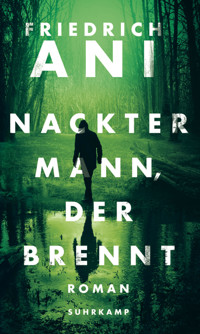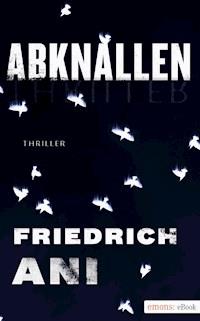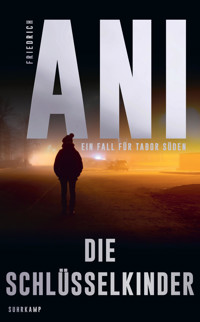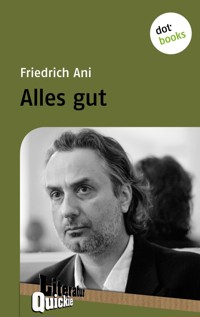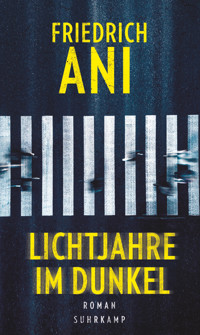6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Tabor Süden
- Sprache: Deutsch
Ariane, 36 Jahre, eine ehemalige Prostituierte, eröffnet ein Lokal. Kaum hat sie sich in ihrer bürgerlichen Existenz eingelebt, erfährt sie, dass sie HIV-positiv ist. Niklas Schilff, 39 Jahre, ist Reporter und zählt zu den begehrtesten Berichterstattern in Los Angeles. So lange, bis er beginnt, Fakten und Fiktion zu vermischen. Desillusioniert und psychisch krank, kehrt er nach Deutschland zurück. In einer Nacht treffen sie aufeinander. Friedrich Anis Roman "Verzeihen" - erstmals im Knaur Taschenbuch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Ani
Süden und die Stimme der Angst
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
There are no mistakes in life, some people say,
it is true, sometimes you can see it this way.
But people don’t live or die, people just float.
She went with the man in the long black coat.
Bob Dylan, »Man in the Long Black Coat«
1
Ich habe den Mann nicht hereingebeten. Er hat sich nicht abwimmeln lassen. Er war schmutzig. Seine Jacke stank nach Rauch. Ich weiß nicht, was er von mir wollte. Er kam von einer Reise zurück, ich habe ihn nicht danach gefragt. Wir saßen beide auf dem Rücksitz des Taxis. Er setzte sich neben mich, ohne zu fragen.
Wenn er mich nicht gezwungen hätte einzusteigen, wäre ich zu Fuß nach Hause gegangen. Das hätte ich geschafft. Es regnete. Ich habe mir vorgestellt, dass ich nüchtern und wach bin, wenn ich die Wohnungstür aufsperre. Und dass ich mir die Haare föhne und mich dann ins Bett lege und tief schlafe. Stattdessen überredete mich der Mann, mit ihm im Taxi zu fahren.
Ich bin so müde. So viel getrunken und nichts gegessen. Nur dagesessen. Drei Stunden. Vier Stunden. Erst im »Blaubart«, wo Lissi mich fragte, ob ich frei habe. Ja klar, habe ich zu ihr gesagt. Ich mag sie nicht. Sie ist eine Trickserin. Das war sie schon bei Enzo. Mir hat er nie geglaubt. Immer nur ihr. Und sie bildete sich was drauf ein. Wenigstens hat sie mir Champagner ausgegeben, billige Marke. Ich habe drei Gläser getrunken. Und zwei Wodka, die mir Roland spendiert hat. Er arbeitet in einer Walzfabrik, seine Frau ist Kleptomanin. Sagt er. Brille und Vollbart. Ehering trug er keinen. Er hat ihn vor der Tür abgenommen. Was denken solche Männer? Dass wir das persönlich nehmen, wenn sie eine Ehefrau haben?
Jetzt habe ich schon wieder »wir« geschrieben. Ich bin nicht mehr wir. Seit dreiundzwanzig Monaten nicht mehr. Nächsten Monat werden es zwei Jahre. Genau zwei Jahre. Genau zwei Jahre, und ich schreibe immer noch »wir«, verflucht. Immer wieder schreibe ich das. Gestern auch. Ich hasse mich dafür. Ich bin nicht mehr wir. Ich bin nicht mehr ihr!
Ich will jetzt nicht schon wieder ausflippen. Ich darf das nicht. Ich habe mir vorgenommen, ruhig zu bleiben. Ich mache mich lächerlich. Nein, das stimmt nicht. Ich mache mich nicht lächerlich. Jetzt fange ich schon wieder zu heulen an. Das ist der Kater, ich werde sentimental, wenn der Alkohol weggeht am nächsten Tag. Das war früher schon so. Da haben mich die anderen gehänselt. Na und? Die haben auch alle ihre Macken. Jetzt schreibe ich schon wieder von denen. Ich muss über mich schreiben. Nur über mich. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir bloß was vor. Vielleicht rede ich mir ja nur ein, dass ich, wenn ich etwas aufschreibe, hinterher eine Kraft habe in mir. Wo soll die denn herkommen? Aus den Wörtern? Aber wenn ich nichts aufschreibe, zerreißt es mich.
Zuerst habe ich den Typ gar nicht bemerkt. Er glotzte mich an. Er hörte nicht mehr auf zu glotzen. Ich hätte ihn gleich wegschicken sollen. Er war aufdringlich, und niemand hat was unternommen. Die haben gedacht, die besoffene Tussi merkt eh nichts. Oder die wollten sehen, ob er mich rumkriegt und abschleppt, der stinkende Kerl.
Hat er nicht geschafft.
Ich frage mich immer noch, wie er in meine Wohnung gekommen ist. Ich muss ihn reingelassen haben. Ich lasse also einen wildfremden Kerl in meine Wohnung und bin auch noch besoffen. Ich bin enthirnt. Und er glotzt ständig meinen Busen an. Das hat er schon in dem Bahnhofsbistro gemacht. Gibt’s da, wo er herkommt, keine Busen? Oder nur welche aus Silikon? Meiner ist echt. Er hat tatsächlich gesagt, ich soll mich ins Bett legen und er geht dann.
Für wie enthirnt hält der mich?
Parkt seinen Koffer mitten im Flur und legt den Arm um mich. Habe ich ihm das erlaubt? Ich habe einfach meinen Mantel fallen lassen, und da fiel sein Arm mit runter. Angeber. Vielleicht hat er gewartet, dass ich ihm was anbiete. Solche Typen erwarten ja immer was. Ich habe mich umgedreht und gesagt: Und jetzt? Und er hat nicht gewusst, was er sagen soll. Bei der ersten falschen Bewegung hätte ich die Pistole in der Hand gehabt. Ich war nicht weit von der Schublade weg, wo ich sie aufbewahre. Ich bin schnell. Ich habe das geübt. Blitzschnelle Drehung, Schublade auf, Knarre raus und Feuer. Sie ist geladen. Ich kann sofort abdrücken, wenn’s gefordert ist. Ich hätte da keine Skrupel.
Nett war, dass er mich gefragt hat, ob ich allein zurechtkomme, wenn er jetzt geht. Das gefiel mir. Er hat das ganz ernst gesagt, ohne blöden Unterton. Ich habe das gehört. Ich erkenne das an der Stimme eines Kerls. Das war nett von ihm, und ich hab es ihm geglaubt. Und es hat nicht viel gefehlt, und ich hätte gesagt, er kann noch einen Tee trinken, wenn er will.
Auf einmal war es so dunkel hier. Es war vorher auch dunkel, nur das Licht im Flur war an, wo sein Koffer stand. Hier im Zimmer hatte ich kein Licht angemacht. Das Licht der Straßenlampe schien herein, wie immer. Ich weiß nicht, warum ich die Schreibtischlampe nicht angemacht habe. Das war ja riskant, mit einem Fremden in die Wohnung zu gehen, und dann ist es auch noch finster. Ich war betrunken. Ich war ja so betrunken.
Nicht jetzt wieder! Ich könnte grünen Tee trinken. Nein, ich mag nicht aufstehen, besser hier sitzen und schreiben. Gemein ist das, weil Iris heute allein im Laden ist. Ich habe sie angelogen. Aber sie schafft das. Anders war es nicht möglich. Ich würde mich ja selber anlügen, wenn ich’s könnte. Aber das geht nicht, verflucht.
Ich darf nicht dauernd fluchen. Ich darf mich nicht in so eine Stimmung bringen, da bin ich verloren. Dann fange ich wieder an zu trinken. Das war immer schon so: Wenn ich mies drauf bin und was trinke, dann bin ich hinterher dreimal so mies drauf. Und wenn’s mir gutgeht und ich trinke, dann fühle ich mich dreimal so gut. Und das ist dann auch Unsinn.
Ich hätte gern ein Gleichgewicht im Leben. Das habe ich mir immer gewünscht, so sein wie andere, die dastehen und nicht bei jedem Windhauch oder wenn’s mal ruckelt umfallen. Diese Leute haben eine Balance, und ich habe keine. Und ich werde vielleicht nie wieder eine Balance haben.
Gestern Abend, in dem scheußlichen Bistro, habe ich gedacht, jetzt gehe ich zum Telefon und rufe meine Mutter an. So weit war ich. Seit zwei Jahren habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen. Nicht mehr, seit ich ihr erzählt habe, dass ich mit Iris das Lokal eröffne. Das hat sie einen Dreck interessiert. Sie hat gedacht, im Hinterzimmer wird gefickt. Da habe ich sie so gehasst, und ich hasse sie immer noch. Aber gestern war ich fast so weit, sie anzurufen und ihr zu sagen, was passiert ist.
Wenn der Typ nicht plötzlich dagestanden hätte, hätte ich’s womöglich getan. Ich hätte sie angerufen, ich hätte ihr alles erzählt. Der Typ hat mich gerettet. Der hat mich vor diesem Dummtum bewahrt. Niemals, das schwöre ich hiermit hoch und heilig, niemals werde ich ihr erzählen, was passiert ist, auch nicht, wenn ich weder ein noch aus weiß. Niemals.
Mir ist schlecht. Ich kann nicht weiterschreiben, ich trinke erst was. Nein, ich trinke nichts. Es war falsch, heute nicht zu arbeiten, blöd war das. Aber jetzt kann ich nicht mehr ins Lokal gehen. Ich muss was machen. Was? Schon wieder die Sirene des Sankas draußen, ich kann das nicht mehr hören. Iris sagt immer, wer neben einem Krankenhaus wohnt, der bleibt gesund. Stimmt gar nicht.
Stimmt ja gar nicht.
Er saß da. Und tat nichts. Er war allein in dem Zimmer mit den Computern und den Telefonen und niedrigen Aktenschränken und Grünpflanzen. Zwei Schreibtischlampen brannten. Sonst kein Licht. Er hatte die Hände flach auf den Tisch gelegt. Und horchte mit geschlossenen Augen auf das Rauschen von der Straße.
Für eine Schallisolierung der Fenster fehlte das Geld. Er machte die Augen auf. Wieso musste er jetzt daran denken? Ist das wichtig?
Und doch stritten sie jeden Sommer darüber, wieso es ihrem Chef nicht gelang, einen Antrag ans Ministerium zu stellen, in dem er ein für alle Mal auf einem Umbau bestand. Andernfalls müssten sie sich neue Räume suchen, da Dienstbesprechungen oder Vernehmungen bei offenen Fenstern wegen des Krachs unmöglich waren, genauso in der stickigen Luft an heißen Tagen.
Jetzt war November. Aber es war warm hier. Und still. Abgesehen von den gedämpften Geräuschen der Autos und Straßenbahnen vor dem Hauptbahnhof.
Wenn alles so blieb, war die Nacht kein Problem.
Er ahnte, dass es so nicht bleiben würde. Bis etwas passierte, wollte er nur dasitzen. An nichts Wichtiges denken. Kaffee trinken. Ein wenig summen. Und gelegentlich lächeln wegen Sonja.
Im Laufe dieses Samstags waren bisher drei Jugendliche und ein erwachsener Mann als vermisst gemeldet worden. Für die Kommissare der Vermisstenstelle kein Grund zur Sorge. Die Jugendlichen, drei Mädchen aus einer Trabantenstadt, waren Dauerläufer. Was bedeutete, sie verschwanden ungefähr jeden dritten Monat und kehrten nach einem weiteren Monat zurück. Unversehrt und missmutig. Obwohl die Polizei den Eltern jedes Mal erklärte, dass eine Suche sinnlos sei, bestanden diese auf einer Anzeige.
Was den Mann betraf, den seine Lebensgefährtin heute Morgen als vermisst gemeldet hatte, ein Maler und Kleingalerist, so zog er vermutlich nicht zum ersten Mal, wie die Frau schließlich zugab, mit einem Freund um die Häuser. Und würde spätestens am Dienstag wieder zurück sein.
Diesmal ist es anders, hatte die Frau gesagt. Das kommt doch oft vor, dass einer behauptet, er geht zum Zigarettenholen, und haut dann ab für immer!
So etwas hab ich noch nie erlebt, hatte Kriminaloberrat Karl Funkel zu ihr gesagt. Sie glaubte ihm nicht.
Unter den eintausendsechshundert Verschwundenen, deren Fälle Funkels Dezernat 11 jedes Jahr bearbeitete, gab es keinen einzigen Zigarettenholer.
Daran musste Tabor Süden jetzt denken, während er seinen Kaffee trank. Und zur Tür blickte. Und sich dort Sonja vorstellte.
Das Telefon klingelte.
Er stellte die Tasse ab. Strich die Haare nach hinten. Und betrachtete das weiße Telefon, als verrate dessen Klingeln etwas über den Anrufer. Süden ließ es fünfmal klingeln.
»Meine Frau ist weg, die kommt nicht mehr.« Der Mann war angetrunken. Und weinte.
»Die kommt wieder«, sagte Tabor Süden.
»Ja«, brüllte der Mann. Dann schwieg er.
Süden hörte ihn schniefen. Er trank seine Tasse leer. Und machte sich Notizen.
»Seit wann vermissen Sie sie?«
»Was?«
Am anderen Ende schepperte etwas. Jemand fluchte. Dann war im Hintergrund eine zweite Stimme zu hören.
»Sagen Sie mir bitte Ihren Namen«, sagte Süden.
»Moment mal.«
Normalerweise hätte Süden ihn auffordern müssen, ins Dezernat zu kommen, um seine Aussage zu machen. Offensichtlich war der Mann jedoch nicht allein. Und Süden wollte erst herausfinden, was überhaupt vorgefallen war.
Er hatte ihn sofort gemocht. Der Mann hatte festgestellt, dass seine Frau verschwunden war. Doch ob er sie vermisste, darüber hatte er noch nicht nachgedacht. Es ist der Bruch der Gewohnheit, der uns am meisten schreckt. Mehr als das plötzliche Fehlen eines Menschen.
»Die seh ich nie wieder, nie wieder.«
»Bitte?«, sagte Süden.
Der Mann am anderen Ende der Leitung hielt sich das Telefon anscheinend direkt vor den Mund. Seine Stimme klang blechern. »Die kommt nicht mehr, die ist raus aus der Wirtschaft und weg.«
»Sagen Sie mir bitte Ihren Namen«, wiederholte Süden.
»Koberl Alfons. Sie müssen die suchen, die Frau, die … die tut sich was an … Die ist ge… gefährt ist die …«
»Was ist sie?«
»Gefährt, die springt in die Isar.«
»Ihre Frau, Herr Koberl?«
»Welche denn sonst«, brüllte er.
»Wieso sollte Ihre Frau in die Isar springen, Herr Koberl?«
»Weil die spinnt.« Der Mann fing wieder an zu weinen. Jemand redete auf ihn ein. Süden verstand nur den Namen Fonsi. Der Mann schneuzte sich. Und hustete.
»Wer ist bei Ihnen?«, fragte Süden.
»Ihre Schwester …«
»Ich möchte mit ihr sprechen.«
»Das geht nicht.«
»Bitte, Herr Koberl.«
Nach einer Weile meldete sich eine Frauenstimme: »Hier spricht Frau Falke.«
»Tabor Süden, Vermisstenstelle. Frau Falke, haben Sie eine Ahnung, wo Ihre Schwester stecken könnte?«
Sie zögerte einen Moment. Und hielt offensichtlich die Sprechmuschel zu. Der Kommissar klemmte den Hörer zwischen Kinn und Schulter. Und blickte wieder zur Tür, die er angelehnt hatte. Langsam begann er zu schwitzen.
Das gefiel ihm.
Manchmal, wenn ihm heiß wurde, machte er auch den obersten Knopf seines Hemdes zu. Und krempelte die Ärmel runter. Und fühlte sich gesund. Du könntest mal was abnehmen, sagte Sonja. Und er gab ihr recht. Mit seinen ein Meter achtundsiebzig wog er achtundachtzig Kilo. Und das Fett war unregelmäßig verteilt. Trotzdem wäre Süden nie auf die Idee gekommen abzunehmen. Er war überzeugt davon, dass sein Körper sein eigener Herr und von Natur aus fair zu sich war.
Spinner, sagte Sonja zu ihm. Er umarmte sie dann.
»Herr Süden?«
»Ich bin hier.«
»Meine Schwester … die hat Streit gehabt mit dem Alfons …« Sie stockte. Jetzt war ihre Stimme leiser. »Wir haben heute … heute Alfons’ Mutter beerdigt, sie war siebenundachtzig, er hat sehr an ihr gehangen, und die Erika … das ist meine Schwester, die … die haben sich halt nicht vertragen. Aber das war nicht böse gemeint, die haben …« Sie stieß ein trauriges Lachen aus. »Die haben, wissen Sie … die wollten immer … sie haben gewetteifert, in allem, beim Kochen, bei den Kleidern … Wer hat die schöneren Sachen, wer kann den besseren Braten … Die waren halt so, und … und dem Alfons ist das auf die Nerven gegangen, immer schon, der hat deswegen rumgebrüllt, er wollte, dass die Erika nachgibt und sich … sich nicht so reinsteigert …«
»Ja«, sagte Süden. Und malte ein krummes Etwas auf seinen Block, das einen Baum darstellen sollte. »Und nach der Beerdigung waren Sie in einem Wirtshaus, und da hat die Erika wieder damit angefangen …«
»Nein«, sagte Frau Falke und senkte sofort die Stimme. »Nicht die Erika, der Alfons … der hat wieder damit angefangen, wir waren alle richtig fassungslos …«
»Er wollte seiner Frau eine letzte Abreibung verpassen«, sagte Süden.
Einige Sekunden lang herrschte Stille in der Leitung.
»Ja … Das hab ich mir auch gedacht, genau dasselbe, eine Abreibung, der wollt noch mal … jetzt, wo die Mutter unter der Erde ist … Und er hat so rumgebrüllt und sogar auf den Tisch geschlagen und Gläser umgeschmissen, dass wir alle gedacht haben, er prügelt jetzt gleich auf die Erika ein, so brutal hat das ausgesehen. Moment mal …«
Wieder hielt sie die Sprechmuschel zu. In der Zwischenzeit stand Süden auf. Und steckte sein Hemd, das herausgerutscht war, in die Hose. Vielleicht wäre es nicht falsch abzunehmen. Er war vierundvierzig. Wenn sein Körper sich weiter so entfaltete, würde er in zehn Jahren eine Kugel sein. Oder so aussehen wie sein Kollege Weber, dessen Bauch sich wie ein Ball unter seinen karierten Hemden blähte.
»Er horcht an der Tür«, sagte Frau Falke mit gedämpfter Stimme. »Ja, und dann fing meine Schwester an zu heulen, war ja sowieso alles so traurig … Und der Alfons hat immer weitergebrüllt, und dann hat er ihr tatsächlich eine Ohrfeige gegeben, wir sind alle erschrocken, und er hat gebrüllt, dass diese Streitereien … das ewige Hin und Her zwischen den Frauen sein ganzes Leben versaut hätt, und deswegen hätt er jetzt Krebs gekriegt … Wir waren alle wie versteinert, davon hat keiner was gewusst … Und er hat auch nichts weiter gesagt, als wär ihm das bloß so rausgerutscht, und die Erika hat geheult und geheult, und dann ist sie aufgestanden und weggegangen. Und weil sie nach einer Viertelstunde noch nicht zurück war, haben wir mal nachgeschaut, auf dem Klo, und draußen, wo im Sommer der Biergarten ist, da war sie nicht. Dann sind wir zu meinem Schwager in die Wohnung gefahren, die Erika schließt sich oft ins Zimmer ein, wenn irgendwas ist … Aber da war sie auch nicht. Wir machen uns solche Sorgen …«
»Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?«, fragte Süden. Gerade wollte er aufstehen, um sich frischen Kaffee zu holen, da stand Sonja in der Tür. In einer halben Stunde begann ihr Bereitschaftsdienst.
»Vor zwei Stunden«, sagte Frau Falke. »Wir haben schon überall gesucht, in den Lokalen, wo sie immer hingeht, im Park, der hier hinterm Haus ist …«
»Waren Sie auf dem Friedhof, Frau Falke?« Auf seinem Zettel hatte er sich alles notiert.
»Was?«
Ohne ihre lederne Schirmmütze abzunehmen und ihren dunkelblauen Mantel auszuziehen, setzte sich Sonja auf den freien Stuhl gegenüber von Süden.
»Auf dem Friedhof …«, sagte Frau Falke.
»Haben Sie Erika auf dem Friedhof gesucht?«
»Ich … ich glaub nicht, nein … Was soll sie da?«
»Sie wird dort sein«, sagte Süden. Er war sich sicher, dass sie zum Grab ihrer Schwiegermutter gegangen war. Um mit ihr zu sprechen.
»Das glaub ich nicht«, sagte Frau Falke.
»Rufen Sie mich an, wenn sie nicht dort ist.«
Jetzt dauerte die Stille länger.
»Und … und wenn sie nicht da ist …«, sagte Frau Falke unsicher. »Wenn … wenn sie sich was angetan hat, wenn sie … in die Isar gegangen ist …«
»Hören Sie mit der Isar auf«, sagte Süden.
»Entschuldigung«, sagte Frau Falke schnell. Sie verabschiedeten sich.
Süden legte auf. Und hob langsam den Kopf. »Endlich«, sagte er.
Sonja nahm die Mütze ab. Sie hatte kurze blonde Haare, die eigentlich braun waren. Sie färbte sie. Niemand im Dezernat verstand, warum. Ihre Augen waren grün wie die von Tabor Süden. Die Spitze ihrer schmalen Nase zeigte nach oben. Was sie seit ihrer Jugend ärgerte. Dafür fand sie ihre Lippen perfekt. Besonders wenn sie sie glutrot anmalte.
Sonja Feyerabend war einundvierzig. Sie arbeitete seit zweieinhalb Jahren in der Vermisstenstelle. Und trotz ihres Vorsatzes, nie wieder ein Verhältnis mit einem Kollegen zu beginnen, war das Gegenteil eingetreten.
Sie küsste Süden auf die Stirn.
»Hier ist es kühl«, sagte sie.
Er schüttelte den Kopf. Und hatte das kindische Verlangen, seine Hand an die Stirn zu legen. Um ihren Kuss zu wärmen.
»Bring mir auch einen Kaffee«, sagte sie.
Sie griff nach seinem Block. Und las die Notizen. Wenn sie das Gekritzel richtig verstand, hielt sie es nicht für abwegig, dass die Frau sich etwas antun könnte.
»Unsinn«, sagte Süden.
»Wieso hast du die Familie nicht herbestellt?«
»Die Frau ist bald wieder da.«
»Soll das ein Baum sein?« Sie gab ihm den Block zurück. Und er hielt ihr die Kaffeetasse hin.
Wieder klingelte das Telefon.
»Soll ich deinen Mantel aufhängen?«
»Mir ist kalt.«
Sonja ruckte auf dem Drehstuhl hin und her. Schob ihre Mütze beiseite. Und griff zum Hörer.
Süden riss die beiden Zettel, die er beschrieben hatte, aus dem Block. Drehte sich zum Computer. Und tippte seine Aufzeichnungen ab.
»Vermisstenstelle, Sonja Feyerabend.«
Schon lange hatte sie es sich abgewöhnt, nur ihren Familiennamen zu sagen. Manche Anrufer hatten geglaubt, sie würde sich einen Scherz erlauben.
Eine Stunde später machten sich Sonja Feyerabend und Tabor Süden auf den Weg zu einem Lokal im Stadtteil Sendling. Die Kneipe hieß »Glücksstüberl«. Eine der beiden Wirtinnen war verschwunden. Sie war erwachsen, das »freie Bestimmungsrecht« erlaubte es ihr zu gehen, wohin sie wollte. Frühestens nach zwei bis drei Tagen hätte es für die Polizei Sinn, mit der Suche zu beginnen.
Das erklärten die Kommissare der anderen Wirtin, der Freundin der Verschwundenen. Diese hieß Ariane Jennerfurt.
Und während der zwei bis drei Tage, in denen niemand nach ihr suchte, ging sie verloren, in einer Welt, von der sie geglaubt hatte, sie sei ihr für alle Zeit entkommen.
2
Im vierten Stock des Dezernats gegenüber dem Südeingang des Hauptbahnhofs stand ein Mann am Fenster. Und blickte hinunter auf das Chaos. Eine Straßenbahn blockierte die Kreuzung. Autofahrer hupten. Fußgänger trommelten wütend auf Kühlerhauben, weil sie zwischen den wartenden Fahrzeugen nicht durchkamen. Radfahrer klingelten sich die Daumen wund. Und die Stadtstreicher feuerten alle lautstark an.
Seit elf Jahren verfolgte Karl Funkel vom Fenster seines Büros aus dieses Schauspiel. Beim ersten Mal, so glaubte er, sah er noch alles auf einmal. Dann nicht mehr. Dann musste er länger hinsehen. Nicht dass er mit dem einen Auge, das ihm geblieben war, besser sehen konnte. Was ihn manchmal wunderte. Immerhin bildete er sich ein, heute geduldiger hinzusehen. Vielleicht auch intensiver.
Doch was sah er schon den ganzen Tag, wenn er nicht gerade eine Pause machte? Akten. Schriftstücke. Seine Kollegen. Gewohnte Bilder. Vertraute Gesichter.
Vor vier Jahren wurde der Kriminaloberrat von einem drogensüchtigen Dealer bei dessen Festnahme schwer verletzt, die Netzhaut seines linken Auges irreparabel zerstört. Seither trug Funkel eine schwarze Augenklappe. Und sonntags, wenn er in der Kirche saß, was er regelmäßig zu tun pflegte, empfand er einen stillen Schmerz darüber, dass er nur noch ein Auge hatte für das Licht der Welt. Aber er lebte in der Gegenwart. Der Minister hatte ihm ausdrücklich erlaubt, weiter im Dienst zu bleiben. Und wenn Funkel nach einer Dienstbesprechung zu einem Kollegen sagte: Ich möchte Sie unter vier Augen sprechen, schmunzelten alle. Auch er.
»Fertig meditiert?«
Funkel drehte sich um. Tabor Süden stand in der Tür. Die Lederjacke über der Schulter, das weiße Hemd bis zum Hals zugeknöpft.
»Morgen«, sagte Funkel.
»Morgen.«
In zehn Minuten begann die erste Sitzung. An diesem Montag nur in kleinem Kreis.
»Ich hab deine Berichte gelesen«, sagte Funkel. Und zog sein rotes Sakko an, das über der Stuhllehne hing. »Die Sachen mit der Wirtin und diesem Maler sind eigenartig.«
»Ja.«
Funkel kratzte sich an der Oberkante seiner Augenklappe. Sah sich um. Lächelte flüchtig. Und ging zu einem Aktenschrank. Auf den stellte Veronika, seine Sekretärin, regelmäßig einen kleinen Topf mit Basilikum. Niemand verstand, wieso. Wenn die Blätter vertrocknet waren, warf Veronika den Topf weg. Und stellte einen neuen hin.
Aus dem niedrigen Schrank holte Funkel eine Pfeife, ein schwarzes Tabaksäckchen und Streichhölzer. Er hatte die kuriose Vorstellung, er würde weniger rauchen, wenn er die Utensilien außer Sichtweite versteckte. Und manchmal vergaß er tatsächlich, wo er sie hingelegt hatte. Dann fragte er seine Sekretärin. Die wusste sofort Bescheid.
»Wo ist Veronika?«, fragte Süden. Sie verließen das Büro. Und gingen in den zweiten Stock hinunter.
»Beim Arzt«, sagte Funkel.
»Ist sie krank?«
»Sie ist die einzige hypochondrische Frau, die ich kenne. Normalerweise sind doch nur Männer Hypochonder.«
»Ich nicht«, sagte Süden.
»Ich auch nicht.«
Funkel wollte noch etwas fragen. Dann ließ er es sein. Der Gedanke kam ihm lächerlich vor. Lächerlich für sein Alter.
»Wie geht’s Sonja?«, fragte er. Die Frage quoll ihm aus dem Mund. Er konnte sie nicht zurückhalten.
»Gut«, sagte Süden, im Stillen amüsiert.
»Hallo«, sagte Sonja Feyerabend zu den beiden Männern. Der Konferenzraum bestand aus zwei Zimmern mit einer Verbindungstür. Was bei Besprechungen von Sonderkommissionen mit vielen Personen zu großer Unübersichtlichkeit führte.
An diesem Montag genügte ein Tisch. Außer Funkel, Süden und Sonja Feyerabend nahmen an der Konferenz noch die junge Oberkommissarin Freya Epp sowie zwei Männer von höchst gegensätzlicher Erscheinung teil.
Der eine, Paul Weber, neunundfünfzig, war ein bulliger Mann mit buschigen Augenbrauen und einem breiten Gesicht. In seinem karierten Hemd, seiner speckigen Kniebundhose und mit seinen weiß-blauen tischtuchgroßen Taschentüchern sah er aus wie ein Bayer von der Postkarte. Dazu hatte er gelocktes Haar. Und seine Ohren liefen manchmal tomatenrot an. Der Hauptkommissar war übergewichtig. Auf seinem runden Bauch konnte er eine Kaffeetasse abstellen. Und wenn er aß, dann garantiert keine Salatblätter an Wachteleiern. Vor fünf Jahren war seine Frau Elfriede gestorben. Seither schämte er sich wie als Kind manchmal seiner Einsamkeit. Wie immer hatte er die Ärmel seines rot-weiß karierten Hemdes hochgekrempelt. Graue Haarbüschel prangten auf seinen Unterarmen. Und er notierte mit einem Bleistift Stichpunkte. Meist Zitate. Auch seine eigenen. Es war ein Spleen.
Der andere, ein Klappergestell, saß neben ihm. Ein dürrer, ausgemergelt wirkender Mann von dreiundvierzig Jahren: Hauptkommissar Martin Heuer. Er hatte nur noch wenig Haare, auf seinem Hinterkopf zu einer Art Nest geformt, und dicke Tränensäcke unter den blassen Augen. Im Kontrast zu seinen eingefallenen Wangen thronte eine fleischige Knollennase in seinem Gesicht, die unvermeidlich an einen Trinker erinnerte. Martin Heuer war Trinker. Er trank nie im Dienst. Und oft tagelang keinen Tropfen. Doch wenn er loszog, immer durch dieselben Lokale, und bei denselben Wirten und Prostituierten die Nächte verbrachte, dann war es, als würde er darauf hinarbeiten, sich zu zerstören. Über so etwas dachte er nicht nach. Er tat es einfach. Versank in Melancholie. Und vergaß, dass er noch ein anderes Leben hatte. Und Freunde. Wenn Sonja ihn fragte, wieso er wieder abgestürzt sei, sagte er: Ich weiß es nicht. Wenn Tabor Süden ihn so lange anschwieg, bis Heuer nicht anders konnte als etwas zu erzählen, sagte er: Ich war wieder bei Lilo, sie hat sich jetzt eine Dusche in ihr Schlafzimmer installieren lassen.
Wenn er sich mit Sonja und Süden traf, wenn sie zu dritt unterwegs waren, zum Baden fuhren, ins Kino oder zum Essen gingen, lachte er viel. Trank wenig. Und vermittelte den Eindruck eines glücklichen Menschen. Vielleicht war er in diesen Momenten glücklich. Auch darüber dachte er nicht nach. Martin Heuer führte das Leben eines zuverlässigen Polizeibeamten. Und in unbegreiflichen Phasen wurde er zu einem Schatten, der über Wände huscht.
»Gut geschlafen?«, fragte Freya Epp.
Heuer sah sie an. Als wäre sie ein bebrillter Engel, der sanftmütig Alltag an alle verteilte. Durch die dicken Gläser ihrer grünen Brille wirkten Freyas braune Augen unwirklich groß.
»Jawohl«, sagte Heuer.
Auf dem Tisch standen Wasserflaschen, Gläser, Tassen und zwei Kannen mit Tee und Kaffee. Jeder hatte ein Getränk vor sich. Und blätterte in den kopierten Aufzeichnungen der Kollegen, die am Wochenende Bereitschaftsdienst gehabt hatten.
»Wart ihr in der Wohnung dieser …« Funkel nahm eines der Blätter. »… Ariane Jennerfurt? Hier steht nichts von Hinweisen auf eine Gewalttat.« Er warf einen Blick auf seine Pfeife, die schräg vor ihm lag. Und die er nicht anzünden durfte.
»Nein«, sagte Süden, »wir waren im Haus und haben mit einer Nachbarin gesprochen. Die hat nichts gesehen. Sie behauptet allerdings, sie habe Ariane weggehen hören, Samstagmorgen.«
»Samstagmorgen«, wiederholte Weber. Und schrieb das Wort auf seinen Block. Und kreiste es ein. »Ihre Freundin hat uns am selben Tag angerufen, nur weil Ariane nicht zur Arbeit erschienen ist. Habt ihr den Eindruck, die ist hysterisch?«
Auch wenn Paul Weber wie der Bilderbuchbayer aussah, sprach er kaum Dialekt. Fast redete er so wie der Leiter der Vermisstenstelle, Volker Thon, der in der Nähe von Hamburg geboren war. Thon nahm an der Sitzung nicht teil. Er baute einige seiner zweihundert Überstunden ab.
»Sie ist nicht hysterisch«, sagte Sonja Feyerabend, »sie ist besorgt.«
»Ich kenn die Kneipe gar nicht, wo genau ist die?« Heuer kratzte sich am Pullover, einem Rolli aus billigem synthetischem Material, von dem der Kommissar mehrere Exemplare besaß.
»Existiert erst seit knapp zwei Jahren«, sagte Sonja. »Die beiden Frauen betreiben sie gemeinsam, Ariane Jennerfurt und Iris Frost.«
»Was sagen die Gäste?« Funkels Verlangen nach Tabak wuchs.
»Das Übliche«, sagte Sonja. »Dass Ariane niemals einfach weggehen würde, dass sie ein nettes Mädchen ist, eine Spitzenwirtin …«
»Das Lokal ist in der Alramstraße, Ecke Implerstraße«, sagte Süden.
»Kenn ich, die Gegend«, sagte Heuer.
»Diese Iris, die Wirtin, also die Freundin von der … von der Ariane …«
Alle schauten Freya Epp an. Wenn sie anfing zu sprechen, verging die Zeit nicht. Jeder schätzte ihre geschriebenen Berichte. Und die offene, freundliche Art, mit der es ihr gelang, rasch Kontakt zu verstockten Zeugen oder Verdächtigen zu bekommen. Nach nur drei Monaten in der Vermisstenstelle hatte sie sich zur besonderen Zufriedenheit von Funkel, der sie aus dem Kommissariat für Todesermittlungen geholt hatte, in das Team integriert. Und bereits in zwei Sonderkommissionen bewährt. Doch kaum fing sie an, vor ihren Kollegen frei zu sprechen, gerieten ihre Gedanken durcheinander. Sie wurde auf eine fast groteske Weise so nervös, dass ihr Gesicht rot anlief und sie nur mit Mühe ihre Sätze zu Ende brachte.
Schweigen und Nicken.
Das irritierte Freya noch mehr.
»Hat sie noch mal angerufen?«, fragte Sonja.
»Was?« Freyas Kulleraugen glänzten hinter den dicken Brillengläsern.
Unauffällig sah Funkel auf die Uhr. Dann fiel sein Blick auf Tabor Süden. Der saß mit verschränkten Armen und gebeugtem Oberkörper da. Bedrückte ihn etwas?
Süden bemerkte Funkels Blick. Und lächelte.
Dieses Lächeln kam Funkel irgendwie hämisch vor.
»Ja«, sagte Freya, »die hat … also erst hab ich gar nicht verstanden, was die wollte, weil … euer Bericht lag schon da, ich bin erst … Meine Mutter hat heut früh wieder einen Terz …«
»Hat sie was von Ariane gehört?«, fragte Sonja.
»Meine Mutter?«
Sonja stieß einen Seufzer aus. Die junge Kollegin erinnerte sie an die KiKos, die vor einigen Jahren durch die Dezernate geisterten. Weil gewisse Kriminaldirektoren und Minister die Idee hatten, die Polizei zu verjüngen. Also beförderten sie Zwanzigjährige in den gehobenen Dienst und übertrugen ihnen die Verantwortung für komplizierte Fälle. Die meisten dieser Kinderkommissare, wie die älteren Kollegen sie nannten, scheiterten. Am Job. An sich selbst. Einige quittierten bald den Polizeidienst. Andere ließen sich in die Verwaltung versetzen.
»Doch nicht deine Mutter«, sagte Sonja etwas zu laut.
»Entschuldige«, sagte Freya.
»Was hat Iris Frost zu dir gesagt?« Noch drei Minuten, dann war für Funkel die Höflichkeitsfrist abgelaufen. Was das Rauchen betraf. Sonja war es gewesen, die das Verbot bei Konferenzen durchgesetzt hatte. Und was Funkel völlig unverständlich fand, war, dass sogar Kollegen, die sonst eine nach der anderen pafften, dafür gestimmt hatten. Auch Volker Thon, der Zigarillos bevorzugte und sich bei seinen Gewohnheiten selten stören ließ, war einverstanden gewesen.
»Dass die … dass sie, also die Ariane Jenner … nein, die Iris, dass die die Mutter angerufen hat, die Mutter von der … Ariane, und die, also die Mutter … die wohnt in … am … in Dießen … die weiß auch nichts, und das beunruhigt sie sehr, also diese Iris … Entschuldigung, ich bin heut echt schlecht aufgestanden und dann noch …«
»Du fährst noch mal zu ihr«, sagte Funkel zu Sonja. »Lass dir Fotos geben, schau dich in der Wohnung um, wir müssen jemanden finden, der sie zuletzt gesehen hat …«
»Die Frau, die Freundin …«, fing Freya an.
Funkel griff nach der Pfeife. Und dem Tabaksbeutel.
»Noch fünf Minuten, bitte«, sagte Sonja.
»Nein«, sagte Funkel.
Heuer spitzte die Lippen. Und kratzte sich am Pullover. Süden klappte den Mund auf und zu. Wie ein Fisch. Reglos hielt Funkel die Pfeife in der Hand, deren Stiel auf Sonja zeigte. Das Blatt in Freyas Hand knisterte.
»Welche Freundin?«, fragte Funkel. Und sah Sonja in die Augen. Was Freya vorübergehend erleichterte. Wenn sie nicht angestarrt wurde, fiel ihr das Sprechen leichter.
»Die von dem Maler in der Galerie, die hat auch angerufen vor einer Stunde, sie hat geweint, sie sagt, alles schaut so aus, als sei er überstürzt aufgebrochen, sonst ruft er sie immer an, wenn …«
»… er dringend was erledigen muss oder ihm was dazwischenkommt oder er ganz plötzlich zu einem Künstler muss, um ihn zu trösten. Sie wissen ja, die Künstler …«
Tränen standen in Edith Leus Augen. Und sie schämte sich deswegen vor den beiden Polizisten.
Zwei Stunden nach dem Ende der Besprechung und nach einer Reihe von Telefonaten wegen anderer Vermisstenfälle waren Tabor Süden und Martin Heuer zu der Galerie in der Konradstraße aufgebrochen. Sonja und Paul Weber hatten sich mit Iris Frost im »Glücksstüberl« verabredet.
»Er zieht manchmal um die Häuser«, sagte Edith Leu, die Freundin des Malers und Kleingaleristen Andreas Binger, den sie seit zwei Tagen nirgends erreichen konnte. »Ich weiß, dass er das jetzt nicht vorhatte, er ist in einer Arbeitsphase, er malt, er ist oben in seiner Wohnung und lässt sich von nichts und niemandem ablenken. Er hat den Anrufbeantworter an, ich sprech ihm drauf, und er ruft zurück, jeden Abend. Wir gehen auch schon mal zusammen was essen, dann geht er allein wieder zurück.«
»Am Freitag waren Sie zusammen essen«, sagte Heuer. Er trug seine braune Daunenjacke, die ihm so etwas wie eine Statur verlieh. Dazu eine Wollmütze. Aus der hingen Fäden heraus. Süden hielt seine Lederjacke in der Hand. Ihm war warm genug.
»Ja«, sagte Edith Leu. Sie betrachtete einen Stapel Post. Und spielte ständig mit ihren Fingern.
»Haben Sie Angst, ihm ist etwas zugestoßen?«, fragte Süden. Sein erster Eindruck war gewesen, dass sie ernsthaft beunruhigt war. Sie schien tatsächlich nur das zu wissen, was sie sagte.
»Nein«, sagte sie. Dann ballte sie die rechte Faust. Und blickte erschrocken zum Fenster. »Doch. Ich hab Angst. Ja.«
»Warum?«, fragte Heuer.
Die Frage verwirrte Edith Leu. Sie schwieg. Wieder spielte sie mit ihren Fingern. Steckte dann die Hände in die Taschen ihrer gelben Jacke. Und wich beim Reden den Blicken der Kommissare aus.
»Er verkehrt … Er steht auf bestimmte Sachen, sexuell … Er geht dann in so … in diese Studios …«
»SM-Studios«, sagte Heuer. Von seinen Touren kannte er genügend solcher Häuser. Das ein oder andere Mal hatte Lilo ihn zusehen lassen, hinter der Wand. Doch diese Art Sex erregte ihn nicht. Meist fand er diese Spiele langweilig. Aber vielleicht war er auch immer nur zu betrunken. Zu verzurrt. Zu deprimiert.
»Ich hab da angerufen …«
»Wo?«, fragte Süden. Er zog seinen kleinen Block aus der Hemdtasche. Und schrieb mit.
»Bei Coletta, das ist so eine Frau … Die Telefonnummer hat mir Andreas mal gegeben, er geht immer nur zu ihr. Er … er war nicht bei ihr, er war nicht dort. Ich mach mir Sorgen …«
»Vielleicht geht er noch zu anderen Dominas«, sagte Heuer.
»Nein«, rief Edith Leu. Sie riss die Hände aus den Taschen. Drehte sich im Kreis. Und sah die beiden Männer an. Einen nach dem anderen.
»Was vermuten Sie? Sie nehmen mich nicht ernst. Was glauben Sie, wo er steckt? Sagen Sie’s mir. Verarschen kann ich mich selber.«
»Niemand verarscht Sie«, sagte Süden. »Wir würden uns gern oben in der Wohnung umsehen.«
»Wie lange kennen Sie Herrn Binger schon?«, fragte Heuer.
»Acht Jahre, fast neun.«
»Hat er Feinde?«, fragte Süden.
Edith Leu schüttelte den Kopf.
»Wir brauchen ein Foto von ihm«, sagte Heuer.
»Oben steht ein Selbstporträt.«
»Ein Foto wär besser«, sagte Heuer. »Nichts gegen die Malkünste Ihres Freundes.«
Nach eineinhalb Stunden verabschiedeten sich die Kommissare von Edith Leu. Und machten sich auf den Weg zum Kurfürstenplatz. Sie wollten mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren.
Nicht nur Süden, auch Heuer benutzte selten den Dienstwagen. Sie hatten es nie eilig. Beide trugen keine Armbanduhr. Ein Handy besaßen sie ebenfalls nicht.
»Der kommt wieder«, sagte Heuer. Und kratzte sich an seiner Wollmütze.
Süden war derselben Meinung. In der Küche des Malers hatte er zwei Gläser bemerkt. An einem waren Spuren von Lippenstift. Und er war sich sicher, dass Edith Leu sie auch gesehen hatte. Sie hatte ihre Überraschung zu überspielen versucht, indem sie plötzlich Wein anbot und die Kommissare aufforderte, sich die Bilder anzusehen, während sie nach einem Foto suchte. Sie tranken nichts. Auf dem Foto war ein bärtiger Mann mit Glatze, der ausdruckslos in die Kamera blickte. Es war ein kleines zerknittertes Bild in Schwarzweiß.
»Wie alt ist das Foto?«, hatte Heuer gefragt.
»Zwei, drei Jahre. Ein Schnappschuss. Andreas mag nicht fotografiert werden.«
Bei der Beschreibung von ihm war die Frau in Verwirrung geraten. Das war normal. Selten war ein Angehöriger oder Freund in der Lage, die hervorstechendsten Eigenschaften einer ihm nahestehenden Person klar wiederzugeben. Die meisten verhedderten sich schon bei der Beschreibung der Haar- und Augenfarbe. Edith Leu hatte zunächst nicht einmal das genaue Alter von Andreas Binger gewusst. Er war fünfundfünfzig.
»Er ist bei der Frau«, sagte Heuer nun. Und angelte ein Päckchen Salem aus den Tiefen seiner Daunenjacke.
»Er ist mit ihr mitgegangen«, sagte Süden.
Heuer zündete sich eine Zigarette an. Er steckte das kleine Feuerzeug und die grüne Packung wieder ein. Eine Bahn der Linie 27 bog um die Ecke und hielt direkt vor ihnen.
»Trotzdem ist etwas anders«, sagte Süden. Und zog die Lederjacke an, die er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte.
Sie setzten sich hintereinander auf einen Einzelplatz.
»Was?«
»Er ist mit der Frau mitgegangen. Warum ist er noch nicht zurück?«
»Er verträgt was.«
»Vielleicht«, sagte Tabor Süden. Verschränkte die Arme vor der Brust. Und drückte die Schulter ans Fenster. Draußen begann es zu nieseln. Und das Licht wurde schmutzig.
»Vermisstenstelle, Epp.«
»Den Herrn Süden hätt ich gern gesprochen.«
»Der ist unterwegs, Sie können auch mit mir sprechen. Wie heißen Sie?«
»Koberl, Erika.«
»Grüß Gott, Frau Koberl.«
»Ich wollt mich beim Herrn Süden bedanken, dass er mich gefunden hat.«
»Wann hat er Sie gefunden?«
»Vorgestern, am Samstag … Eigentlich hat er mich nicht persönlich gefunden … Meine Schwester hat mich … Aber der Herr Süden hat gewusst, wo ich bin. Dafür wollt ich mich bedanken.«
»Ich richt’s ihm aus, Frau Koberl.«
»Das wär mir wichtig.«
3
Ist der Geruch einer Stadt unveränderbar wie der eines Menschen? Hm?«
»Halten Sie endlich die Klappe.«
»Bleiben die Geräusche und das Treiben einer Stadt von der Kindheit bis ins Alter eines Bewohners dieselben?«
»Wenn Sie jetzt nicht still sind, ruf ich die Stewardess.«
»Frage: Gehört ein Mann, der in einer Stadt zur Welt gekommen ist, für immer zum Inventar? Kann man den Wind wiedererkennen und die Spiegelung des Himmels in einem Schaufenster, wenn man nach neun Jahren zurückkehrt?«
»Ist mir so was von wurscht.«
Dann sagte er nichts mehr. Bestellte noch ein Bier. Und gab sich seinen Gedanken hin. Die ihn bedrohten. Und ihm sein Schweigen unerträglich machten.
Sind wir in einer magischen Umarmung? Hm? Kommt die uns vertraut vor? Und raubt sie uns gleichzeitig die Luft? Am Ort der ersten Sanftmut. Der ersten Furcht. Des ersten Staunens. Des ersten Schmerzes. Des ersten Wortes. Des ersten Gesanges. Nein.
»Nein!«, schrie der Mann in sein Bierglas. Die Frau an der Kaffeemaschine des Flughafencafés drehte sich erschrocken zu ihm um. Und das ältere Ehepaar neben ihm bewarf ihn mit vor Verachtung triefenden Blicken.
Niklas Schilff war betrunken. Im Flugzeug, kurz nach dem Start vom Los Angeles International, hatte er das erste Budweiser bestellt. Danach hatte er versucht, mit seinem Nebenmann ins Gespräch zu kommen. Sinnlos. Und sechzehn Stunden später taumelte er. Verwirrt vom Alkohol. Verstört von hundert Fragen. Doch das Bier und die zwei Bloody Marys waren nicht das wahre Problem.
Sein wahres Problem war seine Anwesenheit. Sein bloßes Hiersein. Und die Gewissheit, er würde nicht mehr dahin zurückkehren können, woher er kam. Wo ich gelebt hab. Wo ich was wert war.
»Wo ich gelebt hab und wo ich was wert war«, sagte er laut zu dem älteren Ehepaar. Ohne es wahrzunehmen. Er nahm nur sich selber wahr und er hatte …
»Vielleicht sollten Sie jetzt zahlen«, sagte die Bedienung.
… hier nichts verloren. Hier nicht. Nirgendwo in der Stadt. In der Stadt, in der er nun tatsächlich wieder war. An diesem elften November.
»Wie viel?«, fragte er das ältere Ehepaar.
»Achtzehn vierzig, die Butterbreze ist mit drin«, sagte die Bedienung.
»Ich hab keine Butterbreze gegessen«, sagte Niklas Schilff.
»Natürlich«, sagte die ältere Frau.
Schon als Kind hatte er die Butterbreze, die ihm seine Mutter in den Schulranzen packte, immer weggeworfen. Schulranzen.
»Schulranzen«, sagte er. Glitt vom Barhocker. Und sah sich um. Vielstimmige Sauberkeit. Verschwommen. Schulranzen.
»Achtzehn vierzig«, wiederholte die Bedienung.
»Schulranzen.« Seine Drehung vollzog sich so überraschend, dass die Bedienung wieder erschrak. Die ältere Frau hob den Kopf in Richtung ihres Mannes. Als erwarte sie von ihm augenblicklich ein polizeiliches Benehmen.
Schweigend zog Niklas Schilff seinen Geldbeutel aus der Tasche und legte einen Hundertmarkschein auf den Tresen. Gibt es ein Gesetz in dieser Stadt, das Servicepersonal zwingt, Prüfungen in mürrischem Verhalten abzulegen?
»Sehr freundlich«, sagte Niklas Schilff. Ließ die Münzen liegen. Bückte sich nach seinem Koffer. Und verharrte gebückt.
Von den Dingen, die ihm etwas bedeuteten, hatte er nur so viele mitnehmen wollen, wie in den Koffer passten. Beim Leerräumen seiner Wohnung stellte er dann fest, dass sein Koffer zu groß dafür war. Zwei dicke Mappen mit Zeitungsartikeln. Ein signiertes Foto von Robert De Niro. Eine Mundharmonika, auf der Jim Morrison gespielt hatte. Ein Lederarmband von einem der Hells Angels. Das rote indianische Messer seiner Ex-Freundin Alice, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Mehr nicht. Eine Handvoll armseliger Trophäen aus neun Jahren in einer glorreichen Stadt befanden sich zwischen den Klamotten in dem dunkelbraunen, abgeschabten Koffer. Eingewickelt in Deli-Tüten und geklaute Hotelhandtücher.
In seinem Kopf schoben sich Fragmente bizarrer Panoramen ineinander. Ergaben kein Bild. Keine Stadt. Einen ungeschnittenen Film. Ohne Ton. Mit rasenden Personen. Der Griff des Koffers kam ihm kalt vor. Strömte die Kälte aus seiner zitternden Hand? Ich bin nicht betrunken!
Mühevoll richtete er sich auf. Formte unhörbare Worte. Die ältere Frau und die Bedienung schüttelten einträchtig den Kopf. Der ältere Mann verschränkte die Hände auf dem Rücken. Stellte sich kerzengerade hin. Ein Wachmann in Zivil, um seiner Frau zu gefallen.
In der linken den Koffer, hob Niklas Schilff die rechte Hand. Und winkte. Wedelte mit der Hand. Was ihn amüsierte. Die zwei kleinen Räder des Koffers quietschten. Er hörte das Geräusch. Es erinnerte ihn an etwas. An was? Auch das Klacken seiner Absätze auf dem glänzenden Boden erinnerte ihn an etwas. An ein anderes Klacken. Vor langer Zeit, wann? Wo war er jetzt? Wohin wollte er?
»Zur S-Bahn geht’s da lang«, sagte ein Mann zu ihm. Hatte er ihn nach dem Weg gefragt? Zur S-Bahn. Und dann? Eine Freundin, eine Kollegin, hatte ihm das Hotel ihrer Eltern empfohlen. Nähe Hauptbahnhof. Er könne dort billig wohnen. Sie selbst reiste drei Monate um die Welt. Um Gespräche mit Kindern zu führen. Über … über …
Das Mädchen vor ihm auf der Rolltreppe aß ein Eis. Es trug einen Mantel und eine Mütze. Und schleckte ohne Pause an der weißen Kugel.
»Ist das ein Schnee-Eis?«, fragte Niklas Schilff.
Das Mädchen nickte. Ihr Gesicht war blass. Sie hatte traurige Augen. Niemand war bei ihr.
»Ich fahr in die Stadt«, sagte Niklas Schilff.
»Ich nicht«, sagte das Mädchen.
Sie standen auf dem Bahnsteig. Und der Zug fuhr ein. Das Mädchen traute sich nicht weiterzuessen.
»Bis später«, sagte Niklas Schilff.
»Bis später«, sagte das traurige Mädchen. Machte kehrt. Und fuhr auf der Rolltreppe wieder hinauf.
Schilff stieg ein. Setzte sich. Stellte den Koffer neben sich. Und behielt die Hand am Griff.
Auf den Lippen spürte er den Geschmack nach Salz und Fett. Er strich mit der Zunge darüber. Er hob die Lider. Und sah eine Frau, die sich ihm gegenüber hingesetzt hatte. Und er erschrak. Diese Frau war seine Mutter! Sie griff in die Plasiktüte auf ihren Knien. Und holte etwas heraus. Eine Butterbreze.
Plötzlich musste er würgen. Er drückte die Hand fest auf den Mund. Er bekam keine Luft. Er schloss die Augen. Kniff sie zu, so fest er konnte. Irgendwo ertönte eine Stimme. Um ihn tummelten sich Stimmen. Dröhnten in seinem Kopf. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten. Er hatte keine Hand frei. So umklammerte er den Griff des Koffers. Und hielt sich den Mund und gleichzeitig mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu. Er schnaubte. Und stellte sich verzweifelt den Blick aus seinem Zimmer in der Ezra Street vor. Den Blick hinüber auf den grünen Friedhof. Wo Hunde herumtollten. Und bunt gekleidete Jogger mit Walkmen liefen. Das wusste er alles. Doch er sah es nicht. Nicht jetzt. Nicht hier. In diesem Zug. In diesem Abteil. Auf diesem Platz. Gegenüber der Frau.
So weit er zurückdenken konnte, sah er seine Mutter mit einem Buch in der Hand. Und sie las nicht nur Theaterstücke. Auch Romane. Und besonders gern Gedichte. Und er machte einen Deal mit ihr. Niklas war erst drei oder vier. Aber er meinte es ernst. Wenn er herumtobte, Spielzeug an die Wand warf, weil er testen wollte, ob es stabil genug war, oder die Badewanne volllaufen ließ, um das Wasser mit Wasserfarben zu färben, und wenn daraufhin seine Mutter vergeblich versuchte, ihn zur Ruhe zu bringen, und er erst recht störrisch wurde, dann schlug er ihr ein Geschäft vor. Falls sie ihm eine Stunde lang Gedichte vorlas und währenddessen nicht ans Telefon ging, würde er alles aufräumen oder die Badewanne eigenhändig sauber machen.
Am Anfang hatte Hella Schilff nicht daran gedacht, mit ihrem Sohn zu verhandeln. Sie schaffte es auch so, sich durchzusetzen. Und er war nicht halb so gewitzt und ausdauernd, wie er vorgab. Eines Tages jedoch, es war Sommer, erinnerte sich Schilff plötzlich auf seinem Platz in der S-Bahn, zog sie die Stirn in Falten. Und sah grübelnd auf ihn hinunter. Er hockte auf dem Rand der Badewanne. Die war halb voll mit kuriosfarbenem Wasser, dessen Grundton sich ständig veränderte.
Wieso soll ich dir ein Gedicht vorlesen?, fragte Hella Schilff. Wie immer hatte sie ein Buch in der Hand und ihre roten Haare hochgesteckt. Und Niklas konnte die Sommersprossen an ihrem weißen Hals sehen. Und dieser Anblick kam für ihn gleich nach dem Blick ins Nachthemd, wenn sie sich morgens über ihn beugte, um seinem Vater über das Gesicht zu streichen.
Nicht ein Gedicht, sagte Niklas, viele Gedichte, eine Stunde lang.
Und dann räumst du auf und schrubbst die Wanne sauber?
Niklas nickte. Und schlug mit den Sandalen gegen die Wanne. Die kurzen schwarzen Haare standen ihm vom Kopf ab. Sein schmales, knochiges Gesicht war schweißüberströmt. Manchmal sorgte sich seine Mutter um seine Gesundheit. Sie fand ihn zu dürr. Zu blass. Zu still.
Aber vorher musst du mir eine Stunde vorlesen, sagte Niklas.
Nein.
Dann nicht. Selber schuld.
Eine Stunde ist zu lang, sagte Hella Schilff mit zusammengekniffenen Augen. Eine Viertelstunde, mehr Zeit hab ich nicht.