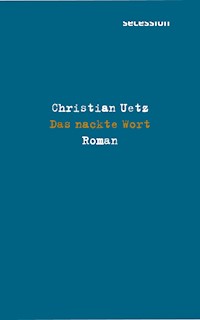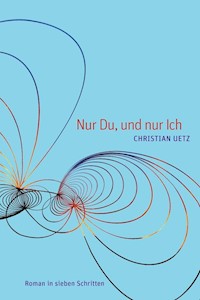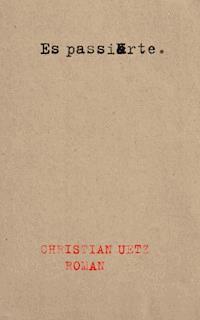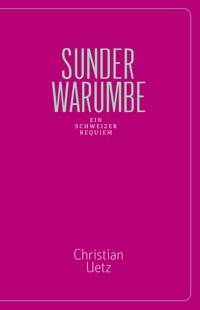
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon die Anspielung an Meister Eckharts tröstende Gebetszeile "So wirt der sun in uns geborn: daz wir sin sunder warumbe gebiert die literarische Energie, mit der Christian Uetz seine Themen zur Sprache bringt. Es liegt dem Tode nahe ein Freund. Der hat ein Leben lang im Verborgenen gedacht, empfunden, seinen Freund geliebt. Er hinterlässt ihm philosophische Aufzeichnungen: über zwanzigtausend Seiten. Seine Hauptthese - wir sind nicht nur Lebe-, sondern ebenso sehr Sterbewesen - schleudert uns aus der biologischen Dimension unserer Existenz in deren ethische Relevanz. Und Uetz trommelt die Sprache zum Tanz: An den Sandkastenfragmenten des Freundes arbeitet er sich, sei es mit wütender Hand zerstörend, sei es mit zarter Liebe bewundernd, ab. Ein betörender Text, ein Gleichnis zur Freiheit!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SUNDERWARUMBE
EINSCHWEIZERREQUIEM
ChristianUetz
SUNDERWARUMBE
EINSCHWEIZERREQUIEM
ChristianUetz
Der Autor dankt für die Unterstützung des Werkes:
Der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und der Thurgauer Kulturstiftung.
So wirt der sun in uns geborn: daz wir sin sunder warumbeMEISTER ECKHART, PREDIGT 41
ERSTES KAPITEL
Über Winter hatte Hieronymus Sunderwarumbe immer wieder Variationen desselben Traums: Ungeheure Schneemengen fallen und schneien das Haus ein, Sunderwarumbe kämpft gegen den Schnee und bittet den Tod, wieder zu gehen. Es war aber ein warmer Winter, völlig schneelos.
Doch in der Nacht auf den 5. März 2006 fiel ein Jahrhundertschnee, über fünfzig Zentimeter hoch und kalt und weiß, und schneite alles zu. Und am Morgen des 6. musste Hieronymus sein Romanshorner Haus, gelegen an der Kastaudenstraße, verlassen, er kehrte nicht mehr zurück, die Schwäche hatte ihn eingeholt.
Immer schon hatte er gesagt, wenn eines der drei Gs ausgehe, sei es Zeit zu gehen, und G stünde nicht für Gott und nicht für Glück, sondern für Geld, Gesundheit, Geduld.
Er wurde neunzig Jahre alt und mit ihm seine Idee von Freiheit: Nicht überleben, sterben muss man wollen!, meinte er durchaus religiös, zugleich verstand er sich streng sokratisch. Da kein Mensch wissen könne, weder ob Gott existiere noch ob Gott nicht existiere, sei es vollends wissenschaftlich, sich im Nichtwissen zu halten und die Existenz zu feiern, Tag für Tag. Doch Gott als Person war ihm nicht nur unvorstellbar als Du sollst dir kein Bildnis machen, sondern auch des Menschen Wissen übersteigend. Vermessen. Und solange Gott Gott bleibe, bleibe er beim philosophischen Glauben des Seinsgeheimnisses.
Die ersten fünf Tage verlangte Sunderwarumbe von den Ärzten ein Mittel, ihn wiederherzustellen. Es müsse möglich sein, er zwang zur Geste, er brauche noch ein paar Jahre, er schärfte seinen Blick, sein Werk zu vollenden wäre ihm das Wichtigste, zwanzigtausend Seiten betrüge es schon, ein Werk! Unmäßig wütend wurde er, da sie es ihm nicht zusichern konnten. Er begann das Essen als Fraß zu verweigern, und als Georg ihm sagte, so schlecht sei es nicht, antwortete er barsch:
Ich will überhaupt nichts mehr machen von all dem, was man macht.
Er schwieg nur eine Sekunde. Er äugte.
Ich habe viel zu lange mitgemacht, was man macht.
Jetzt ist Schluss damit.
Es rührte Georg, erst recht, da Sunderwarumbe ja bereits fünfzig Jahre lang das Kapitel man aus Sein und Zeit nebst dem Sein zum Tode das liebste war. Er nannte Sein und Zeit die Bibel der Philosophie und hatte es auch auf dem Hometrainer, damit er während des Radfahrens die 83 Paragraphen auswendig zu behalten immer neu trainieren konnte. Am siebten Tag bat der Kardiologe Georg zu vertraulichem Gespräch vor die Tür. Hieronymus fragte ihn, was der Arzt denn gesagt habe. Es habe schon etliche erfolgreiche Herzoperationen an Neunzigjährigen gegeben, die Fortschritte der Medizin seien phänomenal. Er habe nämlich einen kleinen Herzinfarkt festgestellt, der schon ein halbes bis ein Jahr zurückliegen könne, und wenn man diesen nun nicht operiere, stürbest du in kürzester Frist. Die Wahrscheinlichkeit, an der Operation zu sterben, sei zwar hoch, aber ohne stürbest du sowieso. Und ich solle dich fragen, was du meinst.
Das kommt überhaupt nicht infrage! Das wäre das Unphilosophischste, was wir in dieser Situation machen könnten. Es heißt also Abschließen.
Georg begann zu weinen.
Sunderwarumbe sagte zu ihm: Jetzt müssen wir stark sein, und weinte auch.
Von da an war jedes Aufbegehren und jedes Hadern vorbei. Hieronymus lächelte. Drei Tage später fiel ihm das Reden schwer, das Lächeln blieb. Und am Morgen des 18. März übernahm Georg zum letzten Mal das Aufschreiben der täglichen Chronik, die Sunderwarumbe ihm seit der Spitalexistenz diktiert hatte und die nicht zu versäumen diesem unbedingte Pflicht gewesen, denn sechzig Jahre lang hatte er sie keinen einzigen Tag ausgelassen. Dieses letzte Zeugnis, nachdem Georg ihn wie immer nach seinem Befinden fragte und ohne dass er sonst noch ein Wort oder einen Satz zu sagen vermochte, kam stockend und leise, aber wie ein dreifach wiederholter Siegesruf: Frei, frei, frei!
Drei Stunden später riefen sie den schon Gegangenen an, er solle gleich wiederkommen, Sunderwarumbe werde jetzt sterben. Georg saß weinend beim Bewusstlosen, den sie zum Sterben in ein Einzelzimmer verlegt hatten, doch nach kaum zwanzig Minuten öffnete Sunderwarumbe die Augen, lächelte, schlief wieder ein. Nun übernahm ihn das Unfassbare des Geistes. Schon immer ordnete er die palliative Methode an, und es sollten weder künstliche Ernährung noch sonst wie Schläuche, keine Beatmungsgeräte und erst recht keine Herzmaschinen eingesetzt werden. Nichts. In der Frühe des 18. März hatte er zum letzten Mal einen Schluck Wasser getrunken und sein Wort gesprochen, von da an atmete er nichts als Sein. Nicht nur einen Tag, auch nicht zwei oder vier, sondern zehn Tage lang. Ein Leben lang hatte er sich nur um den Geist gekümmert, man solle unentwegt einzig dem Tod ganz in die Augen sehen, am Ende hat er zehn Tage still geatmet. Nach vier Tagen war es auch für die Ärzte außergewöhnlich, und nach sieben Tagen sagte der Chefarzt Krause, das sei schier unfassbar und es könne nicht mehr lange dauern. Da Georg dem Hieronymus zwanzig Jahre lang immer vorgelesen hatte zum Tee, tat er dies auch jetzt, in diesen wunderlichen Tagen zur Uhrzeit des Tees.
Sunderwarumbe hatte schon immer bestimmte Stellen lieb, aus dem Faust, dem zweiten Teil, da war er Teil seiner Generation, und dem West-östlichen Divan, das kannten wenige so gut wie er, Sprüche aus dem Tao Te King in der Übersetzung von Viktor von Strauss gehörten dazu, Gedichte von Trakl und Hölderlin. Und immer wenn Georg mit ihm sprach, zitterten seine Augenlider, als sänge er mit, und das änderte sich nicht, die ganzen Tage. Am Nachmittag des 28. März las Georg ihm aus der Offenbarung vor, und bei Kapitel 21 desselben, das da lautet Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, da musste er den Satz unterbrechen, denn laut einatmend verzerrte sich plötzlich Sunderwarumbes Gesicht, nachdem es die ganzen zehn Tage unbewegt war bis auf die zitternden Augen. Die Grimasse sah aus wie ein Wolf, der an etwas sehr Bitterem würgte, und er atmete es mit einem einzigen kurzen Atemanhalt aus. Des Toten Antlitz lächelte.
Hieronymus Sunderwarumbe nannte den Tod den Phänomenalen Raum des Traums oder die Bedingung allen Träumens. Der akuteste Einschlag in das Traumwesen des Geistes fiel auf den Herbst 77, den Deutschen Herbst. Während in Mogadischu das Fieberthermometer des bürgerlichen Selbstverständnisses zu bersten drohte, schrieb er das Fragment Der Mensch als Lebe- und Sterbewesen:
17.10.77
Ich fühle mich nach dem moralischen Infarkt der letzten Nacht nicht nur erholt, ich fühle mich gefestigter denn je. Solange sich die Menschen nur ums Leben kümmern, werden sie die Unverlässlichkeit des Lebens immer bitterer beklagen. Zunächst gilt es, einen Weg in die Öffentlichkeit zu finden. Ich bin kein Messias, der auf die Straßen gehen kann, um zu predigen. Ich bin kein Politiker, der eine Bewegung organisieren könnte, kein Publizist, der fixfertige Konzeptionen in Buchform herausbringt und auf den Markt schwemmt. Mir bleibt das Experiment. Die existenzielle Tatsächlichkeit ist das Sterbewesen des Menschen. Unter allen Lebewesen auf der Erde – die zwar alle auch vergehen, krepieren, eingehen, verenden, verwelken, verscheiden müssen – ist der Mensch das einzige Wesen, für das der Tod nicht nur biologisch unausweichlich, sondern die Bedingung seines Erkennens ist. Alle Lebewesen leben, indem sie den ständig und überall drohenden Tod vermeiden. Doch der Mensch kann auf den Tod zugehen und darin fündig werden. Auch der Mensch ist Lebewesen. Nur ist er nicht nur dieses flüchtige, den Tod instinktiv vermeidende animalische Wesen. Ihm wird der Tod zur Gewissheit, und darin zum zwingenden Grund, erkennen zu wollen jenseits der biologischen Funktion.
Die Einseitigkeit des modernen Menschen besteht darin, dass er sich nur als Lebewesen versteht. Meint der Mensch auf diese Weise seinem Sterbewesen zu entrinnen? Es geht ihm wie Sisyphos: Er überlistet den Tod und erntet den Unsinn.
Je weniger ein Mensch sich des Sterbewesens bewusst ist, desto unheimlicher herrscht es über ihn. Für das Lebewesen ist der Tod pure Absurdität, die es unter allen Umständen zu meiden gilt. Drum auch die gegenwärtige Ratlosigkeit dem Terrorismus gegenüber.
Die Welt steht in diesen Tagen unter dem Alb des deutschen Baader-Meinhof-Terrorismus. Arbeitgeberpräsident Schleyer ist noch immer in den Händen der Terroristen. Über einer Lufthansamaschine mit über neunzig Passagieren samt Besatzung an Bord schwebt seit Tagen das Damoklesschwert der Vernichtung.
Wie grotesk hört sich die Erklärung des Verfassungsgerichts in Karlsruhe an: Das Leben ist der höchste Wert. Haben diese Deutschen eigentlich ihren Schiller vergessen? Das Leben ist der Güter Höchstes nicht.
Müssen wir den Terrorismus nicht im Wesentlichen als ein religiöses Dilemma verstehen und nicht als ein politisches Drama? Der Aufstand des Sterbewesens gegen die Monomanie des Lebenserfolgsfetischismus ! Das Sterbewesen ist das eigentliche Wesen der Religion. So viel Sterbewesen in einer Religion evident ist, so viel Wahrheit ist in ihr offenbar. Buddha und Sokrates und Christus sind Vorbilder des Sterbewesens. Das Sterbewesen birgt die Geschichtlichkeit unseres Daseins. Dasein läuft nicht bloß ab, wie irgendein kausaler oder biologischer Vorgang abläuft, es ereignet sich. Es geschieht nicht einfach, es ist ein Geschehen, das sich selbst schichtet und im Palimpsest seiner Unlesbarkeit das Leben zur Geschichte macht, die gedeutet werden will. Der Tod ist im Menschen nicht das absurde Verenden, wie er es für das bloß Animalische ist, er ist Geistesgegenwart und Existenz. Gerade nicht das, wovor das Lebewesen flieht, sondern darin es lebt und erlebt. Im Sterbewesen, und nur im Sterbewesen, wird des Lebewesens Wahrheit offenbar: dass Sein kosmisch wird und kippt an seinen Grenzen ins Komische.
18.10.77
Mogadischu: die Geiseln aus den Händen der Terroristen befreit. Baader, Raspe, Ensslin (der harte Kern) begehen im Gefängnis in Stammheim, Stuttgart, auf offensichtlich vereinbarte Weise Selbstmord. Aufatmen in der Bundesrepublik. Kanzler Schmidt als Krisenheld. Das Establishment hat das Fieberthermometer zerschlagen – kann jetzt getrost weiter Fieber haben. Die Niederschlagung und Selbstliquidierung des Baader-Meinhof-Terrors ist ein trauriger Sieg, nicht weil dem Terrorismus Unrecht widerfahren wäre, aber weil es der Sieg eines Establishments ist, welches ignoriert, was es der Wahrheit schuldet: sich nicht nur als wohlstandsfetischistisches Lebewesen, sondern auch als geistiges Sterbewesen zu verstehen.
Zuerst einmal gilt es, mir selbst meines Sterbewesens zuinnerst ganz gewiss zu werden. Kein Tag ohne Einübung in der Entschlossenheit des Geistes. Hierzu unerlässlich: die Ablösung von jeder kindlichen, familiären, neurotischen Lebensabhängigkeit. Diese Ablösung ihrerseits aber wäre unzumutbar ohne Suizidbereitschaft.
20.10.77
Nun auch Schleyer ermordet. Wir haben … die korrupte Existenz Hans-Martin Schleyers liquidiert. Großfahndung eingeleitet. Doch was auch immer die Fahndung bringt, es ist ein Pyrrhussieg. Entscheidend ist die Ursache des Terrorismus: eine Eskalation der Verzweiflung an einer Welt, die ihre Wahrheit verraten hat und am Rande der Absurdität die Orgie ihres materiellen Wohlstands feiert. Worauf es hinauskommen muss, ist eine Weltrevolution des Sterbewesens. Mir ist gestern durchsichtig geworden: Die Baader-Meinhofs sind unfreiwillige Propheten, die Terroristen nach dem Nihilismus Nietzsches und dem apokalyptischen Ritt des Nationalsozialismus die letzten Propheten des Abendlandes. Katastrophen-Symptomatik. Da leuchtet sie auf. Flammenschrift an allen Wänden des Establishments. Finale der Hoffnungslosigkeit. Der Tod aber ist das Himmelsgeschenk der Wahrheit. Ein Mensch, der nicht weiß, was er der Wahrheit schuldig, verdient den Tod, den er flieht. Das menschliche Leben ist Verzweiflung. Wer irgendeiner Illusion von Lebensglück nachläuft, muss eines Tages unfehlbar der Verzweiflung verfallen. Der Philosoph geht von Anfang an von der rettungslosen Verzweiflung aus, während seine Generationsgenossen noch bis über beide Ohren im Lebensglücksfetischismus des Systems stecken.
23.10.77
Die Baader-Meinhofs sind Vorreiter der Apokalypse, ihr Terror die Flammenschrift an der Wand des Jahrhunderts. Das Jahrhundert kennt Asche im Übermaß. Die Baader-Meinhofs haben die Sprache, die verstanden werden sollte, sollten darüber auch die Trommelfelle in zu hohe Resonanzerregung geraten und bersten. Aber Terroristen selber sind keine Zukunft, ihre Aufgabe ist es, das Fanal des Untergangs zu sein, Vorboten einer Zerstörung von noch unvorstellbarer Totalität. Das wahre Übel, das aus Baader-Meinhof hervorgegangen, liegt im Establishment selbst. Der Krebs wütet in der Verdrängung, die sich hinter unserem Wohlstand verbirgt. Gefasst sein auf die Katastrophe, die unweigerlich auf uns zukommt, auf jene Tage, von denen es in der Apokalypse heißt: Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden; werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen.
27.10.77
Wann immer es mir gelingt, die Geistesgegenwart des Todes zu erfahren als das Geborgensein im Geheimnis unseres Existenzgrundes, wann immer es mir gelingt, ganz mir selber vorweg zu sein in dieser vollkommenen Aufgehobenheit: kann ich das Lebewesen in seiner Selbstverständlichkeit bejahen und lieben. Hölderlin muss das gemeint haben, als er den Vers schrieb: Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.
Es ist ein uralter Mythos, dass der Mensch im Augenblick des Todes die Wahrheit sehen und erkennen könne. Die Hirnphysiologie widerlegt dies und bestätigt mit der Erforschung und Befragung, dass die Geistesgegenwart des Todes die Geistesgegenwart des Lebens ist.
Solange wir von unseren Leidenschaften getrieben werden – Machtwille, Neid, Rachsucht, Ehrgeiz, Besitzgier –, ist es das verdrängte schlechte Gewissen des Sterbewesens, vor dem wir fliehen. Zuerst das Sterbewesen, dann das Lebewesen! Das Lebewesen will seine Lebenserfolge, natürlich. Diese sind naturgemäß, natürlich. Das Lebensbedürfnis wird aber krank und blind, wenn es zur Ausflucht vor dem Sterbewesen wird.
Die Dynamik von Lebe- und Sterbewesen ist unvollständig, wenn eine alles transzendierende Größe nicht miterzählt wird: das Geheimnis allen Wesens, dass es lebend ist. Die Unerklärlichkeit des Seins ist absolut. Darin ist sie schön.
Das Geheimnis Gott zu nennen, ist eine Benennung, die dem Geheimnis Gestalt geben möchte. Gott als Person ist dem Philosophen nicht angemessen. Gott als Alles-in-allem ist das Gewissen unserer abgründigen Nichtigkeit. Nennen wir es noch Gott, so als Integral über dem Grundverhältnis Seinsgeheimnis.
Der Sinn von Sein ist eine unsichtbare Geistesgegenwart. Wo der Sinn des Geistes gegenwärtig ist, bringt er noch jedes Stäubchen zum Leuchten, wo nicht, zeigt sich auch eine Kathedrale wie Chartres nur als Steinhaufen.
1.1.1980
Was nicht Philosophie ist, ist Vieh! Alles, was der Mensch mehr ist als Vieh, verdankt er der Philosophie, und jeder Mensch, der dem Erkennen nicht Dank zollt, verdient nicht das Glück auf zwei Beinen. Unsere Existenz ist phantastisch! Wer das nicht wahrhaben will, muss sein Bewusstsein in einen blinden Realismus eingemauert haben.
Wäre der Mensch nur Lebewesen, er hätte kein Wesen.
Was ist, ist nicht dasselbe, was lebt.
Ein Mensch, dem das Leben nicht ein Jauchzen ist, der ist dem Leben ein Ärgernis.
Der göttliche Funke der Geistesgegenwart ist aus keinem Stein zu schlagen noch mit irgendeiner Technik hervorzubringen. Was nie Materie war, kann auch nicht zu ihr verfallen. Die Aufgehobenheit des Daseins ist im Nichts, welches in Wahrheit das All von allem ist.
Der Mensch ist eine Individuation des Alls.
1.1.1982
Der Wal hat ein Problem, welches der Hai nicht kennt: Er muss Atem holen. So hat der Philosoph ein Problem: Er muss Sinn schöpfen. Zwar muss jeder Mensch die Unabweisbarkeit der Existenz bedenken, doch der Philosoph schwimmt in der allgemeinen Interdependenz mit wie der Wal unter den Fischen.
Der Mensch ist ein Antagonismus aus Lebe- und Sterbewesen. Der Säugling ist noch fast nur Lebewesen, der Greis fast nur Sterbewesen. Doch schon ein Fünfjähriger kann erschlossen sein für das Sterbewesen und ein Greis kann noch lebendig sein wie ein Junge.
Das stumpfe Dahinsiechen und an Maschinenschläuchen karge Überleben ist die blinde Verkehrung des Lebens in Leben ohne den Sinn der Geistesgegenwart.
Und das Fatalste: dass die Gesellschaft die Flucht vor dem Geist permanent zementiert.
Die Sterbehilfeorganisationen bleiben auf halbem Wege stehen und entsprechen noch immer zu sehr dem einseitigen Lebensglücksirrtum.
Der Philosoph lebt von Tag zu Tod, die Liebenden von Stunde zu Ewigkeit und das Leben von Herzschlag zu Herzschlag.
ZWEITES KAPITEL
1.1.1984
Nach Überwindung des anfänglichen Widerstandes gegen den ewigen Schlauch des Weihnachtszirkus doch wieder Anwandlungen von Geselligkeits-Euphorie bei mir entdeckt – der Wunsch von Georg, mit mir über die philosophische Dissertation seines Seminarlehrers Singer zu diskutieren –, noch einmal der alte Traum vom sokratischen Lehrer aufgeflackert.
8.1.1984
Georg hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Das finde ich jetzt auch ganz in Ordnung. Es war ein Rückfall in einen alten Traum.
14.1.1984
Es ist jetzt bald einen Monat her, dass Georg den Wunsch geäußert hat, mit mir die Dissertation seines Lehrers zu besprechen, drei Wochen, seit er sie mir zum Lesen gegeben, vierzehn Tage, seit wir diesbezüglich zuletzt telefoniert hatten. Seit einer Woche hat er die Zusage für eine Lehrerstelle im Hinterthurgau. Hätte die Dissertation ein leidenschaftliches philosophisches Interesse bei ihm geweckt, so wäre er mir eher auf die Bude gestiegen, als mir erwünscht gewesen wäre, und ich hätte womöglich alles stehen und liegen lassen, um ihm gerecht werden zu können. Wenn er jetzt überhaupt noch einmal kommt, wird er einen Sunderwarumbe finden, der nicht mehr in die Stricke springt, sondern alles andere eher ernst zu nehmen bereit ist als philosophisches Interesse. Bin ich frustriert? Natürlich hat der philosophische Eros wieder eine kalte Dusche über sich ergehen lassen müssen. Aber die vernünftige Einstellung bleibt davon untangiert. Georg bleibt ein liebenswürdiger junger Mann, dem ich für Beruf und Leben nur alles Beste wünsche.
19.1.1984
Im ORF einer Gesprächssendung zum Thema Homosexualität zugehört. Was mich erstaunt hat, dass selbst vonseiten der Homosexuellen eine völlige Unwissenheit über die komplexe Natur des Problems der Homosexualität vorherrscht. Die Psychoanalyse hat im Gefolge Freuds das wahre Verhältnis von Sympathie und Sexualität auf den Kopf gestellt und damit erst recht pervertiert. In Wahrheit ist es eben so, dass die Sexualität eine Ableitung der Sympathie ist und nicht umgekehrt die Sympathie ein Sublimationsprodukt der Sexualität. Die Homosexualität ist nur noch insoweit als relevant anzusehen, als sie für die Philosophie bedeutsam ist. Was Hinz und Kunz von der Homosexualität denken, das kann uns jetzt ebenso gleichgültig sein, wie was sie daraus machen, wenn sie davon betroffen.
20.1.1984
Ich habe jetzt drei Generationen verwandtschaftlicher Interesselosigkeit kennengelernt, das reicht mir. Wenn sie nicht wissen wollen, was sie der Wahrheit schuldig sind, sollen sie meinetwegen vom Kapitalismus zum Narren gehalten werden oder in den Schafherden ihre Vaterunser mitblöken. Die eigentliche Kathedrale der Wahrheit ist schon immer die Philosophie gewesen. Die Firma Pfaff hat ihren Sitz nur usurpiert.
Vor sieben Jahren hieß es: Der Mensch als Lebe- und Sterbewesen, nun will ich’s umkehren: Der Mensch als Sterbe- und Lebewesen. Bevor der Mensch nicht als Sterbewesen zu sich kommt, ist er auch noch kein Lebewesen, sondern eine animalische Wesenlosigkeit. Das Sein, das uns zu einem Wesen macht, haben wir vom Tode, nicht vom Leben. Und so will ich verdeutlichen, dass der Mensch sich erst als Lebewesen begreifen, verstehen, realisieren kann, wenn er sich als Sterbewesen begreifen und verstehen gelernt hat. Es ist absolut unmöglich, selbst einen beredtesten Papageien oder intelligentesten Schimpansen das Wörtchen ist sinnvoll anwenden zu lassen. Wenn wir uns bewusst werden können, dass der Mensch selbstverständlich ist sagen kann, so haben wir erfasst, warum der Mensch nicht ein Lebe-, sondern ein Seinswesen ist.
22.1.1984
Die Unwillkürlichkeit, mit der meine Phantasie den jungen Georg begehrt, der morgen zum Tee kommt, zeigt mir das urphilosophische Verlangen nach einem Schüler, der zugleich mein Geliebter, und nach einem Geliebten, der zugleich mein Schüler ist.
30.1.1984
Lieber Georg, es gibt eine Gegebenheit vor und über allen Gegebenheiten. Sie ist mir gegenwärtig, sobald ich wach bin, ja schon im Traume kann sie mir gegenwärtig sein. Ich fühle sie, und doch ist es kein Gefühl. Ich empfinde sie, und doch ist sie in keiner Empfindung. Ich weiß um sie, aber sie ist kein Wissen. Ich bin mir ihrer bewusst, und doch ist sie das schlechthin Unbewusste, Unerkennbare, Unbegreifliche.
Ich erfahre sie als meine eigenste Gegebenheit und bin mir zugleich gewiss, dass jeder Mensch sie genauso als die seine erfahren kann. Ich kann nicht anders als denken, dass diese Gegebenheit für jeden Menschen eine besondere ist und dass sie zugleich für jeden identisch ist, dass die jedem als die seine gegebene Gegebenheit für alle Menschen doch ein und dieselbe ist. Will ich diese Gegebenheit zum Ausdruck bringen, sage ich einfach: Ich bin da – Und ich wüsste keinen anderen Ausdruck, der diese Gegebenheit angemessener fassen könnte.
Was für eine Bewandtnis aber hat es mit der einzigartigen Gegebenheit, die ich mit dem Ausdruck Ich bin da zum Ausdruck bringen kann? Es gibt keinen Grund, aus dem jedermann gezwungen wäre, sich zu fragen, was es mit der Gegebenheit für eine Bewandtnis hat. Wer sich nicht eigens dafür interessiert, braucht die Gegebenheit nicht zu befragen, er kann sie auch ungefragt als gegeben hinnehmen und sich den Gegebenheiten zuwenden. Niemand ist verpflichtet, die Gegebenheit, die ich mit dem Ausdruck Ich bin da zum Ausdruck bringe, zu hinterfragen. Ich selber aber versuche mir die Gegebenheit zu vergegenwärtigen, ich möchte alles versammeln, was ich mit dem Ausdruck Ich bin da zum Ausdruck bringen kann. Und ich mache das heute ja nicht zum ersten Mal.
Es ist unmöglich, diese Gegebenheit mit analytischen Begriffen zu zerlegen, wie der Anatom mit dem Seziermesser unseren Körper zerlegt. Und doch kann ich nicht anders an das Ganze herangehen, als es in bestimmter Weise zu befragen. Was also hat es für eine Bewandtnis mit der Gegebenheit, die ich mit dem Ausdruck Ich bin da zum Ausdruck bringe? Der Ausdruck Ich bin da umfasst drei Wörtchen, deren jedes mir eine bestimmte Weise, nach ihm zu fragen, nahelegt. Wer Ich? Wie bin? Wo da? Wer ist dieses Ich, welches mir als Ich gegeben ist, und woher kommt es? Wie kam ich in diese Gegebenheit? Wie konnte ich mir darin ihrer bewusst werden, da ich doch eins bin mit ihr? Wo ist dieses Da, wenn ich mit diesem Da im Gedanken auch überall und nirgends sein kann? Und wenn mir die Gegebenheit als ein Verlauf erkennbar wird, gibt es für diesen Verlauf ein Woher? Und was als Frage noch brennender ist: Gibt es für diesen Verlauf ein Wohin? Ein letztes Ziel, eine uneinholbare Zukunft? Diese Fragen, wenn ich sie nicht nur so dahinfrage, sondern mich ganz von ihnen einnehmen lasse, werfen mich vor eine entsetzliche, unheimliche Grundlosigkeit. Wenn ich mich der ganzen Grundlosigkeit in der Gegebenheit ausgeliefert sein lasse, dann kommt damit auch die Gegebenheit in ihrer ganzen abgründigen und unheimlichen Tatsächlichkeit zum Bewusstsein. Und es macht sich die Gegebenheit noch in einer ganz anderen Weise bemerkbar als nur in der, dass ich in ihr gegeben bin. Sie zwingt mich: in die Lauflinie einer letzten Gewissheit, in ihre Gewissheit, sie zwingt mich, auf den Tod hin sein zu müssen.
Ich bin da
und kann mir nicht erklären warum.
Ist Dasein nicht
ein Märchen schlechthin?
2.2.1984
Es scheint, dass das Unternehmen, Georg mit Sein und Zeit vertraut zu machen, auf gutem Wege ist. Ich habe ihm zuerst die Paragraphen 2 und 4 photokopiert, anhand dieser Vorzeichnungen versuchte ich das Interesse von Georg zu prüfen, und er war so begeistert, dass er ein Gedicht geschrieben und nun den Abschnitt des ontischen Vorrangs des Daseins schon nicht anders als ich wie eine Gebetsmühle auswendig rezitiert.