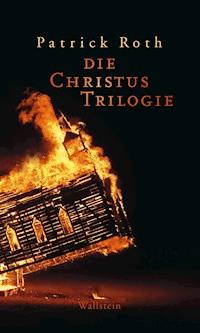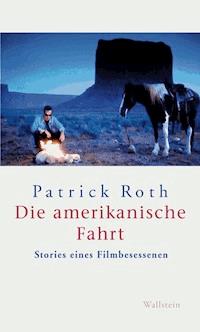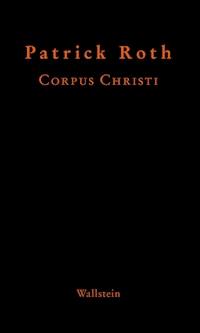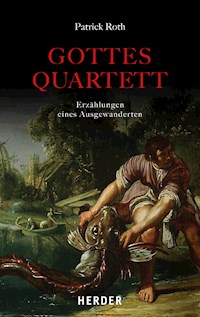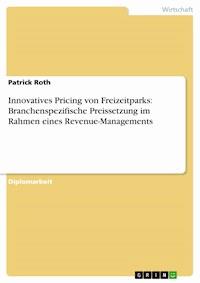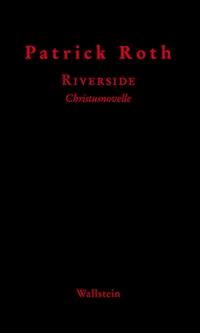Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2012 Patrick Roth erzählt die unerhörte Geschichte des Joseph von Nazaret als die eines Zweifelnden, er erzählt von Josephs tiefem Glauben und seinem Ungehorsam wider Gott. Zugleich spürt "SUNRISE" der Möglichkeit eines Neuanfangs nach. Jerusalem im Jahre 70 nach Christus: Römische Truppen drohen die Schutzmauern zu durchbrechen. Die Belagerung der heiligen Stadt bildet den Ausgangspunkt dieses bildmächtigen Romans, dessen Bogen sich bis in die Zeit vor Jesu Geburt spannt. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht Joseph, der Mann der Maria, von dem die Evangelien berichten, dass er Träumen gehorchte, als er Frau und Kind annahm. Patrick Roth entwirft ihm ein Leben voller Spannungen, ein Drama zwischen Mensch und dem Numinosen. Dreizehn Jahre nach Jesu Geburt fordert Gott ein äußerstes Opfer von Joseph. "Wo ist da Gerechtigkeit, dass ich's verstünde?" klagt er angesichts des ungründlichen Willens Gottes. Wird Joseph dieses Opfer wirklich auf sich nehmen können? In raffiniert ineinander verwobenen Passagen zwischen Traum und Realität dringt der Roman in Erfahrungsräume vor, in denen vermeintliche Gewissheiten brüchig werden. Patrick Roths Erzählkunst geht von existenziellen Erfahrungen aus und zeugt von einer außergewöhnlichen Sprachkraft. Ein ästhetisches Erlebnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Roth
SUNRISE
Das Buch Joseph
Roman
WALLSTEIN VERLAG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2012
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
unter Verwendung des Gemäldes »Flucht nach Ägypten« von Adam Elsheimer
ISBN (print) 978-3-8353-1051-3
ISBN (eBook, pdf) 978-3-8353-2257-8
ISBN (eBook, epub) 978-3-8353-2268-4
Oh, thou big white God aloft there somewhere in yon darkness, have mercy on this small black boy down here; preserve him from all men that have no bowels to feel fear!
Oh, du großer weißer Gott dort droben in den Finsternissen, sei gnädig diesem kleinen schwarzen Jungen hier unten; bewahre ihn vor allen Männern, die’s nicht im Bauch haben, Furcht zu fühlen.
Pip in: Herman Melville, Moby-Dick oder Der Wal
Die Bücher des Abstiegs
Sonnenaufgang des ersten
Tages seit Abschluß der
Schrift. Die Römer sind durch
die Mauer gedrungen. Dem
Hunger Jerusalems wird ein
Ende durch Feuerbrand,
Schärfe des Schwerts.
Vor Stunden noch träumte mir:
Eine Schicht, dünn wie
Haut, hebt der Sohn aus dem
Tiegel flüssigen Erzes. Und
sieht hin: Da ist’s ein Blatt
lebendiges Gold.
Überdauern werden sie also,
die das Versteck hier
empfängt: die Worte des
Buchs, die ich durch Neith
erfahren von Joseph.
Zu mir, Monoimos, der hörte
und aufschrieb, tritt Neith.
Und sie spricht: Wer bis ans
Ende geht dieser Worte, der
wird den Tod nicht kosten.
Erstes Buch. Der Träger
Kapitel 1. Die Belagerung
Im zweiten Jahr der Regierung des Kaisers Vespasian – römische Legionen halten die Stadt umringt – ist der Untergang Jerusalems beschlossen.
Innerhalb der Mauern aber streiten sich die Parteien unserer Verteidiger, ist’s ein Zerfleischen.
Denn während der Feind die Stadt würgt, spornt Hungersnot die Verteidiger zu unsäglicher Grausamkeit.
Gegeneinander nicht nur lassen sie Grausamkeit walten, sondern vor allem wider die Bevölkerung, die sie doch zu schützen gelobten.
Wehrlose suchen sie um jedes Weizenkorn heim und strafen die Hungrigen, auch wenn nichts mehr zu holen ist, als sei Sättigung in den Strafen.
Die einen schlagen sie nieder, wenn man nur das Geringste an Nahrung vor ihnen im Hause versteckt. Andere spießen sie auf, wo man, gelockt durch Geruch oder Gerücht, die Unschuldigen beim Backen von Körnern antrifft.
Aber die Eindringlinge richten auch hin, wenn sie bei ihren Opfern nichts Eßbares finden. Denn sie verfallen darauf, aufzubefehlen die vertrockneten Münder und zu suchen noch unter verklebten Zungen und zu beachten die Winkel rissiger Lippen. Denn dort haftet oft, kaum geschluckt, das verräterisch letzte Morsel.
Vor Tagen nun kam Nachricht von einer Frau, die wußte Hunger und Tod und Erniedrigung in die Flucht zu schlagen. Das aber, indem sie den Plagen die Tür auftat weit.
Maria hieß sie, Tochter des Eleazar, aus Bathezor jenseits des Jordan. Die war wie Tausende andere in die Jerusalem geflüchtet und vielfach von vielen hier ausgeraubt und immer wieder geschlagen.
Die junge Mutter aber entsetzte selbst die Grausamsten ihrer Räuber, gekommen, ihr das Letzte zu nehmen.
Lächelnd bat sie die Eindringlinge in ein Gemach – mit welken Blumen zum Gastmahl geschmückt –, den einzigen Sohn, ihren Säugling, den sie Stunden zuvor geopfert, im Mahle mit ihr zu teilen.
Kapitel 2. Der Auftrag
Von solcher Hölle innerhalb Jerusalems aber wußten wir nichts. Und hätten es doch zu ahnen vermocht, als man uns, jungen Brüdern im Herrn, den Auftrag gab.
Denn noch in Pella, jenseits des Jordan, wohin wir uns geflüchtet hatten, lebten wir mit den Unseren. Da wies uns der Älteste, hinaufzusteigen zur Heiligen Stadt und hineinzufinden in ihre belagerten Mauern.
Ein Traum aber hatte ihn Wochen zuvor ermutigt, Vorbereitungen zu treffen und schließlich den Auftrag zu geben. Nun war’s an der Zeit.
Und er ermahnte uns vier – wie er im Traum, Wochen zuvor, ermahnt hatte vier junge Männer, denen er solchen Auftrag gegeben –, alles zu wagen, an den Belagerern vorbei und in die Jerusalem selbst zu gelangen.
Denn dort sollten wir sichern den einzigen Ort.
Sollten schützen die Stätte.
Sollten mit Leib und Leben bewahren das Grab des Grabzertrümmerers, des Beherrschers des Todes, unseres Herrn, des auferstandenen Christus.
Denn man fürchtete allgemein, daß die Römer, sobald sie eindringen würden, keinen Stein auf dem anderen ließen, dem Erdboden aber gleichmachen würden das Hohe, aufschütten das Niedere. Bis allhin übers Zernichtete Ödnis einkehrte, auch der Wind nicht mehr wüßte zu finden das Grab.
Nachdem wir aber erhalten hatten den Auftrag und uns willig erklärt und dazu bereit, berieten uns andere Brüder. Und sie erklärten uns, wie wir’s anstellen sollten, uns schon kommenden Neumond von einer gewissen Stelle des Kidrontals aus in die belagerte Stadt schleusen zu lassen.
Bereits damals aber lagen die Hänge des Kidrontals voll Hungertoter. Von der Stadtmauer warf man sie ins Tal oder ließ ihre Leichen, umhüllt, an Seilen bis zum Fuße der Mauer herab.
Noch im Aufstieg aber, auf Jerusalem zu, kamen wir einem entgegen, der war geflohen und berichtete uns, römische Truppen seien bereits im Norden durch die letztgebaute der drei Stadtmauern gedrungen. Und die Belagerer seien dabei, zu bedrängen die mittlere Mauer und für sich zu verwüsten den Stadtteil, der liegt zwischen der dritten und der mittleren Mauer.
So sprach er und eilig stieg an uns vorbei, hinab auf Jericho zu. Und ließ uns entmutigt zurück.
Denn da war’s, als seien wir schon ans Ende gelangt, verstellt das Ziel, und der Auftrag, zu sichern die Stätte, nicht auszuführen. Wußten wir doch, daß der Ort, den wir sichern sollten auf Zukunft, zwischen dritter und mittlerer Mauer liegt. Und also bereits verwüstet wäre, unerkennbar vielleicht, sicherlich aber unerreichbar für uns.
Da wollte umkehren einer der vier, so verstört und verzweifelt war der. Und ließ nicht mit sich reden. Blutrot, sagte er, erscheine ihm nun das Rot der Felsen der Steige, die wir stiegen hinauf. Und er sprach zu uns: »Zu lange hat gezögert der Älteste. Hätte uns früher aussenden sollen. Vergebens ist alles, nichtig war unser Vorhaben, eitel sein Traum. Denn zu sichern ist nichts hier.« Und er wollte zurück zu den Unseren, es so dort zu melden.
Die anderen aber sagten, sie hätten in Pella versprochen, alles zu wagen. Und wollten nicht – schon gar nicht auf Nachrichten eines Hergelaufenen hin – zurückkehren, ohne sagen zu können: »Wir haben’s selbst gesehn.« Etwa: »Das Grab liegt zerstört, aber wir kennen den Ort.« Oder gar: »Noch unzerstört liegt es, aufbewahrt.« Denn ob zerstört sei, wonach sie suchten, oder ob unversehrt der Ort, davon habe der Herbeigelaufene ihnen ja nicht gesprochen. Denn der sei von keinem ausgesandt, nach dem Grab zu suchen – eher aber zu versuchen die vier, aufzugeben Hoffnung und Auftrag.
Da stieg der vierte hinab und hatte aufgegeben die Hoffnung. Die anderen drei aber stiegen voran.
Als es uns nun, Tage nach dem Abschied aus Pella, gelungen war, bei Nacht durch den Ring der Römer und ins Tal der Toten selbst zu gelangen, mußten wir zunächst den Schwarzbach queren, den Kidron, eintauchen in ihn, auf dem manches Feuer römischer Wachen sich spiegelte, und ohne das Haupt zu erheben durch ihn hindurch ans andere Ufer kriechen.
Der Bach aber stank, sein Wasser biß in die Haut und drang wie Erbrochenes zwischen die Lippen, zwängte sich zwischen Schlitze geschlossener Augen und führte Fäulnis und Schmutz und Verunreinigung aller Art. Schwarz aber färbten den Bach auch Schlachtungsreste und Opferblut, die, wie wir später erfuhren, durch einen Schacht am Altar auf dem Tempelberg selbst bis hinab in die Tiefe des Tals und den Bach geschwemmt wurden.
Dann, bodennah, stahlen wir uns zwischen den abgeworfenen Leichen hangaufwärts an die Stadtmauer.
Und suchten in einem Bereich, den uns die Brüder genauer bezeichnet hatten, im Dunkeln am Fuße der Quader nach einer Stelle. Sie sollte ertastbar sein, kenntlich, jene Stelle am einzigen Stein. Der Stein aber ruhe, so sagten sie uns, auf Kniehöhe schon: um weniger als eine Handbreit aus der Fläche der Mauer herausgerückt.
Kurz vor Morgengrauen erst glaubten wir, mehr aus Verzweiflung als mit völliger Sicherheit, tastend die bezeichnete Stelle gefunden zu haben.
Und legten uns wie Verendete nieder, nahe beim Stein.
Und lagen drei Tage vor ihm wie tot unter Toten.
Und aus Angst, von Bogenschützen gesehen zu werden, rührten uns nicht bei Tage, sondern lagen unbeweglich zwischen den Kadavern am Kidronhang. Und wagten nicht zu verscheuchen die Aasfresser, wenn sie mit Flügelschlag setzten von jenen herüber auf uns.
Und warteten zwei Nächte lang auf die Nacht.
Und flüsterten miteinander: wessen Hand denn zuerst ertastet habe den Stein? Und ob der sich geirrt haben könnte aus Ermüdung? Und ob er die Worte – aus Verzweiflung vielleicht, vor Anbruch des Tages nicht mehr fündig zu werden, sondern vom Bogenschützen gesichtet – zu rasch an die anderen weitergegeben, flüsternd: »Der Stein ist gefunden, hier ist die Stelle.«
Und flüsterten hin und her, ob die anderen beiden es unserem Finder nachgemacht hätten oder ob sie nicht, nämlich mit eigener Hand, noch bei Nacht, nachgeprüft hätten die Stelle, die jener so glücklich gefunden.
Und ob die anderen ebenso befunden hätten oder ob nicht: nämlich daß dieser Stein, ertastbar auf der Höhe des Knies, um weniger als eine Handbreit aus der Mauer hervorstünde.
Oder ob bei Nacht, vor Erschöpfung, dem Finder zu rasch zugestimmt worden sei, nicht aber nachgesucht mit der Hand, messend auf der Höhe des Knies und messend, nicht was wir unbedingt finden wollten, sondern was wirklich hier war.
Schließlich aber, ob es, hätte die Hand unseres Finders richtig gemessen, nicht noch weitere Steine geben könnte wie diesen, auf gleicher Höhe nämlich, linkshin oder rechtshin, und nicht nur den einen, vor dem wir nun lagen.
Und gegen unsere Zweifel noch, die nicht still wurden, auch als wir untereinander schwiegen, durchwarteten wir die Nacht, daß uns einer herabließe den Toten, wo wir lagen wie tot. Uns dann aber ließe das Seil.
Denn das endlich und einzig wäre uns Zeichen: hinaufzusteigen zu ihm.
Am zweiten Tag aber, da wir reglos lagen, kam ein Sandsturm, der hielt an durch die Nacht.
Und auch am Tage darauf vermochten wir kaum die Steine der Mauer vor uns zu sehen, so dicht zogen Staub und Sand über alles. Und der Sturm ließ nicht nach.
Da, in der dritten Nacht, kam der Tote herab.
Er stieß aber an einen von uns und verharrte quer über ihm.
Und auf dem er zu liegen kam quer, der zwängte sich hervor unterm Toten. Und kniete hin und griff durch den Sturm nach den anderen beiden, die hatten’s gesehen.
Und wir lösten dem Toten die Seile und ließen ihn liegen an unsrer Stelle.
Und kletterten aufwärts am Seil.
Kaum aber hatten wir erklommen die Brüstung der Mauer, da fielen Wächter über uns her.
Und die Bewaffneten töteten Simeon, der uns von der Mauer das Seil hatte herabgelassen, und durchhieben das befestigte Seil.
Simeon aber, so hatten die Brüder in Pella versichert, sollte uns führen hin durch die Stadt bis an den Ort selbst des Grabs.
Denn damals sagten sie uns, der Ort sei versteckt, überbaut längst von anderem. Und nur wenige noch kennten das Ziel, an das Simeon führen werde.
Auch den Alexamenos aber, der als letzter von uns sich auf die Höhe der Mauer gezogen, schlugen die Wächter nieder, obschon wir sie anflehten, uns zu verschonen.
Aus Emmaus war er zu uns gekommen, aufgebrochen mit uns in Pella, zu erfüllen den Auftrag. Ihn aber prügelten sie fast zu Tode, raubten ihn aus und warfen ihn zurück von der Mauer.
Als sie aber aufrissen den Sack, den sie dem Alexamenos geraubt, und entdeckten darin die Nahrung, die er für uns alle bewahrt, fielen sie darüber her und zerstritten sich.
So daß von uns vieren, die auf der Mauer waren zusammengetroffen, nur zwei mit dem Leben davonkamen.
Monoimus und Balthazar nämlich flüchteten sich, sobald die Wächter in Streit um die Beute gerieten.
Wir aber kannten uns nicht aus in der Stadt, durch die Simeon uns hätte führen sollen.
Und zogen bei Nacht, unterm Schutz noch des Sandsturms, durch fremde Gassen und wichen aus in die hintersten Winkel. Das aber aus Furcht, von Bandenpack, das wir streunen und plündern sahen, ergriffen zu werden und den Morgen nicht zu erleben.
Da wurde eine Magd auf uns aufmerksam.
Denn einmal, als sie erwachte bei Nacht, vernahm sie ein Flüstern vor ihrer Tür. Und glaubte, Einbrecher säßen davor.
Als sie aber an den flüsternden Stimmen hörte, daß es Verzweifelte sind, die trauern über den Tod ihrer Leute, den erschlagenen Simeon aus Jerusalem und den hingemordeten Alexamenos aus Emmaus, und erfuhr vom Entsetzen der Fremden über die Zustände in der Stadt, auch daß sie nun nicht mehr wüßten zu finden, wonach man sie ausgesandt, da erhob sie sich und ging hin und weckte leis ihren Bruder.
So öffnete sich uns draußen die Tür. Und zusammen mit ihrem Bruder ließ uns die Magd herein.
Und die beiden wußten nicht zu antworten auf unsere Fragen, wollten uns aber noch in der Nacht, hin durch den Sturm, zu einer Alten führen, die nannten sie Neith. Die wisse uns Antwort.
Und sie nahmen von uns die verunreinigten Kleider. Und wir reinigten uns, so gut es ging. Der Bruder aber brachte uns Kleidung, die gehörte seinem verstorbenen Herrn.
Da verfluchten wir den Schwarzbach, den Kidron, in den wir getaucht waren und der uns beschmutzt hatte mit Fäulnis und Schmutz und Verunreinigung aller Art. Und es war die Magd, die uns sagte, der Bach sei schwarz auch vom Blut des Opfers und von den Schlachtungsresten, die ein Schacht hinabführe vom Tempelaltar selbst bis in den Kidron. Daher sollten wir nicht verfluchen, was uns hatte beschmutzt. Denn das Verunreinigende sei Teil gewesen des Opfers, und ohne die Schlachtungsreste, von denen wir verunreinigt wurden, als wir krochen im Kidron, hätte kein Opfer stattfinden können.
Und wir verwunderten uns, daß die Magd uns so widersprach.
Da fragte sie, ob wir nicht wüßten von den sechzehn Psalmen Davids, die es nicht gäbe, wäre nicht, was uns verunreinigt habe im Kidron. Denn als David bauen ließ den großen Altar, da habe er angewiesen seine Arbeiter, tief zu graben den Abflußschacht, der führte vom Tempelaltar hinab in die Erde. So tief aber gruben den Schacht die Arbeiter Davids, so tief hatten sie senken wollen das Abgeführte, sechzehntausend Ellen tief, daß sie rührten an die verschlossenen Wasser der Tiefe, die wuchsen heraufgereizt und stießen gewaltig nach oben. Und die Wasser drängten aus den Tiefen herauf, zu fluten über die Menschen, die an sie gerührt, und zu vernichten die Erde. Da dichtete David und sang sechzehn Psalmen. Mit jedem gesungenen Psalm aber fielen die Wasser um eintausend Ellen zurück. Bis versiegt waren, in sich zurückgezogen, die Wasser der Tiefe.
So sprach zu uns die Magd.
Und ihr Bruder, als er uns reichte neue Kleidung, die seines Herrn, in die wir uns kleideten, fügte hinzu, ebenso furchtbar aber sei dieser Rückzug gewesen, das Versiegen der Wasser der Tiefe, als sie, unterm Singen eines jeden der Psalmen, immer tiefer versiegten, bis sie schließlich zurückgezogen verschwanden. Denn da ward entdeckt, daß die Erde verlor alle Feuchtigkeit, und nicht mehr genügte der himmlische Regen, fruchtbar zu machen das Feld. Da habe David gedichtet weitere fünfzehn Psalmen und sie gesungen. Und sobald er abschloß die Worte und sang den ersten der Psalme, da schlossen sich auf die Wasser der Tiefe und stiegen an um eintausend Ellen. Und stiegen heraufgerufen, mit jedem gesungenen Psalm, bis sie stillstanden eintausend Ellen unter den Äckern der Erde. Da dankte David dem Herrn, der uns fruchtbar behält die Erde, weil Er dem Abgrund – das sind die Wasser der Tiefe – nicht auszuweichen erlaubt hinabwärts, nicht um ein Jota, und nicht über das Maß heraufzusteigen erlaubt, nicht um ein Jota über das Maß.
Und beide, Bruder und Magd, sagten uns, so aber wäre es nicht gekommen, und keiner der Psalmen wäre je entdeckt und gedichtet noch je von einem gesungen, noch je von einem wiedergelesen, wiedergesprochen im Sang, wenn das Verunreinigende, das man loswerden wollte, nicht wäre. Und darum auch seien die vorsichtig, die es verfluchten. Morgen schon kehre’s als Segen.
Die Worte aber, die wir gehört, beruhigten uns, wir hätten nicht zu sagen gewußt, warum. So daß wir Kraft genug fanden, in der Nacht abermals aufzubrechen mit ihnen zur Hütte der Alten. Und die Magd und ihr Bruder gaben uns Geleit durch die sandsturmverhangene Stadt, wir hätten nicht zu sagen gewußt, wohin. Und sie führten uns zur Hütte der Alten, die nannten sie Neith.
Und wir bückten uns und gingen hinein. Und die Magd hieß uns warten. Ihr Bruder aber setzte sich neben den Eingang der Hütte.
Kapitel 3. Der Mensch
Nach einiger Zeit trat die Alte hinter einem zerschlissenen Tuch hervor, das ihre Hütte teilte.
Und als erstes verbot sie uns, Feuer zu entzünden.
Allerdings, wir Erschöpften durften uns setzen.
Bruder und Schwester aber hielten Wache beim Eingang, halb nach außen, halb nach innen gewandt.
Da erklärten wir nochmals, zu welchem Zweck wir gekommen.
Neith aber sagte, vom Grabe Jesu könne sie uns noch nichts Genaueres sagen. Vom Golgotha jedoch, dem Felsen nahe der mittleren Mauer, wo man früher Verbrecher gekreuzigt, sei heute noch genug zu erkennen. Sollte der Staub des Sturms sich morgen legen, bedürfe es nicht, daß sie führt. Vom Dach des Nachbarhauses aus werde sie auf ihn deuten.
Da wollten wir uns hinlegen und ruhen in einem Winkel der Hütte auf morgen.
Neith aber sprach:
»Den wollt ihr nicht, den ihr sucht und für den ihr glaubt, euer Leben gewagt zu haben. Denn das Seil hätte euch nicht zu mir heraufgezogen, nicht durch die Gassen hinüber zu Neith.
Sondern eure Brüder hätten überlebt, und ihr säßt jetzt bei dem, zu dem Simeon euch führen wollte, am Ziel. Denn bei mir seid ihr nicht am Ziel, auf dem Weg aber. Wie einer, den ich einst kannte, der war auf dem Weg. Seinethalben seid ihr bei mir.«
Da antworteten wir: »Wen meinst du?«
Und Neith sah uns an und sprach: »Ich kenne einen Menschen.«
Da fragten wir abermals: »Wer ist es?«
Neith sprach: »Ich kenne einen Menschen, dessentwegen Himmel und Erde geworden sind.«
Wir sagten nichts mehr, lauschten ihr aber. Denn wir dachten bei uns: Sie meint unseren Herrn.
Und nochmals sagte Neith – denn sie las in unseren Gesichtern, daß wir viele Geheimnisse zu kennen glaubten, auch dieses, denn gemeint sei ihr Herr und unsrer – und sprach zu uns:
»Nicht den. Sondern den, der einst Herr eures Herrn war. Den meine ich. Ich rede vom Vater Jesu, rede von Joseph. Vor siebenundsiebzig Jahren ward derselbe entrückt ins Paradies und hörte unaussprechliche Worte.«
Und Neith sprach, da wir schwiegen: »Wollt ihr sie suchen, zu hören?«
Kapitel 4. Der Nazoräer
Und wir antworteten: »Was wurde ihm gesagt, dem Joseph – und warum ins Paradies entrückt der?«
Da antwortete Neith: »Ihr sprecht, als hätte einer, von dem ihr nichts wißt, dort nichts zu suchen, schon gar nichts zu hören.«
Und Balthazar sprach: »Auch unsere Brüder in Pella, jenseits des Jordan, woher wir gekommen, wissen von Joseph nur, daß er gestorben sein soll, als unser Herr noch jung bei den Seinen, den Nazoräern in Nazaret, lebte. Weiter wüßte ich nichts. Du aber sagst, Himmel und Erde seien geworden – seinethalben?
Neith sprach: »Wie sagt man aber in Nazaret? Liegt Joseph auch dort begraben?«
Da antwortete Balthazar: »Das nehme ich an. Würdig, in Frieden, wie sich’s gehört, wurd er bestattet. Noch zur Seite saß ihm der Sohn am Totenbett, hielt seine Hand bis zum letzten.«
Monoimus aber sprach: »Allerdings, Balthazar, mir sagte einer – es war einer von uns, der Galiläer aus Gat-hefer, der uns im Vorjahr besuchte, und er sagte’s mir insgeheim, unruhig darüber –, daß jener Joseph nicht wirklich Vater, nur Ziehvater gewesen sein soll unseres Herrn. Auch wußte er von Nazoräern, daß Joseph nicht friedlich, sondern gewaltsamen Todes gestorben. Angegriffen wurde Joseph des Nachts, als man außerhalb lagerte und alles schlief. Joseph aber habe nicht vermocht sich zu wehren und war noch im Schlaf von wilden Tieren zerrissen.«
Balthazar antwortete: »Gehört hab ich das auch – und auch von ihm, dem Bruder aus Gat-Hefer, der’s mir ebenfalls insgeheim, mit großer Unruhe, erzählte, als käme nur mir zu, was er zu flüstern hatte. Nun aber, glaub ich’s?«
Da sprach Neith: »Nicht glauben sollt ihr, sondern erfahren. Wenn ihr mich hören wollt.«
Und zum zweiten Mal sprachen wir, ihre Besucher, als hätten wir, so erschöpft, längst vergessen, wovon noch vor kurzem die Rede war:
»Was ist es, von dem du sprichst?«
Kapitel 5. Der Garten
Und Neith gab uns zur Antwort:
»Ich kenne einen Menschen, dessentwegen Himmel und Erde geworden sind. Der hieß Joseph. Er war aber noch nicht Vater des Jesus, eures Herrn. Ausersehen war er, das heißt aber: geschaut im Gedanken Gottes von Anfang. Sieben und siebzig Jahre, bevor euch das Seil zu mir zog, ward derselbe vom Wege entrückt ins Paradies und sah unaussprechliche Worte.
Es geschah noch vor Sonnenuntergang, auf der Wegstunde nach Nazaret.
Joseph kam von der Arbeit aus Sepphoris, der galiläischen Stadt, und schritt auf gewohntem Wege hinabwärts, der Ebene zu, gen Nazaret.
Da streift er auch an der Steinmauer vorbei, die am Rande des Weges ragt. Die umschloß, hoch angelegt, Landhaus und Garten eines römischen Herrn.
Und wie er entlanggeht, kommt ihn seitlich an: Hitze des sonnengewärmten Gesteins, das gehäuft war zur Mauer. Und es schien Joseph, als sei vom Mahle zu riechen, hin durch die Ritzen der Steine, als habe man eben noch Fladen gebacken auf ihnen. Und ihn hungerte, obschon er kaum hungrig gewesen.
Da hört er von hinter ihm kommen über ihn her ein Rauschen, mächtigen Flügelschlag.
Und ward überschattet.
Und hebt auf die Augen und sieht erschrocken den Vogel mit prächtigen Schwingen, der über ihn hin jenseits der Mauer ins Geäst eines Baums fliegt, nicht mehr zu sehen, aber mächtig dort landend, daß bis hinaufhin die Kronblätter zittern des Baums.
Da will Joseph die Mauer erklimmen und setzt den Fuß auf das heiße Gestein.
Leise, vorsichtig steigt er, will nochmals sehen den Vogel, ihn betrachten im Baum. Denn ihm war, als blickten und blinkten im Flug die Federn der Schwingen voll farbiger Augen nach ihm. Und hinaufsteigend, siebenmal sucht er Halt und findet hinauf.
Und Joseph blickt über die Mauer in einen breiten Garten. Wohlbewässert und blühend war der, um den Baum in der Mitte gelegt, dessen äußerste Zweige das Dach noch des Landhauses streiften.
Und zu Joseph betrachtend stieg auf die Ruhe des Gartens. Und sie war wundersam.
Denn sie stieg hinauf zu ihm und legte sich an ihn dort auf die Höhe der Mauer und strich ihm über die Augen, als sei er Kind wieder und habe hier Anfang und als habe mit seinem Anfang hier alles Anfang genommen. Und sie strich ihm über die Augen und menschwärts, friedlich und weich wie Teig, wärmte das Kissen der Steine der Mauer.
Und so begann es mit ihm aus dem Stein. Aus der Hitze des Steins, in der sich eingerollt aufhob der Anfang, begann es mit ihm.
Und er hörte und sah: Bewegung im Laub jenes Baums.
Da erwachten in ihm die gefiederten Augen des prächtigen Vogels, die er zu sehen hinaufgestiegen.
Und er, Joseph, reckte linkshin den Körper gebannt, daß er beim Erscheinen sehe den Vogel und sich ersehe nochmals die Augenpracht. Denn er wünschte sich heimlich und es hungerte Joseph: wiedergesehen zu werden von ihr.
Da aber, sicheren Halt vernachlässigend, rutscht er ab, stürzt von der Mauer.
Und er fällt in den Staub der Straße. Richtet sich auf, noch ist er unverletzt.
Ohne es zu bedenken, klettert er nochmals nach oben. Setzt den Fuß vorsichtiger jetzt, setzt ihn, um ein weniges verschoben, nach links.
Und hinauf, vorsichtig um sicheren Halt, setzt er neunmal den Fuß auf die steinernen Sprossen und kommt nochmals nach oben.
Da liegt der Garten, da stehen Landhaus und Baum. Um ein weniges nur sieht verschoben er sie, Garten und Landhaus und Baum. Und doch, von der neuen Warte aus, scheint ihm alles verändert.
Und Joseph hört aus der Richtung des Baums: Wassergeräusch. Als schöpfe dort eine im Rücken des Baums.
Und jetzt, nicht wie vorhin sieht er den Baum.
Sondern erkennt einen Menschen, einen Ägypter, der, mit dem Rücken zu Joseph, wie reife Frucht daran hängt.
Aber nicht sich klammernd am Ast hängt der, sondern blutig an Schultern, an Rücken und Beinen hängt er, daß seine Fingerspitzen nicht erreichen den Querast, darunter er hängt.
Lederne Riemen umfesseln das Gelenk beider Hände, und wie windgeschoben – aber bei Stille des Winds –, leicht hin und leicht her schwingt der Schwere. Daß der Ast unterm Wiegedruck tönt solcher Last, und die rotbetunkten Halme zu Erden, daß sie hinweichen vor ihm und her, dessen Fußspitzen sie nicht berühren.
Da bricht aus dem Schatten hinterm ägyptischen Sklaven einer hervor.
Erschrocken duckt sich Joseph hinab, sieht aber noch, sieht noch hinüber.
Es ist der Aufseher der Hausknechte. Der kommt mit dem Wasser, das er soeben geschöpft, schüttet’s hinaufwärts heraus, daß es
klatschend antrifft
auf Schultern und Nacken des
Hängenden.
So daß es herabrinnt, eilig
sich mischend in Wundstreif,
schnittief hier rennend, dort
kreuzend zerfetzte Bahn,
durchlösend querhin und
schräghin,
daß es rotsämig wässert die
Halme zu Erden,
erwacht
der Ohnmächtige.
Kaum regen sich wieder die Finger überm Strang der Gelenkriemen, wirft der Aufseher den Kübel, daß er ausrollt beiseit, an der gabligen Wurzel des Baums sich verfängt.
Da einpeitscht der Aufseher von neuem auf den Ägypter.
Und der es sieht, Joseph, sieht weg, will hinabsteigen, spricht bei sich: ›Wem sehe ich zu? Gott sei mein Zeuge: Weiß ich, was hier geschieht? Daran gerührt hab ich nicht. Und also, was ginge’s mich an?‹
Wie gebunden verharrt er, verharren die Hände Josephs am Steinmauerrand, als sein Fuß sich den Halt hinabwärts zu steigen schon sucht.
Da hört er Stimmengeschnatter, Frauengelächter – sieht hin.
Von hinter dem Aufseher, aus dem Eingang der Küche des Hauses kam’s her. Aber niemand zu sehen, denn die Mägde beobachteten sicher im Schatten, und keine wagte’s heraus an den Baum. Rief aber eine dem Aufseher zu:
›Jetzt tu, wie du uns versprochen!‹
Da zieht der Aufseher, dessen Schläge den Sklaven wieder angeschoben hatten, die Peitsche ein. Wischt sich die Stirn, steckt die Riemen in seinen Gurt. Er wendet sich um, geht los, am Haus dort entlang, und verschwindet hinein durch die ferne Tür.
Stille des Gartens.
Nur das leise Tönen des Asts unterm Schwingen der Last.
Und bei sich sprach Joseph:
›Genug. Was dich nichts anging, ist nun vorüber. Genug jetzt. Steig hinab, längst ist es Zeit.‹
Da, beim letzten Blick auf den Baum, im Abstieg begriffen schon, bemerkt er, nur ellenhoch über dem Hängenden: blinkend Bewegung. Sieht eine, die langsam, streifend-gleitend hinabwärts sich zieht.
Wie vom blind sich regenden Finger des Sklaven gelockt, aus dem Dunkel des Kronlaubs herabgerufen, rückt und preßt die Schlange den Stamm auf den Hängenden zu.
Stille des Gartens.
Still auch die Last.
Da überkommt’s Joseph, er will den Mann retten, bevor ihn die Schlange noch beißt.
Und er wagt’s, muß doch, springt hinab in den Garten, trifft auf, hastend rennt hin auf den Hängenden zu.
Und im Rennen noch zieht seine Rechte ihm unterm Handwerkszeug aus der Leinentasche hervor das Beil.
Und der Ägypter: Jetzt blickt sein Auge her auf den atemlos ihm zur Seite Kommenden, durchbohrt Joseph belastend, als sage es:
›Du willst mich schlachten.‹
Und Joseph erschrickt vor ihm, denkt: Für seinen Peiniger hält mich der, den ich losschneiden will.
Und kommt daher nicht hinter, sondern vor ihn zu stehen, ihm unter die Augen. Und sah hinauf zu den Augen, hastig, doch wünschend, die Todesangst wiche aus ihnen, daß der Mann sich beim Zuschlagen nicht sträube.
Josephs Beil aber, das er hinaufreckt, reicht nicht an die Riemen, nicht sie im Schlag zu zertrennen.
Da bemerkt Joseph den hingeworfenen Kübel, den die Gabel der Wurzeln gehalten.
Als er nun zugreift, ihn umkehrt und zurück unter die Augen des Ägypters hinstellt, darauf steigt und jetzt steht, die Fesseln am Ast zu durchhauen: da blickt er hinauf.
Die Schlange zu sehen, wie nah sie gekommen.
Im Aufblick aber wird er gehalten. Erkennt durch den Spalt zwischen Arm und Kopf des Gehängten: den Aufseher.
Der schon rennt auf ihn zu.
Joseph schießt die Angst in die Knie, halb rutscht, halb tritt er vom Kübel, weicht hinterm Ägypter hervor, an ihn stoßend, taumelnd, plötzlich erschöpft, wie angesteckt vom zu Tode Erschöpften.
Der Aufseher aber, ein Messer zum Häuten im Griff, stürzt zu auf Joseph.
Joseph stolpert, er fällt schon – fängt sich knapp vor dem Boden. Entkommt so dem Riß des Messers.
Da fährt Joseph auf mit der Schneide des Beils.
Rechtshin weicht der Aufseher aus.
Die Beilschneide, seitlich verfehlt sie ihn noch – denn rasch wendet der Aufseher den Kopf –, behaucht nur im Fluge die Ader am Hals.
Bricht aber von vorn in die Kehle ein.
Und bleibt stecken in ihr.
Unverrückbar.
Augenblicklang.
Bis der Aufseher sinkt, sich klammernd an Joseph zu halten sucht, das Beil in der Kehle.
Joseph zieht es zurück.
Da fällt der Mann vollends zu Boden. Umhält lautlos, offenen Munds, mit beiden Händen den Hals.
Still stehend, Herz-
Schläge lang
hört Joseph ein Pochen
im Garten.
Wie um Einlaß schlägt es
kehlfarben dumpf
von überall her.
Da, in brennendem Stoß
Bricht’s herein, dringt
hinauf bis ans
Ohr. Anklatscht
der Schrei der Mägde,
an ihn schallt von der Küche her.
Davoneilen hört er sie, fliehen vor ihm, tiefer und tiefer dringen ins Haus.
Erneut packt ihn Furcht, daß er all die Zeit stillgestanden und wie lange schon stand, entsetzt über sein Tun, die Tat, wie betrunken.
Da, ins Windstille, kommt Wind. Leicht erst bauscht er, verschiebt und hebt an den Vorhang zur Küche.
Joseph sieht, so entdeckt: Frauenfüße im Halbschatten stehen.
Höher hebt der Wind da den Vorhang.
Angewurzelt wie er: steht sie. Ist eine Schwangere, eine Ägypterin, hält den Rücken zur Wand gepreßt.
Und pochend stößt der Wind augenblicklang ins Tuch, dahinter sie steht, breitet es fahnengleich vor ihr aus.
Da dreht Joseph sich um, zum Sklaven hinüber, und erkennt, auf den Hängenden zu, daß jeder Schritt schon zu spät kommt.
Die Schlange hat dem Sklaven am Auge vorbei ins Genick gebissen, kriecht stammaufwärts ins Dunkel zurück.
Aber Joseph sieht Leben noch, noch Leben in ihm, der da hängt.
Und mit verdoppelten Kräften – jetzt steigt er, jetzt steht er vorm Hängenden – schlägt ihm die Fesseln los.
Und als sein Beil die linke Fessel aufplatzen läßt, Joseph ihn abnehmen will vom Baum, beidarmig den Sklaven umfaßt, kommt über ihn Schatten.
Und mächtig – er hört’s, sieht hinauf – facht ihn an: Schwingenschlag Vogels, der über ihm schwebt.
Und blicklang, bevor sie sich hebt, sieht Joseph die Augenpracht.
Da senkt, gesehen, Joseph den Blick. Fühlt das Treiben schwingengetriebener Luft, als sprächen unaussprechliche Worte.
Hört Aufflug, Davonfliegen schon.
Und zu ihm heraus eilt eine, die ihn zu sich reißt, Joseph in die Hocke beugt. Daß er schultere den Herabgenommenen.
Es sind die nackten Füße der Schwangeren, die Joseph erkennt. Ihre Fersen, umquillt, dringen ein in den Schmutz roter Halme zu Erden.
Denn keuchend müht sich die Magd, stemmt keuchend rückwärts sich, um von Josephs Stirn her – an die ihr Bauch zweimal stößt – rückwärts sich mühend mit entschlossenen Händen die Arme des Sklaven über Josephs Schultern zu ziehen.
Dann schlägt sie ein Seil um beide, knotet’s auf Josephs Brust, führt seine Hände stützend unter die blutigen Schenkel der Last, preßt sie hin noch, als sage sie: ›Auf, trag es!‹, und schlägt stumm dem Gebeugten mit der Hand an die Hüfte: ›Steh auf nun!‹
Zur Mauer floh Joseph, trug den Sklaven, wie man ein Kind auf dem Rücken trägt.
Kurz vor den Büschen sieht er den kriechenden Körper des Aufsehers, der sich vom Baum weg ins hohe Gras zieht.
Überschreitet ihn und sieht nicht zurück.
Kapitel 6. Die Flucht
Später, kaum setzt Joseph Fuß auf die Straße, weiß er nicht mehr, wie er dem Garten entkam.
War er zurück auf die Mauer geklettert, den Sklaven nachzuziehen am Seil? Oder gar durch ein Tor, eine versteckte Tür getreten?
War ihm die ägyptische Magd vorausgegangen, hatte Richtung gewiesen?
Er weiß nur, hier ist nicht Weitergehen, auch wenn es schon dunkelt: Ich muß vom Weg ab, um andere, die mich sehen könnten, zu meiden.
Einmal rastet er, ohne abzubinden die Last. Da fühlt seine Hand am Felsen die Nässe des Bluts, das der Sklave verliert: Spur den Verfolgern, die nachts Fackeln trügen, Spur jedem, der nachkäme bei Tag.
Da legt Joseph ihn ab am Felsen und bindet los sich die Last, erschöpft, zornig mit sich und verzweifelt. Er verflucht sein Eingreifen, das nicht die Folgen bedachte. Erwägt, ob er den Ägypter nicht hier, wo er ihn abgesetzt und in den Felsen gelehnt hatte, sich selbst überlassen sollte. Und geht erschöpft ein paar Schritte abseits. Was hab ich mit ihm zu schaffen?
Durch die Dunkelheit her hört er ihn frieren, den Ägypter, den er abgesetzt hatte, dort, in den Felsen gelehnt.
Da geht er hin, abstreifend den Mantel, beugt den Sklaven zu sich, legt ihm um das Gewand.
Der Stoff aber nimmt auf das Blut, bemerkt Joseph, so daß es sich im Gewebe verfängt, die Spur sich verringert, erlöschen könnte.
Da wendet sich Joseph, tritt rückwärts heran an den Sklaven und nimmt nochmals den am Leib Zitternden auf, wirft und bindet das Seil auch, nur fester noch als zuvor, als wolle er ausglätten das Zittern, das sich beruhigen sollte, festgezogen am Rücken des Joseph. Und schritt weiter abseits, auf Umwegen, Nazaret zu.
Und wieder, einen Hügel empor, erschöpft Joseph sich so, daß er halten muß, sich zu stützen.
Diesmal, vornübergebeugt, ohne aufzutrennen das Seil, denkt er ängstlich ans Ziel, das er spät zu erreichen sucht: Ich gefährde meine Liebste, setze Sippe und Dorf in höchste Gefahr, wenn sie doch Spur finden oder mich hinführen vor Zeugen, die alles gesehen. Kreuzigen werden sie, nach ihrem Gesetz, den flüchtigen Sklaven. Werden kreuzigen, wer ihm zur Flucht verhalf. Und fordern den Tod eines Nächsten für den, den ich totschlug, um mit dem Sklaven zu fliehen.
Joseph nämlich glaubte den Aufseher an der Wunde verblutet.
Bin ich nicht schon gekreuzigt an diese Last, die man mir aufgebunden, denkt Joseph und will, als er den Weg dennoch fortsetzt, nach einigen Schritten wieder halten, den Ägypter liegenzulassen.
Denn er fühlte auch, daß sich am Rücken beruhigt hatte, den er da trug. Fühlte es so beim Anhalten noch.
Weil aber der Sklave ruhiger zu atmen schien, vielleicht schlief, kamen andere Gedanken hinzu, die retteten ihn, diesen Ägypter.
Denn Joseph war stehengeblieben, die Last endgültig abzulegen und zu verlassen, als der ruhigere Atem jenes, vielleicht sein Schlaf, Joseph an andere Zeit erinnerte und ans andere Rückentragen.
Da ging er weiter und tat’s in Erinnerung tragend.
Kapitel 7. Die Schlafende
Denn nicht lange vor dieser Zeit war Joseph in der Gegend um Nazaret mit einer Tracht unterwegs, Holz, das er gesammelt. Da sah er fern, beim morschen Baum am Fuße der Hügel, einen blauen Flecken im welken Gras.
Als sei dort Wasser, über das der Wind hinzog, hell es hie und da kräuselnd.
Und rätselhaft war ihm, wie er die Wasserstelle nie zuvor bemerkt. Da ging er hin, zu trinken und nachzusehen, warum das übrige Land das Wasser nicht annahm, nicht erblühte im Umkreis.
Als er aber herantritt, erkennt Joseph das Wasser, daß es leichtgewobenes Tuch ist, blau gefärbt und frisch zum Trocknen gebreitet, so daß, hie und da kräuselnd, Strähnen Winds hinstrichen auch über die zierend ins Blau eingewebten bleichweißen Sterne, wie über lebendiges Wasser.
An der Ecke aber des Tuchs, Joseph gegenüber, lag seltsam, im Schlafe verquer, eine junge Frau hingeworfen, ihr rechtes Bein von der Erde verschluckt.
Aber nicht im Schlafe, sondern – sah Joseph – ohnmächtig lag sie, eingebrochen in eine alte Zisterne mit ihrem Bein.
Er wollte sie wecken und kniete hin über sie und berührte sie an den Schultern. Halb wach geworden aber wußte sie nicht, wo sie ist, nicht, wer sie ist, erkannte auch nicht den Nazoräer aus dem eigenen Dorf.
Da ruft Joseph sie: »Maria!«
Und sie kam vollends zu sich und erkannte den auch, der ihr aufstehen half, den Nazoräer aus ihrem Dorf.
Beim ersten Schritt aber schon schrie sie vor Schmerz, konnte auf dem Bein, mit dem sie eingebrochen, nicht weiter, sondern hielt sich an Joseph, humpelnd, den Fuß angezogen nach hinten, den Boden nicht zu berühren.
Da legte Joseph das Bündel, das er auf dem Rücken trug, zu Boden und bot an, Maria statt dessen zu tragen.
Und sie nahm es an, bat ihn, ihr Tuch zu ziehen vom Boden, es über den Rücken zu breiten des Mannes, daß sie es nicht verlöre, und stieg auf das Tuch.
Da war es die Rückengetragene, an die Joseph Erinnerung trug, als er zu retten trug jenen Sklaven.
Und Zeitlang war ebenso dieser Schwere nicht schwer, sondern leicht wie ein Mädchen und nah wie die junge Frau selbst, nah wie ihr Atem gewesen an seiner Schulter. Unruhig nah war der einst, Joseph erinnerte sich, unruhig nah überm Träger, dann aber verruhend, leiser und seltner beim Tragen, wie im Schlaf vor Erschöpfung.
Als er sie aber zum zweiten Mal weckte, zum zweiten Mal sie mit Namen rief, war es kurz vor dem Dorf. Da hatte noch niemand in Nazaret, auch nicht ihre Eltern und Brüder, gesehen, die schlief auf dem Rücken des Trägers. Und als sie wach wurde, dankbar, daß er sie nochmals zu sich gerufen, wußte er, wußte er’s schon. Was wußte er? Denn er hielt. Aber nicht um zu fragen, wohin er nun gehen solle und wo das Haus ihrer Eltern stehe. Denn das wußte er längst, als er hielt. Nein, er hielt an im Moment, da er wußte: Anhalten will ich um sie, die mir traut und die ich gerne getragen. Denn da wußte er, daß er, würde ihr Name gerufen zum dritten Mal, sich ihr verbinden und in Verlobung der Mann Marias sein wollte.
Und so geschah’s, in den Tagen darauf, nach jüdischem Gesetz.
Kapitel 8. Die Halme
So daß Joseph, in Erinnerung tragend, hin durch die Nacht auch ihn leichter trug, jenen Sklaven. Und wann immer die Kraft auf dem Weg ihm versagte, Joseph nicht wußte, wohin er im Dunkeln ging, auch nicht, wo er den Sklaven sollte verstecken und wie sich einstellen auf die Gefahr, daß Verfolger ihm nachkämen, mit Zeugen, die ihn im Garten gesehen, mit Hunden, die weither Blut an ihm röchen vom Blut der Fährte im Garten; wann immer so Furcht und Gedankenbedrängnis den Atem ihm schnitten, verband es Erinnerung: Immer dann kam sie und führte ihn und setzte heilend in ihn ihr Bild.
Daß sich lösten Furcht und Gedankenbedrängnis und hertrat das Bild vom Tag, nachdem er Maria getragen.
Am Tage darauf nämlich ging er nochmals zurück, ging, die Tracht Holz aufzunehmen, die er abgelegt hatte an jenem Ort.
Und hinkommend, geht er schon anders zu auf die Stelle. Denn er sah nicht mehr das welke Gras, sah nur, darin geprägt, Abdruck der Kostbaren. Auch das Viereck, darauf sie ihr gewobenes Wasser gebreitet, war ihm noch deutbar. Und wie kostbar zertreten die Stelle, auf der sie bewußtlos gelegen, erwacht war, geweckt. Die beugte er sich hinab zu berühren. Und zuletzt zu berühren, vorbei am Zisternenmund, auch die Spur der Halme am Boden, wo sie verletzt das Tuch über ihn breitete, er sie auf sich genommen.
Da war’s ihm, als ginge er bereits einzig für sie durch die Welt, als sei er ihrethalben zurückgekehrt an den Ort, das Liegengelassene aufzuheben, es neu in ihr zu errichten. Seitdem war er nicht mehr derselbe.
Kapitel 9. Die Zisterne
Unter solchen Gedanken gelangte Joseph nun nachts, den Sklaven immer auf seinem Rücken, an eben die Stelle, an die ihn auch die Erinnerung geführt.
Und er erkannte den Ort und fand die alte Zisterne, die er, das morsche Holz mit neuem vertauschend, sichernd bedeckt hatte damals.
Und Joseph stieg hinab und nahm Zweige und dürres Gras und richtete auf dem vertrockneten Grund der Zisterne ein Lager und legte den Schwerverwundeten darauf, der im Fieber halb wachte, halb schlief. So daß Joseph nicht mit ihm reden konnte und nicht wußte, ob der verstand, was Joseph ihm sagte, oder es, wie man spricht: mit in den Traum nahm.
In den Traum, wo das Wort – wie wir ja wissen, wie ihr alle nachtnächtlich erfahrt – Welten anstößt, Himmel, Berge, Flüsse, Lichter ausrollen läßt und aus den Finsternissen Menschen herausruft, wie Erstes Wort einst Ersten Tag.
Da sprach Joseph zum Sklaven, von dem er nicht wußte, ob er die Worte doch hörte:
»Liege hier ruhig. Steige nicht nach oben zurück, denn dein römischer Herr wird suchen lassen nach dir. Diesen Ort aber wird man nicht finden. Außer mir und meiner Verlobten kennt keiner mehr ihn.
Fürchte dich nicht. Denn zu essen und trinken will ich dir bringen, sehen lassen nach deinen Wunden bei Tag.
Nur wisse, ich werde’s nicht sein, der dir kommt. Meiner Frau aber will ich dich aus der Not anvertrauen. Ich selbst muß wohl fliehen, daß nicht Schlimmeres auf andere kommt.
Das Wort aber soll dich schützen und mich, dich wieder erstarken lassen und mich. So wollen wir beide überdauern.«
Da legte Joseph beiseits, dem Ägypter zu Häupten, das Seil, das ihn an ihn gebunden, stieg zurück und deckte die Stelle, daß sie niemand bemerke.
Kapitel 10. Die Hütte der Witwe
Als alles schlief, schlich Joseph hinab ins Dorf.
In seinem Haus entzündet er kein Licht, sondern im Dunkel zieht aus das Oberkleid, das er bisher getragen, dessen Rücken war schwer und verklebt von Blut.
Und wäscht leise die Haut sich des Rückens, reinigt die Hände mit Wasser aus dem Krug dort am Herd.
Und zieht an ein Gewand, das hatte Maria gewoben, geschenkt dem Verlobten, nur Tage war’s her.
Und das alte, das er getragen, als er sie bei der Zisterne geweckt, das rollt er in Lumpen, steckt’s ein.
Rüstet ängstlich zur Flucht. Spuren verlöschend verläßt wie ein Dieb er das eigene Haus.
Und wartend, bis das Bellen der Hunde verstummt, stiehlt er sich ein ins Haus der Maria.
Und setzt leis und setzt langsam die Schritte vorbei an den Schlafenden, ihren Eltern und Brüdern. Und Vorsicht, keinen zu wecken, zwingt Joseph – hin auf Maria zu, die dort schlief –, nach jedem gesetzten Schritt zu verharren im Schritt, den Fuß noch hinterm Kopfe des einen, im Überschritt aber bereits am Rücken stehend des andern.
Verweilend so zwischen den Schritten und den nah beieinander Schlafenden, die eng beschliefen den Raum. Und da er gezwungen verweilt, auf Maria zu, den nächsten Schritt hin über den nächsten zu tun, bedacht, ihn wohin zu setzen, dringt Wehmut in ihn.
Denn er sieht doch, an wem er vorbeigeht, sieht, die ihn mochten und die ihm verbunden Familie schon waren. Die er verläßt, sieht er da. Und wer weiß, auf wie lang?
Und hält wieder im Schritt.
Und sieht über zweie von ihnen, Brüder der Frau, fallen den eigenen Schatten. Neidvoll blickt er hinab auf die friedlich Schlafenden. Denn sie wohnt unter ihnen.
Und im letzten Schritt, Schritt hin über den letzten, stieß sein Kopf an einen Rosinensack und an einen Sack Linsen, die hingen von der Decke.
Und aus beiden Säcken fiel’s leise herab, und er fing es auf mit Händen und duckte sich durch unter ihnen.
Da war er angekommen bei ihr, denn bis an sie reichte sein Schritt.
Sacht legt er, was herabgefallen, ins Tuch ihr, und legt sacht ihr die Hand auf den Mund.
Weckt sie flüsternd: ›Maria.‹
Dann zog er sie mit, zog sie hinaus.
Da war, unweit Marias Haus, am Weg eine Hütte, Wohnstatt einer Witwe, die war vor Tagen verstorben. Dort hinein zog er sie, von niemand gesehen zu werden.
Und sprachen einander flüsternd nur dort. Und Joseph vertraute ihr an, was geschehen, und warnte sie vor den Verfolgern, die nach ihm und dem Flüchtigen suchen würden.
Und trug ihr auf, daß sie nach seiner Flucht den Versteckten versorge mit täglichem Brot und Wasser. Und mit Öl und Wein seine Wunden.
›Niemand darf’s sehen und achte, daß keiner dir nachkommt.‹
Und als er ihr, die über das Geschehene erschrak und um ihn in Angst geraten war, das Versteck bezeichnete, jene Zisterne, die ihm die Erinnerung an Maria noch in der Nacht gewählt und gewiesen – denn Joseph sprach: ›War ich ratlos nicht hingeführt worden von dir, von deinem Bild nämlich, zum gemeinsamen Anfang zurück?‹ –, da sah Maria sich bei der Zisterne mit Joseph und erinnerte, zurückgeführt ebenso. Der Ort aber war ihr heilig, wo er sie weckte, und zu behüten das Schicksal, das dort aufbewahrt lag.
Und sie wurde gefaßter, als sie sah, daß ihr Bild ihn geführt hatte, und nahm es als ihren Teil am Geschehenen.
Da sprach Joseph ihr zuflüsternd: ›Zurückkehren werd ich zu dir und weiß, daß die Gefahr vorüber ist, sobald Gott mir Sein Zeichen gibt.‹
Sie wußte aber, daß dem Joseph Zeichen waren die Träume, die ihm nachts träumten und von denen er ihr manchmal erzählte. Maria aber verstand sich nicht auf Träume und sprach deshalb:
›Womit du mich betraut hast im Heimlichen, das will ich tun. Falls nun aber der Traum und sein Zeichen dir ausbleiben und du ausbleibst zu lang, will ich dir mein Zeichen senden, wenn ich nämlich keine Gefahr mehr sehe und du mir zurückkommen sollst.‹
Und sie zeigte ihm einen Streifenrest jenes Tuchs, des blaugefärbten, der übrig geblieben war und noch ungefärbt.
›Den‹, sprach sie, ›send ich dir nach, wenn du nichts mehr zu fürchten hast. Färb ich ihn aber, halte dich Nazaret fern.‹
Und weil sie wissen wollte, wohin sie ihm Nachricht zu senden hätte, vertraut er’s ihr an.
Auf die andere Seite des Jordan werde er fliehen, durch die Schlucht des Baches Kerit hinauf zum Dorf seiner Mutter.
Würde aber in den nächsten Tagen nach ihm gesucht und gefragt, solle sie sagen, Joseph sei noch nicht aus Sepphoris zurückgekehrt und mit Arbeiten dort sicherlich aufgehalten.
Und während sie flüsterten miteinander – und stets bei sich dachten: Es ist das letztes Mal auf wie lang, daß ich sie höre, die liebe Stimme –, da band das Geheimnis, das er ins Ohr ihr geflüstert, beide enger zusammen.
Und sie wehrte’s nicht, sagte keineswegs: ›Wie hast du mir aber getan und welches Unglück über uns gebracht?‹ Oder: ›Der du galtst als Gerechter und Frommer, welcher böse Geist hat dich jetzt ergriffen, solchen Wahnsinn zu tun?‹ Oder: ›Sprachst du nicht den Tod über uns, als du schuldig befreitest den Schuldigen – denn warum wurde der bestraft? –, und reißt du nun nicht den Abgrund mir auf mit der Flucht?‹
Nicht so sprach sie, die sein Flüstern hörte. Sondern bereit, das Geheimnis von ihm zu empfangen als ihres, das beide sich teilten von ihm. Und sie hütete, was er gesprochen, ihr aufgetragen, der Liebste, es vor keinem je zu verraten.
Da, in Schmerz und Vertrauen, umarmten sich beide zum Abschied.
Maria aber sandte ihn fort, denn sie war in Angst, sie würden zusammen gesehen.
Und als er gegangen, verblieb sie noch in der Hütte der Witwe. Da sie aber das Bellen der Hunde hörte der Nachbarn, sprang sie auf in den Eingang, nachzusehen dem Mann.
Und erkannte Joseph nicht mehr im Dunkeln.
Kapitel 11. Maria und der Ältere
Joseph verließ Nazaret gen Osten, zum Jordan zu gelangen.
Nach kurzer Zeit Wegs aber, argwöhnte er wegen der Richtung, die er genommen. Und er dachte bei sich: Es könnte mich, als ich hinausschlich, doch einer gesehen haben. Denn Joseph erinnerte das Bellen der Hunde, daß es verlief, als sei einer aufgestanden, der nachsah.
Und immer noch ging Joseph in gleicher Richtung. Und dachte: Könnte nicht, späterhin, Maria gezwungen werden, andern zu sagen, wohin ich Flucht nahm? Denn man könnte sie zwingen, zumal wenn uns einer beim Abschied gesehen.
Da hielt er an und überdachte’s und kämpfte gegen Verzweiflung, die immer wieder erschöpfend einstach auf ihn.
Und als er’s entschieden, mied er die Richtung gen Jordan, ging linker Hand vom Weg und suchte nordwärts weiter den Pfad, so weit als möglich zu kommen im Schutze der Nacht.
Da fiel – noch war es Nacht – Verzweiflung über ihn her, weil er Maria die tägliche Sorge um den Flüchtling geboten, damit aber täglich Entdeckungsgefahr und grausam drohende Strafe verhängt hatte über die Frau.
Und es stachen ein auf ihn Bilder, wie sie hinginge des Tags zum Versteck, scheinbar unbemerkt, aber verfolgt.
Und verfolgt, weil sie in der Aufregung einen Älteren aus dem Dorfe, an dem sie vorüberging, nicht grüßte.
Und nicht grüßte, weil sie, den Krug in der Hand, das Brot aber am Körper verborgen, in Sorge an ihm vorüberging ohne Gruß.
Der Ältere aber dächte: Was treibt die? Was las ich in ihrem Gesicht? Und warum nimmt sie hinauf ihren Weg, die doch sonst unten zu tun hat?
Und im Abstand ginge ihr der Ältere nach und sähe sie, im Abstand noch, stehenbleiben auf einem Stück Land, das niemand mehr nutzt.
Sähe sie hinknien beim morschen Baum am Fuße der Hügel, nicht ausbreiten aber das Tuch dort im welken Gras, daß es widerglänzte, als sei dort Wasser, darüber der Wind zieht, hell es hie und da kräuselnd – denn nicht trüge Maria bei sich das Tuch –, sondern der Ältere sähe sie hinknien beim morschen Baum am Fuße der Hügel und dann in den Boden eingehen.
Hinabhin verschwinden. Als werde die Frau von der Erde verschluckt.
Und dann?
Wie sähe der Ältere da nicht nach, was Maria dort treibt?
Und wie wäre sie dann nicht ausgeliefert?
Zwiefach sogleich: Ausgeliefert dem Älteren und ausgeliefert Josephs Verfolgern, die in den Dörfern nachfragen würden. Denn der Ältere würde sie ihnen ausliefern samt dem Ägypter.
Und doch könnte, noch in dieser Nacht, Joseph all das verhindern. Ihnen entgegenrennen, gestehen – und damit ablenken von ihr, von Maria. Denn wie hätte sie solche Verfolgung, solche Bedrängnis durch Angst und drohende Folter verdient?
Sondern war sie nicht eingesprungen, weiterzuführen, was er begonnen hatte? Und eingesprungen bedenkenlos? Wie der Sprung von der Mauer, die er bedenkenlos übersprang, als er den Sklaven vor dem Schlangenbiß retten wollte. So war Maria bei ihm gewesen, und ohne Rückhalt ihre Hilfe in seiner Not.
›Und diese Frau‹, sprach Joseph zu sich, ›die mir verlobt ist, hab ich allein gelassen und ungeschützt. Und ist jetzt ohne einen, der ganz für sie stünde.‹
Umstanden war Joseph von solchen Gedanken. Und er hielt noch vor Morgengrauen bei einem felsigen Winkel, kroch außer Sicht.
Und Joseph fror vor Erschöpfung.
Da packte er aus, was er mitgebracht, nahm das Bündel, das blutverklebte Gewand, und lockerte es. Und stellte’s hinein in ein Feuer, das er entfachte. Damit nicht, ergriffen ihn welche, sie Beweis bei ihm fänden der Entführung des Sklaven.
Und verbrannte vor seinen Augen das brennend gefärbte Gewand. Und wie ihm schien, alle Tage, die er’s zuvor getragen, verbrannten mit jenem zu Asche.
Nur blieb – inmitten des Feuers, in das Joseph blickte – der Abend im Garten unverzehrt von den Flammen.
Heller als Flammen brannten Sklave und Baum. Und wurden nicht verzehrt von den Flammen.
Heller als Flammen brannten Schlange und Augenpracht. Und wurden nicht verzehrt von den Flammen.
Und ein Stich aus den Flammen war der Sprung auf den Hängenden zu.
Der verzehrte ihn.
Und Joseph fühlte, verzehrend wie Flammen, die Last auf dem Rücken, da Joseph sie annahm.
Und ein Wind kam auf, daß Joseph die Not tiefer spürte der Flucht und sich hingab unter den Wind, erschöpft und näher ans erkaltende Feuer rückend.
Da schlief Joseph, eingekrümmt, die Knie angezogen wie Ungeborenes, und sein Traum stieg herab, und ihm träumte.
Kapitel 12. Die Ragebilder
Treibender Regen fällt nieder auf ihn am Ort, wo er eingeschlafen, im Traum aber gerade erwacht.
So erwacht Joseph im treibenden Regen des Traums.
Da sieht er, durch eine Hürde von ihm getrennt, zwei Löwen stehen.
Der Aufseher aber des Gartens des römischen Landhauses tritt aus dem Dickicht des Regens, peitscht deren triefende Mähnen, daß sie aufjagen wütend, losgetrieben über die Hürde, Löwen auf Joseph zu.
Und Joseph reißt aus der Asche
glühenden Scheit, daß es
aufflammt,
hält schützend vor sich
die Flamme.
Und weicht rückwärts
hinein in den
Riß
zwischen
Felsen.
Und da, am fleckigen Seil – er erkennt es, das er zu Häupten des Ägypters belassen –, seilt er sich durch den Riß hin abwärts hinab.
Nur der Hall Tiergebrüll dringt ihm nach und, armlang von Joseph entfernt, der Guß Regen.
Durch den Riß gesammelt fließen die Wasser, im Herabschuß aufzweigend aber, sich drehend und wirbelnd in Strängen, strähnig aufsprühend in taumelndem Fall, stärker und schwächer, herabwärts am Seil her, hinabwärts an Joseph vorbei, vorauseilend ihm nach unten ins Dunkel.
Da, auf gewölbt-steinernem Vorsprung landet Joseph am Seil.
Und im schwachen Licht seiner Flamme beschaut er den Teil des Gewölbten, auf dem er zu stehen gekommen.
Und sich haltend am Seil, sieht er: feinstbehauen den Stein des Gewölbes, auf dessen Vorsprung er steht.
Und glaubt zu erkennen, daß der Teil des Gewölbten Teil ist eines mächtig steinernen Lids.
Oder – da Joseph die Grenzen der Wölbung des Lids nicht ermißt und das Auge unterm steinernen Lid nur erahnt – Teil ist einer noch mächtigeren Stirn.
Die Stirn aber Teil eines Antlitzes.
Das Antlitz aber Teil eines riesigen Bildes – aufrecht stehenden Ragebilds, wie er es bei Ismaeliten gesehen.
Das Ragebild aber selbst nur ein Teil – fühlt Joseph und ahnt es durchs Dunkel hinabhin –, Teil eines steineren Kettenstamms Ragebilder, die sich strecken hinabwärts,
Kopf
auf
Fuß
auf
Kopf
auf
Fuß
auf
Kopf
auf
Fuß gestürzt ragend.
So daß Joseph bewußt wird:
Es ist ein Tempel, in den ich am Seil mich gestürzt, ein dunkel vergessener Tempel.
So riesiger Ausmaße aber der Tempel, so grenzenlos unermeßlich, daß es Joseph, wo er stand, das Leben selbst zu sein schien, das unter ihm sich erstreckte.
Die Einsamkeit aber so grenzenlos, sich dehnend hinabhin ins Dunkel hinaus, daß er aufschrie im Aufschrei zur Frau.
Denn über sich, es ist wahr, sah er welche, zwei oder drei, darunter auch eine Frau, nicht mehr weit, die seilten ebenfalls sich herab.
Aber die Frau – denn einsam versuchte er, rufend nach ihr, die da kam, zu erkennen –, war nicht Maria.
Und doch wußte er, hinab, hier hinab, schaff ich es ohne sie nicht.
Also, wer ist sie? Und kommt sie zu mir?
Da sieht er sich gleiten hinab am Seil, sieht die Gesichter der Ragebilder, an denen das Seil ihn hinabführt.
Und erkennt sie, die Ragebilder, jedes für sich,
eins
hinab
nach
dem andern.
Denn Wissen von ihnen, den Ahnen des Joseph, fährt in ihn mit jedem Anblick vorübergleitenden, aufwärts hinaufragenden Ahnenbilds.
Und jeder Blick ruft im Anblick hervor diesen Ahn, ruft dessen Blick, der sich einblickt in ihn, den Joseph, in dem auch der Ahn sich erkennt, erkennt, was er war und wen er aufgebaut hatte aus sich: diesen, ihn, Joseph.
Und hinabfuhr Joseph an
Jakob,
an Jakob hinabhin, dem Vater, Zerscheller-Schneider
des Steins
Hinabhin an Matthan, beschenkt mit der Last
Hinab an Eleazar, denn Gott war ihm Helfer
Hinab an Eliud, auf den traf Gottes Glänzen
An Achim hinab, leid- und klagegetränkt
An Zadok hinab, dem Gerechten
An Asor hinab, dem Hilfreichen, Helfer sich selbst
An Eliakim hinab, dem es aufbaute Gott
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Abiud, denn Macht und Herrlichkeit
gehören dem Vater
An Serubabel hinabhin, der brandopferte Gott
Hinabhin an Schealtiël, genannt des Gefangenen Sohn
Hinab an Jojachin, der zusehen mußte dem
Zerschmettern goldnen Gefäßes
Hinab an Eljakim, der tat, was dem Herrn mißfiel
An Joahas hinab, in Schwarzerd Ägyptens gezerrt
An Joschija hinab, dem Zermalmer der Götzen,
Erneuerer des Gebäus, der erhört das Verlorene
An Amon hinab, der mißfiel, im eigenen Hause
erschlagen
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Manasse, der als Opfer dem Baal die Söhne
verbrannt
An Hiskija hinabin, für den Gott die aus Sebulon
gütig entsühnte, die in Unreinheit kamen zu IHM
Hinabhin an Ahas, dem Sohnopferer, der die Geräte
des Hauses Gottes zerschlug
Hinab an Jotham, der erbaute die Burg, den
waldüberragenden Turm und das Tor
Hinab an Usija, der in den Tempel eindrang zu
opfern, da brach Aussatz an seiner Stirne hervor
An Amazja hinab, der die Söhne der Mörder des
Vaters verschonte
An Joas hinab, der als Kind sechs Jahre versteckt war
im Hause des Herrn
An Ahasja hinab, der floh vom Acker Naboths des
Jesreeliters und ward durchbohrt vom Pfeil Jehus,
Seines Gesalbten
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Joram, König von Juda, der sich zum Weibe
nahm die Tochter Ahabs, des Königs von Israel
An Josaphat hinabhin, der hörte das Wort des
Propheten vom bösen Geist, herausgetreten aus Gottes Heerschar
Hinabhin an Asa, der das Greuelbild Ascherahs am
Schwarzbache Kidron verbrannt
Hinab an Abija, der Jerobeam durch Beit-El hin
nachjagte
Hinab an Rehabeam, der mit Skorpionen züchtigend
entzweiriß das Reich
An Salomo hinab, Sohn der Bath-Seba, welcher beim
Schrei der Mutter einhielt das Schwert vor dem Kind
An König David hinab, Sproß Isais, der Urias Weib
tröstete überm Tod ihres Knäbleins
An Isai hinab, dem Bethlehemiter, der holen ließ seinen
Jüngsten
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Obed, Sohn der Ruth, der stand am Eingang
zur Tenne
An Boas hinabhin, der mittnachts erwachte, ihm zu
Füßen die Frau
Hinabhin an Salma, der verteidigte Rahab, die hatte das
rote Seil
Hinab an Nahesson, der auf Moses Geheiß zur
Einweihung des Altars opferte seine Gabe
Hinab an Amminadab, in Ägypten geboren,
Schwiegervater des Aaron
An Ram hinab, dem Hohen, der sich über dem Tod des
Dieners erhängte
An Hezron hinab, der sechzigjährig die Enkelin Gileads
herbeizog zu zeugen
An Perez hinab, der durch die Bresche als erster brach
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Juda, der als Sklave sich anbot Joseph, an des
Knaben Benjamin Statt
An Jakob hinabhin, dem Gott-Ringer Israel, der wach
rang um den Ragetraum Seiner Verheißung
Hinabhin an Isaak, dem Hals des Knaben, angeritzt,
daß Blut aus ihm trat
Hinab an Abraham, Uraufbürder der Last, nach Licht
und Messer suchend im Zelt
Hinab an Terach, der abging aus Ur, mondlichter Stadt,
folgend dem Sohn in ein Land, das Gott ihm will weisen
An Nahor hinab, der sich müd schrie nach seinem Gott
An Serug hinab, der stark ward fürs Joch seiner
Sünden, die ihm zusammengeknüpft und geflochten
der Herr
An Regu hinab, der gleich einem Freund den Fremden
sich auflud, ihn dem Bösen nicht überließ im
Fluß Elend
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil
dem Regenstrang nach ins Dunkel nach unten
Hinab an Peleg, dem Zerrissenen, zu dessen Lebzeit
Erde und Sprache in Teile zerbebten
An Eber hinabhin, der klammernd die Gegenseiten
zusammenhält, übersetzend vom Jenseits der Wasser
Hinabhin an Schelach, der breitend entsandte den Zweig
Hinab an Arpachsad, der auf der Grenze ihn pflückte
An Schem hinab, der die Scham des nach Alltod
Berauschten verhüllte
An Noah hinab, der gottübrig Tröster war, als der Herr
von harter Vernichtung ruhte
An Lamech hinab, dem Wilden, der sich Männer
erschlug für die Wunde, Knaben für jede Strieme
An Methuschelach hinab, dem auf Erden am längsten
zu harren erlaubt war, bis an die Flut
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer am Seil.
Und streckte aus seine Hand –
da fiel nichts, das sie näßte.
Nicht Regenstrang hin ins Dunkel nach unten.
Denn hierher herab reichte Regen nicht mehr,
kein Wassertropfen erreichte die Tiefe.
Und tiefer stieg Joseph, stieg tiefer hinab
An Henoch hinabhin, der sich erging mit Gott, entrückt
war in ewigen Garten
Hinabhin an Jared, VorausNahmer des Abstiegs der
Wasser und aller im Jordan Getauchten
Hinab an Mahalalel, der im Schatten erglühte der
Augenpracht Seines Auges
Hinab an Kenan, den sein Erzeuger Enos erwarb vom
Herrn
An Enos hinab, der nur schwach war und sterblicher
Mensch, als aufragend Menschen sich Gott-Namen
nahmten
An Seth hinab, dem SproßErsatz Abels, eingesetzt für
den Toten
Bis zutiefst gestiegen war Joseph
in die Tiefe hinab,
und hinabhin, am Doppel-Ragebild
Adams
herab,
auf rosenrötlichen
Erdgrund
setzte den Fuß, wie auf
festen Teig,
den Kloß, aus dem sie
geknetet warn,
Adam,
Erde mit Odem,
er und sie,
Gott zum Bilde von Gott.
Und alle nach Adam
in Adams Bild,
gottbildernd alle in Adam.