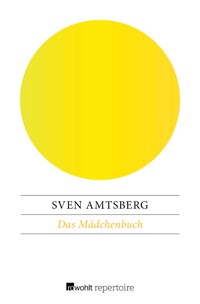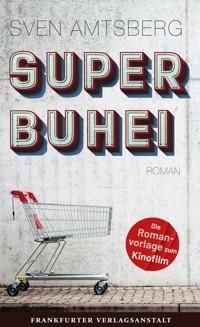
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Debütromane in der FVA
- Sprache: Deutsch
Die Scorpions, ein Supermarkt und ein tödliches Spiel um Identität: Skurriler Roman über das Scheitern mit Kultpotenzial Romanvorlage für die Kino-Verfilmung: Jesse Bronske, ein erfolgloser Kneipenbesitzer, hat Angst, dass ihm sein bösartiger Zwillingsbruder Aaron, vor dem er vor langer Zeit geflohen ist, wieder auf der Spur ist und nun dabei ist, sein Leben Schritt für Schritt zu übernehmen… Dass Langenhagen der Platz sein würde, den das Leben ihm zugedacht hat, hätte Jesse Bronske nicht geglaubt. Auch nicht, dass die Sitzschönheit Mona die Frau an seiner Seite sein würde. Mona ist Supermarktkassiererin im SUPERBUHEI, wo Jesse die Kneipe »Klaus Meine« betreibt. Tag für Tag schenkt er trostlosen Gestalten Drinks aus, die er nach Scorpions-Songs »Gin of Change« oder »Grog you like a hurricane« genannt hat. Mit seinem alten Leben hat er abgeschlossen, vor allem mit seinem Zwillingsbruder Aaron, der ihm so sehr gleicht, dass noch nicht einmal ihr Vater, Imbissbudenbesitzer und Elvis-Imitator in Hamburg-Rahlstedt, sie auseinanderhalten kann. Doch als Jesse eines Nachts vor seinem Haus eine Gestalt im Maisfeld sieht, ist er sich plötzlich sicher: Aaron ist zurückgekehrt und verfolgt den teuflischen Plan, ihn zu ersetzen... Sven Amtsbergs furioses Romandebüt ist Komödie und Vorstadtroman, am Ende ein Thriller. Amtsbergs unverwechselbarer Sound, hanseatisch-lakonisch, ein »Unernst mit Tiefenwirkung« (Hamburger Abendblatt) und sein schräger, unschlagbar charmanter Witz machen SUPERBUHEI zu einem unendlichen Spaß. »In der literarischen Performance-Szene Hamburgs ist er schon lange der bunte Hund, die Rampensau, der komische Vogel. Und jetzt will dieser Sven Amtsberg auch noch einen Roman voller skurrilem Horror und lustiger Depression können? Ja, will er. Und kann er!« Frank Schulz »Der Imbisswagen als Sinnbild einer verfehlten Existenz -‐ Sven Amtsberg bindet in Superbuhei den ganz normalen Wahnsinn zu einem Bouquet wermütiger Heiterkeit.« Jamal Tuschick, der Freitag »Hier will ein Autor, der als Literaturentertainer zur Marke geworden ist, seine Leser unterhalten. Es gelingt ihm vortrefflich.« Thomas Andre, Hamburger Abendblatt »Alles drin: Sven Amtsbergs Roman Superbuhei ist witzig, klug, lakonisch, und spannend.« Judith Liere, STERN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dass Hannover-Langenhagen der Platz sein würde, den das Leben ihm zugedacht hat, hätte Jesse Bronske nicht geglaubt. Auch nicht, dass die Sitzschönheit Mona die Frau an seiner Seite sein würde. Mona ist Supermarktkassiererin im SUPERBUHEI, wo Jesse die Kneipe »Klaus Meine« betreibt. Tag für Tag schenkt er trostlosen Gestalten Drinks aus, die er nach Scorpions-Songs Gin of Change oder Grog you like a hurricane genannt hat. Mit seinem alten Leben hat er abgeschlossen, vor allem mit seinem Zwillingsbruder Aaron, der ihm so sehr gleicht, dass noch nicht einmal ihr Vater, Imbissbudenbesitzer und Elvis-Imitator in Hamburg-Rahlstedt, sie auseinanderhalten kann. Doch als Jesse eines Nachts vor seinem Haus eine Gestalt im Maisfeld sieht, ist er sich plötzlich sicher: Aaron ist zurückgekehrt und verfolgt den teuflischen Plan, ihn zu ersetzen …
Sven Amtsbergs furioses Romandebüt ist Komödie und Vorstadtroman, am Ende ein Thriller. Amtsbergs unverwechselbarer Sound, hanseatisch-lakonisch, ein »Unernst mit Tiefenwirkung« (Hamburger Abendblatt) und sein schräger, unschlagbar charmanter Witz machen SUPERBUHEI zu einem unendlichen Spaß.
»In der literarischen Performance-Szene Hamburgs ist er schon lange der bunte Hund, die Rampensau, der komische Vogel. Und jetzt will dieser Sven Amtsberg auch noch einen Roman voller skurrilem Horror und lustiger Depression können? Ja, will er. Und kann er!« Frank Schulz
The world is closing inDid you ever thinkThat we could be so close, like brothers
Wind of Change, Klaus Meine
INHALT
Teil I
Keep the World Safe
Is There Anybody There?
Send Me an Angel
Does Anyone Know
In Trance
Dynamite
To Be No. 1
Walking On The Edge
Heroes Don’t Cry
Born To Touch Your Feelings
10 Light Years Away
When The Smoke Is Going Down
Can’t Get Enough
Woman
Are You the One?
Rollin’ Home
Where the River Flows
Teil II
Going Out With A Bang
A Moment in a Million Years
Eye To Eye
Speedy’s Coming
Animal Magnetism
I Wanted to Cry (But the Tears Wouldn’t Come)
Teil III
Make It Real
You and I
When You Came into My Life
Blackout
When the Truth Is a Lie
In Search Of The Peace Of Mind
Teil IV
Fly To The Rainbow
To Hell With The Devil
Teil V
Coming Home
Teil VI
Wind Of Change
Maybe I Maybe You
Still Loving You
Danksagung
I
KEEP THE WORLD SAFE
Sicherheit ist wichtig. Das erkannte ich schon früh. Und auch Mona war nach wenigen Wochen unseres Zusammenseins davon überzeugt, dass Sicherheit das höchste Gut ist. Bis dahin dachte sie, es wäre das Glück. Doch im Gegensatz zum Glück hat man auf die Sicherheit größeren Einfluss. Sicherheit lässt sich schnell mit Schlössern, Ketten und Alarmanlagen herbeiführen. Ganz anders als das Glück, das sich ja oft auch nach Jahren intensivster Romantik nicht wirklich einstellen will.
Das Glück ähnelt der Gefahr – im Grunde kann es alles sein. Die meisten glauben, Glück würde mit der Liebe zusammenhängen. Doch in Wahrheit ist die Liebe der natürliche Feind der Sicherheit und damit auch des Glücks. Denn wer verliebt ist, ist nie wirklich wachsam. Mit der Liebe hält auch der Schlendrian Einzug ins Leben. Liebe – das heißt auch Löcher. Lecks. Und wer kann schon glücklich sein, wenn das Leben unsicher ist. Sicherheit ist das Unterpfand des Glücks. Doch die meisten verstehen das nicht. Auch Mona nicht. Nur als Beispiel: Bei Kerzen denkt Mona an Romantik. Ich dagegen sehe das Gefahrenpotential. Vieles, was auf den ersten Blick schön scheint, entpuppt sich oft hintenraus als Risikofaktor. Die Sonne etwa, dieses verklärte gelbe Biest, die so tut, als wäre sie unser Freund. Doch in Wahrheit ist sie unser Feind. Stichwort: Hautkrebs. Gott sei Dank lässt sich Sonne leicht durch elektrisches Licht ersetzen. Frische Luft bekommt man durch einen Schlauch, der mit einem winzigen Sieb verschlossen ist, so dass keine Insekten hineinkönnen. Ritzen müssen verklebt, Kabel nach draußen gekappt werden. Telefon bedeutet Gefahr. Klingeln, Haustür: Gefahr. Je größer ein Raum ist, desto unsicherer ist er. Ein Leben außerhalb eines geschlossenen Raums lässt sich nicht wirklich absichern. Freiheit bedeutet deshalb auch immer Unsicherheit. Am einfachsten ist Sicherheit in einer Kammer ohne Fenster zu erlangen. Ein Raum, der überschaubar ist, sich verriegeln und verrammeln lässt. Ein Gefängnis etwa. Das ist Sicherheit. Und damit beginnt dann auch das Glück. Ganz sicher.
IS THERE ANYBODY THERE?
Ich liege wach im Bett mit einem Gewehr und sorge mich wegen unserer Sicherheit. Ruhig liegt Mona neben mir und schläft. Wenn Mona schläft, sieht es so aus, als atme sie nicht, sondern beiße Stücke aus der Luft. Immer hektischer schnappt sie danach, und im Laufe der Nacht beginnt das Schlafzimmer nach ihrer Mundhöhle zu riechen, so dass es in den frühen Morgenstunden kaum noch darin auszuhalten ist. Vermutlich liegt das am Unterbewusstsein. Vieles liegt ja am Unterbewusstsein. Mona sagt, sie träume oft davon, ein Wolf zu sein. Wegzulaufen und zu beißen. Am Tage hat sie nur wenig von einem Wolf. Sie wirkt dann eher wie ein Beutetier.
Heute Abend ist Mona früh schlafen gegangen, wie immer, und ich war froh darüber. In letzter Zeit macht mir die Stille zwischen uns zu schaffen. Gerade wenn sie wie ein Gas ist, das aus unseren Mündern strömt und uns ganz allmählich betäubt. Ja, ich liebe Mona. Sicher liebe ich sie noch. Doch früher habe ich das auch gefühlt und musste es mir nicht vor Augen halten. Mich fast schon dazu zwingen. Jetzt gibt es Nächte, in denen ich wach im Bett sitze und die schlafende und beißende Mona betrachte und mich frage, wie das alles gekommen ist, warum das der Platz ist, den das Schicksal mir zugedacht hat. Ich denke darüber nach, wo sonst mein Platz sein könnte. Doch so recht fällt mir nichts ein.
Nach wie vor sehne ich mich nach Einsamkeit. Allein sein kann man in einer Partnerschaft ja nur, wenn der andere schläft oder im Krankenhaus ist. Manchmal glaube ich, dass ich nur so sein kann, wie ich wirklich bin, bin ich allein. Und da ich nie allein bin, weiß ich nicht, wie ich wirklich bin. Zumindest bin ich nicht so, wie andere glauben, dass ich bin. Auf alle Fälle bin ich anders, ist wer da, und deshalb bin ich immer froh, wenn Mona früh schlafen geht. Ja, ich warte richtig darauf. Und um von vornherein ehrlich zu sein: Ich mische Mona manchmal etwas Schlafmittel ins Essen, um uns diese quälenden Abende zu ersparen. Wenn wir gemeinsam fernsehen und nichts so recht zu reden haben. Es ist nie viel Schlafmittel. Wirklich nicht. Immer nur ein bisschen, damit ich ein paar Stunden für mich habe, in denen ich einfach nur dasitze, nachdenke, rauche und die bewusstlose Mona betrachte. Sie ist wegen ihrer Müdigkeit schon beim Arzt gewesen.
»Vielleicht die viele Arbeit«, sage ich dann jedes Mal.
»Vielleicht«, sagt Mona.
Der Arzt hat nichts feststellen können. Sie solle mehr Sport treiben, und anschließend ist Mona ein paar Tage lang immer wieder ums Haus gelaufen oder die Straße hoch und runter, hat begonnen, auch abends Kaffee zu trinken. Doch geholfen hat all das nichts.
Um ihr unbemerkt Schlafmittel ins Essen mischen zu können, koche ich in letzter Zeit oft. Was die Sache etwas anstrengend macht. Eigentlich koche ich überhaupt nicht gern. Nun gebe ich vor, es sei mein Hobby. Ständig sehe ich mir irgendwelche Kochsendungen an, lese Bücher über die fleischhaltige Küche der Waliser etwa, bestelle im Internet Gewürze, deren Namen ich mir nie werde merken können und von denen ich ein wenig wahllos mal in dieses, dann in jenes Gericht streue.
An diesem Abend habe ich Mona ein bisschen mehr Schlafmittel ins Essen getan. Etwas ist passiert, und ich weiß, ich muss jetzt wachsam sein. Muss aufpassen auf uns und unsere Sicherheit. Noch mehr als sonst. Mona habe ich nichts gesagt, ich will sie nicht beunruhigen. Sie neigt schon immer zur Hysterie.
Kurz hatte ich Sorge, sie würde auf dem Sofa einschlafen. Hochtragen kann ich Mona schon lange nicht mehr. Dazu hat das Leben sie einfach zu schwer werden lassen. Je müder sie wurde, umso mehr insistierte ich, sie möge doch bitte nach oben gehen und sich ins Bett legen. Am Ende flehte ich sie richtiggehend an. Man kann es glauben oder nicht, aber ich habe Angst um sie. Ich weiß, dass wir nicht mehr sicher sind. Schon gar nicht unten. Vor ein paar Stunden habe ich dieses Foto entdeckt, und die Angst ist seitdem schlagartig wieder da. Diese verdammte Angst.
Ich umklammere das Gewehr fester und lausche in die Dunkelheit. Ob da wer ist. Er. Aber es knackt nur. Das Haus besteht im Inneren zu großen Teilen aus Holz. Monas Vater hat fast alle Wände damit verkleidet. Dazu Holzfußböden verlegt, die in einigen Räumen so schief sind, dass umgekippte Weinflaschen quer durch das Zimmer bis zur gegenüberliegenden Wand rollen. Wir mussten das Bett umstellen, da uns nachts das Blut in den Kopf schoss und die Träume rot ertränkte. Monas Vater ist zur See gefahren, bis er vor fünf Jahren plötzlich verstarb. Ihr Vater sei immer lieber auf einem Schiff gewesen als in einem Haus, erzählte Mona, und tatsächlich sei er oft landkrank geworden, mit ganz ähnlichen Symptomen wie bei Seekranken. Deshalb hat er wohl versucht, alles im Haus so schiffsähnlich werden zu lassen, wie das nur eben möglich ist. Man gerät hier ins Schwanken, taumelt, wankt, und nicht nur einmal meinte ich schon, plötzliche Übelkeit überfalle mich. Was hilft, ist aus dem Fenster zu sehen und einen festen Punkt da draußen zu fixieren. Das Maisfeld. Vermutlich ist es das einzige Haus auf der Welt, in dem man seekrank werden kann.
Nächtelang habe ich wach gelegen und dem Knacken zugehört, nach einem Muster darin gesucht, einem System. Bis ich es gefunden habe. Nun kann ich ohne große Mühe fremdes von natürlichem Knacken unterscheiden – und genau das ist jetzt das Problem: Denn was ich höre, ist nicht das natürliche Knacken des Hauses. Sondern da ist wer! Irgendwo im Erdgeschoss geht wer umher.
Es ist nahezu unmöglich, sich leise durch dieses Haus zu bewegen. Selbst wenn man es so gut kennt wie ich. Alles knackt. Alles knarrt. Ganz egal, wohin man tritt – alles gibt nach. Die einzige Möglichkeit ist, langsam zu gehen, so dass das Knarren der Schritte sich in die natürliche Symphonie des Knarrens des Hauses einfügt.
»Holz lebt«, sagt Mona immer. »Holz lebt«, und manchmal, wenn wir unten auf dem Sofa sitzen, um uns das ganze verdammte knackende Holz, da habe ich das Gefühl, dieses Holz lebt mehr, als wir es tun. Manchmal überkommt mich richtiggehend Neid auf dieses verdammte Holz. Holz, das lebt, ohne dass es dafür groß etwas tun muss. Holz lebt einfach so, wir dagegen müssen uns spüren. Müssen uns verwirklichen, um leben zu können.
Ich stehe auf und schleiche langsam zu einem der beiden Schlafzimmerfenster, schaue nach, ob draußen etwas zu sehen ist. Das Gewehr umklammere ich mit beiden Händen. So fest, dass ich es kaum noch als Fremdkörper wahrnehme, es ist ein Teil von mir.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße steht unser Auto auf unserem Parkplatz. Dahinter beginnt das Maisfeld, das jetzt sachte wogt. An stürmischen Tagen kann es so aussehen wie ein Meer. Ein Maismeer. Vermutlich hat Monas Vater deshalb das Haus gekauft. Echten Meerblick konnten sie sich nicht leisten. Sonst ist dort aber nichts zu sehen.
Das Gewehr ist der natürliche Freund der Sicherheit. Auch ein Hund wäre es, ein großer Hund. Nur leider hat Mona eine Hundeallergie, so dass wir stattdessen einen elektrischen Hund kauften, von dem man keinerlei Allergien bekommt. Es ist ein kleiner weißer Plastikkasten, auf dem auf Taiwanesisch Hund steht, so glaubt Mona zumindest, der nun neben der Haustür liegt und eigentlich blechern bellt, nähert sich jemand. Nur jetzt reagiert er nicht. Warum bloß?
Mona weiß nicht, dass ich ein Gewehr habe. Ich hole es nur, wenn ich mir sicher sein kann, dass Mona wirklich schläft. Ansonsten verstecke ich es hinter der Holzvertäfelung im Zimmer nebenan, das durch eine Tür mit unserem Schlafzimmer verbunden ist. Wir nennen es das Zimmer der Eltern, obwohl ihre Eltern schon eine ganze Weile tot sind. Trotzdem riecht noch immer das ganze Haus nach ihnen, fast so, als akzeptiere es uns nicht als neue Bewohner.
Im Zimmer der Eltern steht noch immer benutztes Geschirr vom Vater, das wegzuräumen oder auch nur abzuspülen Mona nicht übers Herz bringt. Sogar fünf Jahre nach seinem Tod nicht. Auch ich darf es nicht tun. Sie schreit, fasse ich es nur an. In den Schränken hängt Kleidung der Eltern, die anzuziehen sie mich manchmal bittet. Ein Wunsch, dem ich nur nachgebe, wenn ihre Trauer zu groß ist. Dann hocke ich da in den Sachen des Vaters, manchmal auch der Mutter. Mona hinter mir weint oder schluchzt, ich darf mich nicht nach ihr umdrehen. An den Wochenenden sehen wir uns hin und wieder Super-8-Filme von ihren Eltern an. Glück. Für Mona ist das Glück. Diese verwackelten Aufnahmen, auf denen sie nackt irgendwo in Dänemark herumrennt und ihre Mutter im Bikini betont lässig am Strand entlangzustolzieren versucht. Und hier stehe ich nun in der Vergangenheit im Zimmer der Eltern und starre nach draußen in die düstere Gegenwart. Ob dort etwas zu sehen ist, was unsere Zukunft bedroht. Je länger ich nach draußen sehe, umso mehr Silhouetten schälen sich aus der Dunkelheit. Was eben noch schwarz war, beginnt nun grau und bald schon hellgrau zu werden. Ich erkenne nun sogar einzelne Maiskolben, die schwer an den Stängeln hängen und hin und her wogen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich erschießen kann, wenn es sein muss. Oft habe ich mir das vorgestellt. Früher schon. Ihn einfach zu erschießen, um endlich mein Leben leben zu können, so wie ich das will. Er ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Warum ich geflohen und untergetaucht bin. Seinetwegen habe ich mir auch das Gewehr besorgt. Ich habe schon immer gewusst, dass er mich irgendwann finden und dass mir dann vermutlich keine andere Wahl bleiben würde. Und ein Gewehr, weil ich glaube, dass ich, wenn ich ihn erschießen würde, es nur aus großer Distanz tun könnte. Ich will ihn dabei nicht ansehen müssen. Das wäre, als würde ich mir selbst beim Sterben zusehen.
Geahnt, dass er kommen wird, habe ich schon lange. Im Grunde, seit ich geflohen bin. Bald fünf Jahre ist das jetzt her. Aber warum ist er nicht schon früher gekommen? Warum jetzt? Habe ich einen Fehler gemacht?
Er ist im Haus gewesen, so viel ist sicher. Hat vielleicht sogar Kontakt zu Mona aufgenommen, ohne dass sie es weiß. Oder hat sie es bemerkt und lässt sich mir gegenüber nur nichts anmerken? Was, wenn sie mit ihm unter einer Decke steckt und die beiden nun nach einer Möglichkeit suchen, um mich loszuwerden? Unwahrscheinlich, aber trotzdem nicht ganz abwegig. Ich muss vorsichtig sein. Die Sicherheit ist auf alle Fälle in Gefahr.
Ein Knacken aus dem Erdgeschoss reißt mich aus meinen Gedanken, und instinktiv mache ich einen Schritt rückwärts. Tiefer hinein in die Dunkelheit des Zimmers. Dort warte ich. Ein, zwei Minuten. Bevor ich weitergehe. Langsam. Ganz langsam. Es dauert ewig, bis ich so das Zimmer durchquert habe. Anschließend muss ich auch noch durch den Flur und die Treppe nach unten. Ich habe keine andere Wahl, will ich ihn überraschen. Und das muss ich. Ansonsten werde ich es nicht schaffen. Er ist schon immer gerissener gewesen als ich. Rücksichtsloser. Viel rücksichtsloser.
Da! Schon wieder dieses Knacken von unten. Es ist anders als sonst, wenn Fremde im Haus sind, Monas seltsame Freundinnen etwa oder der Paketbote. Leute, die das Knacken nicht kennen, bewegen sich völlig ungezwungen, und der Lärm, den das Knacken dann in meinen Ohren macht, ist kaum auszuhalten. Man muss wissen, auf welche Stellen man treten kann und in welchem Tempo man voranschreiten muss. Das ist wie Ballett. Einmal habe ich es dem Paketboten vorgemacht, und als ich ihn aufforderte, er solle es mir nachmachen, da ist er kläglich gescheitert. Wir haben gelacht. Wir haben Köm getrunken.
Doch er scheint all das zu wissen. Geht da unten genauso langsam wie ich eine Etage über ihm. Ich bin mir fast sicher, dass er das Knacken kennt. Dass er weiß, wo er hintreten darf und wo nicht.
Der nächste Schritt. Es geht nicht anders – der Holzboden gibt unter meinem Fuß nach und knarrt. Es kommt mir in diesem Moment so laut vor, dass ich kurz sogar Angst habe, Mona könnte davon aufwachen. Was würde ich ihr sagen?
Mittlerweile bin ich oben im Flur, kurz vor der Treppe. Dort, wo die gerahmte Käfersammlung ihrer Mutter hängt. Es kommt mir hier kühler vor. Als stünde unten ein Fenster offen. Klar: Ein geöffnetes Fenster hat mit Sicherheit nicht viel zu tun. Fenster sind immer die Schwachstellen eines Hauses. Besser wäre es ohne Fenster. Monitore stattdessen. Mona will sogar manchmal mit offenem Fenster schlafen. Im Sommer dulde ich das, oben. Wir haben Netze davor. Wegen der Insekten. Aber nachts, unten im Erdgeschoss, würden wir nie ein Fenster offen lassen. Selbst Mona nicht, die das Thema Sicherheit für meinen Geschmack immer etwas lax handhabt.
Ich erreiche die Treppe. Unmöglich diese Treppe – natürlich eine Holztreppe – nach unten zu gehen, ohne dass jemand es hört. Deshalb lasse ich mich oben auf dem Treppenabsatz erst einmal langsam auf die Knie sinken, um vorsichtig durch die Streben des Geländers in die Diele zu spähen: Die Fenster sind verschlossen. Der quadratische Hund sieht intakt aus, auch die Haustür ist zu – und doch spüre ich, dass etwas anders ist. Er muss da sein!
Ich stehe auf, umklammere mit beiden Händen das Gewehr und gehe langsam seitwärts die Treppe nach unten, während ich auf die offene Wohnzimmertür ziele. Nach jeder Stufe halte ich kurz inne. Sechs, fünf Stufen noch. Langsam, eine nach der anderen, dann wieder verharrend, gehe ich weiter nach unten, das Gewehr im Anschlag. Der Hund bellt metallisch.
Von der Diele aus gelangt man in die Küche und das Wohnzimmer. Beide Räume sind miteinander verbunden. Vorsichtig betrete ich das Wohnzimmer. Ein großer holzvertäfelter Raum, in dessen Mitte offenes Fachwerk den Ess- vom Wohnbereich trennt. Darin schwere braune Polstermöbel, in denen man versinkt, setzt man sich auf sie, und die nur aus dem Grund immer noch bei uns stehen, weil sie, so Mona, noch nach ihren Eltern riechen. Selbst wir haben angefangen, nach ihren Eltern zu riechen. Außerdem sind da noch der Fernseher, die Sonnenbank und ein gemaltes Bild mit fremden Menschen darauf.
Langsam schleiche ich zum Essbereich, von da aus weiter in die Küche. Gerade als ich dort die Tür zur Speisekammer aufreißen will, lässt mich ein metallisches Klappern aus dem Wohnzimmer aufschrecken: der Kamin, der Schürhaken!
Ich eile zurück ins Esszimmer – und ja, da ist er! Da ist das Schwein! Ohne zu zögern, schieße ich. Dann noch mal. Lade nach und schieße erneut. Wieder und wieder. Nein, das ist kein Traum. Das ist es ganz sicher nicht!
SEND ME AN ANGEL
Mona kann Zigarettenrauch auf hundert verschiedene Arten ausatmen. Sie ist da wie die Eskimos und der Schnee. Oder wie auch immer Eskimos heutzutage korrekt heißen. Mittlerweile sind wir so lange zusammen, dass ich fähig bin, diese Gebilde zu deuten. Mal wächst der Rauch langsam aus dem kleinen Loch, das sie zwischen den Lippen lässt, wie ein Atompilz, dessen Konsistenz immer dichter zu werden scheint, bis er am Ende fast weiß ist: Dann ist sie verärgert. Manifestiert der Rauch sich erst wie eine große Kaugummiblase, bevor er sich in nichts auflöst, ist sie wütend. Mona kann Haufenwolken rauchen, Schäfchenwolken, Schleierwolken, Federwolken. Sie kann Kringel machen, die wie Lassoschlingen durch den Raum wabern und sich mir um den Hals legen. Sie kann den Rauch in zwei Strahlen aus den Nasenlöchern blasen, sie kann den Qualm aus Mund und Nase steigen lassen, so dass er sie umhüllt und dahinter verschwinden lässt. Das alles bedeutet immer, dass sie aus irgendeinem Grund sauer auf mich ist. Nicht selten unterstreicht sie das Ausatmen des Rauchs noch mit einem feinen Seufzen, das mal vorwurfsvoll klingt, dann wieder erschöpft oder aber einfach nur anklagend. Ist sie glücklich, gibt sie sich keine Mühe mit dem Rauch, dann steigt er ihr wie von allein aus dem Mund und den Nasenlöchern.
An diesem Morgen bläst sie den Rauch in einem feinen Strahl mit viel Druck gegen die Windschutzscheibe, so dass er davon abprallt und sich bedrohlich im Wageninnern ausbreitet. Es verheißt nichts Gutes. Auf gar keinen Fall. Droht der Rauch zu dicht zu werden, öffnet Mona das Fenster einen Spalt breit.
Wie jeden Morgen sind wir auf dem Weg zum Supermarkt, in dem Mona als Kassiererin arbeitet und ich eine kleine Kneipe betreibe. Wenn Mona eine Zigarette aufgeraucht hat, steckt sie sich mit deren Glut die nächste an. Sechs, sieben Zigaretten schafft sie so auf der Fahrt zum SUPERBUHEI. Erst danach kommt sie etwas zur Ruhe. Der Rauch ist Erfüllung geworden, und ich glaube, je unglücklicher sie ist, umso mehr raucht sie. Die Zigaretten sind zum Ersatz geworden für das, wonach sie bei mir immer gesucht, es aber nicht gefunden hat. Wenn man mal ehrlich ist, ist Liebe ja im Grunde auch nichts anderes als Nikotin oder Alkohol. Nur billiger. Meistens zumindest.
»Was ist nur los mit dir?«, fragt Mona mich jetzt, nachdem wir bisher den Morgen über geschwiegen haben. Sie war im Bad, hat ausgiebig geduscht, sich so lange die Haare geföhnt wie noch nie, was in mir den Verdacht weckte, dass sie den Föhn einfach eingeschaltet auf die Waschmaschine gelegt haben könnte, um allein sein zu können. Nachdenken und so. Währenddessen habe ich mich im Haus umgesehen. Auf dem Dachboden. Bin sogar im Schuppen gewesen. Ich habe nach Hinweisen gesucht, die darauf hindeuten, dass Aaron sich dort irgendwo versteckt hält. Aber ich fand nichts.
Mona glaubt mir nicht. Noch in der vergangenen Nacht, kurz nachdem ich auf ihn geschossen habe, ist es zum Streit gekommen, wir hörten nur damit auf, weil wir irgendwann einfach zu erschöpft waren. Und nun will sie diesen Streit anscheinend fortsetzen. Wir stehen an einer roten Ampel am Ortseingang von Langenhagen und sehen einem beigefarbenen Hund auf dem Bürgersteig zu, der sich an Stellen leckt, an denen wir uns nie hätten lecken können. Oder lecken wollen.
»Was meinst du?«, frage ich.
»Was ich meine? Du schießt mitten in der Nacht im Haus rum! Du schläfst kaum noch. Wir reden nicht mehr miteinander. Und du fragst mich allen Ernstes, was ich meine?!«
»Mona, da war ein Einbrecher. Hab ich doch schon gesagt.«
»Ein Einbrecher! Du hast doch gehört, was die Polizei gesagt hat. Da sind keine Einbruchsspuren! Du spinnst. Du hast Glück, dass die dich nicht gleich mitgenommen haben! Woher hast du überhaupt das Gewehr?«
Er ist mir entwischt. Die Nachbarn mussten natürlich die Polizei rufen wegen der Schüsse. Die interessierte sich dann hauptsächlich für das Gewehr. Es sei das Gewehr von Monas Vater, log ich, während ich Monas Reaktion aus den Augenwinkeln beobachtete. Sie tat tatsächlich so, als würde das stimmen, und nickte ansatzweise. Ich hätte Schritte gehört. Ich hätte etwas gesehen. Daraufhin hätte ich geschossen. Aus Angst. Ich hätte Angst gehabt um meine Freundin. Meine schwangere Freundin, wie ich noch ergänzte. Auch dazu sagte Mona nichts. Immerhin.
Das Gewehr haben sie mitgenommen. Ausgerechnet jetzt, wo wir in Gefahr sind. Wir würden von ihnen hören. Dann sind sie weggefahren, ohne den Eindruck zu erwecken, sie würden großartig etwas in dieser Angelegenheit unternehmen. Stattdessen wurde ich das Gefühl nicht los, dass sie mir misstrauten.
Das Erste, was ich an diesem Morgen getan habe, ist einen Schlüsseldienst zu beauftragen, neue Schlösser einbauen zu lassen. Später will ich etwas im Supermarkt kaufen, um uns zu beschützen. Eine Axt vielleicht. Oder wenigstens einen Hammer. Einen großen Hammer. Ich werde mich schnellstmöglich um eine neue Schusswaffe kümmern. Das Gewehr habe ich über jemanden aus der Kneipe bekommen.
»Und wenn du mal mit wem sprichst? Ich meine mit einem Arzt oder so. Geh doch zu Dr. Guttmalik. Etwas stimmt doch nicht mit dir.«
»Mona, da war wer. Mit mir ist nichts. Da. War. Wer.«
Mona glaubt, dass ich mich verändere. Seit fast einem halben Jahr oder sogar noch länger liegt sie mir damit in den Ohren. Sie sagt es ständig. Etwas passiere mit mir. Etwas sei da nicht in Ordnung. Aber ganz ehrlich – es stimmt nicht. Ich verändere mich nicht. Ich wäre der Erste, der Acht geben würde, es nicht zu tun. Veränderung bedeutet immer Unsicherheit. Doch Mona glaubt mir nicht. Und nun beobachtet sie mich ständig, was äußerst unangenehm ist. Einmal bin ich morgens sogar davon wach geworden, dass sie mich musterte. Sie hatte sich dazu über mich gebeugt und eingehend mein Gesicht betrachtet, fast so, als wäre ich nicht wirklich ich, sondern jemand anders, der sich nur für mich ausgab, und als suchte sie nun nach Anzeichen, die mich entlarvten. Ich habe sogar Fotos gefunden, die sie von mir gemacht haben muss und die sie wahrscheinlich miteinander verglich, um zu prüfen, ob sie recht hat, ich mich doch veränderte. Aber es stimmt nicht. Ich verändere mich nicht.
Mona und ich haben uns im SUPERBUHEI kennengelernt. Ich glaube, dass genau das unser Problem ist: Ein Supermarkt ist einfach nicht der geeignete Ort für Liebe. Das ist wie mit den Produkten, die man dort einkauft und sich danach zu Hause fragt, was man eigentlich mit ihnen will. Die Wahrheit ist: Es liegt an der Musik. Es ist spezielle Supermarktmusik. Dazu kommen Gerüche, die sie über Düsen an der Decke und unter den Regalböden verströmen. Es hat mit dem Unterbewusstsein zu tun. Unter anderem zumindest. Und natürlich mit Psychologie, wenn das nicht dasselbe ist. Alles mit Menschen hat immer mit Psychologie zu tun. Vermutlich lag es daran, dass wir uns überhaupt ineinander verliebt haben. Wären wir uns irgendwo draußen begegnet, wären wir uns nicht aufgefallen. Die erste Zeit haben wir uns nur im Supermarkt gesehen. Ich kaufte viel ein. Ihretwegen. Vieles verdarb, was zu einem Fliegenproblem führte. Trotzdem waren die ersten Wochen schön. Eigentlich sind sie das ja immer in einer Beziehung, und die restliche Zeit versucht man dann meist vergebens, diese Zeit wieder aufleben zu lassen.
Schon das erste Mal, als wir gemeinsam die Welt des Supermarkts verließen und die Realität betraten, überkam mich ein seltsames Gefühl der Nüchternheit, kaum dass wir über den Parkplatz gingen. Dort fiel mir das erste Mal auf, dass Monas Haare gar nicht blond, sondern eher von einem fast schon unnatürlichen Gelbton sind. Das Licht im Supermarkt lässt die Farben ganz anders leuchten, als es die Realität je könnte. Das ist wie mit der Wurst. Mortadella ist in Wahrheit ja auch nicht rosa, sondern eher grau. Hinzu kommt, dass Mona eine jener Sitzschönheiten ist, wie es viele Kassiererinnen sind. Sitzend sind sie wunderhübsch, doch sobald sie stehen, ist kaum noch etwas von ihrer Anmut vorhanden. Mona wirkte stämmig, wie sie da so ohne ihren Kittel mir vorweg über den Parkplatz ging. Ja, man musste es schon stampfen nennen. Sie erinnerte mich von hinten an diese unförmigen, depressiven Ponys. Auch Monas Proportionen stimmen nicht, insgesamt, aber auch untenrum im Verhältnis zu obenrum.
Über vier Jahre ist das her, und das spüren wir. Spüren es jeden Tag nur allzu deutlich. Da ist man machtlos. Liebe verdirbt eben. Und könnte man Liebe einfrieren, ich bin mir sicher, Mona hätte es getan. Da das nicht geht, versucht sie unsere Liebe mit Fotos zu konservieren. Unzählige Fotos, die sie in der Diele aufgehängt hat. Mir kommt es so vor, als sollten sie den Besuchern oder den Leuten, die an unserem Haus vorbeigehen und hineinspähen – wir leben in einem Dorf kurz vor Langenhagen, auf dem Land ist Neugier gang und gäbe –, ein Leben vorgaukeln, wie wir es in Wahrheit gar nicht führen. Sieht man nur diese Wand mit den unzähligen Fotos – in Rahmen aus dem Supermarkt, Mona bekommt Prozente –, kann man den Eindruck gewinnen, dass wir ein sehr aufregendes Leben führen würden und eigentlich recht glücklich sein müssten. Und je unglücklicher wir in Wahrheit werden, umso mehr Fotos hängt Mona an diese Wand. Es müssen nun bald fünfzig oder sechzig Fotografien sein, kein Wunder also, dass mir das Foto nicht gleich aufgefallen ist. Es hängen dort Fotografien, die anfangs noch eins zu eins die Realität dokumentierten, sie später beschönigten, dann vollkommen neu erschufen. Mona mag es, sich zu fotografieren. Sie ist besessen davon, jeden Moment, in dem sie sich auch nur ansatzweise glücklich wähnt, festzuhalten. Zu Beginn unserer Beziehung war das Geräusch des Auslösers fast ständig zu hören. Wie ein Geigerzähler, der statt radioaktiver Strahlung die Intensität unseres Glücks maß. Mona, die den Fotoapparat über unsere Köpfe hielt, während wir uns küssten. Hin und wieder fotografierte sie uns, während wir miteinander schliefen. Sie betätigte dann den Auslöser mehrere Male hintereinander, anfangs langsam, danach immer schneller, wie in Ekstase. Doch wie es so ist: Die Momente, in denen sie uns fotografierte, wurden seltener, und war ich anfangs irritiert, erschrak fast, war der Auslöser zu hören, so kränkte es mich später, wenn sie uns nicht mehr fotografierte, lagen wir nackt und verschwitzt nebeneinander im Bett und rauchten.
»Willst du uns nicht fotografieren?«, habe ich sie einmal gefragt.
»Na gut«, sagte sie und machte ein Foto von uns, auf dem hauptsächlich sie zu sehen ist. Ich bin blass und unscharf, abgeschnitten am Rand der Aufnahme zu erkennen.
Kurz darauf begannen wir Fotos zu machen, auf denen wir nicht glücklich waren, sondern nur noch so taten. Ich und Mona nackt auf kleinen, pummeligen Aufblastieren. Verkleidet als Hugenotten. Später inszenierten wir für diese Fotos unser Leben völlig neu. Fotografierten uns betrunken tuend. Stellten Feierlichkeiten nach, die so nie stattgefunden haben. Machten Fotos von uns, die uns scheinbar an Orten zeigen, an denen wir in Wahrheit nie gewesen sind. Immer geschickter wurden wir darin, die Realität zu beugen. Sehe ich mir diese Fotos an, kann selbst ich oft gar nicht mehr zweifelsfrei sagen, was wirklich geschehen ist und was nicht. Vermutlich kann man genau auf diese Art das Glück austricksen. Man kann im Nachhinein von bestimmten Situationen glauben, dass man in ihnen glücklich gewesen ist, obwohl man das in Wahrheit gar nicht war.
Und nun habe ich zwischen all diesen Fotos, die im Grunde zeigen, wie uns das Glück und vielleicht auch die Liebe allmählich abhandengekommen sind, gestern dieses Bild entdeckt. Auf den ersten Blick scheint es wie die anderen auch Mona und mich zu zeigen. Doch wir tragen darauf Indianerkostüme. Mona bestellt manchmal Kostüme, und wir haben dann versuchsweise Sex in Postbotenuniform beispielsweise. Obwohl es kaum etwas gibt, das mich weniger erregt als Postbeamte. Doch Mona glaubt, wenn wir uns als Fremde verkleiden, würde es die Sache mit der Liebe einfacher machen, und letztendlich auch das mit dem Glück. Doch Indianer sind wir nie gewesen. Da bin ich mir sicher. Indianer haben etwas Unheimliches, fand ich schon immer. Außer natürlich Winnetou. Winnetou nicht. Bei Indianern weiß man nie, wie alt sie in Wahrheit sind. Und trotzdem – Indianer faszinieren mich. Ja, erregen mich. Nicht so, dass ich sagen würde, ich sei ein Indianerfetischist. Aber doch erregen sie mich. Mir ist das etwas unangenehm, wegen Minderheiten und so. Sagt man, dass einen Indianer erregen, denken die Leute doch gleich, man wäre ein Nazi. Ich bin deshalb überzeugt, dass ich nie mit jemandem darüber geredet habe. Auch nicht mit Mona. Ganz sicher nicht. Und trotzdem ist da dieses Foto. Keine Ahnung, wie lange es da schon hängt, ohne dass ich es bemerkt habe. Diese Ungewissheit steigert meine Angst nur noch mehr. Was, wenn er wirklich schon die ganze Zeit da gewesen ist?
Das Foto muss vor kurzem aufgenommen worden sein, denn Mona hat darauf bereits jene Form der Üppigkeit erreicht, die sie auch heute, fast schon anklagend, vor sich herträgt. Sie sei meinetwegen so dick, sagt sie immer. Letzte oder vorletzte Woche hat sie geschrien: »Du hast mich doch erst so dick gekocht, mit deinen ständigen Chichi-Gerichten!«
Nachdem ich das Foto entdeckte, stand ich lange einfach nur da und betrachtete es. Etwas daran missfiel mir. Erst kam ich nicht drauf. Doch dann wusste ich mit einem Mal, was es war: Mona tut auf diesem Foto nicht nur glücklich. Sondern sie ist es anscheinend tatsächlich.
»Guck, da warten schon deine Freunde und wollen mit dir spielen«, sagt Mona verächtlich, als ich den Wagen vor dem Supermarkt parke. Vor dem Schaufenster meiner Kneipe haben sich bereits einige der rotgesichtigen Männer versammelt. Es sind die Stammgäste, mit denen ich hauptsächlich mein Geld verdiene. Unruhig gehen sie, wie jeden Morgen, vor dem Schaufenster auf und ab und beginnen fast schon hysterisch zu winken, als sie unseren Wagen auf den Parkplatz fahren sehen. Heute winke ich das erste Mal zurück.
Meine Kneipe, das Klaus Meine, ist nicht viel mehr als ein schmaler Anbau, den man vor ein paar Jahren nachträglich an den Supermarkt gebaut hat, ohne dass heute noch jemand sagen kann, warum eigentlich. Auch nach all den Jahren seines Bestehens wirkt er noch immer wie ein Fremdkörper. Eine Art längliche, gläserne Warze, die ein kleines Stück aus dem Supermarkt herausragt. Das Klaus Meine ist eng. Im Grunde gibt es nur den Tresen, vor dem acht Barhocker stehen, an denen man sich gerade so vorbeizwängen kann, will man zu den Toiletten, die sich im Inneren des Supermarkts gegenüber dem Kassenbereich befinden. Es gibt oft Ärger mit der Geschäftsleitung, die sich beschwert, wenn die Betrunkenen zwischen den einkaufenden Familien umherwanken. Gerade an Samstagen, wenn im Supermarkt Hochbetrieb herrscht. Und erst vor kurzem habe ich ein Schreiben von der Geschäftsleitung erhalten, in dem es heißt, ich habe dafür Sorge zu tragen, dass der gleichförmige Fluss des Konsums nicht gestört wird. Keine Ahnung, was genau das heißen soll.
Kommt man aus dem Klaus Meine in den Supermarkt, so ist es, als beträte man eine völlig andere Welt: das grelle Neonlicht, das einen empfängt, dazu die im Gegensatz zum Klaus Meine laute Geräuschkulisse aus schreienden Kindern, schwer verständlichen Lautsprecherdurchsagen und leiser verkaufsfördernder Musik. Die meisten machen sich vom Klaus Meine aus mit Sonnenbrille auf den Weg zu den Toiletten und versuchen dabei, so normal und unbetrunken zu wirken, wie es ihnen nur eben möglich ist. Betont gleichgültig schlendern sie dann an den Kassen vorbei. Manch einer nimmt sich noch einen leeren Einkaufskorb aus dem Eingangsbereich mit, um nicht zu sehr aufzufallen, oder winkt nonchalant einer der Kassiererinnen zu. Bis zum Mittag, manchmal frühen Nachmittag fallen sie auch gar nicht so auf, geht man nicht zu nah an ihnen vorbei. Erst im Laufe des Tages geraten einige von ihnen auf dem Weg immer mehr ins Trudeln, müssen sich an den Wänden abstützen, am Schwarzen Brett, an dem Zettel mit Angeboten von Kunden hängen, die anderen Kunden Unnützes verkaufen wollen. Es ist auch schon vorgekommen, dass einer stürzte, während die Kunden des Supermarktes an den Kassen standen, die Köpfe schüttelten oder demonstrativ wegsahen. Die am Tresen, dankbar für jede Abwechslung, beobachten den Toilettengänger gern, was es natürlich für diesen nicht gerade leichter macht. Wir sind dann die im Raumschiff Zurückgebliebenen, die Neil Armstrong zusehen, wie er mit seiner Fahne den Mond betritt.
Immer wieder gibt es Diskussionen mit der Geschäftsführung des SUPERBUHEI, und jedes Jahr muss ich wieder darum bangen, ob mein Vertrag verlängert wird. Gerade in letzter Zeit hoffe ich manchmal, er würde es nicht. Keine Ahnung, was ich dann täte. Trotzdem wäre ich insgeheim froh, diesen Leuten endlich zu entkommen. Diesen ewig gleichen Scherzen über Alkohol und untenrum. Diesem ständigen Lamentieren darüber, dass nichts geschieht, während sie tagein, tagaus hier herumsitzen und nichts weiter tun, als aus dem Schaufenster zu starren und zu saufen. Was soll da auch schon groß passieren?
Seit etwa vier Jahren betreibe ich jetzt diese Kneipe und werde jeden Tag wieder aufs Neue schmerzhaft daran erinnert, dass aus mir nichts wird. Da der Laden an die Öffnungszeiten des Supermarktes gebunden ist – es gibt keine eigene Eingangstür, die sich absperren ließe – muss ich jeden Tag von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends öffnen. Endlos lange Stunden, die ich damit zubringe, durch das große Schaufenster, das die gesamte Front des Ladens einnimmt, den Parkplatz zu beobachten. Oft tun die Gäste es mir gleich. Die Hocker lassen sich drehen, und dann sitzen ich und die Betrunkenen da und betrachten schweigend die hektische und manchmal auch trübselige Geschäftigkeit auf dem Supermarktparkplatz. Hin und wieder winkt einer der Trinker einem Kind zu, das schüchtern zurückwinkt, bevor es von seiner Mutter fortgerissen wird. Manche Familienväter halten ihre Söhne vor dem Schaufenster der Kneipe kurz fest, hocken sich neben sie und erklären etwas, während sie kopfschüttelnd auf uns zeigen.
Früher hat man wenigstens noch rauchen können. Doch seit sie das Rauchen im Supermarkt verboten haben, müssen wir rausgehen. Zumindest ich, der ich mich weigere, E-Zigarette zu rauchen. Meist stehe ich allein rauchend vor dem Schaufenster und starre hinein, damit niemand Alkohol klaut. Die Gäste winken mit ihren E-Zigaretten. Gäste! Ich muss immer lachen, wenn jemand jene Männer als Gäste bezeichnet. Gäste sind sie ganz sicher nicht. Sie benehmen sich, als würde das alles hier ihnen gehören. Als hätten sie mit ihren täglichen Besuchen ein Besitzrecht an der Kneipe erworben. An mir. Aktionäre des Alkohols. Andere – richtige – Menschen verirren sich nur selten hierher. Und wenn doch, so kann man ihnen ihr Unwohlsein schon kurz nach dem Betreten ansehen. Es gibt nicht viele Getränke im Klaus Meine, in denen kein Alkohol ist. Als ich eröffnet habe, hatte ich noch die Vorstellung, hier würden Familienväter mit ihren Kindern sitzen und sich bei einer Brause und einem Cappuccino von den Strapazen des Lebensmittelerwerbs erholen. Anfangs gab es noch verschiedene Brausesorten, teilweise sehr exotische wie Drachenfrucht oder Litschi. Doch schon kurz nach der Eröffnung wurde das Klaus Meine von den Trinkern okkupiert, die den gesamten Laden in Beschlag nahmen, so dass allein schon vom Platz her eigentlich niemand anders mehr hineinpasste. Nun ist die Fanta meist schal, nur die Cola hat Kohlensäure, weil viele gegen Nachmittag auf Jim-Beam- oder Bacardi-Cola (JimBiCo und BaCo) umschwenken, wenn das Bier sie bleiern und schläfrig hat werden lassen.
Diese Trinker sind Fluch und Segen zugleich. Ohne sie wäre der Laden vermutlich längst pleite. Trotzdem ertrage ich sie kaum noch und kann meine Abneigung ihnen gegenüber auch nicht verhehlen. Meist sind sie viel zu betrunken, um es überhaupt zu bemerken. Und tun sie es doch, kann ich mir sicher sein, dass sie es am nächsten Tag wieder vergessen haben. Sie vergessen wirklich alles.
Jeden Morgen stehen sie vor dem Supermarkt, harren angestrengt aus, und ein wenig fühle ich mich dann wie jemand, der einer richtigen Arbeit nachgeht und dessen Kollegen morgens vor dem Betriebsgebäude auf ihn warten. Es sind immer dieselben neun, zehn Gestalten. Ich frage mich, ob es vielleicht daran liegt, dass ich nur acht Barhocker habe, dass sie so früh kommen, ein, zwei also immer stehen müssen. Eine Art Reise nach Bedusalem. Sie bleiben, bis ich Feierabend mache – oder sie einfach nicht mehr können. In dem Fall bestelle ich ein Taxi und bin dem Fahrer beim Einladen des Betrunkenen behilflich. Von fast allen habe ich die Adresse in einem kleinen Karteikästchen hinter dem Tresen. Einmal traf ein Schreiben von einem Taxiunternehmen ein, in dem man mir mitteilte, dass der und der sich auf der Fahrt eingenässt habe und ob ich mich nicht an der Reinigung der Sitze beteiligen wolle. Rechtlich sei ich dazu natürlich nicht verpflichtet, hieß es da, doch trotzdem trüge ich ja zumindest eine Teilschuld an dem Malheur. Natürlich zahlte ich nicht.