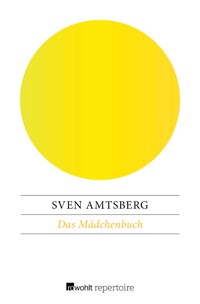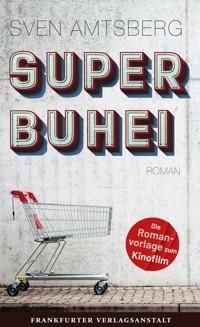9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Vergessen Sie alles, was Sie bisher zu wissen glaubten über Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt, Köln, Stuttgart oder München. Sven Amtsberg – Literaturentertainer und Tausendsassa – nimmt Sie mit auf eine Reise, die Ihren Blick auf Deutschland für immer verändern wird: Er führt Sie an bisher zu Recht vernachlässigte Orte, entdeckt neue Sehenswürdigkeiten, wo keine sind, und erzählt Geschichten über Persönlichkeiten, von denen Sie noch nie gehört haben. Man könnte das Lügen nennen, in Wahrheit ist es aber einfach nur ganz große Unterhaltung. «Vor Amtsberg ist kein Raum mehr sicher.» (Hamburger Abendblatt) Mit Gastbeiträgen von Tino Hanekamp, Clemens Meyer, Joey Goebel, Finn-Ole Heinrich, Tilman Rammstedt, Oliver Uschmann und Sylvia Witt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Die Wahrheit über Deutschland
Städtetouren für Besserwisser
Rowohlt Taschenbuch Verlag
Hallo Buchfreund,
mein Name ist Sven Amtsberg. Ich bin der sympathische Autor dieses Buches, das du vielleicht gekauft hast. Vielleicht stehst du auch noch in der Buchhandlung und überlegst, ob du es kaufen sollst. Ich denke: Ja, tu es. Denn ich spüre, dass es da eine Verbindung zwischen uns gibt, der nachzuspüren es sich lohnt. Wir, du und ich, wollen eintauchen in das Dickicht unserer Gefühle, vor dem Hintergrund einer Deutschlandreise, und während wir scheinbar das Land entdecken, entdecken wir in Wahrheit doch uns.
Ja, ich weiß, das habe ich schön gesagt.
Du glaubst vielleicht, so ein Buch, das ist doch an Anonymität nicht zu überbieten. Allein, wie das schon aussieht: Kühe auf dem Cover, damit Mädchen es niedlich finden. Das ist doch Kalkül. Außerdem kaufst du dir grundsätzlich keine Bücher mit Tieren vorne drauf, sagst du, sondern eher mit Waffen oder Frauen oder nur Schrift. Tschüss. Aber warte! Dieses Buch ist anders. Es ist ein nicht anonymes Buch. Und vielleicht glaubst du, mir wäre es egal, wer dieses Buch kauft, Hauptsache, es kauft überhaupt irgendwer. Aber lass dir versichert sein, dem ist nicht so. Mir ist wichtig, wer dieses Buch kauft. Und schlechte Menschen möchte ich nun bitten, dieses Buch wieder zurückzulegen und sich etwas über Nazis zu kaufen oder aber einen schönen Bildband zum Thema Ausbeutung.
Gute Menschen dagegen spitzen jetzt bitte die Ohren: Ich sitze gerade in einer Strandbar auf Borneo, habe die Augen geschlossen und spüre dich, lieber Käufer, liebe Käuferin, wie du in einer dieser liebevoll eingerichteten Buchhandlungen sitzt, um dich herum junge Damen in karierten Kostümen, und überall duftet es künstlich nach altem Papier und Intelligenz. Viele Leute sitzen ja einfach nur in Buchhandlungen, um durch die Scheiben gesehen zu werden. Es ist immer besser, in einer Buchhandlung gesehen zu werden als am Kiosk oder in der Metzgerei. Aber ich weiß, du bist anders. Du interessierst dich wirklich für etwas. Und lass dir gesagt sein: Deutschland, du und das Leben – ihr seid gar nicht so unterschiedlich, wie du vielleicht denkst. So wie du und das Leben auch nicht an allen Stellen schön seid, so ist auch Deutschland an manchen Stellen schön und an manchen überhaupt nicht. Ich bin es leid, dass alle sich immer nur dasselbe ansehen. Die ganzen verdammten Schlösser und Denkmäler von Menschen mit langen, gelockten Haaren, die mit uns beiden so viel zu tun haben wie Blasmusik und Folklore. Wir wollen Deutschland kennenlernen, wie es wirklich ist. Wir wollen Sachen wissen, die kein anderer weiß. Wir wollen dorthin gehen, wo es dunkel ist, und mit meinem Sachverstand Licht an diese Orte bringen. Wir wollen wieder etwas erzählen können. Etwas, auf das die Leute nicht nur entgegnen: Hau ab, du Sack. Wir wollen, dass die Leute auf uns zeigen und sagen, guck mal die.
Wir, das sind du, dieses Buch und ich. Wir sind nun eine Einheit. Community is a warm gun, wie der Engländer sagt. Eine Woche werden wir nun zusammen dieses Land bereisen. Und zwar nicht irgendwann, sondern exakt jetzt. Kauf dieses Buch und dann fahre nach Leipzig. Nimm sonst nichts mit. In diesem Buch ist alles, was du brauchst. Du kannst die gelesenen Seiten heraustrennen, zusammennähen und als Zelt oder Overall verwenden. Man kann damit auch die Zahnzwischenräume reinigen. Ein Haus bauen – dann braucht es allerdings tausend Bücher. Aber die kann man dir bestimmt bestellen.
Yippie,
Dein Sven
Du wirst in den nächsten Tagen schon bald merken, dass ich mich sehr gut in Deutschland auskenne. Weshalb mich Freunde oft auch Deutschlandsven nennen und ich immer wieder zu offiziellen Anlässen eingeladen werde, wo ich urtypisch deutsche Kunststücke vollführe oder auf zwei Fingern das Deutschlandlied blase. Manchmal wache ich sogar nachts auf und denke, hey, Eule, da hast du doch gerade wieder mal von Deutschland geträumt. Dann stehe ich vielleicht auf einem deutschen Berg und blicke in einen deutschen Wald. Trage in meinen Träumen gerne auch Tracht und zeige meine wunderschönen Kniescheiben. Ich habe weiße Beine, wie es sich für einen Deutschen gehört.
Wir wollen uns gegen den Uhrzeigersinn von Osten in den Norden vorarbeiten, und von dort am Ende zu Fuß in die Hauptstadt einmarschieren.
Leipzig ist dabei die einzige Stadt im Osten in diesem Buch. Das ist Absicht. Ein Sonderband ist in Planung, Die Wahrheit über den Osten, der dann in Farbe erscheinen wird, gebunden, sehr viel größer als dieses Büchlein. Für diesen möchte ich mir die anderen Städte noch aufheben. Auch Leipzig wird darin wieder auftauchen, bunter. Sehr viel bunter.
Leipzig, das ist auch immer ein Neuanfang, denn das Leipzig, so wie es heute da steht, ist im Grunde erst in den letzten zwanzig Jahren gewachsen. Das alte Leipzig hat man zu großen Teilen abmontiert und auf die übrigen Bundesländer verteilt, so findet sich ein Teil Leipzigs beispielsweise in Chemnitz wieder, ein anderer in Jena oder Magdeburg.
Leipzig, das war schon frühzeitig eine Vision, doch fehlte damals das nötige Geld, um all das umzusetzen. Doch nun ist es da, und man hat Meisterliches geschaffen. Alte Gebäude wie beispielsweise die Nikolaikirche wurden ebenfalls demontiert und in den Nahen Osten verkauft, um eine neue, größere Nikolaikirche zu errichten. Die ursprüngliche findet sich nun in einer Stadt im Libanon, wo sie Freude, aber auch Unverständnis stiftet.
Auch das Völkerschlachtsdenkmal war ursprünglich wesentlich kleiner und erinnerte eher an einen Ferienbungalow als an dieses klotzige Pummelchen, das nun aus ihm geworden ist.
Leipzig, das ist die Stadtwerdung der Superlative. Architekten aus der ganzen Welt haben sich hier ausgelebt, und so finden sich ganz verschiedene Stile, die nur der Wunsch nach Exorbitanz eint: Der neue Hauptbahnhof, das City-Hochhaus oder die alte Börse, all das sollte erst in New York errichtet werden, doch den New Yorkern war es zu pompös, zu wenig Understatement, wie man es sonst dort gewohnt war. New York, das hieß Puzzeln im Kleinen, wohingegen in Leipzig seit dem Fall der Mauer die Devise gilt: Big Is The New Large.
Ich möchte, dass Sie nachts zu dieser Tour aufbrechen. Starten Sie gegen Mitternacht im Ilses Erika in der Bernhard-Göring-Str. 152. Trinken Sie dort, bis es hell wird. Anschließend lassen Sie sich mit einem Taxi bis zur Karl-Liebknecht-Straße fahren. Das ist zwar nicht weit, aber besser ist besser.
Sie wissen, nun müssen Sie sich gut konzentrieren. Nach außen hin soll Sie eine Aura des Sachverstands umwehen. Keine leichte Aufgabe um diese Zeit, leicht angetrunken, mit einem seltsamen Buch mit Kühen auf dem Cover in der Hand.Aber ich weiß, dass Sie das schaffen. Setzen Sie sich ruhig, wenn Ihnen danach ist. Die Straßen Leipzigs sind so sauber, dass man davon essen könnte. Könnte. Gehen Sie nah an das Buch ran und lesen Sie ruhig laut vor.Beginnen wollen wir erst mit etwas ganz, ganz Schönem, das Ihnen immer wieder begegnen wird. In Ihrem Leben, aber auch auf der Karl-Liebknecht-Straße.
1.1. DER LEIPZIGER WALD
Überall, u. a. Karl-Liebknecht-Straße
Auf den Leipziger Wald stößt man immer wieder. Manchmal sind es einzelne Bäume, dann wieder ganze Rudel, die einen bedrängen. Doch der Stadt reicht das nicht. Bis 2015 soll Leipzigs Waldanteil von 7 Prozent auf 10 Prozent erhöht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Wald natürlich auch dort wachsen, wo heute noch Häuser stehen. Sehr zum Verdruss derer, die dort wohnen. Denn so schön der Wald auch ist, so unhygienisch ist es doch, darin zu leben. Wald – das ist etwas für Tiere und Pilze. Und die einzige Hoffnung, die den Menschen bleibt, ist die, dass es ewig dauert, bis aus einem Baum ein Wald wird.
Hier an der Karl-Liebknecht-Straße hat man schon einmal damit begonnen. Ein Baum, aus dem bis 2015 ein Wald geworden sein soll, der über sich aber auch die Straße, die Wiese hinauswachsen soll und sich spätestens 2014 das Hochhaus geholt und es in Wald verwandelt haben soll. Wir werden wiederkommen und nachsehen.
Folgen Sie nun der Karl-Liebknecht-Straße, bis Sie rechterhand einen Indianer in der Luft schweben sehen. Kein Flachs.
1.2. VEB-INDIANER – DER INDIANER IN LEIPZIG
Karl-Liebknecht-Straße
Nicht viele wissen, dass die Idee der Indianerei ursprünglich aus Deutschland stammt. Um 1930 war es, als sich im Gebiet der Stadt Leipzig die ersten Indianer zusammenfanden, wo sie teilweise noch heute leben. In der Stadt selbst sieht man sie natürlich kaum noch, man findet sie hauptsächlich in den unzähligen Parkanlagen, wo sie tagsüber oft eins mit der Natur werden, sodass sie von Nichtindianern kaum zu sehen sind. Das eigentliche Indianerleben beginnt erst mit Einbruch der Dunkelheit, wenn man die Tipis und den Marterpfahl aufbaut und ein wenig seinem Handwerk nachgeht.
Indianerwissenschaftler schätzen, dass im Großraum Leipzigs noch immer mindestens zehn verschiedene Indianerarten anzutreffen sind, u. a. die Apachen, die Irokesen oder die Miltitz.
Die Idee der Indianerei stammt ursprünglich von Horst Mahler, dem Urvater aller Indianer. Und man kann sicher vieles über Mahler denken, aber eins muss man ihm lassen: Die Idee der Indianerei ist großartig und genial zugleich. Mahler wollte diese immer als Kontrapunkt zum hektischen Treiben der Gesellschaft verstanden wissen. Und wer weiß, vielleicht hätte sie sich durchgesetzt, wäre die Zeit eine andere gewesen – oder vielleicht auch nur der Ort. Denn damals war Leipzig noch nicht dieses aufgeklärte Fleckchen Erde, das es heute ist. Anfangs überforderte die Indianerei den Ostdeutschen. Denn ihre Grundmaxime ist die Freiheit. Ihr huldigt der Indianer beispielsweise dadurch, dass er ständig nackt ist. Sein einziges Zugeständnis an die Regeln der Gesellschaft ist ein kleines Läppchen vor dem Gemächt.[1] Der Indianer arbeitete nicht, sondern ernährte sich stattdessen von Gebüsch und den wenigen freilaufenden Tieren in Leipzig, wo die erste Indianersiedlung der Welt an der Karl-Liebknecht-Straße entstand. Noch immer erinnert ein Denkmal daran.
Wo heute Straßenbahnschienen liegen, fand sich früher eine Eisenbahnlinie, die der Indianer nach Lust und Laune überfallen konnte, um sich und seinen Stamm so mit dem Notwendigsten zu versorgen. Hinzu kam, dass hier ausreichend Platz vorhanden war und die Indianer von den Bewohnern geduldet wurden. Ja, diese fast froh schienen, dass sie durch das bunte Indianertreiben aus ihrem Alltagstrott gerissen wurden.
Anfangs bestand die erste Indianersiedlung nur aus Horst Mahler und seiner Frau Sabine. Später stießen andere Indianer hinzu. Angelockt vom Reiz des Neuen und der euphorischen Freude, die dieses stets geschminkte Volk auszusenden schien, waren es nicht gerade wenige Leipziger, die sich spontan der Indianerei anschlossen.
Am Wochenende feierte man laut und ausgelassen, und eine Art Vorläufer des späteren Swingerclubs etablierte sich früh in der Leipziger Südvorstadt unter Leitung Mahlers. Neben dem Handel mit Selbstgemaltem, Selbstgetöpfertem und Selbstgebatiktem war es eben jenes Etablissement, das den Indianern ein Auskommen bescherte, denn dort gingen auch Menschen wie du und ich ein und aus. Meist nur um bei einem Schnäpschen dem Indianer beim Schnackseln zuzusehen.
Jahre lebten die Indianer glücklich auf diesem Gebiet. Selbst Adolf Hitler, der zwar alles Andersartige erst einmal grundlegend verachtete, bevor er es dann hasste und vernichtete, duldete die Indianer. Denn, wie er selbst sagte, spüre auch er in sich einen gewissen Hang zur Indianerei, und was er selbst empfinde, könne nicht verkehrt sein und andersartig schon einmal gar nicht.
Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges entdeckte der Amerikaner die Indianer und lockte sie mit falschen Versprechungen in sein Land, wo man noch heute Unsummen mit Hochglanzindianerfilmen verdient. Spätestens seit dieser Zeit geht es den Indianern in Leipzig nicht mehr so gut. Irgendwie halten sie sich über Wasser. Nicht zuletzt wegen der anständigen Bürger, die Speisereste in die Natur schmeißen, damit diese sich davon bedienen können. Darüber hinaus vermietet sich der Indianer heute für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder Konfirmationen, wo er dann verrückt tanzt oder einfach nur halbnackt und geschminkt unter dem Tisch der Gesellschaft kauert.
Nur ein kleines Stückchen weiter finden Sie links die Braustraße, in die biegen Sie ein.
1.3. THE KING IN LE
Braustraße 28
Über die Zeit Elvis Presleys in Leipzig wissen nur die wenigsten etwas. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis, über das selbst Elvis noch zu Lebzeiten schützend seine Hand breitete. Nur durch einen Zufall bin ich auf diesen Umstand überhaupt aufmerksam geworden und möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei der Familie Schworz bedanken, die ich bei meinem sechsmonatigen Rechercheaufenthalt vor Ort kennenlernte. Diese war es, die mir zu verstehen gab, dass Elvis eine Zeitlang bei ihnen gelebt hätte. Der Elmar, wie er sich anscheinend genannt hatte.
Sein Aufenthalt in dem Haus in der Braustraße 28, von November 1958 bis Anfang 1959, war generalstabsmäßig vorbereitet. Rückblickend kann man sagen, dass Elvis’ gesamte Armeezeit nur als Tarnung für seinen Leipzigaufenthalt diente. Denn, man hätte doch niemals Elvis Presley – ich meine, hallo, Elvis Presley! – zum Armeedienst eingezogen, hätte dieser nicht inständig darum gebeten. Zurückgezogen im Osten Deutschlands, wollte Elvis etwas tun, was er noch nie getan hatte – er wollte Songs schreiben. Er war es leid, immer nur die Texte anderer[2] zu Melodien anderer zu singen. Er spürte, dass da etwas in ihm war. War er allein, summte er manchmal Melodien, die seiner selbst zu entspringen schienen. Ein hoher Singsang, der sich so anfühlte wie das, was er in sich spürte, dieses flauschige Gemisch aus Angst und Größenwahn.
Sein Manager Colonel Parker hatte nie gewollt, dass Elvis Songs schrieb. Wusste er doch um dessen Melancholie, das Faible für Naturbilder und phantasiesprachliche Ausdrücke.[3] Er glaubte, all das würde die Fans verschrecken – und hatte sicher auch recht damit.
Es war an einem Donnerstag im März 1958, als Enrico Schworz einen Anruf bekam. Er verstand wenig von alledem. Es war die Zeit, da Englisch im Osten verboten war. Aber anscheinend ging es darum, dass jemand ein Zimmer im Untergeschoss des Hauses mieten wollte. Dieses Zimmer vermieteten die Schworz’ immer mal wieder an alleinstehende Männer, die sich dort einschlossen, tranken und Gedichte produzierten. Noch heute gibt es das Schworz-Stipendium für alkoholsüchtige Dichter, von denen man meist nie wieder etwas hört.
Vermutlich war es Presley persönlich, der sich in gebrochenem Deutsch als Elmar Preßler vorstellte und sagte, er wolle gern das Zimmer mieten. Ursprünglich wollte er bis 1960 in Leipzig bleiben, um dort ein Konzeptalbum zu erarbeiten, das hauptsächlich aus sphärischen Synthesizer-Sounds bestehen sollte. Auch textlich wollte er weg von den Boomboom-Lyrics, wie er es nannte, hin zu anspruchsvolleren Themen. Schon lange begeisterte er sich für das Übernatürliche, und hatten andere in ihrem Leben, wenn es hochkam, ein Ufo gesehen, so waren es bei Elvis zwei. Doch nicht nur das: Elvis’ Vater, Vernon Presley, will während der Geburt von Elvis ein blaues Licht am Himmel gesehen haben, von dem er immer wieder erzählte. Mit diesem Wissen erscheint es uns fast zwangsläufig, dass Elvis vorhatte, eine Art Science-Fiction-Musical zu erschaffen. Thematisieren wollte er die Liebe zwischen einer blauen Außerirdischen und sich. Grundstory sollte sein, dass die Rohstoffvorkommen auf der Erde knapp werden, sodass man jemanden losschickte, um auf dem Mond den begehrten Rohstoff zu holen. Dabei entdeckt er The Blue Girl, wie der erste Song heißen sollte.
Wie wir alle wissen, scheiterte dieses Projekt gründlich. Elvis schrieb in seinem ganzen Leben nie auch nur einen einzigen Song.[4] Frustriert begann er mit der Schauspielerei. In 27 Filmen wirkte er mit, und der erste, den er gleich nach seiner Rückkehr drehte, hieß dann auch passenderweise G.I. Blues, eben als Hommage an seine Leipzigzeit und das großartige Science-Fiction-Musical um das blaue Mädchen, das er hier hatte schaffen wollen.
Dass Elvis sich gerade Leipzig ausgesucht hat, lag vermutlich an seiner Liebe für Wagner, der hier geboren wurde. Elvis hoffte, noch etwas von dessen Geist in der Stadt zu spüren. Natürlich tarnte Elvis sich. Schnitt sich die Haare kurz. Trug eine dicke Brille, wie sie zu jener Zeit in der DDR en vogue war. Es gibt einen Schnappschuss aus jener Zeit, von dem wir heute annehmen, dass es sich bei dem Mann um Elvis handelt.
Viel dünner sieht er darauf aus. Ist auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Doch bei näherer Betrachtung fällt die leicht schräge Haltung des Kopfes auf. Der wache, ja, fast bohrende Blick, der den Betrachter einschüchtert, wie er auch schon auf dem Cover von Elvis As Recorded At Madison Square Garden zu finden ist. Dazu der halboffene Mund, der ihm immer etwas Abenteuerlustiges verlieh, durch den Elvis in Wahrheit aber Luft einsog, litt er doch zeit seines Lebens unter Polypen, die ihm das Atmen an Sommertagen erschwerten.
Zurück, und dann wieder die Karl-Liebknecht weiter runter. Überqueren Sie irgendwann die Straße, wenn es Ihnen möglich ist. Bitten Sie sonst Leute, dass sie Ihnen behilflich sind. Die Leipziger sind nett, und sie sind Menschen wie Sie gewohnt. Trauen Sie sich. Meist lädt man Sie noch ein zu Soljanka und Schubberschwapp, eine Art Party-Getränk nebst Ritual. Lassen Sie sich überraschen …
Leipzig hat seinen ganz eigenen Sog, und meistens bleibt man länger, als man will. Die Leute reichen einen herum, bekochen einen, lassen einen bei sich wohnen, und eh man sich versieht, ist man Teil Leipzigs geworden. Kaum wer, der heute hier lebt, hat das wirklich beabsichtigt. Sie kamen wie Sie und blieben für immer.
Irgendwann kommt rechts die Schletterstraße. Das Eckgebäude, das ist es. Machen Sie ein Foto von sich davor.
Sie finden dort das Bild eines Arztes. Berühren Sie es mit der Hand. Riechen Sie daran. Es lohnt sich.
1.4. DIE SCHÖNHEITSCHIRURGIE – EINE PFLANZE DES OSTENS
Schletterstraße
Nur wenigen ist bewusst, dass die Schönheitschirurgie nicht aus Florida stammt, sondern aus Ostdeutschland. Genauer gesagt aus Sachsen. Wir alle kennen den Ausspruch In Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Wobei dieses wachsen nicht ganz richtig ist, denn eigentlich müsste es heißen: In Sachsen, wo die Mädchen schön gemacht werden. Aber das würde sich nicht reimen.
Mit der Schönheitschirurgie begann man hier Mitte der Sechziger. Man hatte es leid, diese ganzen hässlichen Menschen, und wenn man schon nicht den Reichtum von drüben hatte, so wollte man wenigstens schöner sein. Hier in Leipzig fanden die ersten Busenexperimente stand. Hier ließ man Fett verschwinden, formte Hintern und Gesichter.
Auch Honecker war nicht immer diese sozialistische Ausgeburt an Altherrenschönheit, wie wir sie von den unzähligen, immer gleich wirkenden Fotografien her kennen. Auch er glich einmal in Aussehen und Habitus einem Breschnew, und erst die Errungenschaften der Leipziger Schönheits-chirurgie schufen diesen ostdeutschen Beau, zu dem man gerne aufsah und den oft schon Jugendliche als Schönheitsideal anhimmelten.
Silikon kannte zu jener Zeit hier natürlich niemand. Die Rohstoffe waren knapp, und wenn es etwas gab, so war das Braunkohle und Stahl. Und wenn man etwas konnte, dann sich arrangieren. So kochte man, beispielsweise, vorzüglichen Braunkohlekaffee. Formte aus Stahl und Wasser Bananen, die tatsächlich bei der Berührung mit Luft gelb wurden und so dem Kunstbananenesser ein wenig das Gefühl von Exotik vermittelten. Ganz ähnlich war es mit der Schönheitschirurgie.
«So ein Mensch ist im Grunde auch nichts anderes als ein kleines Gebäude, in dem viel Wasser steht. Eine menschliche Hütte, die man ganz nach Belieben umbauen oder abreißen kann», sagte Dr. Gerd Diotr, ein Pionier auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie. Unter seinen magischen Händen wuchsen Milliarden von ostdeutschen Brüsten. «Diotr, Diotr, lässt die Bubbels groß werdre», sangen damals schon die Kinder.
Diotr ist es auch, der erst so etwas wie ein Schönheitsideal geschaffen hat. Er sorgte dafür, dass das Bewusstsein und der Wunsch nach Veränderung nicht vor dem eigenen Körper haltmachte – ansonsten war es ja auch nicht so weit her mit der Veränderung zu jener Zeit. Diotr schürte die Unzufriedenheit.
«Dünnsein ist nicht gleich Dünnsein», pflegte er potenziellen Patienten zu sagen und präsentierte selbst Abgemagerten Fotografien von noch dünneren Menschen. Großbrüstigen zeigte er Aufnahmen von noch Großbrüstigeren – die, wie sich später herausstellten, allesamt gefälscht waren. Er selbst war es, der sich mit zwei abgezogenen Hunden, die er sich um seine schmale Knabenbrust gebunden hatte, fotografieren ließ. Dazu trug er Brustwarzen aus dunklen Waldfröschen. Täuschend echt.
Anfangs las Diotr hässliche Menschen von der Straße auf und versprach ihnen, sie schönzuoperieren. Ein René Böhm ist hier entstanden, eine Renate Kollenschwacker. Sämtliche Indianer aus allen DEFA-Indianerfilmen wurden hier erschaffen, und gerade die Siebziger und Achtziger waren eine goldene Zeit für Dr. Diotr. Erst mit dem Ende der DDR veränderte sich auch das Schönheitsideal. Mit einem Mal wollte niemand mehr aussehen wie ein Indianer, stattdessen wollte die ganze Welt sein wie amerikanische Schauspieler – Diotrs Meinung nach eine wahllose Aneinanderhäufung von Überproportionen. Doch seine Meinung interessierte kaum noch wen. Immer weniger ließen sich in der Klinik in der Schletterstraße operieren. Viele ließen sich die Braunkohle aus dem Busen entfernen und stattdessen durch das umweltfreundlichere Silikon ersetzen. Alles wurde mit einem Mal größer, der Mensch wurde mehr. «Die Erde schwerer, sie sank sogar ein Stückchen», so Forscher.
Dr. Diotr versuchte noch mit Schnurrbärten und großen Brillen das Ruder des Schlachtschiffes Schönheit herumzureißen – doch leider vergebens. In seiner letzten großen Operation operierte er sich selbst fremd. Seitdem weiß niemand mehr, wie er aussieht. Denn während das Gebäude verfällt und hässlich wird, behaupten immer wieder Menschen, sie hätten ihn gesehen, den Leipziger Schönheitsengel.
Noch heute findet sich eine Fotografie Diotrs an der Hausfassade, in seinen Händen der Bauplan der Schönheit.
Nun möchte ich, dass Sie sich konzentrieren. Denn jetzt wird es etwas kompliziert. Gehen Sie die Schletterstraße weiter geradeaus. Rechts gehen Sie ein kleines Stück in die Bernhard-Göring-Straße. Richtig, das ist die Straße, in der das Ilses Erika ist. Aber das ist zu weit, um dort noch einen Schlummifix zu trinken. Also weiter, und dann schnell wieder links in die Hohe Straße, der Sie folgen, bis diese auf die Kohlenstraße trifft. Dort sieht es trist aus. Ein bewachter Parkplatz, auf dem niemand parkt. Ein überwucherter Wendeplatz. Auch dieser ist nicht schön, aber interessant.
1.5. JOANA RODRIGUES ODER WIE DER FADO NACH LEIPZIG KAM
Hohe Straße Ecke Kohlenstraße
«Mecheno di rechio constessa, Mi nemo ressionioni meloco Leipzig», sang Joana Rodrigues in ihrem letzten großen Hit: «Das Leben ist ein großer Vogel, und ich weiß, wo er lebt: Leipzig.»
Joana Rodrigues war die wohl bedeutendste Fadosängerin der Welt. Fado, das ist die traurigste Musik der Welt. Oft bestehen Fadolieder nur aus zwei Tönen, die in schneller oder langsamer Abfolge wechseln. Gerne auch beides. Oft nur gesummt oder gehaucht oder ganz, ganz hoch gesungen, wodurch ein wehklagender Laut entsteht.
Rodrigues hatte durch unglückliche Umstände Anfang der Neunziger Hans Zumaller kennengelernt, einen Portugalurlauber, der nicht das erste Mal versuchte, Frauen nach Leipzig zu locken. Immer wieder, schrieb Rodrigues, bedrängte er sie, bot ihr viel Geld für Fado, aber vor allen Dingen Liebe, sodass sie schließlich einwilligte.
Zumaller hatte ihr gesagt, ihm würden in Leipzig mehrere Fabriken, Villen und Autos gehören, doch in Wahrheit besaß Zumaller nur einen leeren Wendeplatz. Dort hauste er in der Mitte, in einer Konstruktion aus alten Plastiktüten, Einwegflaschen und Stöcken, wie Rodrigues es nur von den Indios her kannte, bei denen sie eine Zeitlang gelebt und gelernt hatte, mit sehr wenig sehr unglücklich zu werden.
Noch am Abend ihrer Ankunft ging Zumaller los und kam mit einigen Plastiktüten wieder, mit denen er die Unterkunft künstlich vergrößerte. Sie stand an der Stelle, an der heute das Gras versucht, die Vergangenheit zu überdecken. Kamen Autos, baute er alles ab, ließ die Fahrer für einen geringen Obolus wenden, baute anschließend alles wieder auf.
Schon allein berufsmäßig war Rodrigues auf die Traurigkeit angewiesen. Glück, das war schlecht fürs Geschäft, und wann immer es kam, wusste Rodrigues es doch durch geschickte Schachzüge wieder zu vertreiben. Liebte sie einen Mann, verließ sie ihn sofort wieder. Ihrer Lieblingskatze Moléstia hatte sie das Fell abrasiert. Sich selbst einmal wegen ihrer Schönheit das Gesicht mit einer Fadoschere zerschnitten. Fadoscheren sind sehr scharf und dafür gemacht, glückliche Sachen zu zerstören. Oft dienen sie dazu, Fotos zu zerschneiden, die das Glück abbilden oder aber Gesichter, Häuser, Tiere.
Rodrigues glaubte auf dem Wendeplatz, unter den Planen, mit diesem unsympathisch riechendem Wesen, dem ein dicker Bauch aus dem Bauch wuchs, würde sie ihre besten Fadohits schreiben. Sie probierte sich daran, Fadolieder auf Deutsch zu texten. Und ihr erstes Fadostück hieß dann auch gleich Hans:
Hans du traurigkeit
haut haare liebe no no no
ich gehe du gehst
zusammen no
portugal gut
hans schlecht
sehr schlecht
Jeden Tag stand sie nun vor der Nikolaikirche und sang ihre Lieder. Wartete darauf, entdeckt zu werden, während Hans dazu unansehnlich tanzte, herumwirbelte, sich auf den nackten Bauch schlug, wahllos Kinder griff und sich diese in den Speck drückte.
Doch es brachte kaum etwas ein. Hatte Rodrigues es in Portugal mit Fado zu einigem Reichtum gebracht, so kam sie hier gerade so über die Runden. Sie tranken Wasser aus Brunnen, aßen Gefahrgut und Eier, die zu jener Zeit noch nicht so viel kosteten, galt doch Leipzig lange als die Eierhochburg schlechthin.
Doch Portugiesen waren zu jener Zeit nicht nur selten, sondern auch nicht wohl angesehen. Ganz im Gegensatz zu heute, wo der Portugiese neben dem Mongolen zum Lieblingsausländer des Leipzigers gehört. Und so waren es andere, die mit deutschem Fado Erfolge feierten. Ingrid Peters beispielsweise, die als deutsche Fadokönigin gilt und mit Hits wie Afrika unsterblich wurde.
Eines Tages, als Zumaller vom Essensrestesammeln zurückkehrte, mit einer bunt bemalten Pfandflasche, die er Rodrigues zum Geburtstag aufgelesen und mit Eierfarben bemalt hatte, fand er sie auf dem Wendeplatz liegen, reglos und kalt. Auf ihrem Leichnam saß ein Rotkehlchen, das ihn vorwurfsvoll ansah und kurz darauf zu singen begann, so schön, wie noch nie zuvor ein Vögelchen gesungen hatte. Dann schwang der Vogel sich auf in den Himmel, nur um sich anschließend auf Zumaller zu stürzen. Hackte auf ihn ein. Vertrieb diesen von hier.
Das Rotkehlchen von Leipzig gibt es auch heute noch. Menschen sehen es, wenn sie sehr traurig sind. Und sehr allein. Es taucht auf Fensterbänken und Zehen auf, setzt sich nieder und singt Lieder. So traurig, so depressiv, dass es den Menschen stets noch etwas schlechter geht und sie das Rotkehlchen zu vertreiben versuchen.
Es geht die Sage, im Inneren des Rotkehlchens lebe Rodrigues. Wenngleich das Vögelchen viel zu klein dafür ist, glaubt man doch hartnäckig daran. Nur Zumaller nicht. Von ihm stammt die Biographie Fadomaso – mein Leben in der Einbahnstraße, die sich aber nur recht mäßig verkaufte. 2008 zog es Zumaller nach Mallorca, wo er nun den größten Wendeplatz Europas betreibt.
Noch heute kommen oft Angehörige und/oder Portugiesen hierher, um zu trauern. Denn an dieser Stelle starb die traurigste Stimme der Welt. «Quejero muliokiono jero – Hier ist nun der Fado begraben», sagte einst Juan Poppke vom 1. LFV – dem 1. Leipziger Fado Verein über diesen Ort.
An der Stelle, an der es geschah, wachsen heute wieder Blumen. Dazwischen sehen wir noch immer die Asche von Rodrigues’ Leichnam – obwohl diese gar nicht hier bestattet worden ist, sondern in Faro. Es ist der Wind, der diese wieder hierhertreibt. An die Stelle, an der sie so unglücklich war wie nie zuvor.
Wie’s jetzt weitergeht, ist im Grunde viel zu kompliziert, um es zu beschreiben. Fragen Sie die Leute. Auch wenn es noch früh ist, fragen Sie trotzdem. Tun Sie bitte seriös. Geben Sie sich Mühe, deutlich zu artikulieren. Üben Sie diesen Satz erst einmal alleine für sich. Vielleicht mit einem Korken im Mund, wie alle großen Schauspieler das machen.
«Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin nicht von hier. Aber wie komme ich denn, bitte sehr, zum Wilhelm-Leuschner-Platz?» Hören Sie anschließend gut zu und tun Sie, wie Ihnen geheißen.
1.6. MIRO
Wilhelm-Leuschner-Platz
Den katalanischen Künstler Joan Miró kennt jeder, wohingegen den sächsischen Johannes Miro niemand kennt. Johannes Miro heißt eigentlich Hannes Mirosevicz und hegte zeit seines Leben den Wunsch, ein bedeutender Maler zu werden. Ein Wunsch, der verwundert, wuchs Hannes doch in einer Familie auf, der Kunst ohnehin fern war, aber die Malerei im Besonderen. In dem Haus der Mirosevicz waren Farben verboten. Dort fand sich nichts, das bunt war, und gab es doch einmal etwas, so schabte Herr Mirosevicz mit einem Farbschaber die Farben ab, oder man setzte das bunte Stück so lange der Sonne aus, bis die Farben verblichen waren.
Dieses Buch widme ich den Mirosevicz. Deshalb beinhaltet es keine Farben. Euer Sven Amtsberg.
Niemand wusste darum, woher dieser aberwitzige Wunsch Hannes’ herrührte, Maler zu werden.
«Scheiße Farben», schrie Utze Mirosevicz, Hannes’ Mutter, und schlug ihrem Sohn ins Gesicht. Als sich seine Wangen daraufhin rot verfärbten, gleich noch einmal. «Scheiße Farbe.»
Vermutlich war es Hannes’ Wunsch, sich von seiner Familie abzugrenzen. Denn wenn er vielleicht auch nicht wusste, was er werden wollte, so doch ganz sicher nicht so wie seine Eltern.
Nur, dass es damit natürlich nicht getan war. Picasso war ja auch nicht Maler geworden, nur weil er nicht hatte Schlachter werden wollen. Ein Maler braucht neben Farben vor allem Disziplin. Frühes Aufstehen ist für den Maler oberste Pflicht, denn morgens sind die Augen am größten und die Farben am schönsten. Hinzu kommt viel Training. Denn ein Maler muss erst einmal alles gemalt haben, was es gibt, bevor er dann etwas malen kann, was er sich selbst ausgedacht hat.
Mirosevicz konnte nicht malen. Mirosevicz konnte nur früh aufstehen. Wochenlang tat er das. Sah sich alles an. Malte anschließend. Es war so schlecht, dass er am nächsten Tag oft noch nicht einmal mehr selbst erkannte, was er da hatte malen wollen. Seine nackten Frauen sahen aus wie altes Obst. Seine Landschaften glichen Brät vorm Kuttern. Es war, als besäßen seine Hände ein Eigenleben. Schlendriane, nannte er sie. Glaubte tatsächlich, dass seine Hände nachts, wenn er schlief, wach waren. An seinem Kopf saßen und sich über ihn lustig machten. Im Stillen hegte er die Hoffnung, sie würden, während er schlief, bedeutende Werke des ausgehenden 20. Jahrhunderts schaffen, und so ging er tatsächlich eine Weile mit Palette, Leinwand und Ölfarben ins Bett, in der Hoffnung, am nächsten Morgen neben einer sächsischen Mona Lisa oder ostdeutschen Sonnenblumen zu erwachen. Doch meist war er nur von oben bis unten mit Farben besudelt, die sich zwar kaum wegwaschen ließen, aber ihm immerhin so eine Aura des Besonderen verliehen.
Eine Art Erweckungserlebnis hatte er, nachdem er den DEFA-Film Der Bildhauer gesehen hatte – die Liebesgeschichte eines Bildhauers zu einem Stein, den wir heute als Kritik daran verstehen müssen, den Menschen als Individuum verändern zu wollen. Stein und Bildhauer lieben sich darin gleichermaßen. Doch der Bildhauer bearbeitet den Stein. Formt ihn, bis dieser augenscheinlich schöner geworden ist. Mit einem Mal merken beide, wie sie sich entfremden. Der eine ein schöner Stein, der andere noch immer hässlich. Schließlich kommt es, wie es kommen muss, die Liebe gerät ihnen abhanden. Der Bildhauer verkauft den Stein.
Ein trauriger Film, den Mirosevicz sich viele Male ansah, bis er selbst den Wunsch in sich verspürte, Bildhauer zu sein. Und wenn er vielleicht auch nicht fähig war, etwas Schönes zu schaffen, so dann doch vielleicht etwas sehr Großes. Anfangs versuchte er Geld von der Stadt zu bekommen. Eine Million Ostmark wollte er haben, was in etwa 800 Euro entspricht. Doch man lehnte ab. Kunst sei nichts für die DDR. Der ganze Kunstscheiß sei doch ausgemachter Kapitalismus. Kunst dürfe nichts kosten, sonst tauge sie zu nichts als zum Konsum.